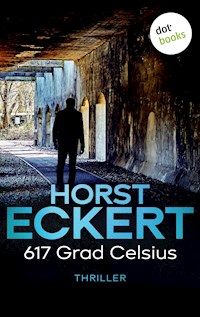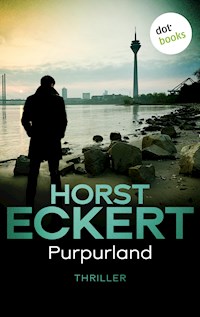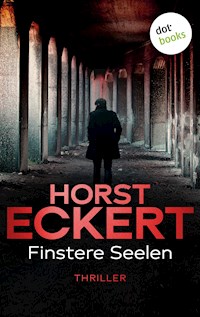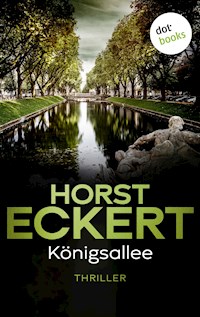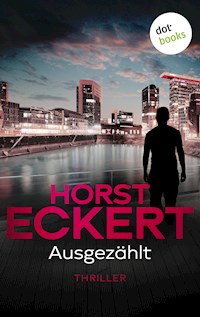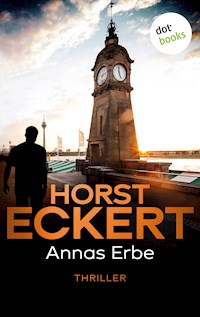9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Melia-Khalid-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Macht lädt zum Missbrauch ein. Geheime Macht erst recht.
Mein Name ist Melia Khalid. Ich leite das Referat für Linksextremismus beim Inlandsgeheimdienst. Mir wurde ein Geheimpapier zugespielt, das die Gründung einer neuen RAF ankündigt. Das Amt steht Kopf, aber ich misstraue der Quelle. Ich habe den Verdacht, dass einige Leute in meiner Behörde selbst einen Umsturz vorbereiten. Als Teil eines rechten Netzwerks, dem Freiheit und Demokratie ein Dorn im Auge sind. Mein Chef will mich kaltstellen. Und mein eigener Vater, ein Spitzenpolitiker mit Geheimdienstvergangenheit, weiß mehr, als er zugeben will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Ähnliche
Das Buch
Melia Khalid arbeitet in Düsseldorf für den Inlandsgeheimdienst. Als ihr aus Antifa-Kreisen ein brisantes Geheimpapier zugespielt wird, glaubt ihre Behörde an das Erwachen einer neuen RAF. Doch Melia stößt auf Indizien, die sie an ihrer Quelle zweifeln lassen. Versucht jemand, den Geheimdienst zu manipulieren? Ihr Chef will sie kaltstellen, doch Melia spornt das nur an.
Hauptkommissar Vincent Veihs jüngster Mordfall scheint rasch geklärt zu sein. Die Staatsanwaltschaft bewertet ihn als Beziehungstat und erklärt die Ermittlungen für abgeschlossen. Doch das Opfer war ein Journalist, der undercover in der rechten Szene recherchiert hatte. Worauf ist er gestoßen? Vincent sucht nach Antworten, und rasch eckt er dabei an.
Die Wege von Vincent und Melia kreuzen sich, und gemeinsam kommen sie einer rechten Verschwörung auf die Spur, deren Verbindungen bis in die Regierung reichen. Melia, Tochter einer politisch Verfolgten, die einst in Somalia gefoltert wurde, begreift den Schutz der Freiheit als persönliche Sache. Erst recht, als sie erkennt, wie mächtig der Feind ist. Und dass er ihr viel näher sitzt, als sie dachte.
Der Autor
Horst Eckert, 1959 in Weiden/Oberpfalz geboren, lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Er arbeitete fünfzehn Jahre als Fernsehjournalist, u. a. für die »Tagesschau«. 1995 erschien sein Debüt »Annas Erbe«. Seine Romane gelten als »im besten Sinne komplexe Polizeithriller, die man nicht nur als spannenden Kriminalstoff lesen kann, sondern auch als einen Kommentar zur Zeit« (Deutschlandfunk). Sie wurden unter anderem mit dem Marlowe-Preis und dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet und ins Französische, Niederländische und Tschechische übersetzt.
HORST ECKERT
IM NAMEN
DER LÜGE
THRILLER
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Horst Eckert
Copyright © 2020 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lars Zwickies
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann, Designomicon,
unter Verwendung eines Motivs von © Mark Owen/Trevillion Images
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-23634-2V003
www.heyne.de
In memoriam Hans Eckert (1931–2018)
PROLOG
MANCHMAL VERGLEICHEICHMEINEN BERUF mit dem Winter.
Keiner mag es, wenn die Tage kurz sind und die Nächte schwarz. Wir denken an Stillstand und Tod. Dabei verkennen wir den Charakter dieser Jahreszeit. In Wahrheit bereitet sie weiteres Leben vor – je dicker der Mantel aus Schnee, desto reicher die künftige Ernte.
Wie der Winter täusche ich Sie.
Denn mein Wissen teile ich nicht öffentlich. Ich arbeite unter einem dicken Mantel der Geheimhaltung und lasse Menschen für mich spionieren. Ich mache sie zu Spitzeln, die ihre Genossen und Kameraden an mich verraten. Wenn es sein muss, auch ihre Liebsten, mit denen sie das Bett teilen.
Klingt in Ihren Ohren unsympathisch, nicht wahr?
Aber wenn wir schlimmeres Chaos vermeiden wollen, muss jemand den Job machen.
Damit auch in Zukunft dem Winter ein Frühjahr folgt.
Mein Amt sammelt Erkenntnisse über Möchtegern-Revoluzzer und Demokratieverächter. Setzt V-Leute auf Krawalltouristen an, auf Stalinjünger und Naziparteien. Auf Bomben bastelnde Diener des Gottesstaats. Auf rassistische Hooligans, die sich das Land als KZ erträumen.
Ich bin gut in diesem Job. Mit zweiunddreißig Jahren die jüngste Regierungsrätin des Ministeriums. Weil ich unter dem Mantel hart bin. Weil meine Mutter mich zur Kämpferin erzogen und mich gelehrt hat, Freiheit zu leben, indem ich gegen den Strom schwimme, meinem eigenen Urteil vertraue und mein Anderssein als Auszeichnung trage.
Und plötzlich stand alles infrage.
Die RAF war zurückgekehrt. Als Rentnergang mit Panzerfaust.
Während Rechtsextremisten die Machtergreifung planten.
Rote Socken, brauner Mob – das Land geriet aus den Fugen.
Die Tugenden des Winters waren gefragter denn je.
Ich, Melia Khalid, war gefragt.
TEIL EINS
ROTE SOCKEN –
BRAUNER MOB
And who knows which is which and who is who.
(Pink Floyd, »Us and Them«)
01
Samstag, 17. Februar
CARLO STEUERTEDEN GELDTRANSPORTER. Mit ihm war Nadia noch nie gefahren. Überhaupt war es für sie die erste Tour nach zwei Jahren Pause in diesem Job. Und ausgerechnet an den Ort ihres Schreckens würde diese Fahrt gehen.
»Was ist los mit dir?«, fragte Carlo. »Du sagst die ganze Zeit kein Wort. Bist du immer so langweilig? Wie wäre es mit einem Spiel, Nadia?«
»Was für eins?«
»Actionfilme – jeder nennt die zehn stärksten Szenen, die ihm einfallen.«
Sie erreichten das Gewerbegebiet am Autobahndreieck Stuhr bei Bremen, fuhren auf den großen Parkplatz, und Nadia konnte nicht anders, als daran zu denken, was sich hier vor zwei Jahren zugetragen hatte.
»Ist das ein Männerding, oder was?«, fragte sie.
Carlo warf ihr einen irritierten Blick zu.
»Listenspiele sind albern. Und ausgerechnet Actionfilme. Als hätte ich an diesem Ort nicht schon genug Action erlebt.«
»War das hier? Echt krass!«
Carlo steuerte auf den Eingang des Supermarkts zu.
»Wirklich hier bei Lidl? Stimmt das mit der Viertelmillion?«
Nadias Blick wanderte über die Fahrzeuge, die links und rechts von der Fahrspur abgestellt waren. Sie hatte sich die ganze schlaflose Nacht gefragt, wie es sein würde, hierher zurückzukehren. In einem Fahrzeug voller Geldkassetten, genau wie damals.
Ihr Herz klopfte heftig. Sie räusperte sich, um den Frosch im Hals zu vertreiben.
»Immer locker bleiben«, sagte Carlo und übte ein mitfühlendes Lächeln.
»Du und deine Sprüche.«
Nach dem Überfall hatte Nadia bei Kottmann-Security gekündigt und sich etwas anderes gesucht. War völlig aus der Spur. Hatte mal hier, mal dort gejobbt, war meistens pleite und selten glücklich gewesen, bis der alte Kottmann sie ansprach, ob sie es nicht doch noch einmal versuchen wolle. Die Geldtransport-Branche brauche Personal.
Ich bin darüber hinweg, hatte sie in dem Moment gedacht.
Carlo runzelte die Stirn. »Wenn du willst, gehe ich allein rein.«
»Kommt nicht infrage, aber danke.«
Sie hielten an, gingen mit ihrem Wägelchen in den Markt, schoben die Metallkoffer heraus und luden sie in den Transporter.
Heute kein Zwischenfall. Niemand mit einer Kalaschnikow. Keine Maskierten, die bereit waren, über Leichen zu gehen. Natürlich nicht, dachte Nadia.
So etwas passiert mir nicht zweimal.
Der Kollege drehte den Zündschlüssel, und der gepanzerte Wagen setzte sich wieder in Bewegung. Carlo schnalzte mit der Zunge.
»Ist was?«, fragte Nadia.
»Also, ich fahr total auf Autoverfolgungsjagden ab. French Connection, kennst du garantiert. Gene Hackman, wie er unter der Hochbahn entlangrast. Oder Ronin von John Frankenheimer. Die alten Filme sind die besten, alles noch analog, keine Computertricks. Wusstest du, dass beim Dreh von Ronin achtzig Autos zerstört wurden?«
Na super, dachte Nadia und verdrehte die Augen.
Sie erreichten die Bundesstraße und lagen gut in der Zeit. Nadia setzte ihre dunkle Ray-Ban auf, weil die Sonne herauskam und der Schnee seitlich der Fahrbahn, der letzte Nacht überraschend gefallen war, sie blendete.
Nahm der verdammte Winter kein Ende?
»Nummer drei: Die Bourne Verschwörung«, sagte Carlo. »Matt Damon im russischen Taxi, weißt du noch?«
»Der ganze Film ist eine einzige Verfolgungsjagd.«
»Du kennst dich also doch aus. Von wegen Männerding!« Lachend musterte er Nadia.
»Ich mag Matt Damon«, stellte sie klar. »Aber nicht, wenn Autos zu Schrott gefahren werden. Und pass auf, wohin du fährst.«
Sie legten einen guten Kilometer zurück, dann erreichten sie den nächsten Großparkplatz. Carlo lenkte den Transporter um die Ecke eines gigantischen Baumarkts und stoppte vor dem Tor für die Anlieferung. Kalte, trockene Luft schlug Nadia entgegen, als sie die Beifahrertür öffnete.
Sie hörte Schritte. Eine Frau rannte ihnen zwischen den Autos entgegen. Im Laufen zupfte sie sich eine Sturmhaube zurecht. In der Hand trug sie eine Maschinenpistole.
Das darf doch nicht wahr sein.
Die Vermummte blieb stehen, riss die Waffe hoch und zielte. »Aussteigen, Hände hoch!«
Nadia ließ die Tür wieder zuknallen. Carlo tat es ihr gleich. Die Unbekannte schoss, aber die Panzerung hielt die Projektile ab. Vier Millimeter Stahl, vier Zentimeter Spezialglas in den Fenstern. Nadia hörte den mehrfachen Knall, das Aufprallen der Geschosse und das Dröhnen des eigenen Pulsschlags in ihren Ohren.
Damals hatten sie und ihr Begleiter sich ergeben, weil eine Panzerfaust im Spiel gewesen war. Lieber den Räubern das Fahrzeug samt Inhalt überlassen, als das eigene Leben zu riskieren – bei Kottmann bekam das jeder Mitarbeiter schon im ersten Gespräch eingebläut.
Jetzt tauchte auch noch eine zweite Frau auf. Ihre Haube war rot mit schwarzen Rändern um die Augen. »Los, raus!«, schrie sie.
Ruhig atmen, ermahnte sich Nadia.
Carlo startete den Wagen, um abzuhauen.
In diesem Moment schob sich hinter ihnen ein VW-Bulli in die Gasse längs der Hallenwand.
Nadias Herz raste. Vor ihnen standen Müllcontainer. Jenseits davon erhob sich auch schon die Mauer, die den asphaltierten Platz vom Autobahnzubringer abgrenzte. Kein Fluchtweg in Sicht.
Sie wandte sich um. Ein Mann stieg aus dem Bulli, langsam, als habe er alle Zeit der Welt. Hagere Gestalt, gebeugter Rücken. Nadia sah die Waffe in seinen Händen und wusste sofort, was das war. Sie glich einem Rohr mit aufgepflanzter dicker Patrone.
Ach du Scheiße.
Eine Panzerfaust.
Der Typ blieb bei seinem Fahrzeug stehen und legte sich das Rohr auf die Schulter. Der Gefechtskopf zeigte in ihre Richtung.
»Aussteigen!«, schrie die erste Frau wieder.
Nadia griff zur Türklinke. »Wir tun, was die wollen«, sagte sie zu Carlo.
Stattdessen trat er das Gaspedal durch.
Der Transporter schoss nach vorn und rammte einen Abfallcontainer. Carlo stoppte vor der bunt mit Graffiti besprühten Betonmauer und ließ die Gänge krachen. Mit quietschenden Reifen wendete er auf engstem Raum.
»Lass das, bitte!«, flehte Nadia ihren Kollegen an.
Doch Carlo gab Gas. Die Beschleunigung drückte Nadia in den Sitz. Die Lücke zwischen dem Bulli und der Außenwand des Möbelhauses war verdammt eng. Und davor stand der Kerl mit der Panzerfaust.
Sie rasten mit laut dröhnendem Motor auf ihn zu.
Die Frau mit der MP schoss erneut. Die Kugeln prallten ab. »Klaus, mach sie fertig!«, schrie die andere.
Der Mann wich zur Seite aus und zielte weiter auf den Transporter.
Wir kommen nicht durch, dachte Nadia.
Sie schloss die Augen.
Ein Ruck riss sie fast aus dem Sitz, zugleich krachte es. Sie waren gegen den VW-Bulli gestoßen und schrammten an der Halle entlang. Der Panzerwagen schlingerte, dann beschleunigten sie weiter. Nadia rang keuchend nach Luft.
Sie sah nach hinten.
Die Vermummten und ihr demolierter Bus wurden im Heckfenster kleiner. Der Mann mit dem krummen Rücken ließ die Panzerfaust sinken.
Carlo jauchzte wie ein Filmheld nach dem gelungenen Stunt.
Dann fuhren sie auch schon über den Zubringer und erreichten die Auffahrt Groß-Mackenstedt. Carlo fädelte den schweren Wagen in den dichten Strom der Fahrzeuge in Richtung Delmenhorst ein.
Allmählich beruhigte sich Nadias Pulsschlag. Die zitternden Hände vergrub sie in den Taschen ihrer Uniformjacke. Sie lebten.
Die Panzerfaust hatte geschwiegen.
Gleich erreichen wir Kottmanns Betriebshof, überlegte Nadia. Und dann hänge ich diesen Job endgültig an den Haken. Für diese Art von Actionfilmen bin ich zu alt.
Sie zog ihr Handy hervor und rief die Polizei an.
Montag, 19. Februar
Weser-Kurier – Aufmacher:
SPUREN ZUR RAF NACH ÜBERFALL AUF GELDTRANSPORTER
DNA-Vergleich belegt: Täter waren seit Jahrzehnten gesuchte RAF-Terroristen
Sibylle Arnold, Klaus Büchner und Herlinde Weiß, deren genetische Fingerabdrücke nach Polizeiangaben in einem zurückgelassenen VW-Transporter gefunden wurden, sollen 1993 auch an dem Sprengstoffanschlag der RAF auf die Justizvollzugsanstalt im hessischen Weiterstadt beteiligt gewesen sein. Damals seien ebenfalls ihre DNA-Spuren gefunden worden. Belege für einen terroristischen Hintergrund des Überfalls auf den Geldtransporter gebe es allerdings nicht. Die Behörden gehen davon aus, dass sich die drei »RAF-Rentner« damit ihr Leben im Untergrund finanzieren wollten. Das Amtsgericht Verden hat Haftbefehle wegen versuchten Mordes sowie versuchten schweren Raubes erlassen.
Bis sie sich 1998 für aufgelöst erklärte, war die RAF der Inbegriff von Terror und Mord. Ihrem »bewaffneten Kampf« gegen das »imperialistische System« fielen Dutzende Menschen zum Opfer, darunter Repräsentanten von Wirtschaft und Politik. Vorläufer war die nach dem Kaufhaus-Brandstifter Andreas Baader und der Journalistin Ulrike Meinhof benannte Baader-Meinhof-Gruppe. Nach dem »Deutschen Herbst« von 1977 formierte sich eine dritte Generation mit namentlich kaum bekannter Kommandoebene. Ihre Morde sind bis heute ungeklärt.
Düsseldorfer Morgenpost, Seite eins:
MINISTERPRÄSIDENT FRANTZEN: ROT-ROT-GRÜN WÜRDE DEUTSCHLAND RUINIEREN
Eindringliche Warnung vor »Volksfront-Koalition«
Einen knappen Monat vor der NRW-Landtagswahl liegen die Nerven blank. Während die AfD ihr altes Ergebnis von 7,4 Prozent weit mehr als verdoppeln könnte, wittern auch Befürworter von Rot-Rot-Grün Morgenluft. Auf dem Unternehmertag des Handwerks, der gestern in Essen eröffnet wurde, warnte Ministerpräsident Hajo Frantzen vor einer Regierungsbeteiligung der in Teilen verfassungsfeindlichen Linkspartei. Im bevölkerungsreichsten Bundesland hätte ein solcher Tabubruch verheerende Konsequenzen für ganz Deutschland. Nur eine starke CDU könne »die Irren von rechts und links« in die Schranken weisen, so Frantzen.
02
KIM BRANDSTÄTTERUND DENNIS HEIM hatten ihren Streifenwagen auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins im tiefsten Süden von Düsseldorf abgestellt, um zu frühstücken. Kim öffnete das Seitenfenster einen Spalt weit, damit der Zwiebelgeruch, den das Mettbrötchen ihres Kollegen verströmte, abziehen konnte.
Sie rechnete jeden Moment damit, dass Dennis seinen unerwarteten und unbeholfenen Annäherungsversuch von gestern fortsetzen würde. Ihr war nicht wohl dabei, denn sie schätzte ihn als Partner im Dienst, doch mehr war da nicht. Wie bringe ich es ihm schonend bei?
Als der Funkspruch der Leitstelle eintraf, war Kim regelrecht erleichtert.
Ein Notruf. Möglicherweise häusliche Gewalt. Duderstädter Straße 23.
»Auf der anderen Seite der A59«, brummte Dennis und wischte sich Krümel von der Uniformjacke.
Kim griff nach der Handpuste. »Düssel 43, wir sind in drei Minuten da.«
Sie stopften ihr Essen zurück in die Tüten. Kim startete den Motor, stieß zurück, ließ den blau-gelb-silbernen BMW auf die Straße rollen und beschleunigte. Auf Blaulicht konnte sie verzichten.
Sie unterquerten Eisenbahnstrecke und Autobahn. Dahinter bog Kim mit quietschenden Reifen in die Frankfurter Straße ein, gerade noch bei Gelb.
»Nächste links«, sagte Dennis.
Wahlplakate an den Laternenmasten, in wenigen Wochen war es mal wieder so weit. Hinter den Grünstreifen rechts und links überragten schlichte Bürogebäude die dürren, blattlosen Bäume. Ein großes Schild, irgendwas mit Pharma, Wimpel mit dem Firmenlogo.
»Ein scheiß Gewerbegebiet«, sagte Dennis. »Wer soll denn da wohnen?«
Nach rechts in die Duderstädter. Hier das gleiche Bild. Eine Halle, weitere Büros, die Gebäude wirkten wie lieblos hingeworfen. Die Straße endete in einer Wendeschlaufe. Plakate der AfD in Kopfhöhe – offenbar gab es in diesem Viertel keine Antifa-Kids, die sie zerstörten.
Dennis verdrehte seinen Hals. »Hier gibt’s gar keine Nummer 23.«
Kim bemerkte Schilder zur Linken. Eine Schreinerei, ein Hersteller von Markisen, weitere Namen und Abkürzungen. Ein gepflasterter Weg zweigte hier ab, eine Fortsetzung der Straße.
Kim drehte am Lenkrad. »Das muss es sein«, sagte sie.
Am Ende der Sackgasse stiegen sie aus.
Ein Gitterzaun, dahinter dichte Sträucher. Das Tor zum Grundstück stand offen. An einem Mast hing die Deutschlandfahne. Kim fiel auf, dass sie verkehrt herum angebracht war, oben das Gelb, unten das Schwarz.
Das Haus wirkte trist und abweisend. Sämtliche Fenster zur Straßenseite waren mit Rollläden verschlossen. Sie näherten sich der Tür. Kim wies auf die verschnörkelten Ziffern aus geschmiedetem Eisen, die darüber angebracht waren: 23.
Von drinnen kein Laut.
Eine einzige Klingel. Die vergilbte Plastikabdeckung des Namensschilds hatte einen Sprung.
FreieRepublik Hellerhof.
Kim presste ihren Daumen gegen den Knopf und hörte, wie es drinnen schellte. Dennis drückte zugleich die Klinke, die Haustür sprang auf. Sie nickten einander zu und betraten den dunklen Flur.
»Polizei!«, rief Kim.
Mehrere Türen, eine davon nur angelehnt, Licht drang durch den Spalt. Ein Schniefen war deutlich zu hören.
Kim klopfte, Dennis ging voraus, dann standen sie in der Küche und starrten auf eine Frau, die am Tisch saß und mit verheulten Augen zu ihnen hochblickte. Die Rötung ihrer rechten Gesichtshälfte schien von einer Ohrfeige zu stammen.
»Haben Sie uns gerufen?«, fragte Kim.
Irgendwo ertönte ein Poltern, dann ein halb erstickter Aufschrei.
»Er bringt ihn noch um«, sagte die Frau fast tonlos.
»Ist er bewaffnet?«
Sie nickte.
Kim hob das Funkgerät und rief nach Verstärkung, dann nahm sie wie Dennis ihre Dienstpistole aus dem Holster. Sie trugen Westen aus Kevlar. Für Kopf und Unterleib boten diese jedoch keinen Schutz.
Zurück in den Flur.
Sie rissen sämtliche Türen auf – jedes Mal Fehlanzeige. Am Ende lag eine Treppe vor ihnen. Rechts ging es in den Keller, links ins Dachgeschoss.
Ein lauter Knall – eindeutig von unten.
Das konnte nichts Gutes bedeuten.
Mit beiden Händen an der Waffe, die Mündung nach unten gerichtet, stiegen sie vorsichtig hinab. Dennis deutete auf Blutflecken an der Wand. Kim nickte. Sie erreichten eine Stahltür.
Kim zog sie auf, Dennis streckte seine Waffe in den großen, muffigen Raum, der vor ihnen lag. An das Halbdunkel mussten sich Kims Augen erst gewöhnen.
»Polizei!«, rief Dennis.
Vergeblich tastete Kim nach einem Lichtschalter.
»Legen Sie sich auf den Boden, und schieben Sie Ihre Waffe zu uns herüber!«
Ein Röcheln war die einzige Antwort.
Neben dem Eingang stand eine Plastikwanne, darin ein Sack und allerlei Werkzeug. Weiter hinten eine Kiste, die von alten Polstermöbeln umgeben war. Ein Blechschild lag auf dem Boden: Sie verlassen das Territorium der Bundesrepublik Deutschland.
Kim stieß auf einen Mann, der hinter dem Sofa auf dem Boden lag. Dunkle Locken, runde Wangen. Der schwarze Fleck an der Seite seiner Stirn sah aus wie eine Schusswunde aus nächster Nähe. Er atmete noch.
Während Dennis neben dem Verletzten auf die Knie ging, blickte sich Kim um. Eine zweite Person konnte sie nirgends ausmachen. Wo zum Teufel war der Kerl, der geschossen hatte? Sie drückte die Sprechtaste des Funkgeräts und forderte zusätzlich den Notarzt an.
Dennis tastete nach dem Puls des Verletzten und fluchte leise. Der Lockenkopf stierte gegen die Decke. Er war etwas über dreißig, schätzte Kim, besaß aber das Gesicht eines Jungen – der dickliche Streber, der in der Klasse ganz vorne saß.
Kim hob die Waffe und drang weiter in den Raum vor. Am anderen Ende standen Schränke, in denen sich jemand verstecken konnte. Ein Vorhang schien ein Regal abzudecken – oder ein weiteres Kabuff. Kim registrierte, dass sie viel zu schnell atmete. Unter Schussweste und Jacke wurde ihr heiß.
Als sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm, war es bereits zu spät. Ein Stoß ließ sie stürzen. Im nächsten Moment fiel die Stahltür krachend ins Schloss.
Sie rappelte sich auf, setzte nach und zerrte an der Klinke. Dennis kam hinzu, und gemeinsam stemmten sie die klemmende Tür auf.
Schritte über ihnen, dann ein Rattern und Poltern. Sie hasteten hinterher und erreichten den letzten Treppenabsatz. Am oberen Ende einer herabgelassenen Leiter fiel Tageslicht aus einer Deckenluke. Füße, die sich ins Freie schwangen, dann war der Täter außer Sicht.
Die Schindeln klapperten über ihnen.
Dennis packte die Leiter. Kim hielt ihn zurück.
»Der Kerl schießt auf dich«, warnte sie. »Warte lieber. Ich spreche ihn von unten an und lenke ihn ab.«
Sie machte kehrt und nahm jeweils zwei Stufen auf einmal. Sie befürchtete, dass Dennis nicht stillhalten würde. Sobald er die Verfolgung aufnahm und den Kopf durch die Luke reckte, würde er ein viel zu leichtes Ziel abgeben.
Sie erreichte das Erdgeschoss und rannte hinaus auf den asphaltierten Hof. Sekunden ohne Deckung, dann drückte sie sich an eine Garagenwand.
Durchatmen. Orientierung gewinnen.
Sie erspähte einen Mann in dunkler Kapuzenjacke, der breitbeinig auf dem Dachfirst stand und mit einem Gewehr auf die Stelle zielte, an der er nach draußen geklettert war.
Zum Glück hielt sich Dennis zurück.
»Geben Sie auf!«, rief Kim nach oben.
»Verschwinden Sie!«, brüllte der Kerl zurück. »Sie haben hier keine Befugnis!«
Die Verstärkung näherte sich mit Musik aus Richtung der Autobahn. Kim hoffte, dass die Kollegen die gepflasterte Sackgasse rasch finden würden.
»Werfen Sie die Waffe weg, und kommen Sie herunter!«
»Das ist freies Territorium. Ihr werdet mich nicht versklaven!«
Ein Irrer, durchfuhr es Kim.
Hinter ihr knirschten Reifen. Ein hochbeiniger weinrot lackierter Pick-up mit viel Chrom rollte durch die Einfahrt auf den Hof. Hektische Gitarrenmusik drang aus dem Inneren. Zwei Insassen vorne, eine Person auf der Rückbank. Durch die Scheiben, in denen sich die Umgebung spiegelte, konnte Kim nicht mehr erkennen. Der Wagen kam wenige Meter von ihr entfernt zum Stehen, und die Musik verstummte zugleich mit dem Motor.
Verdammt, was wollen die?
Und wo bleibt die Verstärkung?
Der Mann auf dem Dach schwenkte das Gewehr herüber.
Hinter ihm stemmte sich Dennis aus der Luke und zielte.
»Hände hoch, Waffe weg!«
Der Kerl in der Kapuzenjacke trat hastig einen Schritt zur Seite und rutschte aus. Dachschindeln zersprangen laut scheppernd auf dem Asphalt. Der Typ suchte Halt am Schneefanggitter, doch das riss ab, und er stürzte von der Dachkante. Ein lautes Klatschen, dann war es still. Kim schloss für einen Moment die Augen. Ihr war, als hätte sie den Aufprall mit ihrem eigenen Körper gespürt.
Sie war als Erste bei dem Mann. Er lag auf dem Rücken und regte sich nicht. Stirnglatze, dunkle Augenringe, hagere Züge. Anfang vierzig, schätzte sie. Sein Hals war oberhalb der Jacke tätowiert, Worte in Frakturschrift. Sie betastete die Halsschlagader unterhalb des Kinns. Spürte sie einen Puls, oder irrte sie sich?
Türenschlagen. Die drei Männer waren aus dem Auto gestiegen. Einer von ihnen war deutlich älter, Brille, unrasiert. Er rief »Jana!«, und lief sofort ins Haus. Kim war das gar nicht recht, doch sie kam nicht dazu, ihn aufzuhalten.
Die anderen beiden hatten sich neben ihr aufgebaut, junge Kerle, Anfang zwanzig, kurzes Haar. Sie begafften den Mann, der vom Dach gefallen war. Kim beorderte sie mit harschen Worten und einem Wink mit ihrer Pistole zu ihrem Fahrzeug zurück.
Plötzlich ging ein Zittern durch den Tätowierten, und er öffnete die Augen. Rasch trat Kim sein Gewehr zur Seite und schloss die Acht um die Gelenke des mutmaßlichen Täters.
Endlich war der Streifenwagen da, im Schlepptau das Notarztfahrzeug und ein Rettungswagen. Das Martinshorn verstummte, die blauen Lichter flackerten weiter. Ein Arzt eilte zu ihr, gefolgt von zwei Sanitätern mit einer Trage.
»Kümmern Sie sich zuerst um den Verletzten im Keller«, rief Kim ihnen zu. »Den hat es schlimmer erwischt.«
Den Kollegen der Bezirksdienststelle Benrath erklärte sie in wenigen Sätzen, was geschehen war. Sie schickte einen von ihnen ins Haus, um den Zugang zum Keller zu sichern, den anderen bat sie, die Personalien der Frau und der gerade hinzugekommenen Männer aufzunehmen.
Dann lehnte sie sich gegen die Wand und schloss für einen Moment die Augen.
Schritte. Eine Hand auf ihrer Schulter. Dennis.
»Hast alles richtig gemacht«, sagte er.
»Danke, du auch.«
»Schade, dass sich der Mistkerl nicht das Genick gebrochen hat.«
»Sag mal, Dennis, wusstest du, dass wir Leute versklaven?«
Der Kollege guckte verständnislos.
»Republik Hellerhof, freies Territorium.«
»Wie bitte?«
Sie wies zum Fahnenmast hinüber. »Was bedeutet es, wenn man das Ding verkehrt herum aufhängt?«
»Egal«, antwortete Dennis. »Vielleicht hat ja Vincent Veih eine Antwort darauf.«
»Verständigst du die Mordbereitschaft?«
Dennis nickte. »Das ist jetzt deren Job. Und ehrlich gesagt will ich gar nicht wissen, für welchen Scheiß wir schon wieder Kopf und Kragen riskiert haben.«
Der Notarzt kehrte aus dem Haus zurück. Er fing Kims Blick auf und schüttelte mit ernster Miene den Kopf.
Ein Toter mehr auf dieser Welt.
Kim glaubte zu vernehmen, wie drinnen die Frau wieder schluchzte. Sie blickte hinüber zu den Typen im Pick-up. Der Dritte, der ins Haus gelaufen war, hatte sich nicht wieder blicken lassen.
Eine Leichensache fürs KK11, dachte Kim. Wir schreiben unseren Bericht und sind raus.
Aber im Unterschied zu Dennis wüsste ich gern, was hier vorgegangen ist.
In diesem düsteren Haus am Ende der Sackgasse.
03
MELIA KHALIDWARIM MORGENGRAUEN losgefahren, die erste längere Autobahnstrecke für ihren nagelneuen himmelblauen Fiat Cinquecento. Sie hatte Glück, kein endloser Stau an den Baustellen rund um Wuppertal, nur die Steigungen des Bergischen Landes machten dem Kleinwagen zu schaffen. Sie nahm die Ausfahrt Hagen-West, überquerte die Autobahn und fuhr in der Gegenrichtung wieder auf. Nach gut einem Kilometer erreichte sie den vereinbarten Treffpunkt.
Parkplatz Eichenkamp. Am frühen Vormittag noch nicht mit Lkw zugeparkt. Ihr Kollege war noch nicht da.
Sie hatte Zeit, um noch einmal den Text zu lesen, den ihr die Außenstelle Dortmund geschickt hatte. Drei Seiten, eng beschrieben, jeder Satz so martialisch wie die Headline.
Die revolutionäre Front in den Metropolen neu aufbauen.
Vor einiger Zeit waren in mehreren Städten Deutschlands, Spaniens, Italiens und der Schweiz Haftbefehle vollstreckt und Wohnungen durchsucht worden. Ein Schlag gegen die während des Hamburger G20-Gipfels von 2017 als besonders militant aufgefallenen Randalierer. Auf dem Laptop eines Linksautonomen in Witten waren dabei erste Hinweise auf dieses Pamphlet gefunden worden. Der Mann schwieg dazu. Weil es gegen ihn keinen Haftgrund gab, hatte die Polizei ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Natürlich beobachtete ihn der Verfassungsschutz weiterhin.
Konstantin Pfeifer, ihr Dortmunder Kollege, hatte schließlich den Text besorgen können. Das Traktat erinnerte Melia an die typische Sprache der RAF. Es war von der Aktualität einer Stadtguerilla die Rede, von der Notwendigkeit des Kampfes, sogar Anschlagsziele wurden benannt, wenn auch nur abstrakt: Repräsentanten von Staat und Kapital.
Schlagt sie, wo es ihnen wehtut.
Melia fiel ein Satz aus ihrem Entwurf für den neuen Verfassungsschutzbericht ein. Es war derselbe wie jedes Jahr, seit sie für das Kapitel Linksextremismus verantwortlich war: Nach der Auflösung der RAF ist bis heute keine Entwicklung erkennbar, die auf eine Rückkehr zum bewaffneten Kampf in Form von Terror gegen den Staat schließen lässt.
Falls Pfeifers Papier authentisch ist, muss ich meine Einschätzung revidieren.
Ein dunkler Wagen rollte langsam an ihr vorbei und hielt auf dem Standstreifen. Der Fahrer stieg aus und zündete sich eine Zigarette an. Melia betätigte ihre Lichthupe. Der Mann schlenderte zu ihr herüber, öffnete die Beifahrertür und stieg ein.
Es war Konstantin Pfeifer, der seit Kurzem die Außenstelle Dortmund leitete. Der Kollege war vom Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz in die Landesbehörde gewechselt. Vielleicht sein letzter Karriereschritt – er stand geschätzte zehn Jahre vor der Pensionsgrenze, hatte Bauch und Doppelkinn und kaum noch Haare auf dem Kopf.
Er grüßte und blickte sie fragend an.
»Nichtraucherauto«, sagte Melia.
Pfeifer verzog das Gesicht, ließ das Fenster herunterfahren und warf die glimmende Zigarette nach draußen.
»Erzähl mir was über deinen V-Mann.«
Er hatte sie am Telefon geduzt, also blieb sie dabei, obwohl sie das nur aus dem Polizeidienst kannte, nicht vom Ministerium.
»Es ist eine Frau«, antwortete Pfeifer. »Wir nennen sie Rebecca Schulmeister. Sie gehört zu einer kleinen, verschworenen Studentengruppe, die an der Uni Bochum aktiv ist. Bislang nur linksradikale Agitation, nichts Kriminelles. Der Typ in Witten gehört ebenfalls dazu.«
»Führst du sie selbst?«
Pfeifer nickte. »Kenne sie schon länger, eine alte Quelle des Bundesamts.«
»Warum arbeitet sie für uns? Geld, Überzeugung, Geltungsdrang?«
Pfeifer zuckte mit den Schultern.
»Oder steht sie auf dich?«
Der Scherz prallte spurlos an ihm ab. Kein Lächeln, ein mürrischer Typ, wie Melia fand.
»Natürlich ist es die Kohle«, antwortete er.
»Und was sagt sie zu dem Papier?«
»Dass es authentisch ist. Dass sie in ihrer Gruppe darüber diskutiert haben. Und dass sie nicht die Einzigen sind, die sich daran aufgeilen.«
»Für wie verlässlich hältst du sie?«
»Schulmeister hat uns noch keine Info geliefert, die sich hinterher als falsch herausgestellt hätte. Sie hat vorhergesagt, dass es während des G20-Gipfels an der Elbchaussee brennen würde, was wir auch an die Hamburger Kollegen weitergegeben haben. Blöd nur, dass die es ignoriert haben. Die Sozis dort waren ja so geil auf ihren Gipfel.«
»Dann gehe ich mal rüber zu ihr.«
Auch der Kollege wollte seine Tür öffnen. Melia legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Ich hol dich, wenn ich mit ihr fertig bin.«
Seine Miene verfinsterte sich, was Melia ignorierte. Sie ging nach vorn zur Fahrerseite des dunklen Mercedes und stieg ein.
»Guten Morgen, Rebecca.«
Eine kleine, schmale Frau blickte sie an. Schwarze Klamotten, Tattoos auf den Handrücken, dunkle Augenringe. Ihre zierliche Erscheinung ließ sie jünger wirken, aber Melia schätzte sie auf mindestens vierzig. In ihrer Studentengruppe sicher der Methusalem.
»Etwas dagegen, wenn wir uns duzen?«
Pfeifers Informantin schüttelte knapp den Kopf.
»Du weißt, warum ich dich sprechen will?«
»Wegen des Strategiepapiers.«
»Wie neu ist es?«
»Es ist nach Hamburg entstanden.«
»Und wie ist seine Verbreitung?«
»Ich war auf überregionalen Treffen in Berlin und Bremen, wo es diskutiert wurde. Und ich weiß, dass es auch schon ins Spanische und Griechische übersetzt worden ist.«
»Wie groß ist der Zustimmungsgrad?«
»Schwer zu sagen. Es spaltet die Szene. Den Weg der Guerilla wird wohl nur ein Teil mitgehen. Andere werden sympathisieren und im Geheimen unterstützen. Seit den Naziaufmärschen in Chemnitz und Halle geht ein ziemlicher Ruck durch die Antifa-Szene. Und wenn der Bundesinnenminister von der Migrantenfrage als Mutter aller politischen Probleme spricht, fühlt sich die linke Szene an Judenfrage und Holocaust erinnert. Das provoziert Widerstand. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass die Linke jemals so in Aufruhr war.«
»Wird es wirklich dazu kommen, dass sich Leute bewaffnen?«
»Wenn sich die Stimmung weiter aufheizt – klar. Also ziemlich wahrscheinlich, würde ich sagen.«
Melia musterte die Frau. Die Anzeichen von Nervosität oder Unbehagen hielten sich im Rahmen. Zudem fiel Melia kein Grund ein, warum Schulmeister sie anlügen sollte. Melia fragte sich, warum Pfeifer diesen Decknamen gewählt hatte. War sie etwa Lehrerin?
Die Kälte kroch ins Wageninnere. Die Informantin verschränkte die Arme.
»Eine letzte Frage, Rebecca. Wer ist der Kopf hinter dem Papier, wer hat es verfasst?«
»Ich hab da nur Gerüchte gehört.«
»Erzähl.«
»Über alte RAF-Genossen, die aus dem Untergrund heraus den Widerstand bündeln und neu formieren wollen. Wer mitmacht, wird großzügig mit Knarren und Sprengstoff versorgt, heißt es.«
»Genossen aus dem Untergrund?«
»Die Zeitungen nennen sie die RAF-Rentner.«
Melia nickte, verabschiedete sich und eilte zu ihrem Auto zurück.
Pfeifer lehnte an der Fronthaube und rauchte schon wieder. Der Alte trug seine Winterjacke offen. Der eisige Wind schien ihm nichts auszumachen.
»Was ist dein Eindruck?«, fragte er.
Ihr kam das Du irgendwie übergriffig vor. Sie mochte den Kollegen nicht. Vielleicht auch nur, weil er vom Bundesamt gekommen war. Ich sollte ihm eine Chance geben.
»Verlässlich«, antwortete sie.
»Sag ich doch.«
»Soweit man das von einem Spitzel behaupten kann.«
»Süßer Kleinwagen«, bemerkte Pfeifer und kehrte zu seinem Mercedes zurück.
Auf der Heimfahrt diktierte Melia den Entwurf für ein Memo an ihren Chef ins Handy. Sie war beunruhigt. Seit Jahren beobachtete sie die roten Socken dieses Bundeslandes. Mit einem Schlag befand sich ihre Einschätzung auf dem Prüfstand.
Falls Rebecca recht hatte, war Hamburg nur ein Lüftchen gewesen, und der Sturm stand erst noch bevor.
04
DAS KLEINE EINFAMILIENHAUSMITDENDICKEN, kalten Mauern lag in weitem Abstand zu den Nachbarn am Küstenkanal westlich von Oldenburg. Die Räumlichkeiten waren zu eng, um noch als kuschelig durchzugehen. Steile Treppe, Schrägen im Obergeschoss, nur ein Bad für drei Leute. Vor sechs Jahren hatten sie den Mietvertrag unterzeichnet, unter Vorlage gefälschter Papiere. Bis jetzt hatte sich die Hütte als sicherer Hafen erwiesen.
Trotzdem glaubte Herlinde, ihr Kopf platze gleich, als sie die Sohlen an der Fußmatte abstreifte und die Tür aufschloss. Sie fragte sich, ob sie sich eine Erkältung eingefangen hatte. Aber es war nur die schiere Ausweglosigkeit, die ihr den Wintertag zur Qual machte und aufs Gemüt schlug.
Der Frust über ihr verfahrenes Leben.
Sibylle kam ihr entgegen. »Und?«
Herlinde hängte ihren Parka an die Garderobe, zog die Stiefel aus und schlüpfte in die gefütterten Hausschuhe. Einst war Sibylle für sie wie eine ältere Schwester gewesen, zu der sie aufschaute und der sie blind vertraute wie sonst nur ihrem Freund. Doch das Verhältnis hatte sich in all den Jahren gewandelt.
Sie waren Zellengenossinnen, die das Schicksal zusammengesperrt hatte.
Und an besonders miesen Tagen hassten sie einander.
Herlinde ging voraus in die Küche, wo Klaus gerade Tee aufbrühte. Er bewegte sich schwerfällig, sein Rücken schmerzte schon seit Wochen.
»Erzähl!«, verlangte Sibylle.
Herlinde setzte sich, goss sich einen Becher voll und wärmte ihre Finger daran. Sie wandte sich Klaus zu. »Zivilbullen.«
»Bist du dir sicher?«
»Plan B können wir ebenfalls vergessen.«
»Ich hab’s befürchtet!« Sibylle verdrehte die Augen. »Wenn wir die Panzerfaust niemals einsetzen, nimmt uns keiner mehr ernst. Mensch, Klaus, hättest du das verdammte Ding doch abgefeuert!«
Er atmete hörbar durch. »Der Überfall war … na ja, aber wir müssen nach vorn schauen.«
Herlinde rieb sich den verspannten Nacken. Sie spürte jeden Pulsschlag als Hämmern hinter den Schläfen. Den Großteil der vergangenen Nacht hatte sie wach gelegen. Mit jedem Fehlschlag nahm der Fahndungsdruck zu. Während die Stimmung in der Gruppe den Gefrierpunkt erreichte.
Allmählich wurde das Geld knapp.
»Das nächste Mal nehme ich das Ding«, sagte Sibylle.
»Dafür solltest du erst einmal üben«, antwortete Klaus.
»Spiel hier nicht den Macho.«
»Ich bin froh, wenn du die Panzerfaust nimmst, denn ihr Gewicht ist Gift für meine Bandscheiben. Aber falls du sie falsch handhabst, kannst du dich schwer verletzen. Kriegsgerät ist nichts für Laien.«
Herlinde rührte Zucker in ihren Tee. »Ich bin froh, dass wir niemanden umgebracht haben.«
»Früher waren wir nicht so zimperlich.«
»Sibylle, das haben wir zur Genüge diskutiert. Und die Panzerfaust bleibt bei Klaus.«
Die Genossin breitete theatralisch die Arme aus. »Führt unser Küken jetzt das Kommando?«
Herlinde nahm einen Schluck. Zitronengras und Ingwer. Allmählich wurde ihr warm. Küken war sie schon lange nicht mehr genannt worden.
»Wir brauchen ein neues Quartier«, schlug sie vor. »Einen Revierwechsel. In dieser Gegend können sich die Bullen bereits ausrechnen, wo wir als Nächstes zuschlagen werden.«
»Für einen Neuanfang fehlen uns die Mittel«, warf Sibylle ein.
»Ist es wirklich so dramatisch?«
»Hätten wir den VW-Bus und den Focus geklaut statt gekauft, dann wäre die Lage anders.«
»Auch das haben wir lang und breit diskutiert.«
»Waren das wirklich die Bullen?«, fragte Klaus. »Vor Real und bei Ikea?«
Herlinde nickte.
»Aber sie können nicht die ganze Zeit Wache schieben. Wir warten, bis die Luft rein ist. Und danach ein gründlicher Tapetenwechsel. Die nächste Beute sollte reichen, um für ein, zwei Jahre nach Holland zu gehen. Ich glaube, das täte uns allen gut.«
»Kroatien wäre mir lieber«, sagte Sibylle.
Wir hätten uns schon vor langer Zeit trennen sollen, dachte Herlinde. Bevor wir verlernten, allein zurechtzukommen. Wir hätten diesen Weg erst gar nicht beschreiten sollen.
Wenn es siamesische Drillinge gibt, dann sind wir das.
In ihrer kleinen Kammer unterm Dach machte sie es sich mit ihrem Rechner auf dem Bett bequem und begann, im Netz zu surfen. Rasch landete sie auf Seiten aus ihrer alten Heimat, auf denen sie sich immer öfter herumtrieb: Antifaschistische Linke Düsseldorf, Autonome Stattzeitung, Linkes Zentrum Hinterhof …
Früher, als ich wirklich noch das Küken war, besaßen wir noch eine Perspektive, dachte sie.
Aber dann haben wir es vermasselt.
Herlinde stieß auf die Ankündigung einer Lesung in der Buchhandlung Nickel. Neugierig recherchierte sie und erfuhr: Der Inhaber hieß Jens.
Ihr Jens Nickel, gut möglich.
Meine Güte, was habe ich den Kerl geliebt! Und dann entpuppte sich ihre vermeintliche Zuflucht in der Bretagne als geheimer Ort eines staatlichen Zeugenschutzprogramms. Vor ein paar Jahren hatte sie Klaus gebeichtet, wie blind sie gewesen war. Sibylle würde mich umbringen, wenn sie das ebenfalls wüsste.
Herlinde hätte zu gern gewusst, wann Jens begonnen hatte, für die Gegenseite zu arbeiten. Bereits in der Kiefernstraße, wo sie sich kennengelernt hatten? Erst kurz vor Weiterstadt?
Warum interessiert mich das eigentlich noch?
Herlinde rieb sich die Schläfen und klickte weiter. In Düsseldorf referierte heute Abend ein renommierter Historiker über den spanischen Bürgerkrieg. Eine italienische Band spielte Ska-Punk, sicher ein großer Spaß. Linke Fortuna-Fans trafen sich im selbst verwalteten Zentrum zum Altbier. Das Leben könnte so schön sein.
Es klopfte an ihrer Tür. Herlinde schloss das Browserfenster.
Sibylle lugte ins Zimmer. »Hast du einen Moment?«
»Was gibt’s?«
»Wir haben mal unsere liquiden Mittel zusammengerechnet. Vielleicht hast du recht, und wir sollten umziehen, bevor wir wieder auf Beutefang gehen. Was schlägst du vor?«
»Du fragst das Küken?«
»Sei nicht eingeschnappt.«
»Es gibt nur eine Gegend außer hier, wo ich jeden Winkel kenne.«
»Jeden Baumarkt und jede Ikea-Filiale?«
Herlinde nickte. Beim Gedanken an den Rhein und an die Stadt, in der sie aufgewachsen war, musste sie lächeln.
»Okay«, sagte Sibylle. »Wir mieten ein Wohnmobil und machen uns noch heute auf den Weg.«
Herlindes Kopfschmerzen verflogen, während sie zu packen begann.
Es war, als öffne sich ihre Zellentür und die Sonne schien herein.
Als löse das Frühjahr schon jetzt den Winter ab.
05
FAST HÄTTE VINCENTDEN TATORTnicht gefunden, dann bemerkte er die Fahrzeuge der Kollegen von Mordkommission und Spurensicherung, die eine gepflasterte Zufahrt blockierten. Vincent parkte in der Wendeschlaufe, schlug den Kragen seiner Jacke hoch und ging den Rest des Wegs zu Fuß.
Als er das Haus mit den herabgelassenen Rollläden betrat, vernahm er Bruno Wegmanns charakteristische Bassstimme und folgte ihr bis in die Küche, wo Bruno, der die Mordkommission leitete, mit dem Kollegen Hamid Belhanda und einer jungen Frau am Tisch saß. Offenbar handelte es sich bei ihr um die Hausbewohnerin, die den Notruf gewählt hatte.
Hamid grüßte Vincent mit einem fröhlichen Nicken, während Bruno nur kurz die Stirn runzelte und gleich darauf die Frau anherrschte: »Wollen Sie uns allen Ernstes weismachen, dass Sie nichts mitbekommen hätten? Irgendeine Vorstellung müssen Sie doch davon haben, warum Ihre beiden Mitbewohner in Streit geraten sind!«
Die Frau knetete ein Papiertaschentuch und schniefte nur. Sie war Mitte zwanzig und hatte strähniges blondes Haar. In ihrem graublauen Strickpullover schien sie fast zu verschwinden.
»Seit wann lebte Milo Grünberger bei Ihnen?«, fragte Hamid in ruhigerem Ton.
»Muss ich dem Araber antworten?«
»Ja«, sagte Bruno barsch.
»Zwei Monate. Milo hat beim Renovieren geholfen. Gegen Kost und Logis drüben im Gästehaus.«
Sowohl Hamid als auch Bruno machten Notizen, als hätten sich die beiden Kollegen nicht abgesprochen, wer für das Protokoll zuständig war.
»Wie haben Sie und Grünberger sich kennengelernt?«
»Ich und er?«
»Oder Ihr Freund und er.«
»Bei einem Infoabend über alternative Heilmethoden in Königsbrunn.«
»Königsbrunn?«
»Bei Augsburg.«
»Waren Sie auch dort?«
Die Frau fuhr sich durchs Haar, dann nickte sie.
Vincent sprach Bruno an. »Kommst du mal kurz mit raus?«
Der Kollege blähte die Backen auf, dann erhob er sich unwillig vom Stuhl.
Vincent wandte sich an die Frau. »Und wenn Sie dem Araber nicht alles brav erzählen, was er wissen will, nehmen wir Sie mit.«
Sie traten vor den Hauseingang. Bruno zündete sich eine Zigarette an. Er hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger, als wolle er sie mit seiner Hand verbergen.
»Was ist?«, fragte er.
»Die Frau erwähnte ein Gästehaus. Wo befindet sich das?«
Bruno deutete über seine Schulter. »Hinter der Garage. Dort hat Grünberger in den letzten Wochen seines Lebens gehaust. Unterbrichst du meine Vernehmung, nur um mich das zu fragen, Chef?«
Alle im Team wussten, dass Vincent nicht so angesprochen werden wollte. Deshalb taten es manche Mitarbeiter besonders gern. Er hatte es aufgegeben, sie zurechtzuweisen.
»Hast du die Kriminaltechnik hingeschickt?«, wollte Vincent wissen.
»Natürlich, was denkst du?«
»Wer leitet die Spurensicherung?«
»Fabri.«
»Das ist gut.«
Bruno zog an seiner Zigarette und schwieg.
»Wie schätzt du die Zeugin ein?«
»Hör mal, Vincent, Anna hat mich vorgewarnt, dass du dich gern in die Ermittlungsarbeit einmischst. Aber ich komme mir trotzdem ziemlich dämlich vor, wenn der Dienststellenleiter zu jeder Befragung erscheint wie ein Aufpasser, der seinen Leuten nicht traut.«
»Nicht zu jeder.«
»Das ist die erste in der Leichensache Grünberger und sie dauert noch keine Viertelstunde.«
»Wer ist die Frau?«
»Jana Meier, die langjährige Freundin des Hausbesitzers Helge Simonis. Zusammen betreiben sie hier eine Art Naturheilpraxis.«
»Die Buchführung überprüfen.«
Bruno zuckte mit den Schultern und zog am Glimmstängel.
Vincents Handy spielte die ersten Takte von »London Calling«.
»Wusste gar nicht, dass du ein alter Punk bist«, sagte Bruno mit schiefem Lächeln.
»War«, antwortete Vincent, nahm das Gespräch an und hatte Dominik Roth am Ohr.
»Hallo, Chef«, grüßte Dominik. »Todesursächlich ist die Schussverletzung. Außerdem weist der Körper eine Vielzahl von Prellungen auf, die alle frisch sind. Der Mann ist also ziemlich verprügelt worden, bevor …«
Vincent unterbrach ihn. »Erzähl das bitte Bruno. Er leitet die Mordkommission, wie du weißt.« Er reichte das Mobiltelefon weiter. »Dominik aus der Rechtsmedizin.«
Bruno drehte Vincent den Rücken zu und unterhielt sich mit dem Kollegen. Als er fertig war, gab er das Mobiltelefon zurück. »Warum ruft er dich an und nicht mich?«
»Woher hatte Simonis das Gewehr?«, fragte Vincent zurück.
»In einer Kammer da drin befindet sich ein Waffenschrank voller Flinten und Pistolen. Der Mann ist Mitglied im Schützenverein. Wenn du nur ein paar Stunden Geduld hättest, könntest du alles in unseren Berichten nachlesen.«
»Was bedeutet ›Freie Republik Hellerhof‹?«
»Wovon sprichst du?«
»Steht auf dem Klingelschild. Frag bitte mal die Zeugin danach.«
Bruno schleuderte den Zigarettenstummel auf den Asphalt.
Schritte im Flur, Hamid gesellte sich zu ihnen.
»Sie hat mit Milo Grünberger geschlafen«, berichtete er.
»Das hab ich mir gedacht«, erwiderte Bruno. »Eine Eifersuchtstat.«
Vincent verschränkte die Arme. »Bringt die Frau ins Präsidium, und befragt sie dort weiter. Heute Abend will ich nachlesen, was zwischen Grünberger, Meier und Simonis in den letzten zwei Monaten vorgefallen ist. In allen Details.«
Auf dem Weg zum Gästehaus sagte sich Vincent, dass Bruno froh darüber sein konnte, wie er das Kommissariat führte. Was soll schlecht daran sein, wenn ich ihm mit Rat und Tat zur Seite stehe?
Am Eingang fing ihn ein Kriminaltechniker ab, der ihm Handschuhe, einen Overall und Überzieher für die Schuhe aufnötigte.
Drinnen war es hell und roch nach unlängst verlegtem Teppichboden. Im Erdgeschoss gab es drei Zimmer und ein Bad. Im ersten Stock war der Grundriss derselbe. Hier stieß Vincent auf Fabri, der in einem Zimmer auf dem Heizkörper saß und etwas in die Tastatur seines Laptops tippte.
Sie begrüßten einander mit Handschlag.
»Wie sieht’s aus?«, fragte Vincent.
»Bis auf diesen Raum wirkt alles unbewohnt. Kampfspuren haben wir keine gefunden.«
Vincent merkte dem Kollegen an, dass das noch nicht alles war. »Aber?«, fragte er.
»Wie interpretierst du das, wenn wir in dem Zimmer, das zwei Monate lang das Zuhause eines jungen Mannes gewesen sein soll, kein Handy finden und weder Laptop noch Tablet? Nirgendwo auch nur ein Zettel, nicht einmal ein Tankbeleg im Portemonnaie. Sogar der Papierkorb ist leer, bis auf einen gebrauchten Kaugummi, der am Boden festklebt.«
Vincent blickte sich um. Ein ungemachtes Bett, ein blanker Schreibtisch. Er öffnete den Schrank. Allerlei Klamotten, zwei Paar Schuhe auf dem Einlegeboden.
Auf einem Regal zeichnete sich im Staub ab, dass hier einige Bücher gestanden hatten.
»Ausweis, Führerschein, Versicherungskarte?«
Fabri schüttelte den Kopf.
»Dann hat hier jemand aufgeräumt«, schlussfolgerte Vincent.
»Das denke ich auch«, bestätigte der Chef der Spurensicherung.
06
MELIA BETRATDAS VORZIMMERUNDDEUTETE auf die Durchgangstür zum Chefbüro. »Er wollte mich sprechen. Ist er drin?«
»Telefoniert«, antwortete die Sekretärin, ohne aufzublicken.
Melia verschränkte die Arme und atmete tief durch. Sie hasste es, zu warten.
Jakobs war seit Jahresbeginn im Amt. Ein Vertrauensmann des Ministers, wie es hieß. Er kam von der Bezirksregierung in Detmold, wo er für Gesundheit und Soziales zuständig gewesen war. Promovierter Jurist. Ein Beamter ohne geheimdienstlichen Hintergrund, geschweige denn Stallgeruch. Keiner wusste ihn bislang einzuschätzen.
Immerhin hatte Jakobs einige freie Stellen besetzen können, indem er Leute aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz abwarb. Damit hatte er die Behörde gestärkt, was ihm die meisten Kollegen als Pluspunkt anrechneten. Zudem hatte er sich öffentlich mit der Forderung hervorgetan, die technische Ausstattung zu verbessern. Im eigenen Haus kam so etwas gut an.
Sein Vorgänger hatte die Abteilung fast zwanzig Jahre lang mit ruhiger Hand und einigermaßen pannenfrei geleitet, bis er in vorzeitigen Ruhestand geschickt worden war – man munkelte über politische Differenzen. Genaueres wusste Melia nicht. Geht mich auch nichts an, dachte sie.
»Jetzt hat er aufgelegt«, sagte die Sekretärin.
Melia klopfte, bekam keine Antwort und zählte bis drei. Dann ging sie hinein.
Der neue Chef war Anfang vierzig, schätzte sie. Dreiteiliger Anzug, rote Krawatte, Anstecker mit Bundesadler am Revers. Aufmerksamer Blick hinter kleinen, ovalen Brillengläsern. Dr. Walter Jakobs war als Leiter der Abteilung Verfassungsschutz einer der wenigen, die unter ihrem Klarnamen den Dienst versahen.
Er musterte sie mit gerunzelter Stirn. Entweder missfiel ihm ihr Kraushaar, das von einer länger zurückliegenden Blondierung noch an den Spitzen hell war, oder das Jäckchen mit Camouflagemuster, das sie trug – nicht gerade das übliche Büro-Outfit. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, dachte Melia.
Sie nahm auf dem Besucherstuhl Platz, ohne seine Aufforderung abzuwarten. Dabei schweifte ihr Blick über die Familienfotos, die Jakobs’ Telefon umgaben, vier kleine Kinder und eine streng wirkende Frau, die in die Breite gegangen war. Den Rest des Schreibtisches bedeckten aufgeschlagene Zeitungen. Zuoberst ein Artikel mit drei Fahndungsfotos aus den frühen Neunzigerjahren.
Die dritte Generation der RAF – übrig bleibt ein Trio krimineller Rentner.
Diesen Bericht hatte sie noch nicht gelesen. Offenbar entsprach er dem, was auch die übrigen Medien über Arnold, Büchner und Weiß meldeten.
»Ihr Memo ist bei mir angekommen«, begann Jakobs und nickte, als müsse er sich selbst bestätigen. »Und ich teile Ihre Befürchtungen voll und ganz. Ich habe auch schon den Ministerpräsidenten informiert. Gute Arbeit, Frau … Khalid.«
»Danke.«
Der Abteilungsleiter wies auf den Zeitungsartikel. »Aber das hier geht nicht.«
»Natürlich. Niemandem gefällt ein Raubüberfall.«
»Ich meine die Überschrift. Das Gerede von den drei armen, verzweifelten RAF-Rentnern, die angeblich keine politische Agenda verfolgen, sondern lediglich …«, er schrieb Anführungszeichen in die Luft, »… für ihr karges tägliches Brot im Untergrund sorgen. Mit dieser Verharmlosung muss Schluss sein. Uns soll keiner nachsagen, wir seien auf dem linken Auge blind.«
»Bevor wir offiziell von einer konkreten Terrorgefahr ausgehen können, brauche ich aber noch eine zweite Quelle. Bislang hat nach meiner Kenntnis keine V-Person, die wir im linksextremistischen Umfeld führen, die Information der Dortmunder Außenstelle bezüglich des Aufrufs und seiner Autorenschaft bestätigt.«
»Glauben Sie, dass der Kollege Pfeifer oder seine Quelle uns einen Bären aufbinden will?«
»Nein, natürlich nicht, aber …«
»Wir haben die Pflicht, den Bürgern reinen Wein einzuschenken. Immerhin stehen wir vor Landtagswahlen. Stellen Sie sich vor, es passiert etwas!«
Das tat Melia lieber nicht. »Wie lautet also mein Auftrag?«
»Erstens: Rücken Sie das Bild der angeblichenRAF-Rentner in der Öffentlichkeit zurecht. Ich nehme an, Sie wissen, wie man das macht.«
»Und zweitens?«
Jakobs warf ihr ein dünnes Dossier hin.
Melia schlug den Deckel auf. Vom DIN-A4-Ausdruck eines grobkörnigen Fotos blickte ihr ein junger Kerl mit beginnenden Geheimratsecken und Vokuhila-Frisur entgegen. Er trug ein labbriges, schwarz-weiß gemustertes T-Shirt und einen Brilli im linken Ohrläppchen. Aufgenommen vor rund dreißig Jahren, schätzte Melia.
Ihr Chef räusperte sich und sortierte seine Notizen. »Jens Nickel war ein V-Mann unserer Abteilung. Als Student gehörte er der Hausbesetzerszene in der Kiefernstraße an. Unsere Vorgänger haben ihn Anfang der Achtzigerjahre angeworben und zum wichtigsten Informanten aufgebaut, den je eine Verfassungsschutzbehörde geführt hat.«
»Wow.«
»Vielleicht glauben Sie mir, wenn ich Ihnen verrate, dass er in die RAF eingeschleust werden konnte. Genauer gesagt in die Kommandoebene der dritten Generation. Wir sollten ihn reaktivieren. Ein solcher Mann fehlt uns aktuell enorm.«
»Wir hatten einen Maulwurf im harten Kern?«
»Das weiß ich selbst erst seit Kurzem.« Er blickte auf seine Zettel. »Nickels Mitarbeit führte 1986 zur Festnahme von Eva Haule und sechs Unterstützern aus der Kiefernstraße sowie sieben Jahre später zur Ergreifung von Birgit Hogefeld und zur Ausschaltung von Wolfgang Grams in Bad Kleinen. Er hat uns die damaligen Hauptfiguren der RAF sozusagen auf dem Tablett serviert. Nickel und seine Führungsbeamten haben Geheimdienstgeschichte geschrieben.« Er lachte. »Also Geschichte im Geheimen.«
»Was hat Nickel danach gemacht?«
»Zeugenschutzprogramm. Und vor einigen Jahren ist er zurückgekehrt. Hier in Düsseldorf hat er den Buchladen seiner Mutter übernommen. Letzte Woche hat er sich überraschend gemeldet.«
»Bei wem?«
Jakobs wich ihrem Blick aus. »Bei einer früheren … Kontaktperson.«
Melia wog das Dossier in ihrer Hand. »Ich soll Nickel also auf den Zahn fühlen?«
»Mehr noch. Werben Sie ihn an.«
Melia steckte die dünne Akte, die das Foto und grobe Daten eines Lebenslaufs enthielt, in ihre Tasche. Beide erhoben sich. Jakobs hielt die Tür für sie auf, ganz der Gentleman.
Dabei glotzte er wieder ihre Haare an.
»Ist was?«, fragte Melia.
»Wir leben in sehr stürmischen Zeiten, und der Fels in der Brandung, das sind wir, Frau Khalid.« Wieder nickte er. »Sie, ich und diese Behörde. Vergessen Sie das nicht.«
07
MELIA VERSAMMELTEDIE MITARBEITER ihres Referats im Konferenzraum am Ende des Flurs. Ihr Kollege Knut Richter hatte Geburtstag und deshalb Kuchen mitgebracht. Die Runde bedankte sich mit einem Ständchen, dann schaltete Melia über die abhörsichere Telefonanlage die Außenstellen des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen zu, während ihre Sekretärin die aktuellsten Informationen zu den RAF-Oldies verteilte.
Die zuständigen Ermittler der niedersächsischen Polizei machten in einer bislang unter Verschluss gehaltenen Einschätzung das Trio für nicht weniger als neun schwere Raubdelikte verantwortlich, die in den letzten acht Jahren in Niedersachsen und Schleswig-Holstein verübt worden waren – versuchte und vollendete. Die Beute summierte sich auf vierhunderttausend Euro. Plus eine Million Mark aus einem ähnlichen Überfall in Duisburg im Jahr 1999.
Nicht gerade ein Klacks.
Ines Röttinger, die jüngste Mitarbeiterin, meldete sich. »Sorry, falls ich etwas verpasst habe, aber warum genügt es nicht, wenn sich die zuständige Kripo um die RAF-Rentner kümmert?«
»Wer sagt uns, dass sich die Leute in den Ruhestand begeben haben?«
»Wie aktuell sind die Fahndungsbilder?«, fragte Richter, der als Einziger den Kuchen aß.
Melia verzog das Gesicht. »Das Landeskriminalamt in Hannover hat uralte Fotos überarbeiten lassen, um zu zeigen, wie Arnold, Büchner und Weiß heute aussehen könnten.«
»Also pure Spekulation.«
»Aber das Beste, was wir haben.«
»Wie kommt die Kripo darauf, dass es dieselben Täter waren?«, wollte Reinhard Zacharias wissen, ein erfahrener Kollege, der an diesem Montag nach längerer Krankheit zum ersten Mal wieder im Dienst war.
»In einigen Fällen gibt es Fingerabdrücke«, erklärte Melia. »Außerdem fällt der immer gleiche Modus Operandi auf. Die Zahl der Räuber, die Ausrüstung mit Sturmhauben, Kalaschnikow und einer Panzerfaust – zum Glück ist die nie benutzt worden.«
»Noch nicht.«
»Fest steht: Das Trio wird wieder zuschlagen. Und zwar bald, nachdem es zuletzt leer ausgegangen ist.«
Und mit jedem Erfolg wuchs die Gefahr, dass sie ihre Guerilla-Träume umzusetzen versuchten. Der Gedanke an die entdeckten Terrorpläne ließ Melia schaudern.
Die revolutionäre Front in den Metropolen neu aufbauen.
Schlagt sie, wo es ihnen wehtut.
Sie verteilte den Text, der möglicherweise von Arnold, Büchner und Weiß stammte. Sie resümierte den Inhalt und berichtete von ihrem Treffen auf dem Autobahnparkplatz bei Hagen. Konstantin Pfeifer, aus Dortmund zugeschaltet, beteuerte noch einmal, wie glaubwürdig seine langjährige Quelle war. Ein überregional vernetztes Mitglied der Bochumer Gruppe.
Melia bedankte sich bei ihm und fuhr fort: »Um das Ausmaß der Terrorgefahr genauer abschätzen zu können, bitte ich euch, all eure Quellen auf das Traktat hin anzusprechen. Wo wurde es bereits diskutiert, wie wird es aufgenommen? Und schließlich: Auf welchen Kanälen kommunizieren die drei RAF-Räuber mit ihren Gleichgesinnten? Gibt es Kontaktleute in unserem Bundesland?«
Sie blickte in die Runde und erkannte, dass ihre Mitarbeiter ausnahmslos von der Brisanz der Lage überzeugt waren. Die Gesamtzahl der Linksautonomen in Nordrhein-Westfalen veranschlagte das Referat auf momentan neunhundertsiebzig Personen. Die Runde beriet, welche roten Socken zuerst für eine Überwachung infrage kamen. Sie einigten sich auf achtunddreißig Namen.
Radikale Wortführer, alte Hasen und notorische Mehrfachtäter. Gewaltbereite Antifaschisten, umtriebige Antiimperialisten, reisende Randalierer. Sie saßen zumeist in den Universitätsstädten.
Der mögliche Kern einer vierten RAF-Generation in diesem Bundesland.
Melia wies ihre Leute an, die Handys und Festnetzanschlüsse der Gefährder abzuhören sowie deren Computer anzuzapfen. Es gab Programme, die verdächtige Aktivitäten im Netz automatisch aufzeichneten – sie sprachen auf einschlägige Begriffe in E-Mails an, auf Eingaben in Suchmaschinen, Seitenaufrufe im Internet. Ziemlich zuverlässige Seismografen.
»Lest stichprobenartig mit, auch wenn die Software keinen Alarm schlägt.«
»Und wenn die Korrespondenz privat wird?«
»Subversive tarnen ihre Ziele und Aktionen gern mit harmlos klingenden Metaphern. Bei ihnen kann auch das Private politisch sein.«
»Sollten wir sie nicht auch observieren?«, fragte Ines Röttinger.
»Oder die Wohnungen verwanzen?«, schlug Knut Richter vor.
»Leider übersteigt das unsere Kapazitäten«, beschied Melia. »Ich würde eher die Liste der Zielpersonen erweitern, deren Kommunikation wir überwachen. Wir werden das je nach Entwicklung der Gefahrenlage entscheiden. Noch Fragen?«
Das war nicht der Fall. Melia beendete die Sitzung und verabschiedete die Kollegen, die via Telefonleitung zugeschaltet waren.
Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss für einen Moment die Augen. Was für ein Coup es wäre, Arnold, Büchner und Weiß das Handwerk zu legen und dem Stadtguerilla-Gespenst ein Ende zu bereiten, bevor es real werden konnte!
Zacharias stand vor ihr. Er hatte Gewicht verloren, wirkte aber erholt. Sein Lächeln gab ihr Zuversicht.
»Gut, dass du zurück bist«, sagte Melia.
»Schön, wieder mit dir arbeiten zu können«, antwortete der Kollege.
08
IM LAUFDES NACHMITTAGSRIEF MELIA zwei Journalisten an. Der eine arbeitete frei für den Spiegel, der andere leitete das Investigativressort der Süddeutschen Zeitung. Beide hatten vor einigen Jahren zu einem Thema recherchiert, für das Melia zuständig gewesen war. Sie hatte ihnen mit geheimen Informationen geholfen, seitdem vertrauten sie ihr.
Was sie gelegentlich nutzte, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Der beste Geheimdienst ist derjenige, dessen Arbeit keiner mitbekommt. Falls das nicht möglich ist, soll er zumindest im besten Licht erscheinen.
Der Mann von der Süddeutschen reagierte skeptisch. »Neulich haben Sie mir noch etwas anderes erzählt. Und warum sollten ausgerechnet die RAF-Rentner eine Gefahr für den Staat darstellen?«
»Die Lage wurde neu bewertet.«
»Und warum?«
»Womit begann die erste Generation der RAF?«, fragte Melia zurück.
»Mit Brandbomben gegen Kaufhäuser in Frankfurt.«
»Und danach?«
»Banküberfälle.«
»Jetzt sind es Geldtransporter. Fällt Ihnen die Parallele auf?«
»Wegen einer missglückten Raubsache soll die Republik in Panik ausbrechen?«
»Es ist nicht bloß eine Raubsache.«
Melia verriet dem Mann die Vorgeschichte. Neun Überfälle. Mit Duisburg zehn. Sie deutete an, welches Waffenarsenal man sich mit dem erbeuteten Geld zulegen konnte, Fluchtfahrzeuge, falsche Pässe – für eine ganze Brigade an Untergrundkämpfern.
»Hm«, war alles, was der Leiter des Investigativressorts darauf antwortete.
Sie spielte ihren letzten Trumpf aus. »Wir müssen als Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Trio auf die Bildung einer neuen Stadtguerilla hinarbeitet. Denn in der Szene kursiert ein Text, der genau das propagiert.«
Der Journalist am anderen Ende der Leitung begann Interesse zu zeigen. Melia las ihm einige Sätze aus dem Pamphlet vor, das sie aus Dortmund erhalten hatte.
Schlagt sie, wo es ihnen wehtut.
Der Redakteur widersprach ihr nicht mehr.
Seinen Kollegen vom Spiegel konnte Melia ebenfalls überzeugen.
Damit hatte sie zwei Leitmedien im Sack. Die übrigen Blätter würden von ihnen als verlässlichen Quellen abschreiben. Damit würde die Nachricht von den perfiden Plänen der RAF-Veteranen und der drohenden neuen Stadtguerilla für Schlagzeilen sorgen.
Ach was – für ein Erdbeben.
Melia informierte ihren Abteilungsleiter, dass er den Minister und die Staatskanzlei darauf einstimmen konnte.
Sie telefonierte mit ihren V-Mann-Führern und schärfte ihnen noch einmal ein, ihre Quellen nach dem Strategiepapier zu fragen und sich sofort bei ihr zu melden, falls es weitere Bestätigungen gab.
Schließlich ging sie noch einmal die Gefährderliste durch. Wem traue ich am meisten zu, die RAF wieder aufleben zu lassen?
Melia blieb an einer Person hängen, die nur wenige Kilometer entfernt auf der anderen Rheinseite lebte, in einem Dorf namens Uedesheim, das zu Neuss gehörte.
Brigitte Veih, Jahrgang 1950 und einstiges Mitglied der zweiten Generation der RAF. 1979 hatte man sie bei einer Schießerei in Augsburg gefasst und nach Verbüßung von zwanzig Jahren Haft in die Freiheit entlassen.
Eine besonders harte Nuss.
Die Frau hatte sich weder von ihren Taten distanziert, noch zu ihren Komplizen ausgesagt. Sie arbeitete als künstlerische Fotografin, galt als einigermaßen renommiert und engagierte sich nebenbei für Flüchtlinge – alles ganz harmlos.
Was Tarnung sein konnte.
Ihr Sohn leitete das hiesige Kommissariat für Tötungsdelikte, wie Melia wusste.
Wie kam der Mann mit seiner Mutter zurecht?
09
VINCENT STELLTESEIN HANDYSTUMM, blätterte durch den Pressespiegel seiner Behörde und wartete darauf, dass die Besprechung der »Mordkommission Gast« endlich begann. Neben ihm sortierte Felix Mey, der die Akten führte, seine Unterlagen. Dominik Roth traf als Letzter im Konferenzraum ein und murmelte einen Gruß. Der Staatsanwalt nickte Vincent zu. Es konnte losgehen.
»Wie geht es dem Täter?«, fragte Vincent als Erstes.
»Schlimmer verletzt, als wir dachten«, antwortete Bruno. »Schädel-Hirn-Trauma, sagen die Ärzte. Dazu beide Beine gebrochen, die OP dauert noch an. Wie’s aussieht, hat Helge Simonis heute wirklich keinen guten Tag.«
»Hat er irgendwas gesagt?«
»Nein, und vor morgen ist an eine Vernehmung nicht zu denken. Aber wir konnten schon mal Fingerabdrücke nehmen und die Schmauchspuren an Händen und Kleidung sichern.«
Dominik meldete sich. »Die chemische Zusammensetzung entspricht der beim Schuss verwendeten Munition. Simonis war definitiv der Schütze.«
»Dafür sprechen auch die Fingerspuren an der Waffe«, ergänzte Fabri.
»Wie müssen wir uns den Ablauf der Tat vorstellen?«, fragte der Staatsanwalt.
Bruno antwortete: »Laut Jana Meier hat Simonis sie zur Rede gestellt, und sie hat den Seitensprung gestanden. Ihr Freund verpasst ihr einen Schlag ins Gesicht und läuft wutentbrannt zum Gästehaus hinüber. Sie sitzt wie erstarrt in der Küche. Als sie das Geschrei hört und Simonis seinen Nebenbuhler in den Keller schafft, kriegt sie Panik und wählt den Notruf. Leider kamen die Kollegen um ein Haar zu spät.«
Dominik hob den Finger wie in der Schule. »Einblutungen im Schulterbereich deuten darauf hin, dass der Täter sein Opfer mehrfach mit dem Gewehrlauf vor sich her gestoßen hat.«
»Auf der Kellertreppe kam es zum Sturz«, sagte Fabri.
»Und Simonis hat das Opfer auch mit dem Kolben verprügelt oder getreten.«
Der Staatsanwalt nickte. »Totschlag, die Eifersucht hat ihn übermannt.«
Vincent widersprach: »Simonis hat die Waffe aus dem Schrank geholt, bevor er Grünberger aus seinem Zimmer trieb. Das sieht also eher nach vorsätzlichem Mord aus.«
»Nicht unbedingt. Er will das Gewehr zunächst nur zur Einschüchterung benutzen und feuert erst, nachdem er im Lauf des Streits mehr und mehr in Rage geraten ist. Zumindest wird sein Anwalt so plädieren, und der Richter könnte dem folgen.«
»Und das Werkzeug im Keller? Spitzhacke, Schaufel, Zement, eine Wanne zum Abtransport des Erdaushubs?«
»Was wollen Sie damit andeuten?«
»Vielleicht war es keine Affekttat. Simonis könnte die Sachen bereitgestellt haben, um nach der Exekution seines Opfers den Boden im Keller aufzubrechen und die Leiche darunter verschwinden zu lassen.«
»Ist das nicht zu weit hergeholt? Außerdem sprach die Zeugin von Renovierungsarbeiten, wenn ich das Protokoll richtig gelesen habe. Die erwähnten Gerätschaften werden dazu gedient haben.«
Während sich der Staatsanwalt von den Kollegen die Aussage von Jana Meier darlegen ließ, zog Vincent den Ordner, der vor Felix Mey lag, zu sich heran und blätterte in den Berichten der Streifenpolizisten, die den Tatort gesichert hatten.
Sein Interesse galt den Personen, die während der Ereignisse mit einem Pick-up vor dem Haus an der Duderstädter Straße aufgekreuzt waren. Er stieß auf die Namen und Adressen zweier Männer, Freunde von Simonis und Meier, die laut ihren Angaben auf einen Kaffee vorbeischauen wollten. Einer von ihnen war der Halter des Pick-ups: Elias Horn, vierundzwanzig Jahre alt. Der andere, Johann Abel, war erst neunzehn.
In den Notizen einer Kollegin war von drei Besuchern die Rede.
Die Personalien des Dritten suchte Vincent vergeblich.
Sein Handy vibrierte. Auf dem Display eine Nummer der Düsseldorfer Polizei, die Vincent nicht kannte. Er entschied, sich jetzt nicht stören zu lassen.
Der Staatsanwalt hatte offenbar genug gehört. Er packte seine Sachen ein und stand auf. Vincent wandte sich an Bruno. »Was hat es mit der ›Freien Republik Hellerhof‹ auf sich?«
»Die Zeugin meint, das Klingelschild befand sich schon dort, bevor sie und Helge Simonis dort eingezogen sind. Simonis hat das Anwesen von seinem Vater geerbt, der vor einiger Zeit gestorben ist. Du siehst, ich hab den Punkt nicht vergessen.«
»Herr Veih«, sagte der Staatsanwalt, reichte Vincent die Hand und war verschwunden.
Die Versammlung begann sich aufzulösen.
Wieder vibrierte das stumm gestellte Mobiltelefon, dieses Mal nur kurz.
Eine SMS. Vincent entsperrte das Display.
Bitte um Rückruf. POKin Brandstätter.
So hieß die Kollegin der Benrather Wache, die einen dritten Besucher erwähnt hatte.
Vincent rief sie zurück.
»Kim hier.«
»Brandstätter?«
»Vincent Che Veih?« Ihre Stimme hatte einen angenehmen Klang, aber es behagte ihm nicht, wie sie seinen zweiten Vornamen betonte. An den Stempel, den ihm seine linksradikale Mutter damit verpasst hatte, würde er sich nie gewöhnen. Auch mit achtundvierzig Jahren fehlte ihm in dieser Hinsicht die Gelassenheit.
»Was gibt’s?«, fragte er, vielleicht ein wenig zu schroff.
»Das Klingelschild. Die Fahne. Die Äußerung des Täters, das Grundstück sei freies Territorium, auf dem ich als Polizistin nichts zu suchen hätte.«
»Und?«
»Reichsbürger.«
»Sicher?«