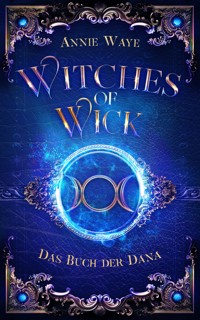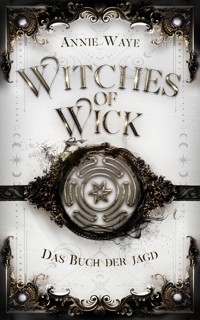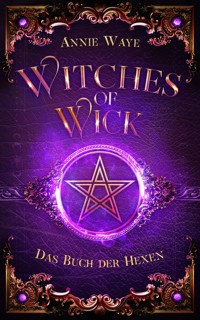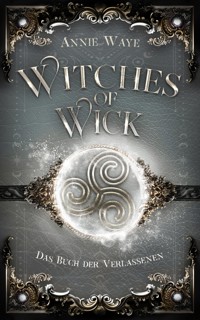2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Annie Waye
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Verdammt, ich war eine erwachsene Frau! Ich würde nicht wie ein kleines Mädchen vor Jan davonlaufen. Zumindest nicht zweimal hintereinander.“
Das neunzehnjährige Dorfmädchen Elli ist ein wahrer Freigeist und hat keine Lust auf ihr neues Leben im spießigen München: Weder auf das Zusammenleben mit ihrer ehrgeizigen Schwester noch auf das schnöde Finanzpraktikum, das diese ihr organisiert hat. Als sie dann auch noch versehentlich in den Schrebergarten von Vorzeigestädter Jan einbricht und dessen Ärger auf sich zieht, ist der München-Horror perfekt – bis sie ihn in ihrer Praktikumsfirma wiedertrifft und von einer ganz anderen Seite kennenlernt, die ihr Herz zum Höherschlagen bringt. Doch Jan hat eine Vorgeschichte, und wenn es nach seinem Umfeld geht, hat Elli in seinem Leben und in seinem Herzen nichts verloren.
"Berührend, romantisch, humorvoll. Die Liebesgeschichte von Elli und Jan hat mich im Sturm erobert." – Autorin Nina Bilinszki („Between Us“-Reihe).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Unterstützt keine Verbrechen. Lest keine Raubkopien. Kauft Bücher.
Annie Waye
c/o JCG Media
Freiherr-von-Twickel-Str. 11
48329 Havixbeck
´
© 2022 Annie Waye
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung: Emily Bähr
Lektorat und Buchsatz: Kaja Lange
ISBN (Taschenbuch): 978-3-9859-5314-1
Für alle, die suchen, was sie nicht finden, und dabei finden, was sie nie suchten.
1. Kapitel
Im Zug war es eng und laut, und über allem lag ein leichter Geruch von Kotze. Ich wusste nicht, ob ich mir die Augen, die Nase oder die Ohren zuhalten sollte. Das hier könnte ein Sinnbild für das Leben sein, das mich in München erwartete.
Seit zwei Stunden befand ich mich nun schon auf diesem Ritt in die Hölle. Ich hatte zwei große Koffer bei mir, die nicht mehr in die Kofferablage gepasst hatten, weil aus irgendeinem Grund noch hundert andere Menschen auf die Idee gekommen waren, genau um diese Tageszeit mit diesem Zug in diese Richtung zu fahren – bepackt mit noch mehr Gepäck als ich.
Ich zog für mein restliches Leben von zu Hause aus. Was war ihre Ausrede?
Also saß ich in einem Vierersitz, meine Koffer vor mir, sodass eigentlich kein anderer hier Platz gefunden hätte. Hatte die zwei dicken Kerle aber nicht davon abgehalten, sich mir gegenüber niederzulassen und sich am laufenden Band über mein Gepäck zu beschweren, weil es ihre Beine streifte.
Ich hasste Züge. Ich hasste Autos. An Tagen wie diesen hasste ich sogar Menschen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich ab sofort mehr davon bekommen würde als in meinem ganzen bisherigen Leben.
Dieses hatte ich auf dem Bauernhof meiner Eltern verbracht – den sie in genau diesen Sekunden verkauften, um ebenfalls ihre Sachen zu packen und pünktlich zum Ruhestand in die Schweiz auszuwandern. In. Die. Schweiz. Was hatten die dort, was das Berchtesgadener Land nicht hatte? Und was zur Hölle sollte ich jetzt machen?
»Du bist neunzehn Jahre alt, Elli«, hatte Mama zu mir gesagt. »Alt genug, um endlich deinen eigenen Weg zu gehen.« Ich kapierte es immer noch nicht. Andere Eltern waren froh, wenn ihre Kinder den Betrieb übernehmen wollten. Mir hatten sie nicht mal eine Wahl gelassen.
Mein Abi war schon ein Jahr her, und ich hatte die letzten zwölf Monate Vollzeit auf dem Hof gearbeitet. Ach was – ich war darin aufgegangen! Ich hatte es geliebt. Eigentlich hatte ich nie etwas anders machen wollen. Jetzt aber blieb mir nichts anderes übrig. Die mehreren hunderttausend Euro, für die meine Eltern den Hof zum Verkauf angeboten hatten, hatte ich mir von meinem Taschengeld leider nicht zurücklegen können.
Was macht man also, wenn man geglaubt hat, sein Leben voll auf die Reihe zu bekommen, nur um dann von einem Tag auf den anderen wieder mit nichts dazustehen? Richtig – man studiert. Oder man versucht es zumindest.
Es war Juni, vier Monate vor Beginn des ersten Semesters – sollte ich denn angenommen werden. Entgegen den Ratschlägen meiner Eltern hatte ich mich nur auf einen einzigen Studiengang beworben: Tiermedizin. Ein paar Wochen lang hatte ich auch mit agrar-wissenschaftlichen Fächern geliebäugelt, war dann jedoch zu dem Schluss gekommen, dass mir das Leben in dieser Hinsicht schon genug beigebracht hatte.
Tiermedizin. War das mein Traum? Ich hatte keine Ahnung. Aber es war mein Plan A, und ich hatte noch nicht weit genug gedacht, um einen Plan B zu finden.
Das war auch völlig in Ordnung so. Denn bis zum Studienstart würde ich ein paar tolle Sommermonate bei meiner Schwester Lydia verbringen. So toll sie bei ihr eben sein konnten.
Auf dem Weg zu Lydias Apartment brach die Sonne zwischen den Wolken hervor, fast so, als wollte sie sich für den schrecklichen Start in München entschuldigen. Ihre Strahlen brachten meine Haut zum Kribbeln. Sie ließen mich auf halber Strecke sogar einmal innehalten, die Augen schließen und darauf hoffen, dass das alles vielleicht doch nicht so schlimm werden würde wie gedacht.
Lydia und ihr Mann Mats lebten in Nymphenburg im Norden Münchens. Der Stadtteil war genauso gut betucht, wie er sich anhörte. Das namensgebende Schloss war nicht weit entfernt – ein Prachtstück von Gebäude, das in München erstrahlte, ohne protzig zu werden, mit einer weitläufigen Grünanlage und Seen, in denen strahlend weiße Schwäne ihre Kreise zogen.
Hätte sich ihr die Chance geboten, wäre Lydia wahrscheinlich direkt ins Schloss eingezogen. So aber hatte sie mit einem Luxuswohnblock einige Ecken weiter vorliebnehmen müssen.
Die Aussicht darauf, im Loft zu wohnen, begeisterte mich inzwischen nicht mehr annähernd so sehr wie bei meinen letzten Besuchen. Für drei Zimmer bezahlten sie über zweitausendfünfhundert Euro im Monat – ein Betrag, der keinen von ihnen juckte.
Absolut überall reichten die Fenster bis zum Boden, und hätten sie nicht im dritten Stock gelebt, hätte man sich ständig Sorgen machen müssen, dass irgendein herumstreunender Passant einen beim Umziehen bespannte. Die Küche war ziemlich groß, der Wohnbereich übertrieben riesig und das Bad dafür geradezu beengt winzig. Das Waschbecken war sogar so klein, dass man nicht mal ein Kaninchen darin hätte ertränken können. Was sie vor dem Erstbezug vermutlich als weitläufigen, privaten Dachgarten beschrieben hatten, war einfach nur ein nacktes Dach, auf dem man einen Baum angepflanzt hatte. In Zahlen: 1.
Die Aussicht von da oben war ganz okay, aber meistens zog so ein elendiger Wind vorbei, dass man es nicht länger als dreißig Sekunden dort aushielt.
Neben dem Dachgarten besaß das Gebäude ein übertriebenes Fitnessstudio, das wahrscheinlich sowieso niemand benutzte, weil sich diejenigen, die sich den Schuppen hier leisten konnten, lieber noch eine Mitgliedschaft in einem VIP-Schickimicki-Gym gönnten, zu dem sie dann eine Stunde mit dem Auto durch den Verkehr schnecken konnten, nur um nach zwanzig Minuten Zumba wieder abzudampfen.
Es war Mittwoch zur Mittagszeit und normale Leute bei der Arbeit, sodass ich im Gebäude kaum jemandem begegnete. Damit fand ich auch keine gute Seele, die mir dabei half, meine beiden Koffer in Richtung Aufzug zu wuchten. Lydia hatte sich den halben Tag freigenommen, um mich zu empfangen. Darauf, dass sie mich auch vom Bahnhof hätte abholen können, war sie wohl nicht gekommen. Meine Nachricht hatte sie jedenfalls nicht beantwortet, sodass ich mich auch noch in dem Gewirr aus U- und S-Bahnen hatte zurechtfinden müssen, bis ich schließlich irgendwie in Nymphenburg gelandet war.
Alles hier war so anders als zu Hause. Teisendorf war, wie der Name schon sagte, ein Dorf. München war die Hauptstadt von Bayern. Teisendorf hatte Kühe und Schweine und Felder. München hatte Parks, in denen der allgegenwärtige Verkehr aber immer noch deutlich hörbar war. Teisendorf hatte nur eine Amtssprache, und zwar Bairisch – ein Dialekt, mit dem man hier teilweise eher schlecht als recht durchkam. In München brachten viele nicht mal ein glattes »O’zapft is!« heraus.
Teisendorf hatte Freunde und Nachbarn, die ich mein Leben lang kannte. München hatte unzählige Menschen, denen man höchstens dann näherkam, wenn sie einen auf der Straße anrempelten, ohne sich zu entschuldigen.
Oh, wie ich mich doch darauf freute.
Der Aufzug brachte mich unbeschadet in den dritten Stock. Nachdem ich den ersten Koffer herausgezogen hatte, schlossen sich die Türen jedoch wieder, und obwohl ich verzweifelt gegen den Knopf hämmerte, dauerte es nochmal fünf Minuten, bis er endlich zu mir zurückkehrte. Mein Gepäck war zum Glück noch drinnen.
Obwohl Lydia extra auf mich gewartet hatte, brauchte sie eine schiere Ewigkeit, bis sie nach dem Anklopfen die Tür öffnete. Sie lächelte freudlos. »Willkommen in München, Elena.«
Ich strich mir eine pinke Haarsträhne hinters Ohr und versuchte zumindest, mein Lächeln aufrichtig wirken zu lassen. »Ich hab gut hergefunden, danke.«
Das war alles an Begrüßung. Lydia beugte sich gnädiger Weise vor und nahm mir einen meiner Koffer ab, zog ihn aber gerade so über die Türschwelle, ehe sie ihn wieder losließ.
Wir hätten uns vielleicht ähnlich gesehen, hätte ich meine Haare nicht gefärbt und würde sie nicht ständig eine Schnute wie zehn Tage Regenwetter ziehen. Sie arbeitete als Anwältin, und obwohl sie immer betonte, dass sie sich den Job nicht wegen der Kohle ausgesucht hatte, sondern weil sie ihn liebte, konnte sie die tiefe Stirnfalte nicht mehr kaschieren, die er ihr beschert hatte.
Innerlich hatten wir quasi nichts gemeinsam. Während ich mein Leben auf dem Hof verbracht hatte, war meine Überflieger-Schwester mit siebzehn ausgezogen, um Jura zu studieren, und hatte seitdem nicht zurückgeblickt. Sie war nicht mal nach Teisendorf gekommen, um sich von ihrer Kuh Lily zu verabschieden, die meine Eltern vor fünfzehn Jahren verschont hatten, weil sie sie so sehr ins Herz geschlossen hatte.
Lily war eine sehr, sehr traurige Kuh gewesen.
»Du bist spät dran.« Lydia schritt ins Innere der lichtdurchfluteten Wohnung. Obwohl wir draußen gut achtundzwanzig Grad hatten, war es hier drinnen schon fast unangenehm kühl. Vielleicht lag es an der Klimaanlage, vielleicht auch an der Stimmung zwischen uns.
»Sorry, mein Zug hatte Verspätung«, erwiderte ich. Und der danach auch. Und der danach auch. »Ich hatte dir eine Nachricht geschrieben.«
Lydias Brauen schossen in die Höhe. Sie zog ein dickes Handy aus der Tasche ihres schwarzen Zweiteilers und warf einen Blick darauf. »Oh«, sagte sie ohne wirkliches Bedauern. »Hab ich gar nicht gesehen.«
Was du nicht sagst.
»Ich muss gleich los, also …« Sie steckte ihr Handy zurück und führte mich quer durch den Wohnbereich in Richtung einer schlichten Tür. »Du schläfst hier. Das hier ist das zukünftige Babyzimmer«, klärte sie mich auf, ohne zu betonen, in welcher weit entfernten Zukunft der Teil mit dem Baby noch lag. »Aber bis es da ist, wirst du sowieso schon was anderes gefunden haben.« Das war keine Frage, sondern eine Drohung.
Ich dachte, ich hätte die Bedeutung von zukünftiges Babyzimmer verstanden – bis Lydia die Tür öffnete und ich von dem Anblick förmlich erschlagen wurde.
Die Wände waren in einem geradezu stechenden Sonnengelb gehalten. Auf der rechten Seite des Zimmers befand sich ein hohes Baby-Bett inklusive Stofftieren und Mobile mit bunten Hunden, Katzen und Vögeln. Dazu ein schmaler Kleiderschrank, eine Kommode und ein überdimensionaler Plüsch-Hase, der in einer Ecke des Zimmers darauf wartete, nachts zum Leben zu erwachen und mich zu fressen.
»Oida!«, stieß ich hervor. »Ihr wisst doch noch nicht mal das Geschlecht.«
»Das ist egal«, erklärte sie in perfektem Hochdeutsch. Ihren Dialekt hatte sie wahrscheinlich an dem Tag abgeworfen, als sie nach München gezogen war – oder spätestens dann, als sie den gebürtigen Kieler Mats kennengelernt hatte. »Wir haben uns dazu entschieden, das Kind geschlechtsneutral zu erziehen, so wie Harry und Meghan. Und mit der Einrichtung kann man nie früh genug anfangen.«
O doch. Wenn man bedachte, wann sie damit begonnen hatten, dieses Zimmer umzugestalten, konnte man sechzehn Monate zu früh anfangen. Immerhin war sie jetzt seit ein paar Wochen schwanger, und die Baby-Willkommens-Party, die sie bestimmt schon seit fünf Jahren plante, könnte endlich bald steigen.
Lydia nickte in Richtung der linken Wand. Dort lag eine Matratze inklusive Kissen, Decke und Bezüge auf dem Boden. Alles noch in Plastik verpackt. Wahrscheinlich würde sie die Sachen nach meinem Auszug verbrennen. »Du kannst dich hier später breitmachen.« Aber nicht zu sehr, schwang es deutlich in ihren Worten mit. »Jetzt müssen wir erst mal ein paar Eckpunkte klären.« Oje. Wollte sie mich dazu zwingen, einen Untermietvertrag zu unterschreiben? Da wäre nicht mal das Verrückteste, was sie je abgezogen hatte.
Lydias Absätze klackerten auf dem Parkettboden, als sie in Richtung der offenen Küche schritt. Sie war verdammt stolz auf ihre Wohnung. Mats und sie waren erst vor drei oder vier Jahren hierhergezogen, und der Boden strahlte noch genauso wie am ersten Tag. Gleichzeitig besaßen sie all das Smarthome-High-Tech-Zeug, das man heutzutage (nicht) brauchte. Das änderte aber nichts daran, dass das Gebäude von außen auch genauso gut ein Altenheim hätte sein können.
Aus irgendeinem Grund besaßen sie drei Öfen, die nebeneinander auf Brusthöhe an der Wand angebracht waren, und anstelle eines normalen Esstischs stand da eine lange Tafel mit zehn Stühlen, die sie bestimmt noch nie alle besetzt bekommen hatten. Die Arbeitsfläche und Spüle befanden sich auf einer Insel mitten in der Küche und bildeten das einzige Hindernis zwischen Lydia und mir. Diese füllte gerade ein Glas mit Wasser, als könnte sie spüren, wie trocken meine Kehle war – und leerte es in einem Zug selbst.
»Also gut. Im Oktober ist Studienbeginn«, zählte sie auf, »und spätestens im August solltest du alle Rückmeldungen der Universitäten haben.« Lydia rieb sich ihren Bauch, obwohl von ihrer Babykugel noch rein gar nichts zu sehen war. So wie sie alles in ihrem Leben peinlich genau geplant hatte, war sie pünktlich zu ihrem dreißigsten Geburtstag schwanger geworden, bevor ihre biologische Uhr hätte anfangen können zu ticken. »Die Frage, die sich mir nun stellt, ist: Was ist dein Plan für die nächsten Monate?« Erwartungsvoll starrte sie mich an – und verunsicherte mich damit in Grund und Boden.
»Was?«, fragte ich. »Denkst du, ich hab ne PowerPoint vorbereitet?«
Sie runzelte die Stirn. »Das war nur eine einfache Frage.«
Ich zuckte die Achseln. »Und ich hab keine Antwort darauf.« Verdammt, ich war doch gerade erst zur Tür reingekommen! Und ich hasste es jetzt schon.
Meine Schwester verengte die Augen. »Sag bitte nicht, dass du den Sommer nur zum Faulenzen eingeplant hast.«
Auf einmal konnte ich ihrem Blick nicht mehr standhalten. Aus ihrem Mund klang es so, als wäre das etwas, wofür man mich noch in achtzig Jahren in die Hölle stecken würde. »Ich würde es eher als Selbstfindungsphase bezeichnen. Du weißt schon«, fügte ich hinzu. »Ob Tiermedizin das Richtige für mich ist.«
Sie verzog keine Miene. »Und wenn du erst gar nicht zugelassen wirst?«, fragte sie scharf. »Was angesichts deines tollen Abi-Schnitts höchstwahrscheinlich passieren wird?«
Ich verdrehte die Augen. »Dann mach ich ein FSJ oder so. Mir rennt schließlich nichts davon.«
Lydia schnaubte belustigt. »Kommt überhaupt nicht infrage, Fräulein!«
Ich stutzte. »Seit wann hast du das zu entscheiden?«
»Seit du hier unter meinem Dach wohnst.« Also seit fünf Minuten. »Dir ist klar, dass du dich hier keine vier Monate bei mir durchfressen wirst, oder? Ich tue Mama und Papa einen Gefallen, weil ich dich hier wohnen lasse.« Sie griff in ihre Handtasche, die neben der Spüle stand, und begann darin zu wühlen. »Aber ich bin kein Gratis-Hotel. Ich bekomme also dreihundert Euro monatlich von dir – in bar oder per Überweisung.«
Entsetzt riss ich die Augen auf. »Nicht dein Ernst.« Ließ sie ihr ungeborenes Kind auch schon Miete bezahlen? »Wo zur Hölle soll ich denn dreihundert Euro herbekommen?« Ich konnte mein Erspartes jetzt schon heulen hören wie einen Wolf.
Sie seufzte, als wären bei mir schon Hopfen und Malz verloren. »Und genau deshalb«, verkündete sie, »hab ich dir einen Praktikumsplatz besorgt.«
Ich verstand die Welt nicht mehr. War es zu spät, meine Koffer zu packen, von hier zu verschwinden und so zu tun, als wäre all das hier nicht passiert?
Lydia zog einen dunkelblau-pinken Flyer aus ihrer Tasche hervor, den sie mir unter die Nase hielt.
Ich nahm ihn ihr ab, und mir drehte sich der Magen um. Auf dem Flyer sah man eine junge, strahlende Frau, die mit einem Mini-Computer vor einem blitzblank glänzenden Elektroauto posierte. DEINE KARRIERE BEI TNT MOTORENWERKE stand in fetten Lettern darauf geschrieben.
»TNT?«, stieß ich hervor. Gefühlt alle deutschen Firmen hatten ihren Sitz in München. Aber wenn man in der Masse untergehen wollte, bewarb man sich bei TNT. Dort, wo jeder arbeitete, Teil des Systems wurde und einen Haufen Geld verdiente, ohne wirklich etwas im Leben zu erreichen. »Wenn die nicht seit neustem wieder klassische Pferdestärken herstellen, bin ich nicht interessiert.«
»Ich hab dich über meine Bekannte Marta dorthin vermittelt«, teilte sie mir mit und spielte schon wieder mit ihrem Handy rum. Hundertpro ihr Diensthandy – so viele Freunde konnte sie schließlich nicht haben. »Du wirst in der Finanzabteilung eingesetzt werden.«
»Finanzen?!«, wiederholte ich. Okay, jetzt wurde mir endgültig übel. »Und wie kommst du darauf, dass jemand wie ich im Bereich Finanzen gut aufgehoben wäre?« Ich wünschte, ich hätte die Chance bekommen, Mathe in der Schule abzuwählen. Dann hätte ich jetzt nicht mit einer zusätzlichen Drei im Zeugnis herumlaufen müssen.
Lydia verdrehte die Augen. »Es ist nur ein Praktikum. Die werden keine Meisterleistungen von dir erwarten. Hauptsache, du bekommst Kohle auf dein Konto. Und das ist bei Praktika heutzutage nicht selbstverständlich.«
»Bei einem sozialen Jahr verdiene ich doch auch Geld!«, hielt ich dagegen.
Lydia schnaubte. »Aber nicht genug, um hier auch nur einen Monat zu überleben.«
Ungläubig schüttelte ich den Kopf. »Das ist ja jetzt wohl eindeutig –«
»Was ist der Sinn von einem sozialen Jahr?«, sprach sie es in einem Tonfall aus, den nur Anwälte draufhatten, für die Pro Bono ein Fremdwort war. »Du willst es machen, um herauszufinden, wohin du im Leben willst. Aber du kannst bei TNT genau dasselbe tun – und dir nebenbei etwas Geld für später zurücklegen. Es ist deine vernünftigste Option.«
Ich presste die Kiefer aufeinander. Ich hasste es, wenn sie die Vernunft-Keule schwang. Weil sie mir damit jeglichen Wind aus den Segeln nahm. Ich war nicht der Typ für Logik und Weitblick. Was war so falsch daran, das Leben einfach auf sich zukommen zu lassen?
Ich jedenfalls hatte nicht geringste Lust, mich in die Schublade zwängen zu lassen, die Lydia für mich ausgeräumt hatte. Ich wandte den Blick ab. »Nein. Definitiv nein.«
»Also gut. Wenn du auf stur schalten willst, dann machen wir es eben so: Wenn du die Stelle nicht annimmst«, grollte sie, »brauchst du deine Koffer erst gar nicht auspacken. Verstanden?«
Das reichte aus, um den Funken der Wut endgültig in mir zu entzünden. »Das ist Erpressung!« Ich schluckte. »D-Das ist nicht fair!«
»Fair?« Sie hob eine Braue. »Du wohnst hier bei uns, also bezahlst du Miete. Um die Miete bezahlen zu können, musst du arbeiten und Geld verdienen.« Sie schüttelte den Kopf. »Was daran soll bitte unfair sein?«
Mein Mund klappte zu. Ich hasste es, wenn sie Argumentationsketten runterratterte. Als wäre es Teil ihres Jobs, mich in Grund und Boden zu reden.
Lydia atmete tief durch. »Montag geht es los.« Sie musterte mich kurz. »Bitte tu mir den Gefallen und sorge dafür, dass du bis dahin vorzeigbar aussiehst.«
Ratlos blickte ich an mir hinab. Ich trug ein weißes Tank-Top mit nichts drunter, weil es absolut nicht nötig war, und blaue Hotpants. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie von der roten Rose sprach, die auf meinem rechten Schulterblatt prangte, oder von meinen Haaren, die ich mir seit ein paar Monaten pink färbte, bei denen sich aber ein dicker, blonder Ansatz abzeichnete. »Warum?«, gab ich zurück und wickelte mir eine Strähne um den Finger. »Passt doch zu den Firmenfarben.«
»Tu, was ich dir sage«, beharrte sie. »Ich muss jetzt los.«
Ich folgte ihr mit dem Blick, während sie ihre Tasche packte und zur Haustür stolzierte. »Wann kommen Mats und du nach Hause?«
»Am Abend«, war alles, was sie mir verriet. »Und zieh dir nen BH an!«
»So was hab ich nicht!«, rief ich ihr hinterher, und ihr genervtes Stöhnen drang noch durch die geschlossene Tür hindurch.
Das war es dann. Stille legte sich über die Wohnung, und urplötzlich fühlte ich mich in einer Stadt mit über einer Million Einwohnern so einsam wie noch nie in meinem Leben zuvor.
Lustlos schlurfte ich zum Esstisch und ließ mich an dessen Kopfende nieder. Ich warf den Flyer auf die Tischplatte und starrte das vereiste Lächeln der Pseudo-Mitarbeiterin von TNT an.
Ich seufzte. »Willkommen in München, Elli.«
Der Nachmittag war zäh wie Kaugummi. Ich hatte mir ein etwas längeres Willkommen von Lydia erhofft und mir deshalb überhaupt keine Gedanken gemacht, wie ich den restlichen Tag verbringen könnte. Also war ich durch Nymphenburg spaziert und hatte mir von meinem letzten Taschengeld, mit dem ich auch meine erste Monatsmiete hätte bezahlen können, ein gebrauchtes Fahrrad gekauft. Die S-Bahnen hatten mir schon heute den letzten Nerv geraubt.
Ich fuhr damit durch mehrere Parks, verfuhr mich mindestens zweimal und kam erst um achtzehn Uhr wieder im Apartment an.
Damit war ich die Erste. Arbeiteten Lydia und Mats immer so lange? Ich schrieb beiden eine Nachricht, wagte es aber gar nicht erst, zu hoffen, dass sie sie lasen.
Nachdem ich das ohnehin schon beengte Kinderzimmer restlos mit meinem Krempel vollgestopft und mein Bettzeug ausgepackt hatte, gab es immer noch kein Lebenszeichen von ihnen. Musste ein ziemlich stressiger Tag für die beiden sein. Noch stressiger als für mich, die in aller Herrgottsfrühe aufgestanden war, fertig gepackt, sich unter Tränen von ihren Tieren verabschiedet, ihre Koffer in drei Züge, vier S-Bahnen (ich war ein paarmal falsch eingestiegen) und einen Aufzug gehievt hatte, nur um dann den restlichen Tag allein zu verbringen.
Lydia und ich hatten noch nie ein enges Verhältnis gehabt – allein schon wegen der elf Jahre Altersunterschied nicht –, aber ich hatte das Gefühl, dass wir uns heute auf einem noch falscheren Fuß erwischt hatten. Auch wenn ihr mein ganzer Lebensstil nicht in den Kram passte, wollte ich als Vorzeige-Untermieterin mein Bestes tun, um den Haussegen wieder geradezurücken.
Ich sah mich etwas in der Küche um und fand … so gut wie nichts. Irgendwie kratzte ich gerade so zwei Packungen Vollkornnudeln und eine Dose gehackter Tomaten zusammen und machte mich daran, das Abendessen zu kochen. Damit wollten sich Lydia und Mats nach einem anstrengenden Arbeitstag bestimmt nicht abgeben.
Um Viertel nach sieben war ich fertig damit – und starb schon vor Hunger. Ich hatte den ganzen Tag über nichts Richtiges gegessen, abgesehen von einem lauwarmen Panini am Hauptbahnhof. Von meiner Schwester und meinem Schwager war immer noch weit und breit nichts zu sehen – nicht einmal, als ich die nächsten zwanzig Minuten damit verbrachte, aus dem riesigen Fenster in Richtung Straße zu starren.
Wo waren sie?
Totenstille legte sich über die Wohnung. Der ganze Block lag in einer ruhigen Gegend, in der für Münchener Verhältnisse vergleichsweise wenige Autos herumfuhren. Die Wohnung war dabei so gut schallisoliert, dass nicht einmal ein leises Rauschen durch die Fenster drang. Auch aus Richtung des Hausflurs ertönte kein einziges Geräusch.
Ich schrieb ein paar mehr Nachrichten und rief Lydia an – nope. Während ihr Diensthandy sogar sonntagnachts angeschaltet war, zollte sie ihrem privaten Telefon keine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich, weil sie sonst sowieso niemand erreichen wollte.
Ich hielt die Nudeln im Topf warm, bis sie hoffnungslos verklebt waren, und spielte mehr als einmal mit dem Gedanken, einfach ohne sie anzufangen. Aber sogar daraus könnte mir Lydia einen Strick drehen, weshalb ich die Zähne zusammenbiss und mich mit Keksen aus einem meiner Koffer über Wasser hielt.
Ich hatte fast die ganze Packung gefressen, bis endlich eine Reihe monotoner Pieptöne aus Richtung Wohnungstür an meine Ohren drang: Jemand gab den Zugangscode in das dazugehörige Panel (total abgespaced, ich weiß) ein. Eine schubartige Nervosität stieg in mir hoch. Ich sprang von meinem Stuhl auf und riss förmlich die Nudeln vom Herd. Als ich zum gedeckten Tisch zurückkehrte, waren Lydia und Mats gerade so drinnen angekommen.
»Hey, Elli«, begrüßte er mich freundlich.
»Willkommen zu Hause!« Obwohl ich ihnen am liebsten an die Gurgel gegangen wäre, rang ich mir ein Lächeln ab. »Ich hab Pasta mit Tomatensoße gekocht«, verkündete ich und stellte den Topf auf dem Tisch ab. Schnell eilte ich zurück zur Küchenzeile, um den zweiten mit der Soße zu holen. Erst als ich auch diesen zu seinem Platz gebracht hatte, fiel mir auf, dass die beiden zwar Schuhe und Jacke ausgezogen hatten, sich abgesehen davon jedoch nicht vom Fleck bewegten.
Ich stockte. »Ist was?« Waren sie allergisch gegen Pasta? Aber dann würden sie wohl kaum welche in ihrer Wohnung bunkern.
Während Mats peinlich berührt dreinblickte, wirkte Lydia genervt. »Wir sind auswärts essen gegangen«, sagte sie. »So wie jeden Mittwoch.«
Stille legte sich über den Raum, die einzig und allein vom Knurren meines Magens unterbrochen wurde. »Oh.« Deshalb hatten sie so lange gebraucht.
Unsicher blickte Mats von Lydia zu mir. »Also, ehrlich gesagt«, hob er an und kam auf mich zu, »hätte ich immer noch Platz für ein bisschen Pasta.« Damit schob er den Stuhl mir gegenüber zurück und setzte sich. »Ich liebe Tomatensoße.« Er schnappte sich die Nudelkelle vom Tisch. »Komm, reich mir deinen Teller.«
In diesem Moment wollte ich einfach nur heulen. Wie hatte jemand wie meine Schwester einen so tollen Mann wie ihn abbekommen können?
Ich hielt ihm meinen Teller hin, und er belud ihn mit einer riesigen Portion Nudeln. Dann drehte er den Kopf und blickte Lydia entgegen, die sichtlich ratlos mitten in der Wohnung stand. »Setzt du dich zu uns, Schatz?«
Sie atmete einmal tief ein und aus. »Von mir aus.« Anstatt sich neben ihm niederzulassen, machte sie einen Umweg in Richtung Küche, wo sie sich ein Glas Placebo-Wein (Traubensaft) einschenkte. Mit diesem bewaffnet setzte sie sich ans Kopfende, als wollte sie mir damit auf subtile Art etwas unter Beweis stellen.
»Wie geht’s dir, Elli?«, fragte Mats höflich. »Freust du dich schon auf das Praktikum?«
Es überraschte mich nicht, dass er davon ausging, das Praktikum wäre eine sichere Sache. Wahrscheinlich hatte Lydia ihm genau das erzählt. Ich bemühte mich, die Fassung zu bewahren. Denn schlechter als unsere erste, kühle Begrüßung konnte es trotz allem immer noch werden. Das hatten mir die letzten zehn Jahre Eiszeit zwischen uns gezeigt. »Ja«, sagte ich schließlich und versuchte dabei, die Reaktion meiner Schwester aus dem Augenwinkel zu beobachten. »Ich war am Anfang nicht sehr begeistert, aber … eigentlich ist es keine so schlechte Idee.« Ich hatte den ganzen Tag Zeit gehabt, um mir Gedanken zu machen. Fakt war, dass ich hier absolut niemanden kannte. Mit einem Job wäre ich zumindest fünf Tage die Woche unter Menschen. Auf Lydias und Mats’ Gesellschaft konnte ich ja ganz offensichtlich nicht zählen.
»Glaube ich auch.« Er hatte vielleicht gerade so zwei Nudeln gegessen, lehnte sich aber schon auf seinem Stuhl zurück, als wäre er fertig. »TNT ist ein sicherer Arbeitgeber. Wenn du dich gut machst, könntest du bestimmt auch länger bei ihnen bleiben.«
So groß war meine Begeisterung dann doch wieder nicht. »Mal sehen.«
Lydia räusperte sich. »Und? Hast du dich etwas in München umgesehen?«
Ich lächelte. »Ja. Und ich hasse es.«
Lydias Augen weiteten sich, doch Mats verstand meinen trockenen Humor und lachte. »Das muss eine ganz schön große Umstellung für dich sein. Wenn du mal ein bisschen Abstand von dem ganzen Trubel brauchst, kannst du ja mal bei unserem Schrebergarten vorbeischauen.«
Erstaunt sah ich auf. »Ihr habt einen Schrebergarten?«
Mats nickte. »Ist schon eine Weile in Familienbesitz, allerdings haben wir uns die letzten Jahre über nicht so gut darum gekümmert.« Er lächelte verlegen. »Die Arbeit. Aber«, fügte er hinzu, »jetzt, wo ein Kind im Anmarsch ist, wäre es vielleicht an der Zeit, ihn herzurichten.«
Mein Herz machte einen freudigen Sprung. »Das könnte ich doch machen! Ich bringe ihn auf Vordermann.« Und könnte dieser furchtbaren Stadt damit zumindest für ein paar Stunden die Woche entfliehen.
Mats wirkte erstaunt darüber, dass ich meine Hilfe anbot. »Klar. Wenn du willst.« Er wechselte einen Blick mit Lydia. »Dafür könnten wir ja glatt deine Miete reduzieren.«
Lydia grunzte. »Wir werden sehen«, sagte sie schroff.
»Komm.« Mats erhob sich und durchquerte den Wohnbereich, bis er vor einem Schlüsselhalter neben der Wohnungstür stehenblieb. Neben Auto- und Ersatzschlüsseln für die Wohnung hing dort noch ein weiteres, viel kleineres Exemplar, das er herunternahm und mir hinhielt. »Damit bekommst du das Gartentor und die Tür der Hütte auf«, erklärte er.
Als ich das kalte Metall auf meiner Handfläche spürte, fühlte ich mich meinem bisherigen Leben gleich ein bisschen näher. So sehr, dass ich kaum mehr zuhören konnte, als Mats mir völlig überflüssige Anweisungen gab. Als wüsste ich nicht, wie ein Garten aussah.
»Es ist die Parzelle Nummer …«
Obwohl ich erst seit ein paar Stunden von zu Hause weg war und noch keine Nacht in diesem furchtbaren Babyzimmer geschlafen hatte, kam mir der Garten auf einmal wie das Paradies auf Erden vor.
»… erkennen … ein kleines bisschen verwahrlost …«
München war so riesig und voller Menschen und Autos und Lärm. Und wenn es nach Lydia ging, würden die nächsten Monate die Hölle für mich werden.
»… Gartenhaus ist nicht …«
Umso schöner die Aussicht, der Großstadt und ihr entkommen zu können, wann immer ich wollte.
2. Kapitel
Ich wollte mir ein paar Tage Zeit geben, um München in all seinen Facetten (von denen ich noch auf positive hoffte) kennenzulernen, hielt es aber nicht lange aus. Schon am Samstag hatte ich die Auszeit im Schrebergarten dringend nötig. Da Lydia und Mats sowieso wieder arbeiten oder essen oder vielleicht auch einfach spontan für zwei Monate verreist waren, ohne mir Bescheid zu sagen, schnappte ich mir meinen Schlüssel und schwang mich auf mein Rad. Die Gartenanlage befand sich nur ein paar Blocks von der Wohnung entfernt, und ich wäre in null Komma nichts da.
Dachte ich zumindest.
Ich konnte Autos nicht ausstehen. Ich hatte zwar schon mit sechzehn meinen Führerschein gemacht, aber nur, weil ich vom Land stammte und Bus und Bahn dort Fremdwörter waren.
Ich konnte auch Verkehr nicht ausstehen. Am wenigsten die Ampeln, die sich in den entlegensten Ecken und Winkeln der Kreuzung versteckten, wo ich sie nicht sehen konnte, und die immer dann umschalteten, wenn ich sie erreichte. Ich hasste den Lärm, die Abgase, das ständige Gehupe und die Fahrer, die einen alle fünf Minuten beinahe vom Rad fuhren. Genauso wie die Fußgänger, die mir konstant in die Quere sprangen, als wollten sie es darauf anlegen, überfahren zu werden. Warum konnten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer zumindest durchschnittlich sozial verhalten?
Nein, ich war definitiv nicht für die Stadt geschaffen. Und auf einmal kamen mir Zweifel, dass ich ein mindestens fünfjähriges Studium hier überstehen würde.
Du wirst dich daran gewöhnen, redete ich mir ein. Aber ganz sicher war ich mir da nicht.
Letzten Endes brauchte ich fast eine halbe Stunde bis zu den Schrebergärten – doch ich wurde nicht enttäuscht. Die Anlage war eine grüne Oase mitten in der Stadt, umgeben von hohen Hecken und Büschen, die neugierige Blicke ausschlossen. Ich sperrte mein Fahrrad vor dem Eingang an einer Straßenlaterne ab und trat ein. Der bloße Anblick brachte mein Herz zum Höherschlagen.
Wohin ich auch sah, erstreckten sich süße kleine Gärten mit süßen kleinen Hütten in allen möglichen Farben und Holz-Arten, umringt von süßen kleinen Zäunen. Was ihre Grundfläche betraf, waren sie alle gleich, aber damit endeten auch schon die Gemeinsamkeiten.
Blumen- und Gemüsebeete drängten sich dicht an Sträucher und Bäume. Die Geräusche der Autos wurden beinahe vollständig von Vogelgezwitscher und – leider – Rasenmähern übertönt. Die Sonne schien hier noch heller und wärmer zu strahlen, als hätte sie die Gartenanlage als ihren absoluten Lieblingsplatz in München auserkoren. Sogar die Luft fühlte sich hier frischer und einfach besser an als im Rest der Stadt.
Die Menschen flanierten in ihren Gärten, mit Sonnenbrillen auf Liegestühlen oder mit Picknickkorb im Gras. Andere schaufelten in ihren Beeten herum oder stutzten Büsche. Ich war gespannt, was ich in Mats’ Garten …
Nach ein paar Schritten blieb ich abrupt stehen. Wohin musste ich überhaupt?
Was hatte Mats am Mittwoch noch mal zur Hausnummer gesagt? Es ist die Parzelle Nummer … Fünf? Sechs? Ich war mir nicht mehr sicher, hatte aber das Gefühl, dass ich es sehen würde, wenn ich davorstand. Ein kleines bisschen verwahrlost konnte aus Mats’ Mund nämlich nur das absolute Chaos bedeuten, das inmitten dieses Paradieses schon aus der Ferne herausstechen würde.
Tatsächlich musste ich nicht lange warten, bis ein potenzieller Kandidat in Sichtweite kam: die Parzelle Nummer 5.
Und mit ihr Parzelle Nummer 6. Die beiden Grundstücke befanden sich direkt nebeneinander, und eines davon sah schlimmer zugerichtet aus als das andere. Wo blieb der Publikums-Joker, wenn man ihn brauchte?
Der Garten mit der Nummer 5 sah ganz nett aus, doch mein Schlüssel passte nicht. Garten Nummer 6 war minimal gepflegter. Hier schoss zumindest nicht das Unkraut an allen Ecken und Enden in die Höhe und … der Schlüssel passte auch nicht.
Meine Schultern sackten herab. Hatte Mats mir den falschen Schlüssel gegeben? Ratlos sah ich mich um, konnte aber keinen anderen Garten entdecken, auf den seine superhilfreiche Beschreibung zutraf. Wahrscheinlich hatte er sich tatsächlich mit dem Schlüssel geirrt.
Um auch wirklich sicher zu sein, lief ich einmal den ganzen Weg auf und wieder ab, konnte aber nichts Vielversprechendes entdecken. Irgendwann war ich kurz davor, den Schlüssel an einem anderen Tor zu testen – ehe ein dicker Mann oben ohne aus der dazugehörigen Hütte kam und mir einen giftigen Blick schenkte. »Wos treibstn du do?«
Verdammt, ich konnte hier nicht jedes Tor probieren. Wie dumm sähe das denn aus?
Ich schrieb eine kurze SMS an Mats, aber leider war er im Antworten nicht viel besser als Lydia, und ich hatte keine Lust darauf, die nächsten Stunden hier auf dem Weg zwischen den Gärten zu campen.
Frustriert steckte ich den Schlüssel ein und kehrte zurück zu den beiden Garten-Kandidaten. Fünf oder sechs? Fünf oder sechs?
Schrebergarten 5 sah absolut lieblos aus. Das Gras war viel zu hochgewachsen und das Gemüsebeet nichts als ein unförmiger Haufen Erde. Die Gartenhütte sah leicht verwittert aus und benötigte dringend einen neuen Anstrich.
In Schrebergarten 6 war auch schon länger nicht mehr gemäht worden, aber es hielt sich noch im Rahmen. Unmittelbar neben dem Tor wuchsen ein paar rote Rosen, gepaart mit dem einen oder anderen Unkraut.
Rosen – Mats schenkte Lydia ständig Blumen. Zum Geburtstag. Zu Weihnachten. Zum Jahrestag. Wann immer er aus Versehen eine andere Frau angeschaut hatte. Es machte Sinn, dass er sie im eigenen Garten anpflanzte. War auf Dauer billiger so.
Ich entschied mich also für die 6. Verstohlen sah ich mich um, doch die Menschen in den umliegenden Gärten waren alle mit sich selbst beschäftigt. Dann stieg ich locker über den Zaun – nicht lässig wie ein Einbrecher, der das hier schon hundertmal gemacht hatte, sondern wie eine Schrebergartenbesitzerin, die ihren Schlüssel vergessen und keine Lust hatte, dafür nochmal nach Hause zu fahren und ihr Leben im Höllenschlund von Münchens Straßen aufs Spiel zu setzen.
Zum Glück war die Gartenhütte nicht abgeschlossen. Sie war vollgestellt mit zwei Rasenmähern, mehreren Stühlen, einem Tisch, Säcken voller Erde und Dünger und einer ziemlich bedrohlich aussehenden Spitzhacke. Passierte nicht gefühlt die Hälfte aller Morde in Schrebergärten? Kein Wunder.
Ich zog einen der Rasenmäher heraus und musste mir mehrmals Spinnweben von den Armen, aus meinem Gesicht und meinen Haaren zupfen, bis ich es nach draußen schaffte. Dann machte ich mich an die Arbeit.
Andere Frauen in meinem Alter hätten wahrscheinlich nur wenig Lust darauf, doch ich hatte mein Leben lang nichts anderes gemacht. Okay, ich hatte Ställe ausgemistet, Kälber zur Welt gebracht und Kitten mit der Flasche aufgezogen, aber in dieser Hinsicht waren meine Möglichkeiten gerade begrenzt.
Tatsächlich hatte ich in meinem Leben noch nicht allzu oft Rasen gemäht. Dafür hatten wir schließlich unsere Weidetiere gehabt.
Mit einem Mal wurde mir schwer ums Herz. Eine tiefe Beklommenheit erfüllte mich vom Kopf bis in die Zehenspitzen und ließ meine Knie weich werden. Wie sehr ich meine Tiere jetzt schon vermisste. Immerhin konnte ich mir sicher sein, dass die meisten davon auf dem Hof weiterleben würden – in ihrem gewohnten Umfeld, nur unter anderer Betreuung. Ich könnte sie besuchen, wenn ich wollte, doch andererseits würde es dann vielleicht noch mehr wehtun als ohnehin schon.
Ich mähte den Rasen extra sorgfältig. Ein Teil von mir hoffte, dass ich Lydias steinernes Herz irgendwie erweichen könnte, wenn ich mich nützlich machte – nachdem die Sache mit der Pasta ja schon in die Hose gegangen war. Oder dass ich Mats dazu bringen konnte, doch noch auf eine Mietminderung zu pochen. Aber auf jeden Fall konnte ich mir noch ein kleines bisschen meiner Zeit vertreiben, ehe ich meine Seele an TNT verkaufte.
Als ich fertig war, nahm ich den Auffangbehälter des Rasenmähers ab und verteilte das Schnittgut einigermaßen gleichmäßig im Gras. Dann räumte ich das Gerät zurück dorthin, wo es hergekommen war.
Die letzten Wochen waren ziemlich heiß und trocken gewesen, weshalb ich eine verstaubte Gießkanne aus der Hütte trug. Ich befüllte sie mit dem bisschen Wasser, das sich noch in der Regentonne befand – nicht, ohne beinahe kopfüber hineinzufallen –, und wandte mich dem Rosenbeet zu. Je näher ich den Blumen kam, desto ungesunder war der Eindruck, den sie auf mich machten. Während ein paar von ihnen noch wacker gegen die Sonne ankämpften, waren andere schon hoffnungslos vertrocknet. Ich verteilte das Wasser auf der Erde und benutzte den Rest, um die übrigen, vermeintlich leeren Beete zu gießen, weil ich keine Ahnung hatte, ob und was Mats darin angepflanzt hatte.
Als ich auch damit fertig war, betrachtete ich mein Werk – und war nicht besonders begeistert. Um den Garten wieder auf Vordermann zu bringen, bräuchte es noch viel mehr als ein bisschen Gießen hier und ein bisschen Rasenmähen da. Aber es war ein Anfang – und mehr als genug Arbeit für heute.
Ich betrat die Hütte also ein viertes Mal und fand eine zusammengeklappte Liege darin. Ich brachte sie nach draußen, baute sie auf, strich den Staub und die toten Käfer von der Liegefläche und ließ mich darauf nieder.
Eine Weile lag ich einfach nur da, genoss die frische Luft und starrte in den wolkenlosen Himmel hinauf. So musste sich Freiheit anfühlen. Und ich sollte sie genießen, solange ich noch konnte.
Ich spürte, wie meine Lider schwerer wurden. Die Sonne schien mir ins Gesicht und prickelte warm auf meiner Haut. Es war zu angenehm, um sich nicht zu entspannen.
Der Trubel der letzten Wochen rund um den Verkauf des Hofs und meinen Umzug hierher hatte mir viel abverlangt. Umso schöner war es, jetzt einfach relaxen zu können. Die letzten Nächte über hatte ich nicht besonders gut geschlafen. Ich hatte mich ständig von dem riesigen Kaninchen-Plüschtier angestarrt gefühlt, und sobald ich meine Augen geschlossen hatte, hatte es mich in meinen Albträumen durch einen labyrinthartigen Schrebergarten gejagt. Irgendwann hatte ich es in den Schrank gestopft, war mir aber dadurch noch mehr beobachtet vorgekommen.
Hier gab es weit und breit keine mutierten Kaninchen, und Lydia interessierte es wahrscheinlich sowieso nicht, wo ich war und wann ich nach Hause kam, solange ich am Montag pünktlich um neun Uhr bei TNT auf der Matte stünde. Ich konnte hier also getrost für ein paar Minütchen meine Äuglein schließen …
»Hey!«, drang eine entsetzte Stimme an mein Ohr, doch ich kümmerte mich nicht darum. Vielleicht beschwerte sich ein Opa darüber, dass ein vorbeifahrender Teenager auf einem Skateboard von seinen Kirschen naschte. Oder ein anderer Besitzer regte sich darüber auf, dass der Strauch seines Nachbarn immer weiter in seinen Garten hineinwuchs. Oder –
Ich hörte, wie ein Schlüssel in einem Schloss gedreht wurde. Ein lautes Quietschen ertönte nur Schritte von mir entfernt, und ich ahnte Böses.
»Was tun Sie da in meinem Garten?«
Oh, verdammt. Ich hatte mich doch in der Nummer geirrt. Erschrocken riss ich die Augen auf und rappelte mich auf der Liege hoch.
Tatsächlich war ich nicht länger allein. Auf halber Strecke zwischen mir und dem weit geöffneten Gartentor stand ein junger Mann, der mich so fassungslos anstarrte, wie man nun mal wildfremde Frauen anstarrte, die ein Nickerchen in seinem Schrebergarten hielten.
Er war ein ganzes Stück größer als ich, vor allem jetzt, wo ich lag und er umso höher über mir aufragen konnte. Das ärmellose Shirt, das er trug, betonte seine breiten Schultern und schmalen Hüften – und nicht zuletzt die Muskeln an seinen Oberarmen. Seine Augen waren von einem Nussbraun, viel heller als seine schwarzen Haare. Ein Dreitagebart umgab seine vollen Lippen. Obwohl wir Sommer hatten und ich schon meine Maximalbräune erreicht hatte, wirkte er eher blass um die Nase – und das nicht, weil er eine Einbrecherin in seinem Garten erwischt hatte.
Mir wurde heiß und kalt zugleich. Ich sprang auf die Füße, konnte aber nicht verhindern, dass mir eine Schamesröte in den Kopf stieg, die man unter meinem sonnengeküssten Teint hoffentlich nicht sehen konnte. Sofort straffte ich die Schultern. »Sorry«, sagte ich und war stolz, dass meine Stimme nicht höher wurde. »Ich muss mich in der Nummer geirrt haben. Mein Schwager hat hier –«
»Und da brechen Sie einfach in einen fremden Garten ein?«
Ich stockte – und widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen. Um Gottes willen. Sie. Hochdeutsch. Dieser scharf-vorwurfsvolle Ton, wie ihn nur waschechte Almans draufhatten. Mein Blick zuckte zu den Füßen des Mannes, doch glücklicherweise steckten sie nicht in Socken und Sandalen. »Genau genommen bin ich nicht eingebrochen«, verteidigte ich mich, weil mir abgesehen davon die Spucke wegblieb, »sondern über den Zaun geklettert.«
Irritiert schüttelte mein Gegenüber den Kopf. »Das ist Hausfriedensbruch! Dafür könnte ich Sie anzeigen.«
Das schlechte Gewissen, das beinahe in mir aufgestiegen wäre, war inzwischen wie weggeblasen. Was war sein Problem? »Nur wenn man ein Drama draus machen will.« Der Mann kniff die Augen zusammen, und ich hob sofort abwehrend die Hände. »Wie wär’s? Ich räume die Liege weg, verschwinde von hier und dann kannst du dich wieder abregen.« Ich dachte gar nicht daran, ihn zu siezen. Da, wo ich herkam, hatte man das höchstens mit Lehrern gemacht – wenn es hochkam. Außerdem konnte er gar nicht so viel älter sein als ich.
Er sah sich im Garten um, und seine Augen wurden immer größer. Gleichzeitig teilten sich seine Lippen, doch ein paar Sekunden lang drang kein Ton daraus hervor.
»Hast du den Rasen gemäht?«, fragte er entgeistert und schraubte seine falsche Höflichkeitsform glücklicherweise zurück.
Ich schnaubte. »Gern geschehen«, erwiderte ich und machte mich daran, die Liege einzuklappen.
»Ist das hier irgendein dummer Streich oder so?«, ertönte seine Stimme in meinem Rücken.
Ich presste die Kiefer aufeinander. Was jetzt? Nur weil ich pinke Haare hatte, war ich auf einmal ein streichespielendes Kind? Ganz ruhig, Elli. Er ist ein Städter. Er wurde so geboren.
»Das frage ich mich auch«, brummte ich und hob die zusammengefaltete Liege hoch.
»Lass stecken«, zischte der Mann. »Ich mache das schon.«
Genervt drehte ich mich um – und rechnete nicht damit, dass er schon hinter mir stand. Ehe ich stoppen konnte, rammte ich ihm versehentlich die Liege in den Oberkörper. »Huch!«
Er stöhnte vor Schreck und vielleicht auch vor Schmerz und stolperte leicht gekrümmt einen Schritt rückwärts. »Was zur Hölle soll das?«
»S-sorry!« Abrupt ließ ich die Liege fallen – und zuckte zusammen, als sie mit einem viel zu lauten Knall auf dem Boden landete.
Seine Kinnlade klappte herunter. »Und das soll es besser machen?!« Jetzt, wo er mir nähergekommen war, fielen mir seine langen, geschwungenen Wimpern auf, für die ich töten würde. Dem Ausdruck in seinen Augen nach würde er aber eher mich töten als andersherum.
Ich biss mir auf die Unterlippe. Seine bloße Nähe jagte ein gefährliches Prickeln über meine Haut. »Tut mir leid, okay? Wirklich. Das alles hier ist ein ganz, ganz großes Missverständnis.«
Einen Moment lang starrte mich der Mann einfach nur an – mit seinen braunen Augen, die trotz seines Ärgers eine Wärme ausstrahlten, die sogar die Sommertemperaturen in den Schatten stellte. Dann machte er eine wegwerfende Handbewegung. Er sah so aus, als wollte er etwas hinzufügen, gab es jedoch auf. »Verschwinde einfach und komm nicht wieder.«
Wow. So was Süßes hatte noch nie jemand zu mir gesagt.
Ein Funke der Wut wurde in meiner Magengrube entzündet. Warum war er so gemein? Sprang man so mit jemandem um, der einem unfreiwillig eine Rasenmäh-Session abgenommen hatte? Als wäre das sein einziges Ventil, mit dem er den Menschenhass, den er in seinem langweiligen 40-Wochenstunden-Bürojob ansammelte, herauslassen konnte, ohne dass jemand durch seine Spitzhacke zu Schaden kam.
»Liebend gerne!«, fauchte ich. Ich ließ die Liege Liege sein und stapfte in einem hohen Bogen um ihn herum. Am Gartentor angekommen, fiel mir noch etwas ein, und ich war zu sauer, um es ihm nicht unter die Nase zu reiben. »Ich hab auch deine Rosen gegossen«, sagte ich und schloss das Tor. »Aber die sind eh schon halb verreckt. Daraus wird kein romantischer Strauß mehr.«
Der Mann, der gerade Anstalten gemacht hatte, die Liege in die Hütte zu tragen, blieb stehen und sah sich erst nach mir, dann nach den Rosen um. Mehrere Sekunden lang haftete sein Blick auf den Blumen – und was ich in seinen Augen sah, hielt mich davon ab, auch nur einen weiteren Schritt in Richtung Ausgang zu machen. Es war wie ein Unfall: Etwas, das ich nicht sehen sollte, von dem ich mich aber auch nicht losreißen konnte. Etwas, das mir das Herz brach.
»Danke.« Okay, obwohl es die naheliegendste Reaktion war, war es irgendwie die letzte, mit der ich gerechnet hatte. Als er dieses eine Wort aussprach, klang er auf einmal ruhig und gefasst. Aber da war noch etwas anderes: Er wirkte traurig. Als wären diese Rosen seine Hundewelpen und er hätte sie versehentlich im vierzig Grad heißen Auto zurückgelassen. Als wäre ich diejenige, die die Scheibe eingeschlagen und sie gerade so vor dem Hitzetod bewahrt hatte.
Mir lag ein schnippischer Kommentar auf der Zunge, aber ich schluckte ihn herunter. Ich hatte keine Lust darauf, dass er mir doch noch die Polizei auf den Hals hetzte. Anstatt meine Kaution zu bezahlen, würde Lydia die Cops wahrscheinlich noch eher anflehen, mich zu behalten, damit sie ungestört ihr Babyzimmer geschlechtsneutral zu Ende dekorieren konnte.
Keine Sekunde lang spielte ich mit dem Gedanken, mich in den Schrebergarten Nummer 5 zu verziehen und das Spiel von vorne beginnen zu lassen. Falls ich mich ein zweites Mal irrte, würde der andere Besitzer vielleicht keine Fragen stellen, sondern sofort die Kettensäge aus der Hütte holen. Und für einen Tag hatte ich schon mehr als genug durchgemacht.
Obwohl ich den ganzen Nachhauseweg über mit Fluchen beschäftigt war, lag mir die Begegnung im Schrebergarten wie ein Stein im Magen. Einerseits war ich wütend, andererseits fühlte ich mich immer noch irgendwie schlecht.
Ach, was soll’s. Ich würde den Typen sowieso nie wiedersehen. Oder zumindest wäre es so, würde Mats’ Familie nicht irgendein anderer dieser Gärten gehören …
Aber solange ich mich innerhalb meines Zauns aufhielt, konnte überhaupt nichts schiefgehen. Ich kümmerte mich um meinen Kram und dieser Kerl kümmerte sich um die Rettung seiner blöden Rosen. Damit wäre alles in bester Ordnung.
Wieder einmal hatte ich nicht die geringste Ahnung.
3. Kapitel
Am Abend darauf erfuhr ich von Mats zwei Dinge.
Erstens: Er hatte mir tatsächlich den falschen Schlüssel gegeben (für ein Fahrrad, das ihm schon vor vier Jahren geklaut worden war).
Zweitens: Der Reinhard-Family gehörte Parzelle Nummer 5.
Ich hatte mich um exakt ein Gartentor geirrt und eine Begegnung gemacht, die dafür sorgte, dass ich mich am nächsten Tag nicht in Richtung Gartenanlage traute. Vielleicht sollte ich erst einen neuen Versuch wagen, wenn etwas Gras über die Sache gewachsen war – im wahrsten Sinne des Wortes.
Nach einer halben Woche voller Verkehr, schlechter Luft und noch schlechter gelaunter Menschen hatte ich eigentlich schon genug von München. Dabei ging es gerade erst los. Am Montag um Punkt neun Uhr betrat ich die Lobby des turmförmigen Gebäudes am nördlichen Ende von München. Okay, das stimmte nicht ganz. Zuerst hatte ich versehentlich die Bahn in die falsche Richtung genommen, was mir erst nach fünf geschlagenen Haltestellen aufgefallen war, sodass ich wieder hatte umkehren müssen. Genau genommen war es bereits halb zehn. Aber wer achtete schon auf solche Kleinigkeiten?
Mir wurde mulmig zumute. Wenn es jemand tat, dann die Finanzabteilung.
Die Finanzabteilung. Was hatte sich Lydia nur dabei gedacht?