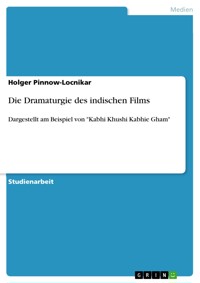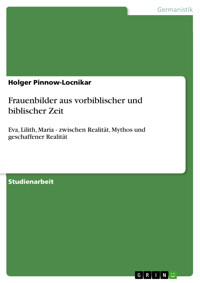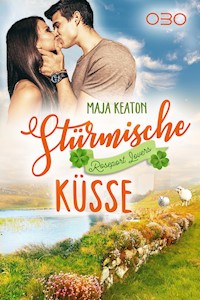36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Filmwissenschaft, Note: 1,0, Universität Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Über die filmwissenschaftliche Analyse des Films „Fire“ wirft der Autor einen tiefen Blick in die urbane indische Gesellschaft. Dabei geht er explizit der Frage nach, was „Fire“ über die Lebensumstände von Frauen in der städtischen Mittelschichtgesellschaft Indiens aussagt. Mittels der Filmanalyse arbeitet er die zentralen Aussagen des Films und seine Rollenbilder heraus und setzt diese Aussagen in Relation zu wissenschaftlichen Erkenntnissen über die indische Gesellschaft. Dabei berücksichtigt er auch die filmdramaturgischen Aspekte des indischen Kinos. Den umfassenden Rahmen des Forschungsfeldes bilden zum einen der indische Film als nationale Kunstform und dabei – in Abgrenzung zum exemplarischen Betrachtungsgegenstand – insbesondere Bollywood, und zum anderen die kulturethnologische, kulturgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Forschung zur Situation von Frauen in Indien und zu den verschieden definierten Rahmenbedingungen dieser Situation. Die thematische Fokussierung des Forschungsfeldes erfolgt über den spezifischen Betrachtungsgegenstand, den Film „Fire“ von Deepa Mehta. Zum indischen Film und dort insbesondere zu Bollywood gibt es mittlerweile umfassende Literatur mit einer stetig wachsenden Zahl von Werken, die leider nur zum Teil den Anspruch von Wissenschaftlichkeit erfüllen kann. Zu den Filmen von Deepa Mehta existiert bislang sehr wenig wissenschaftliche Literatur. Die hier vorliegende Arbeit leistet somit Pionierarbeit in einem bislang wenig untersuchten Forschungsfeld abseits der Bollywood-Hochglanzindustrie und bedient sich zudem einer modernen analytischen Methode, um Einblicke in eine für uns immer noch fremde Kultur zu gewinnen. Der Film „Fire“ von 1996 bildet den Auftakt einer Trilogie, in der sich die Regisseurin Deepa Mehta äußerst kritisch mit der Geschichte ihres Heimatlandes auseinander setzt. Deepa Mehta gilt heute als bekannteste und erfolgreichste Regisseurin Kanadas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 4
Einleitung
„Cinema functions significantly in narrating nations and producing national identities… When films such asFire… do not conform to these expectations, they are rendered illegible or primitive in dominant national and international discourses.“(Desai 2004: 36)
Im Frühjahr 2004 sah ich zufällig einen indischen Spielfilm im Fernsehen. Meine zunächst oberflächliche Anteilnahme wandelte sich bald in eine eigentümliche Faszination: Dieser Film - mit deutschem Titel „In guten wie in schweren Tagen“ - war so anders als alle mir bis dahin bekannten Filme, dass ich mich dem nicht entziehen konnte. Gut drei Stunden dauerte der Film und er schleuderte mich durch ein kurzweiliges Wechselbad der Gefühle.
Seitdem habe ich sehr viele indische Filme gesehen. Die meisten Filme, die den Weg von Indien nach Deutschland schaffen, stammen aus „Bollywood“, der Filmindustrie in Bombay. Sie stellen den indischen Mainstream dar und sind nach einem immer ähnlichen Muster aufgebaut, bei dem viel Tanz und Musik nicht fehlen dürfen.
Mir fiel bald auf, dass nicht nur immer wieder dieselben dramaturgischen Elemente repetiert werden, sondern auch stereotype Rollenbilder. Zusammen mit den seit einigen Jahren durch die Großstädte tourenden Musicals und exotischen Tanzshows entwerfen die Bollywood-Filme ein Bild von Indien und seiner Gesellschaft, das vielen Betrach-
tern und vor allem Betrachterinnen wie das Paradies erscheinen muss.1
So entwickeln Bollywood-Fans oft auch ein Interesse für Indien als Land, wollen gern dorthin reisen und die Exotik und Romantik der Filme aus erster Hand erleben. Sie belegen damit das an den Anfang dieser Arbeit gestellte Zitat von Jigna Desai eindrücklich. Die vornehmlich weiblichen Bollywood-Fans ziehen sich gern „indisch“ an, mit traditionellen Saris oder indischen Accessoires, kaufen in indischen und pakistanischen Lebensmittelläden ein, pflegen einen innerdeutschen Bollywood-Kino-Tourismus und sind in Internetforen vernetzt. Sie feiern die traditionellen hinduistischen Feste, obwohl sie keine Hindus sind. Das Indien der deutschen Fans wird so zur Projektion einer Projektion: Die bunten Bollywood-Melodrame generieren - aus einem reichhaltigen kulturellen Fundus - die modernen Märchen aus Tausendundeiner Nacht, in denen Träume
1Gerhard Emmer weist darauf hin, dass diese Entwicklung im Grunde schon viel älter ist und auf die amerikanischen Filme der 50er Jahre zurückgeht („Der Tiger von Eschnapur“), die ein Indien der Paläste und Moguln zeigen (vgl. Alltagskulturen in Indien 1997: 9).
Page 5
von orientalischer Exotik und unvergänglicher Liebe noch wahr werden2. Aber diese Märchen zeigen nicht das wahre Leben, weder in Indien, noch in irgendeinem anderen Land. Vielmehr verdecken die Bollywood-Filme den Blick auf eine Realität, die viel ernüchternder ist und in der keine Prinzessinnen vorkommen, die von ihren Prinzen auf Händen getragen werden:
„Der Durchschnittseuropäer (…) weiß von Indien …nur wenig. Aber auch der durchschnittliche Indienreisende (…) bleibt nur allzu gern in den Klischees hängen. In Wien die Lipizzaner und Schönbrunn - in Indien die Elefanten und das Taj Mahal. Die Reisen finden … im Kopf statt, und die Realität bleibt auf der Strecke.“(Emmer 1997: 10)
Ich werde in dieser kulturwissenschaftlichen und filmanalytischen Arbeit dieser Realität im Schatten von Tausendundeiner Nacht, im Schatten des Bollywood-Märchen-Kommerzes, nachgehen.
Das Medium Film soll dabei dennoch das Fenster für die Betrachtung bilden, denn abseits der öffentlich präsenten Hochglanz-Fantasien des Mainstream-Kinos gibt es Filme, die ein anderes Indien zeigen.
Firevon Deepa Mehta ist ein solcher Film. AlsFireim November 1998 in Indien in die Kinos kam, rief er nach kurzer Zeit einen - politisch gelenkten - Sturm der Entrüstung hervor. Die Regisseurin wurde als Nestbeschmutzerin beschimpft und mit dem Tode bedroht. Deepa Mehta hatte es gewagt, Tabus zu brechen, indem sie an den Monumenten der indischen Gesellschaft - Familie und Ehe - rüttelte, das Bild des Patriarchen demontierte und die Frauen dazu ermutigte, eigene Wege zu gehen, abseits der Unterwerfung unter die von Männern gemachte Tradition.
Für diese Untersuchung werde ich durch das Fenster des FilmsFireeinen tieferen Blick in die urbane indische Gesellschaft werfen. Innerhalb des Betrachtungsausschnitts werde ich explizit der Frage nachgehen,was der Film Fire über die Lebensumstände von
2Die Märchenerzählungen aus Tausendundeiner Nacht sind im Kern vermutlich indischen Ursprungs und wurden erst später in Mittelpersische übertragen und verschriftlicht. Sie gehen auf Erzählungen zurück, die dem indischen Dichter und Dramatiker Kalidasa zugeschrieben werden. Die Geschichten wurden um altpersische Erzählungen ergänzt und im 7. Jahrhundert im persischen BuchHazar Afsan(„Tausend Erzählungen“) zusammengefasst und im 8 Jahrhundert ins ArabischeAlf Ayla(„Tausend Nächte“) übersetzt und islamisiert, d.h. mit islamischen Formeln und Zitaten angereichert. Es gibt keinen einheitlichen Urtext, sondern eine offene Geschichtensammlung, zu der im 11. und 12. Jahrhundert weitere Erzählungen aus dem arabischen Raum kamen. Die älteste erhaltene Handschrift stammt von 1450. Dieser fügte der französische Orientalist Antoine Galland in einer Veröffentlichung um 1710 weitere Geschichten hinzu, etwa die berühmten ErzählungenAli Baba und die 40 Räuber, Sindbad der SeefahrerundAladin und die Wunderlampe.Galland entfernte bei seiner Übersetzung alle religiösen und erotischen Konnotationen aus den Erzählungen und machte so „Märchen“ daraus (vgl. u. a. Tharoor 2005: 284, 407; Chanda 2007: 13).
Page 6
Frauen in der städtischen Mittelschichtgesellschaft Indiens aussagt.Dazu werde ich mittels einer Filmanalyse die zentralen Aussagen des Films herausarbeiten und diese Aussagen in Relation zu wissenschaftlichen Erkenntnissen über die indische Gesellschaft setzen. Dabei werde ich die filmdramaturgischen Aspekte des indischen Kinos berücksichtigen.
Zunächst werde ich kurz über die für die Filmanalyse verwendete Methodik referieren, bevor ich im Hauptteil der Arbeit in der gebotenen Kürze einige allgemeine Grundlagen zum indischen Kino der Gegenwart und zum Werk von Deepa Mehta der eigentlichen Filmanalyse voranstelle.
Zugunsten von Lesbarkeit und inhaltlicher Stringenz werde ich im Hauptteil über die in der Analyse ermittelten Rollenbilder, die Figureninteraktion und über die festgestellten Realitätsbezüge referieren, während sich die vollständige szenische Analyse im Anhang befindet. Die Ergebnisse der szenischen Filmanalyse werde ich exemplarisch in Bezug zu den recherchierten literarischen Quellen setzen.
Im Schlussteil werde ich die Resultate der Analyse im Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit darstellen und bewerten.
Stand der Forschung
Den umfassenden Rahmen des Forschungsfeldes bilden zum einen der indische Film als nationale Kunstform und dabei - in Abgrenzung zum exemplarischen Betrachtungsge-genstand - insbesondereBollywood,und zum anderen die kulturethnologische, kulturgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Forschung zur Situation von Frauen in Indien und zu den verschieden definierten Rahmenbedingungen dieser Situation.
Die thematische Fokussierung des Forschungsfeldes erfolgt über den spezifischen Be-trachtungsgegenstand, den FilmFirevon Deepa Mehta.
Zum indischen Film und dort insbesondere zuBollywoodgibt es mittlerweile umfassende Literatur mit einer stetig wachsenden Zahl von Werken, wobei zwischen wissenschaftlichen Werken und devotionaler „Fan-Literatur“ scharf zu trennen ist. Die hier verwendete Literatur zu diesem Forschungsaspekt stammt überwiegend aus dem englischsprachigen Raum, zu dem im literarischen Sinne auch Indien zu rechnen ist.
Page 7
Bei der an sich überreichlich vorhandenen kulturethnologischen, kulturgeschichtlichen und sozialwissenschaftlichen Literatur erfolgt die Eingrenzung über den Bezug auf die Situation von Frauen in Indien, ergänzt um forschungsrelevante Aspekte der Gegenwartskultur und der Kulturgeschichte.
Zu den Filmen von Deepa Mehta existiert bislang sehr wenig wissenschaftliche Literatur. Aus diesem Grund habe ich für die Filmanalyse auch online verfügbare Quellen herangezogen: Interviews, Zeitungsberichte und Essays. Der kritischen Betrachtung dieser Quellen kommt besondere Bedeutung zu, um den wissenschaftlichen Anspruch dieser Arbeit nicht zu beeinträchtigen. Um hier nicht zu sehr von eventuell schwer zu bewertenden Fremdquellen abhängig zu sein, wurden wichtige Informationen über einen ständigen Austausch mit der Regisseurin und mit dem ausführenden Produzenten David Hamilton verifiziert.
Methoden und Aufbau
Die methodische Basis der Untersuchung ist die systematische Filmanalyse zuFire.Ich werde mich dabei im übergreifenden Rahmen an der Methodik von Helmut Korte (Korte 2004) orientieren. Diese sieht die Einbeziehung relevanter externer Faktoren in die Filmanalyse vor.
Auf diese Weise können Faktoren sowohl auf der Seite der Filmentstehung wie auch auf der rezeptiven Ebene berücksichtigt werden.
Korte unterscheidet bei der Analyse vier ineinander verzahnte Bereiche:
1. Filmrealität (Inhalt, Form, Handlung)
2. Bezugsrealität (Verhältnis der filmischen Darstellung zur Realität)
3. Bedingungsrealität (Kausalität der Entstehung hinsichtlich der historischen Situation, unter Berücksichtigung von Inhalt und Form)
4. Wirkungsrealität (dominante zeitgenössische Rezeption / heutige Rezeption)
Der Schwerpunkt der Analyse vonFirewird auf der Ermittlung der Filmrealität und der Bezugsrealität liegen.
Page 8
Für die Detailanalyse der Beziehungsstrukturen der Figuren in der Filmrealität und für die Erfassung kultureller Besonderheiten habe ich die Szenenanalyse mit Elementen aus der Methodik nach Lothar Mikos (Mikos 2003) ergänzt.
Hier stand vor allem der Ansatz im Vordergrund, die immanente Filmanalyse am speziellen Erkenntnisinteresse auszurichten und somit einer ausufernden und zu unspezifischen Detailanalyse vorzubeugen.
Aus beiden methodischen Ansätzen habe ich ein Analyse-Werkzeug entwickelt, zu dem sich im Anhang (Szenische Filmanalyse) nähere Erläuterungen befinden.
Weiterhin habe ich mit Deepa Mehta und mit David Hamilton im August und September 2007 mehrere fernmündliche Gespräche zur Erörterung von Details geführt, die in die Analyse und Interpretation eingegangen sind.
Die Bedingungsrealität beinhaltet die Frage nach der Intention der Regisseurin, die zugleich Drehbuchautorin vonFireist. Hierfür werde ich Material aus älteren Interviews mit Deepa Mehta und aus den eigenen Erörterungen mit Deepa Mehta und David Hamilton heranziehen.
Für die Evaluation der Wirkungsrealität werde ich neben Abschnitten aus den verwendeten Monografien zeitgenössische Zeitungsberichte über die Ereignisse und Reaktionen bei der Veröffentlichung des Films heranziehen, weiterhin auch später erschienene, darüber reflektierende Artikel aus der Fachpresse.
Die Arbeit wird die Bereiche der Bedingungsrealität und der Wirkungsrealität im Rahmen der Analyse berücksichtigen, aber sie werden keine Kernbereiche darstellen.
Zu Gunsten besserer Lesbarkeit und zur Vermeidung von Redundanzen werde ich die Untersuchungsbereiche der Filmrealität und der Bezugsrealität in Bezug auf den jeweiligen Betrachtungsaspekt in direkter Abfolge gegenüber stellen.
Page 9
I. Hauptteil
1. Deepa Mehta
1.1 Vita
Deepa Mehta wurde 1950 in Amritsar im Bundesstaat Punjab/Indien, nahe der Grenze
zu Pakistan, als Tochter eines Filmhändlers und Kinobesitzers geboren.3Als Hindus mussten die Eltern 1947 aus dem Pakistan zugeschlagenen Teil Indiens in das indische Hoheitsgebiet im Punjab fliehen. 1952 wurde ihr Bruder Dilip geboren.
Deepa Mehta studierte bis 1971 Philosophie an der Universität Delhi. In dieser Zeit lernte sie Paul Saltzman kennen, einen kanadischen Regisseur und Produzenten. Mit ihm wanderte sie 1973 nach Kanada aus und heiratete ihn im gleichen Jahr.
Noch 1973 gründete sie mit Paul Saltzman und Dilip Mehta die Filmproduktionsfirma Sunrise Films Ltd.
Aus ihrer Ehe mit Paul Saltzman ging eine Tochter, Devyani Mehta-Saltzman (*1980), hervor. Die Ehe wurde 1995 geschieden (Kanda 2003: 2).
Zwischen 1975 und 1986 trat Deepa Mehta als Regisseurin oder Autorin kaum in Erscheinung. Sie hatte Probleme mit der eigenen Identität als Immigrantin und Angehörige einer Minderheit sowohl in Kanada wie auch in Indien, wo sie jetzt zu denNRIsgezählt wurde, denNon-Resident Indians(Desai 2004: 185).
Während ihres Scheidungsprozesses, der zwei Jahre in Anspruch nahm, schrieb Deepa Mehta das Drehbuch zuFire.
Am 13. Juni 2006 wurde ihr für ihre kritische filmische Auseinandersetzung mit den indischen Frauenrechten die Ehrendoktorwürde der juristischen Fakultät der Universität in West-Ontario/Kanada verliehen.
Deepa Mehta gilt heute als Kanadas international bekannteste Regisseurin (Levithin 2002: 273). Eigentlich muss man sie jedoch als eine Diaspora-Kulturproduzentin begreifen, denn als Angehörige zweier Staaten steht sie für einen kosmopolitischen Transnationalismus, der ihr auf der einen Seite Zugang zu verschiedenen Sichtweisen ge-3Ineinigen Quellen wird das Geburtsjahr auch mit 1949 angegeben, was jedoch unzutreffend ist (Pinnow-Locnikar 2007b).
Page 10
währt, auf der anderen Seite aber auch kritische Fragen nach kultureller Authentizität provoziert. Insbesondere im Bezug auf ihren FilmFiremusste sich Mehta den Vorwurf gefallen lassen, unter einem „Mangel an Intimität“ mit ihrem Heimatland zu leiden (Desai 2004: 185)
1.2 Filmografie4
Deepa Mehtas Karriere begann 1973. Zunächst schrieb sie Drehbücher für Kinderfilme, dann arbeitete sie vor allem an Dokumentarfilmen. 1974 war sie für das Drehbuch und den Schnitt bei der DokumentationThe Bakeryverantwortlich, bei der ihr Mann Regie führte. Es folgte ein Dokumentarfilm (At99: A Portrait of Louise Tandy Murch,1975) und - nach einer langen Pause - eine Dokumentation über die Arbeit ihres Bruders (TravellingLight: The Photojournalism of Dilip Mehta,1986).
Zwei Jahre später stieg Deepa Mehta als Co-Regisseurin fürMartha, Ruth & Ediein die Spielfilmproduktion ein. Es schlossen sich kleinere Regiearbeiten für Serienproduktionen an, namentlich für eine Episode der kanadischen TV-SerieThe Twin(1988) und die Regie für vier Folgen der SerieDanger Bay(1988 - 1989). Als alleinige Regisseurin für
einen vollständigen Spielfilm debütierte sie 1991 mitSam & Me.5Der Film gewann eine Auszeichnung auf dem Filmfestival in Cannes.
Steven Spielberg engagierte sie 1993 für die Regie einer Folge vonThe Young Indiana Jones Chronicles(Benares,January 1910).1994 folgte der FilmCamillamit Jessica Tandy und Bridget Fonda in den Hauptrollen. 1995 arbeitete sie nochmals für Spielberg als Regisseurin fürThe Young Indiana Jones Chroniclesin dem FernsehfilmTravels with Father.Sie führte Regie für den AbschnittGreece(ausgestrahlt 1996).
Im gleichen Jahr begann Deepa Mehta die Dreharbeiten an ihrerElements-Trilogiemit dem FilmFire.Sie war auch erstmals selbst für das Drehbuch verantwortlich und damit alleinig für die künstlerische und inhaltliche Leitung. Der Film gewann 14 internationale Auszeichnungen.
4Quelle: www.imdb.com (Datum des letzten Besuchs: 28.02.2007)
5Das Drehbuch zuSam & Me,der in Kanada spielt, verfasste Ranjit Chowdhry, der inFireden Hausangestellten Mundu darstellt. InSam & Mespielte er auch die Hauptrolle, den jungen indischen Immigranten Nikhil.
Page 11
1998 setzte sie die Trilogie mitEarth / 1947fort, wobei sie wiederum allein für Drehbuch und Regie verantwortlich zeichnete. Dieses Prinzip der künstlerischen Alleinver-antwortung behielt sie bei allen ihren folgenden Filmen bei.
Watersollte die Trilogie im Jahr 2000 abschließen, aber der Film konnte wegen massiver, politisch gelenkter und gewalttätiger Proteste nicht gedreht werden. Davon schockiert und frustriert, verfilmte Deepa Mehta 2002 mitBollywood/Hollywoodeine harmlose Komödie mit leichten Seitenhieben auf die indische Mainstream-Filmproduktion und auf indische Traditionen. Dem schloss sich 2003 mitRepublic of Loveein Liebesdrama an, basierend auf einem Roman von Carol Shields.
Erst 2004 nahm Deepa Mehta geheim und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Dreharbeiten zuWaterwieder auf, diesmal auf Sri Lanka. Ende 2006 kamWaterauch in die deutschen Kinos und erhielt eine Oscar-Nominierung für den besten ausländischen Film bei den Academy Awards 2007.
Gegenwärtig arbeitet Deepa Mehta an einem Film mit dem TitelExclusion,der nach einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1914 das Schicksal indischer Flüchtlinge auf einem Schiff vor der Küste Kanadas beleuchtet. Die Veröffentlichung ist für 2008 vorgesehen.
2. Das indische Kino der Gegenwart
Für die bessere Einordnung des FilmsFireerfolgt hier zunächst ein kurzer Überblick über den indischen Film, seine Verbreitung, Rezeption und Entstehungsbedingungen. Die Darstellung muss sich dabei darauf beschränken, einen allgemeinen Einblick in das Forschungsfeld zu gewähren, ohne dieses in seiner ganzen Komplexität erfassen zu können.
2.1 Bollywood und die indische Filmindustrie
Das indische Kino kann auf eine über hundertjährige Geschichte verweisen. Als „Vater des indischen Kinos“ gilt Dhundiraj Govind Phalke (1870-1944). Der gelernte Lithograf und Fotograf sah um 1910 einen französischen Passionsfilm -Life of Christ- im Kino in Indien. Er war so beeindruckt davon, „Augenzeuge“ des Werkes und der Leiden Christi geworden zu sein, dass er sich fortan autodidaktisch am Filmemachen versuch-
Page 12
te.6Er bediente sich thematisch an der reichen indischen Mythologie und Geschichte, weshalb Phalke in Indien als derjenige gilt, der „die indische Tradition auf Celluloid“ gesichert hat. Seine Einflüsse reichen jedoch vom traditionellen indischen Sanskrit-Theater über den „westlichen“ Film bis hin zur Fotografie (Schulze 2003: 12f.). Phalke war es auch, der 1918 eine Art Standard für gutes indisches Kino festlegte:
„The concept for a good film requires a story full of rasa7, divinity and virtue, giving a real/accurate view of existence/the world, effortlessly showing the true path. This is no easy task, but by the grace of God the mute will speak in dulcest tones and the lame will scale the mountain peak.” (Schulze 2003: 10)
Aus diesen hehren Anfängen hat sich die größte Kino-Industrie der Welt entwickelt. Die Filme aus Indien türmen sich zu einem jährlichen Berg von 800 bis 1000 Neuveröffentlichungen, von denen etwa 150 bis 200 aus Bombay kommen, das seit 1995 Mumbai heißt (Ganti 2004: 3; Uhl/Kumar 2004: 12). „Bollywood“ ist eine Verballhornung von „Bombay“ und „Hollywood“ und rekurriert damit auf den ökonomischen und massenmedialen Siegeszug des Bombay-Kinos. Die Filme aus Mumbai werden in der Sprache Hindi veröffentlicht, weshalb alternativ zu „Bollywood“ auch vom Hindi-Kino gesprochen wird. Es existieren daneben noch viele andere lokale Kino-Industrien, teils mit kaum geringerem Produktionsausstoß, etwa das tamilische Kino oder das Telegu-Kino aus dem Bundesstaat Andra Pradesh, das Bengali-, Kannada- und Malayalam-Kino. Diese regionalen Industrien bedienen jeweils einen eigenen Sprachraum in Indien -Telegu wird beispielsweise von etwa 75 Millionen Menschen in Indien gesprochen -und sind zum Teil ähnlich kommerzialisiert wie das Hindi-Kino. Hindi sprechen in Indien geschätzte 370 Millionen Menschen als Muttersprache, weitere 155 Millionen als Zweitsprache, insgesamt über 600 Millionen im südasiatischen Sprachraum. Zu der Verbreitung des Hindi als Zweitsprache hat das Bollywood-Kino mit seiner Popularität in Indien wesentlich beigetragen (Tharoor 2005: 162f.).
Dabei sind es die zeitgenössischen Bollywood-Filme, wie sie etwa seit Beginn der 90er produziert werden, die das westliche Bild des aufstrebenden Indiens mit seiner faszinierenden Mischung aus exotischer Tradition und westlich orientierter Modernität prägen. Der Beginn der 90er Jahre markiert einen technologischen und kulturellen Wendepunkt
6Später reiste er auch nach London, um Materialien zu kaufen und sich bei anderen Filmemachern weitere Kenntnisse zu verschaffen (vgl. Dwyer/Patel 2002: 13)
7„rasa“ ist ein schwer zu übersetzender Begriff, der etwa als Wohlgeschmack, emotionale Bewusstheit oder als sensitive Resonanz des Betrachters begriffen werden kann. Die „rasas“ haben ihren Ursprung im traditionellen indischen Theater (vgl. Schulze 2003: 11; Gargi 1960: 27f.)
Page 13
in Indien, denn zu dieser Zeit verbreitete sich in den größeren Städten mehr und mehr das Satelliten-Fernsehen, so dass der Einfluss westlicher Medien auf die nationale Medienproduktion zunahm. Gleichzeitig kam es in den westlichen Ländern mit größerem indischen Diaspora-Anteil zu einem Bollywood-Boom. In Singapur, London, Toronto, Moskau, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco und etlichen weiteren Großstädten in der ganzen Welt entstanden neue Kinos, die ausschließlich indische Filme zeigten. Schon bald verdienten die indischen Filmproduktionsfirmen an der Veröffentlichung und Aufführung ihrer Filme in den westlichen Ländern mehr als am indischen Markt (Ganti 2004: 38f.).
Diese plötzliche „Globalisierung“ des Bollywood-Films wirkte sich auch auf dessen Inhalte aus. Waren zuvor noch Klassenunterschiede, Armut, ökonomischer Überlebenskampf und Krieg mögliche Themen, so verschwanden diese nun fast gänzlich aus dem Repertoire. Der Fokus speziell der Familien-Melodramen und der Romanzen - der so
genannten „family entertainers“ - lag nun auf gesellschaftlichem Wohlstand.8Die Protagonisten gehörten nicht mehr der Arbeiterklasse oder niedrigeren Mittelklasse-Kasten an, sondern waren plötzlich unvorstellbar reich, für gewöhnlich die Söhne und Töchter von Millionären. Kamen doch mal Angehörige der Arbeiterklasse vor, so waren sie