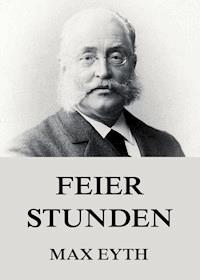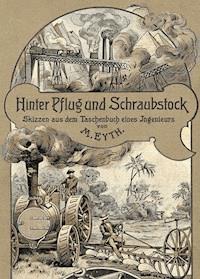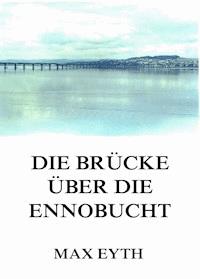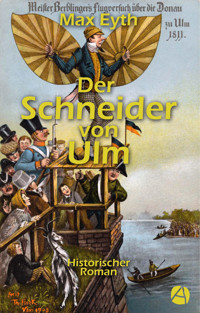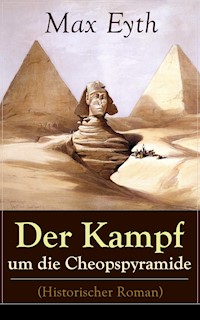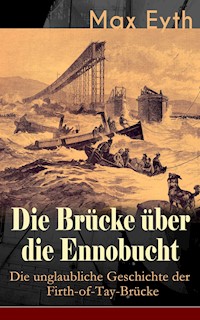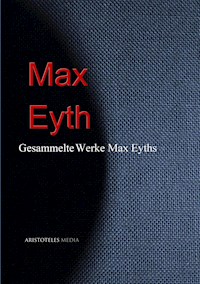Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Strom unserer Zeit ist die Autobiographie des 1906 in Ulm verstorbenen deutschen Ingenieurs.
Dies ist die Ausgabe mit allen drei Bänden.
Das E-Book Im Strom unserer Zeit wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1660
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Strom unsrer Zeit
Max Eyth
Inhalt:
Max Eyth – Biografie und Bibliografie
Im Strom unsrer Zeit
Erster Teil - Lehrjahre
Einführung
Aus der Kinderzeit.
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Zweiter Teil
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Dritter Teil
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Zweiter Teil - Wanderjahre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
Dritter Teil - Meisterjahre.
Einleitung
Säezeit
Erster Abschnitt. 1882 – 1883
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zweiter Abschnitt. 1883 – 1884
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Dritter Abschnitt. 1884 – 1885
23.
24.
25.
26.
27.
28.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Vierter Abschnitt. 1885 – 1886
39.
40.
41.
42.
Fünfter Abschnitt. 1886
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Sechster Abschnitt. 1886 – 1887
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Nachschrift.
Erntezeit
Erster Abschnitt. 1887 – 1888
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Zweiter Abschnitt. 1888 – 1889
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Dritter Abschnitt. 1889 – 1890
83.
84.
85.
86.
Vierter Abschnitt. 1890 – 1891
87.
88.
89.
90.
Fünfter Abschnitt. 1891 – 1892
91.
92.
93.
Sechster Abschnitt. 1892 – 1893
94.
95.
96.
97.
Siebter Abschnitt. 1893 – 1894
98.
99.
100.
Achter Abschnitt. 1894 – 1895
101.
102.
103.
Neunter Abschnitt. 1895 – 1896
104.
105.
106.
107.
108.
Zehnter Abschnitt. 1896
109.
110.
111.
112.
113.
Nachwort
Im Strom unserer Zeit, Max Eyth
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849612290
www.jazzybee-verlag.de
Max Eyth – Biografie und Bibliografie
Maschineningenieur und Schriftsteller, geb. 6. Mai 1836 in Kirchheim unter Teck, Sohn des auch als Dichter (»Gedichte«, 3. Aufl., Stuttg. 1856) genannten Pfarrers Eduard E. (gest. 1884), trat 1861 als Ingenieur in die große Landwirtschaftsmaschinenfabrik von Fowler zu Leeds ein, für die er bis 1882 die meisten Länder Europas und die fremden Erdteile bereiste. 1863–66 war er bei Einführung des Dampfpflugs in Ägypten Chefingenieur des Prinzen Halim Pascha. 1882 ließ er sich in Bonn nieder, war in den nächsten Jahren Mitbegründer der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft und lebt gegenwärtig in Ulm. Das bewegte Wanderdasein, das E. jahrzehntelang führte, schilderte er in dem prächtigen »Wanderbuch eines Ingenieurs. In Briefen« (Heidelb. 1871–84, 6 Bde.), das in dritter Auflage in abgekürzter Form unter dem Titel »Im Strom unsrer Zeit. Aus Briefen eines Ingenieurs« (das. 1903–1904, 3 Bde.) erschien. Abgesehen von seinen technischen Schriften (»Das Agrikulturmaschinenwesen in Ägypten«, Stuttg. 1867; »Das Wasser im alten und neuen Ägypten«, Berl. 1891, u. a.) veröffentlichte er noch das historisch-romantische Gedicht »Volkmar« (3. Ausg., Heidelb. 1877), auch ein Lustspiel »Der Waldteufel« (Heilbr. 1878), »Mönch und Landsknecht«, Erzählung aus dem Bauernkrieg (2. Aufl., Heidelb. 1886), »Hinter Pflug und Schraubstock«, Skizzen (Stuttg. 1899, 2 Bde.; 5. Aufl. 1902) und »Der Kampf um die Cheopspyramide« (Heidelb. 1902, 2 Bde.).
Im Strom unsrer Zeit
Wanderbuch eines Ingenieurs
In Briefen von Max Eyth
Erster Teil – Lehrjahre
Einführung
Die Entwicklung der Dampfmaschine ist die Schule gewesen, in der die moderne Industrie großgewachsen ist, und der Missionar, der von ihrer Geburtsstätte ausziehend den Samen über Europa verbreitet hat, ist der englische Monteur, der bei jeder Lieferung einer Dampfmaschine vertragsmäßig mitgeschickt wird und mit seiner Maschine in den Dienst des Käufers übergeht. Der englische Monteur im "Schneider von Ulm" ist ein Beispiel.
Nirgends fiel dieser Samen auf so fruchtbaren Boden wie in Deutschland. Die theoretische Behandlung der Technik war ein spezifisch deutsches Talent, und gleichzeitig mit den neuen Maschinenfabriken, die es ihren englischen Vorbildern, wenn auch nicht so bald an Unternehmungsgeist und Kapitalkraft, so doch an Gediegenheit und Vielseitigkeit gleich und zuvortun konnten, wuchsen überall die technischen Hochschulen auf. Ihre ersten Erfolge empfindet der junge Eyth schon am eignen Leibe, und ihre vollen Triumphe beginnen sich erst in unsern Tagen zu entfalten, da die Technik sich immer mehr zur Wissenschaft verfeinert und den alten Praktikern, die sie geschaffen haben, längst entwachsen ist.
Gerade in der Zeit, in der Eyth seine Lehrjahre in den heimischen Werkstätten durchlebte, setzte eine Rückströmung ein. Es begannen aus der jungen deutschen Schule Ingenieure hervorzugehen, denen ihre gründliche wissenschaftliche Vorbildung sogar in England eine Überlegenheit sicherte, die bald gefühlt wurde und den Schrei nach systematischem Unterricht auslöste, der noch in unsern Tagen nicht ganz verstummt ist.
Eyth war einer der ersten, den die Sehnsucht, das Heimatland des Maschinenbaues kennen zu lernen, über die See trieb, und in demselben Briefe, in dem er unter dem frischen Eindruck der himmelstürmenden jungen amerikanischen Industrie das bedächtige Nachhinken der deutschen Schulweisheit hinter der schaffenden Arbeit der Angelsachsen bespöttelt, bemerkt er mit Erstaunen, daß er mit den Resten chemischer Kenntnisse, die er aus dem Kolleg daheim mitgebracht hat und längst mit anderm Schulkram in der Rumpelkammer seines Gedächtnisses begraben wähnte, unter den amerikanischen Zuckersiedern als Lehrmeister auftreten kann.
Solche halb unbewußte Wahrnehmungen sind es gewiß nicht zum kleinsten Teil, die sein eigentümliches Wesen geformt haben. Das Gefühl, trotz der praktischen Überlegenheit der ausländischen Technik, in deren Welt und Wesen er sich einzuleben hatte, doch einer höheren Kultur anzugehören, bewahrte ihn davor, wie es so vielen andern in ähnlicher Lage ergangen ist, Engländer oder Amerikaner zu werden.
So mag es gekommen sein, daß dieselben Anlagen und dieselbe Schulung, die ihm seine Erfolge als Ingenieur sicherten, ihn gleichzeitig daran gehindert haben, ein typischer großer Ingenieur zu werden.
Solange er im Dienst fremder Unternehmer stand, brachten es die Umstände mit sich, daß seine technische Arbeit der Lösung von mehr sekundären Aufgaben galt, wie sie sich jedem selbständig denkenden Ingenieur in der Praxis des Geschäftslebens beständig stellen. Obgleich die Liste seiner technischen Erfindungen und Konstruktionen, die er bei Gelegenheit seines Abschiedes von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft selbst mitgeteilt hat, eine stattliche Reihe ausmacht, findet sich doch keine grundlegende Neuerung darunter, die seinen Namen trägt.
Als er dann mit ungebrochenem Unternehmungsmut und überreich an wertvollen Erfahrungen in die Heimat zurückkehrte, zeigte es sich, daß sein Ehrgeiz, für sich als Techniker weitere Lorbeeren zu erringen, schon gestillt war. Er ging ganz in der neuen Lebensaufgabe auf, die ihm anfangs wie eine kurze Episode erschienen war.
Und auch aus seinem Wirkungskreis in der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft sehen wir ihn freiwillig scheiden, um endlich als Dichter seine Tage zu beschließen.
Daß er seinem Vaterlande so besser gedient hat, als wenn er eine der zahlreichen glänzenden Anerbietungen angenommen hätte, die ihm bei seiner Heimkehr gemacht wurden, kann niemand bezweifeln. Aber auch die Zunft der Techniker darf ihn mit größerem Stolze zu den ihren zählen, als wenn er bloß die Zahl der bedeutenden Erfinder und Unternehmer vermehrt hätte, denn er ist ihr ein seltenes Vorbild eines Mannes, der mit gewaltiger praktischer Leistungsfähigkeit eine echte vielseitige Geistesbildung verband.
A. du Bois-Reymond.
###
Als wir Max Eyth im Jahre 1886 kennen lernten, lagen die Lehrjahre und die Wanderjahre, die er in diesen Briefen so unvergleichlich schildert, schon hinter ihm – er widmete sich, von Bonn aus, der Gründung seiner Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft –, die Meisterjahre hatten begonnen! Unsre Freundschaft mit ihm wurde gerade durch diese Reisebriefe angebahnt. Mein Vater, Sebastian Hensel, der sie mit Entzücken gelesen hatte, schrieb an Eyth. Eyth antwortete und besuchte uns, als er bald darauf nach Berlin kam. Daraus entwickelte sich dann allmählich eine feste Freundschaft, und in den Zeiten seiner Abwesenheit von Berlin ein regelmäßiger Briefwechsel mit meinen Eltern und später mit mir.
Es war für unsre Freundschaft vom größten Wert, daß wir Eyth durch diese wundervollen Briefe an die Seinigen schon einigermaßen kennen gelernt hatten, ehe der persönliche Verkehr begann, denn er gab sich schwer, so offen, so unbefangen heiter er aus der Fülle des Erlebten mitzuteilen schien. Es war einer seiner Glaubenssätze, über den wir in späteren Jahren oft, scherzhaft und ernsthaft, gestritten haben, daß leichter fremde Nationen einander nahekommen, miteinander vertraut werden könnten, als Norddeutsche und Süddeutsche. Und das Schwabentum war in ihm bei all seinen Wanderungen auf beiden Halbkugeln (für die er Gott zu danken pflegte) ganz unvermischt geblieben, und diese starke Lokalfarbe des vielgereisten und weltgewandten Mannes bildete einen der merkwürdigsten Gegensätze, in denen ich immer den großen Reiz seiner Persönlichkeit und eines der Hauptgeheimnisse seiner ungewöhnlichen Erfolge gesehen habe!
Wer noch das Glück gehabt hat, ihn zu kennen, wird mir darin recht geben, die Freunde, die seine Bücher ihm erworben haben, werden, was ich meine, auf jeder Seite der vorliegenden Briefbände bestätigt finden: das schwäbische Gemüt und die englische Zähigkeit, die deutsche Poesie und die englische Energie und Geschäftsklugheit, das warme Herz und der kühle Kopf, der Wahlspruch des Mannes: "Dem Phlegma gehört die Welt", und der Lieblingsvers desselben Mannes – schon als er ein sanftes Büblein von drei Jahren und zwei Fuß zwei Zoll Größe war: "Und wenn die Welt voll Teufel wär!" – die tiefe Religiosität, der rastlose Tatendrang – und der Hang zu träumerischer Mystik, zu buddhistischer Weltflucht – und besonders: die schwieligen Hände des Technikers und der Schulsack des schwäbischen Humanistensohnes!
Dieser letzte Gegensatz scheint mir der merkwürdigste und wichtigste, und hätte Eyth das im Grunde nicht selber geahnt, seine Ausfälle auf die humanistische Bildung würden wohl kaum so zahlreich und herzhaft sein. Durch die buntwechselnden Bilder dieser Briefbände hindurch habe ich mit Rührung und Behagen diese widerspruchsvolle Harmonie seines Wesens verfolgt. Gleich sein erstes technisches Abenteuer in der Sägemühle zeigt das warme Herz, was dem kühlen Kopf die Arbeit diktiert, "weil der Sägemüller mit seiner Frau und vier netten Kinderlein bankrott geworden wäre, wenn die Maschine hätte aufgegeben werden müssen, war ihm die Sägemühle fast zur Herzenssache und Gewissenssache geworden, und er hatte seine Finger verklopft und verhämmert, hauptsächlich deshalb". –
Und bei dem zweiten Abenteuer, da der junge Kesselschmied, unter seinen rinnenden Kesseln liegend, an Schillers Flucht denkt, zwischen den mathematischen Berechnungen Scharaden reimt, außer den Kesseln Verse schmiedet – wie deutsch ist dieser junge Mann, der seinen Landsleuten ihr Träumen und Dichten gar nicht streng genug vorhalten kann! Bald kommt er dann nach England mit der Losung, die ihn nie im Stich läßt: kühl! Wirklich bewunderungswürdig ist die kühle Ruhe, mit der der Fünfundzwanzigjährige die – wie es zuerst scheint – aussichtslose Stellungsjagd in diesem überwältigend großartigen, lärmenden, atemlosen, neuen Leben betreibt, mit der zähen Ausdauer und leidenschaftslosen Energie, die ihm gleich an den Engländern so imponieren; aber so oft er einen Knopf an seine Hosennaht und auf dem Knopfschächtelchen liest: "Zwinksche Apotheke in Göppingen, Herrn Pastor C.s Söhnle, täglich zwei Eßlöffel voll!" schlürft er "Ludwig Richtersche Bilder von Ruhe, Gemütlichkeit und lieblichem Kindergeschrei – unklugerweise täglich zwei Löffel voll!"
Aber das ist es eben – schon der junge Mensch versteht sich darauf, die Dinge auseinanderzuhalten und richtig zu bewerten. Das "Jedes zu seiner Zeit" ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn er, während der Londoner Ausstellung, einen impertinenten Artikel in der "Times" findet, in dem die Freude der Deutschen an Spielsachen lächerlich gemacht wird, so eilt er zu seinen Landsleuten und liest den würdigen Herren, die durch das andachtsvolle Spielen mit einer aufgezogenen Maus den Spott hervorgerufen haben, den Artikel vor.
Von derselben Ausstellung schreibt er: "Die Abende und Nächte brachte ich mit Fowler und andern großen englischen Ingenieuren zu und lernte dabei in der Tat vieles, was man in Büchern und Studierstuben nicht lernt. Bei solchen Leuten wird einem der Unterschied zwischen dem deutschen Dichten und Trachten, zwischen Beobachten und Handeln, zwischen Vergangenheit und Zukunft fast etwas unangenehm klar. Ich gebe mir alle Mühe, mich von dem urdeutschen Fehler, das Fremde mit günstigen Augen zu betrachten, möglichst freizumachen. Aber wo finden wir einen Maßstab, um derartige Vergleiche unparteiisch zu halten? Keine plastischere Illustration kann ich mir denken als den Fowlerschen Stand in der Weltausstellung. Hier steht die wuchtige Maschine und die wunderlichen Werkzeuge, die jetzt schon Hunderten ihr Brot verschaffen und Tausenden in allen Weltteilen dienen werden, das Produkt einer energischen Jugendkraft – im Grunde eines Lebens; auf dem Ehrenplatz des Standes steht auch das Produkt eines Lebens, eines jahrelangen gründlichen Studiums; hier stehen die Pflüge und wundersamen Geräte, die teilweise vor tausend und zweitausend Jahren schon vergessen waren. Und es ist immer das erste Zeichen, woran ich den Deutschen von einem Engländer unterscheide: der eine bleibt vor der Sammlung stehen und betrachtet Stück für Stück, wie's die Väter gemacht, der andre mustert die Maschinen, mit denen wir und unsre Enkel arbeiten werden!" Und keine bessere Illustration zu der glücklichen Mischung deutscher und englischer Vorzüge konnte es geben, als daß dieser begeisterte Ingenieur Fowlers doch so viel deutsches Verständnis für die historische Pflugmodellsammlung des Hohenheimer Professors hatte, daß er im Schweiße seines Angesichts gearbeitet hatte, um ihr einen würdigen Platz auf der Ausstellung zu sichern.
Und nun geht es in die Welt hinaus, die schon des kleinen Knaben heimliche Sehnsucht gewesen war, zu der Zeit, da er die Ränder seiner Schulhefte durch seltsame Figuren entweihte, in denen der entrüstete Lehrer nicht die uralte Rätselbildung der Sphinx erkannte – nun geht es nach Ägypten!
Sein Motto "kühl" läßt ihn fast auch im Stich bei dem Auf und Ab der ersten Verhandlungen, während deren er sich wieder und wieder bereithalten darf, sofort nach Ägypten oder Indien abzureisen, um dann doch wieder in Leeds bleiben zu müssen. Endlich aber wird es ernst, und er fährt "an der Küste Griechenlands hinunter. Alles, vom Schäferleben Arkadiens bis zur Schlacht von Navarin herab, voll gewaltiger Erinnerungen, mit denen man die deutsche Jugend großsäugt, oder kleinsäugt? Ich weiß es nicht; – und alles tot!" so schreibt er wenigstens – aber waren ihm diese Erinnerungen tot?
Nur wenige Tage später heißt es: "Wie soll ich Euch auf einem Blättchen Postpapier auseinandersetzen, was ich seitdem gesehen, gehört, gefühlt und geschmeckt habe – vom rauhen und realen Meißelschlag am zerbrochenen Dampfpflug bis zu dem einsamen Träumen im Schatten des Obelisken von Heliopolis, vom widerlichen Intrigieren in dem Hofstädtchen eines Paschas bis zu dem ergreifenden Beten eines Arabers in der öden, unabsehbaren Wüste?" – Wie bezeichnend ist diese Gegenüberstellung.
Nur wenige Wochen später heißt es zwar wieder: "Hätt' ich was Rechtes gelernt! Warum jagt ihr, ihr Mütter, Großmütter und Tanten Deutschlands den strebsamen Sprößling der Familie mit einem kränkenden ›Küchenmichel‹ aus der Küche hinaus, so oft er instinktmäßig die Bedeutung eures Berufes anerkennt? Eine Stunde in der Küche ist nützlicher als zehn im Cornelius Nepos. Und warum brandmarkt man das Wichsen eines Stiefels mit Verachtung? Es kann unter Umständen schwerer ins Gewicht fallen als der schönste Hexameter." –
Aber würden Eyths Briefe, und gar erst seine Bücher, wohl diesen großen, ganz eigentümlichen Reiz haben, wenn er Kochen und Stiefelwichsen ohne Hexameter und Cornelius Nepos betrieben hätte? "Die heutige Menschheit würde in einen bodenlosen Abgrund versinken, wenn die Jugend auf dem Wege zum Jahrmarkt des Lebens nicht den stillen Tempel des erhabenen klassischen Altertums durchschritte," sagt Jean Paul (Levana), und man möchte dieses schöne Wort heute tiefer hängen! Heute, da der Jahrmarktsstandpunkt und -maßstab so verbreitet ist, daß man immer wieder die Frage hören muß, was denn das humanistische Studium den jungen Leuten für ihr späteres Leben nutze! Eyths Leben und Eyths Werke sind die beste Antwort auf diese banausische Frage – um so überzeugender, weil er selbst so wenig überzeugt ist oder scheint, weil er, wie gesagt, jede Gelegenheit ergreift zu scherzhaften oder ernsthaften Ausfällen auf die philologische Umgebung und Anschauungsweise, aus der er hervorgegangen ist, auf deren Grunde er aber viel fester wurzelt, als er selber ahnt, wenn er zum Beispiel schreibt: "Wie himmelweit fühle ich mich von der Welt entfernt, in der ich doch eigentlich geboren bin, wie unbegreiflich wird mir's allmählich, was bei Euch Geist und Gedanken bewegt, Kraft und Leben verzehrt! Eine Charakterschilderung Agamemnons! Ich verstehe, wie man über den historischen Wallenstein, über Nero und Themistokles Bücher schreiben kann, über Agamemnon, über den Mythus, das Gedicht eines längst vergessenen Jahrtausends – nein! Warum nicht Erbsen durch ein Nadelöhr werfen?" Was er verurteilt, ist nicht die Methode, sondern ihre Auswüchse. Klarer geht das aus einem andern Briefe hervor, in dem er schreibt: "Es ärgert mich immer, daß so wenige unsrer deutschen Gelehrten imstande sind, solche Bücher (Tyndalls Fragmente) zu schreiben, daß sie nicht von ihren Kathedern herunter wollen, daß sie nicht merken, wie langweilig sie da droben, in ihrer bornierten Unfehlbarkeit, erscheinen. Es ist das Dozieren und Dozierenwollen, was das Volk an Leib und Seele ruiniert und was ihnen den Stil und Stoff verdirbt. Denn uns, die wir unten stehen, fehlt der Glaube."
Tyndall zeigt uns auf jeder Seite, nicht wie er lehrt, sondern wie er lernt; nicht bloß die glänzenden Resultate seiner oder fremder Arbeit, sondern auch die hundert unüberwundenen Schwierigkeiten, die den Weg der Wissenschaft im Labyrinth der Natur umlagern, und schämt sich nicht, die Grenzen – nicht des menschlichen (denn wer weiß, wo diese in 3000 Jahren sind), sondern des Tyndallschen Begreifens zu zeigen, wo immer er ihnen begegnet! Gerade das ist es nun, was Eyths erste literarische Versuche auszeichnet. Er zeigt uns – in einem hübschen novellistischen Rahmen – die Resultate seiner eignen und fremden Arbeit auf technischem Gebiet, und macht zugleich auch dem Laien klar, wo die Schwierigkeiten liegen, die zu überwinden waren.
Er hat damit ein für Deutschland noch fast ganz brachliegendes Feld seiner literarischen Pflügerarbeit erschlossen; mir wenigstens sind, außer den sehr viel unbedeutenderen Skizzen von Max Maria Weber (Vom rollenden Flügelrade, Schauen und Schaffen) keine ähnlichen Bücher wie Eyths "Hinter Pflug und Schraubstock" bekannt geworden.
Aber seinen Roman: "Der Kampf um die Cheopspyramide" haben wir viel korrespondiert, und ich habe die meisten seiner Briefe, die sich darauf beziehen, hier veröffentlicht, weil sie einen hübschen Einblick geben in seine Art zu arbeiten: die erstaunliche, methodische Gewissenhaftigkeit, mit der jedes, auch das scheinbar unbedeutendste Detail ergründet wurde!
Es existieren dicke Aktenstücke über jedes seiner Bücher. Das zum "Schneider von Ulm" beginnt mit einem genauen Journal, was der damals fast siebzigjährige Geheime Hofrat über seine Lehrzeit bei dem würdigen Ulmer Schneidermeister geführt hat. Jeder Stich, den er gelernt hat, ist zierlich darin aufgezeichnet und beschrieben, die Gespräche der Mitgesellen notiert. Als ich ihn das letztemal in Ulm besuchte, zeigte er mir, nicht ohne eine kleine, berechtigte Eitelkeit, das Probetuch, auf dem er die verschiedenen Stiche, Knopflöcher und so weiter geübt hatte.
Er arbeitete eben nicht wie der Deutsche in dem bekannten Vergleich, der sich das Kamel aus der Tiefe der sittlichen Anschauung konstruiert, sondern wie der Engländer, die in die Wüste geht und das Kamel dort zeichnet.
Einen andern der vielen Widersprüche, die Eyths so harmonisches Wesen bildeten, kann man in den Briefen über die Cheopspyramide und vielen andern finden. Eyth, der einen so stark entwickelten Familiensinn hatte, der alle eignen Lebens- und Reisepläne aufgab, um bei seiner alten Mutter zu bleiben, der überall an fremdem Familienleben gemütlichen und verständnisvollen Anteil nahm, der eigentlich kein Weihnachtsfest vorübergehen läßt ohne einen Anflug von deutscher Sentimentalität, den er unter allerlei Masken, doch gar nicht verbergen kann. Eyth konnte Ausfälle auf Liebe und Ehe ebensowenig unterdrücken wie solche auf humanistische Bildung und Philologie, und aus demselben Grunde, wie mir scheint!
Fast spaßhaft wirkt ja seine Entrüstung über die unschuldigen Liebespaare, die ihm selber in das weit gespannte Garn seiner Pyramidengeschichte gelaufen sind – wie es scheint, gegen seinen Willen!
Und – um mit einem letzten Widerspruch zu schließen – Eyth, der friedlichste Mensch, in seinem persönlichen Leben, der Hunderte von Freunden gehabt hat und gewiß keinen Feind, war der überzeugteste Kriegsgläubige, der mir je begegnet ist! Es stand für ihn unumstößlich fest, daß die Menschheit ohne Kriege nicht leben könnte, noch sollte, noch jemals würde, und er pflegte meine entgegengesetzte Ansicht sehr anmutig ins Lächerliche zu ziehen, meistens in Briefen an unsern jüngsten Sohn, seinen Paten, von denen ich einige folgen lasse, weil sie Eyth von einer besonders liebenswürdigen Seite zeigen.
Denn das ist, was ich möchte: Max Eyth hat vielen so viel gegeben. Seinem Vaterland, an dem er mit starker Treue hing, hat er durch die Gründung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ein wirklich wertvolles Geschenk geben dürfen. Den deutschen Landwirten hat er gezeigt, was man aus eigner Kraft, ohne Staatshilfe erreichen kann. Hunderten, Tausenden haben seine Bücher Freude und Belehrung gebracht – hier möchte ich ihn nun, im persönlichen Verkehr mit nahen Freunden, von Seiten zeigen, die nicht viele gekannt haben, aber von vielen gekannt zu werden verdienen.
Als ich, am Morgen nach seinem Begräbnis, durch das sonnenbeglänzte schöne Schwabenland fuhr, das einer reichen Ernte entgegenreifte, als ich überall die Schnitter an der Arbeit sah und die Obstbäume in den goldenen Feldern ihre schwerbeladenen Äste niederbeugten, da mußte meine tiefe Trauer um den Tod des Freundes dem Gefühl ebenso tiefen Dankes weichen für die reiche Ernte dieses Lebens! Wo immer er ins volle Menschenleben hineingegriffen hatte, da hatte er die reifen Früchte gebrochen und die vollen Garben gebunden. Und sein Vermächtnis an uns andre, die wir noch weiter im Lichte dieser goldenen Sommersonne wirken durften, schien mir in Goethes Worten zu liegen, wie auch in der wunderbaren Übersetzung, die Carlyle für sie gefunden hat: Wir heißen euch hoffen – und work and despair not!
Potsdam,Herbst 1909.
Lili du Bois-Reymond.
Einleitung
Wie man vor einem halben Jahrhundert Ingenieur wurde
Aus der Kinderzeit.
Einen gebahnten, mit Ecksteinen, Wegzeigern und Warnungstafeln versehenen Weg wie heute gab es damals noch nicht. Die meisten begannen damit, an einem halbverbrannten, halbzerfaserten Strick eines Blasebalges zu ziehen und gelegentlich vom Obergesellen eine Ohrfeige zu erhalten, wenn sie beim behaglichen Schein des Schmiedefeuers darüber einnickten. Auf der Wanderschaft mochte sie dann der Gott, der Eisen wachsen ließ, in die Werkstatt eines strebsamen Schlossers führen, der sich mit dem kühnen Plane trug, eine Dampfmaschine zu bauen. Vielleicht stand er schon nachdenklich vor dem ersten, reichlich mit Löchern und Blasen geschmückten Gußstück der künftigen Maschine und überlegte sich, ob er es wegwerfen müsse oder von dem neuen Gesellen ausflicken lassen könnte. War der Geselle ein geschickter Bursche, so begann er zu bohren und zu meißeln, zu feilen und zu schaben, und wurde schließlich einer der großen Ingenieure der vorvorigen Generation: ein alter Borsig, ein alter Hoppe, ein Riedinger, ein Kuhn und wie sie alle hießen.
Andre begannen anders und wurden zumeist kleinere, wenn auch gelehrtere Ingenieure. Man zerbrach sich in ihren Kreisen den Kopf nicht wenig: weshalb die Dinge sich so wunderlich gestalteten und nicht sie die größeren, die Schlosserlehrlinge die kleineren wurden; aber mit geringem Erfolg. Man verstand nämlich damals in Deutschland den Unterschied zwischen Wissen und Können noch weniger als heutzutage. Schließlich mußte man sich mit dem Gedanken trösten, daß der schulgerecht gebildete Ingenieur doch auch dazu gehöre, ja, ohne ihn nicht viel ausgerichtet werden könnte. Es ist dies mit der Zeit wesentlich anders und besser geworden. Wohin wir noch gelangen werden, wenn einmal eine genügende Anzahl von Doktoren der Ingenieurgelehrsamkeit in die Zahngetriebe der Technik eingreifen werden, ist gar nicht abzusehen.
Von einem dieser Art erzählt das vorliegende Buch; allerdings nicht von einem Doktor: dieses Zöpfchen ist erst später Mode geworden. Und da solche Leute sich notgedrungen an ein einigermaßen geordnetes Denken gewöhnen mußten – von Logik brauchten sie nichts zu verstehen, denn diese, soweit sie für ihr Schaffen nicht hinderlich war, stellte sich von selbst ein –, will ich wenigstens andeutungsweise mit dem Anfang beginnen.
Meine Kinderjahre verlebte ich in Schöntal, einem kleinen Nestchen von wenigen Häusern in einem waldreichen Winkel an der Jagst, im weltabgeschiedensten Teil Württembergs. Dort steht der stattliche Bau eines früheren Zisterzienserklosters, in welchem heute eines der vier evangelischen Seminarien des Landes untergebracht ist, das gegen vierzig junge Leute im Alter von vierzehn bis achtzehn Jahren beherbergt. Mein Vater war daselbst als Professor tätig, sein Lieblings- und Berufsstudium Griechisch und Geschichte, und ich zunächst sein einziges, nicht allzu hoffnungsvolles Söhnchen. Mein Großvater war Professor am Gymnasium zu Heilbronn, der nächsten, etwa sechsunddreißig Kilometer entfernten Stadt. Seine Spezialität war Lateinisch und Hebräisch. Bei ihm durfte ich meine Ferien zubringen. Das war die Luft, in der ich aufwuchs; und doch wird es mir schwer, über die Poesie jener grünen Klostereinsamkeit mit Stillschweigen wegzugehen.
Die Zöglinge zu Schöntal sind die heranwachsenden Geistlichen Württembergs. Lange ehe ich alt genug war, in das Seminar einzutreten, lag es schon aus diesem Grunde in dem Plan meiner Erziehung, daß ich den Weg beschreiten sollte, den Vater und Großvater gegangen waren, und den jede fromme Mutter ihrem Erstlinge wünscht. Die Wahl zwischen Theologie und Philologie stand mir frei. Ich wußte es selbst nicht anders, so sauer es mir fiel, die anfänglich so trockene und steinichte Straße des klassischen Wissens emporzuklettern. Bei diesem Punkte wird mir das Stillschweigen fast zur angenehmen Pflicht.
Wie alles anders kam, als es die treue Fürsorge meiner Eltern geplant hatte, gehört zu den Geheimnissen von Natur und Leben, die noch kein Forscher zu ergründen vermochte. Auch ich will nicht versuchen zu erklären, wie der Trieb erwachte, der mich unwiderstehlich auf eine Bahn drängte, von der man in meiner ganzen Umgebung kaum eine Ahnung hatte, noch werde ich erzählen, wie sich eins ans andre fügte, bis ich meinen Weg gefunden hatte. Nur andeuten möchte ich, wo und wie der erste Funke des neuen Feuers, des Geistes unsrer Zeit, auf mich fiel, um bald zur hellen Flamme zu werden, die mich durch ein langes, nicht müheloses Leben warmgehalten hat.
Ein schmaler, waldiger Bergrücken trennt bei Schöntal das Jagst- vom Kochertal. Das nächste am Kocher gelegene Dörfchen ist Ernsbach, wo seit alter Zeit, von der Wasserkraft des kleinen Flusses getrieben, ein Eisenhammer in Tätigkeit ist: die einzige Spur industriellen Lebens, die weit und breit in jener von allem Verkehr abgeschnittenen Gegend anzutreffen war. Ich mochte neun Jahre zählen, als ich meinen Vater bei einem Besuch des Besitzers jenes bescheidenen Hammerwerks begleiten durfte und mit weitaufgerissenen Augen die Wunder anstarrte, die mir dort zum erstenmal entgegentraten. Der dickköpfige, eifrige Hammer, das sprühende Eisen, das geheimnisvolle, keuchende Zylindergebläse, das ganze Leben und Lärmen in der schwarzen Werkstätte erfüllte mich mit einem wunderlichen Gemisch von Schauder und Entzücken. Ich wußte nicht, was ich mit den wirren Gedanken in meinem kleinen Kopf und mit dem mächtigen, tatendurstigen Gefühl in meinem kleinen Herzen anfangen sollte und ging an der Seite meines Vaters, dem ich nicht erklären konnte, was ich selbst nicht verstand, schweigend durch den Wald, den wir auf unserm Heimweg zu durchqueren hatten. Er dachte wohl, daß dieser Besuch nicht wiederholt werden dürfe, denn beim Konstruieren von Cornelius Nepos am folgenden Morgen war ich vernagelter – dies war der übliche Kunstausdruck – als je.
Ich allerdings dachte anders. Vierzehn Tage später folgte auf eine häßliche Regenwoche an einem Sonnabend der erste sonnige Frühlingsnachmittag. Diese Nachmittage waren gewöhnlich den Vorbereitungen auf die Lektionen der kommenden Woche gewidmet. Mein guter, für meine körperliche und geistige Entwicklung stets besorgter Vater riet mir, den Cornelius Nepos mit in den Wald zu nehmen und dort, das Angenehme mit dem Nützlichen verbindend, die auf Seite 28 bis 33 unterstrichenen Wörter meinem Gedächtnis einzuprägen. Ich gehorchte mit verdächtiger Bereitwilligkeit, legte den Nepos unter einen mir wohlbekannten flachen Stein am Waldsaum, wo ihm nichts geschehen konnte, und lief gebückt wie ein von Hunden gehetztes Rehböcklein durch das Dickicht den Berg hinan. Es verfolgte mich niemand als das böse Gewissen, und selbst dieses gab die Verfolgung auf, als ich am oberen Bergrande aus dem Gebüsch trat und nun behaglich über Wiesen und Felder schlenderte, ja sogar gelegentlich stillstand, um die schmetternden Lerchen im Blau des Himmels zu suchen. Dann ging's wieder durch den Wald, fast eine Stunde lang. Den Weg hatte ich mir genau gemerkt und zögerte keinen Augenblick, wenn mir auch in einer Schlucht, wo der zum Versinken schmutzige Pfad einen rauschenden Bach kreuzte, etwas bange wurde. Der Wald war doch länger, wenn man allein ging, als ich mir in meinem Eifer vorgestellt hatte. Ich rannte zuletzt wieder, aus Besorgnis, das Ende nie zu erreichen. Doch endlich und plötzlich wurde es helle. Ich stand am Rand der mit schlechtgepflegten Weinreben bepflanzten, steil abfallenden Berghalde des Kochertals und dort unten, im Grün fast begraben, lag das Ziel meiner kindlichen Sehnsucht.
Ein liebliches Bild: das Dörfchen mit den braunen Dächern an dem kleinen, da und dort aufblitzenden Flüßchen, die schmale Talsohle in frischem Wiesengrün, jenseits die schroff ansteigenden Hügel, bedeckt von waldumkränzten Feldern, darüber am Horizont die blauen Langenburger Berge, aus unbekannter sonniger Ferne herüberwinkend. In der ganzen idyllischen Landschaft fesselte mich jedoch nichts als dort unten, am Ende des Dorfs, ein trüber, braungrauer Fleck – schmutzig hätten ihn andre wohl genannt –, hinter dem einige größere Gebäude kaum zu erkennen waren. Es war Rauch, der schwer und dick aus zwei plumpen kurzen Schornsteinen quoll, der Rauch meiner Hammerschmiede.
Ringsum lag alles in nachmittäglicher Stille. Man hörte die Grillen zirpen, und zwei Pfauenaugen tanzten am nächsten Steinriegel auf und ab, ohne mich zu reizen. Ich legte mich hinter einem Dornbusch auf die Lauer, ja ich drückte das Ohr kunstgerecht auf den Boden, wie ich's aus Indianergeschichten gelernt hatte. Doch blieb dieses Verfahren ohne Erfolg.
Plötzlich aber pochte es unten im Tal laut genug: "Tapp, tapp, tapp, tapp," hastig, dumpf, zwei Minuten lang. Wie mich's rief und lockte! – Dann kam eine lange Pause, als ob mein Freund auf Antwort wartete. Hätte er hören können, wie mein kleines Herz klopfte, der gutmütige, trutzige, dickköpfige Hammer! – Jetzt rief er wieder: "Tapp, tapp, tapp, tapp!" Diesmal nur kurz, wie wenn er vorhin etwas vergessen hätte. – Darauf folgte eine schier endlose Stille. War er mit allem fertig? Hatte er mir nichts mehr zu sagen, der arbeitslustige Geselle? – O nein; es ging wieder los: fünf ganze Minuten lang, als könnte er nicht mehr aufhören, wie toll vor Eifer: "Tapp, tapp, tapp!"
Er dachte wohl gar nicht mehr an mich; er war zu sehr beschäftigt! – Das war ein andres Schaffen, als wenn ich Wörtchen aus dem Cornelius Nepos klaubte, um sie wieder zusammenzusetzen wie in einem Geduldspiel. – Tapp, tapp, tapp! – Ein wenig einförmig, ja! Aber das Feuer, mit dem der brave Hammer draufklopfte, und das Wasserrad und das Zahngetrieb, die ihm halfen! – Wie der rote Eisenklumpen sich dabei dehnen und strecken mochte! Das konnte ich allerdings nur vermuten, aber ich sah es so deutlich wie den Hammerkopf, der vor Eifer so rot wurde wie das spritzende Eisen selbst. – Jetzt wird der runde Klotz viereckig, und der viereckige länger und länger; er wird schon eine Stange, die man zu allem brauchen kann, was das Herz begehrt – zu einer Wagenachse, zu einem Blitzableiter, wer weiß zu was noch! – Das fühlte das Hämmerchen wohl; kein Wunder, es war so eifrig. Wüßte ich, zu was man den Cornelius Nepos brauchen kann, wer weiß, ob ich nicht ebenso eifrig wäre! Aber das konnte ja kein Mensch wissen! – "Tapp, tapp!" rief ich laut dem Hammer in seiner eignen Sprache zu. Sie war so viel leichter und lustiger zu erlernen als die des Nepos. "Tapp! tapp! tapp!"
"Tapp, tapp, tapp," äffte eine rauhe, höhnische Stimme über mir, und eine schwere Hand legte sich auf meine Schulter. "Was der Kuckuck treibst denn du da, Bub'! Woher bist du? Wem gehörst du? Rede gestanden! Mit tapp, tapp ist bei mir nichts zu machen."
Ich war ein kleines erschrockenes Bürschchen von kaum neun Jahren, verschmiert und verspritzt bis über die Ohren, denn in den aufgefahrenen Waldwegen hatte das Wasser fußtief gestanden. Zitternd sah ich an einem "Landjäger" hinauf, der seinen fürchterlichen Schnurrbart drehte und das Gewehr klirrend auf den Boden stieß. Es wollte mir nichts einfallen. Auch fühlte ich, daß der Mann mich nicht verstanden hätte, wenn mir auch alles Erdenkliche eingefallen wäre, selbst wenn ich ihm gesagt hätte, daß von drunten im Tal mein bester Freund heraufsignalisiere und gerade jetzt aufs emsigste drauflostappe.
"So – aus Schöntal bist du! Dem Professor Eyth gehörst du," schnauzte der Mann. "Dummheiten gemacht! Durchgebrannt! Schon gut! – Auf dem Weg nach Schöntal bin ich selbst. Na, na! Gut, daß ich dich erwischt habe. Dein Vater wird dir schon die Lust an dem Tapp, tapp austreiben. Rechtsumkehrt! Vorwärts marsch!"
Der Unhold hatte kein Erbarmen. Wie ein ausgewachsener Verbrecher marschierte ich auf dem langen Rückweg vor dem Vertreter der Staatsgewalt her, manchmal leise schluchzend, streckenweise in stummem Jammer mein gräßliches Schicksal betrachtend. Als wir in der Abenddämmerung Schöntal unter uns sahen, legte ich mich aufs Bitten: "Lassen Sie mich los, Herr Landjäger! Wenn mich die andern Buben sähen! Ich gehe ja schon von selbst heim!"
Es half nichts. Höhnisch lächelnd richtete er die Mündung seines Gewehres auf meine gefährdete kleine Rückseite und donnerte sein: "Vorwärts marsch!" laut genug für drei Raubmörder. Unter dem Tor des Klosterhofs begegneten uns meine sämtlichen Schulfreunde, drei Mann hoch, jeder mit einem Cornelius Nepos unter dem Arm. Sie schlossen sich staunend, wenn auch etwas verschüchtert, der unerhörten Prozession an. An einem wohlbekannten Fenster des Klosterbaus glaubte ich für einen Augenblick meine Mutter zu sehen, die aber, wie mir schien, mit einer Gebärde unsäglichen Schmerzes sogleich wieder verschwand. Natürlich, dachte ich, verzweifelnd, sie holt den Vater. "Vorwärts, vorwärts!" brummte mein Henker.
Kein Wunder, daß mich das überwältigende Elend völlig betäubte. Ich lief jetzt, so daß der Landjäger Mühe hatte, mir zu folgen, und sah und hörte nichts mehr. Nur in meinen Ohren summte es lauter als je: "Tapp, tapp, tapp, tapp!" Es war ganz deutlich und tröstlich dazu. Wie wenn mein lieber neuer Freund mich in all diesem Jammer nicht verlassen wollte.
Als mich der Ortsvorsteher, Klostermüller und Bäcker zugleich, unter seiner Backstubentüre stehen sah, lachte er hellauf und hieß den Herrn Landjäger zu meinem freudigen Erstaunen ein Rindvieh. Zu mir aber sprach er: "Mach daß du heimkommst, Büble, und laß dich waschen. Richt auch einen schönen Gruß an deinen Vater aus; er soll dich das nächstemal bester hüten."
Tapp, tapp, tapp! Wie ich lief! Mein Vater begegnete mir schon auf halbem Wege und ließ mir nicht Zeit, den Gruß auszurichten. Tapp, tapp, tapp! Nur eins freute mich heimlich, selbst in der Bitternis dieser Stunde: Mein Cornelius Nepos mußte heute die ganze kalte Nacht unter einem Stein im Wald zubringen. Tapp, tapp, tapp!
Ob ich auf der Bergkante über dem Kochertal oder erst im weiteren Verlauf jenes Nachmittags Ingenieur wurde, weiß ich nicht genau. Aber an jenem Tag geschah's, und das Tapptapp meines fernen eisernen Freundes ist mir eine Art Wahlspruch geworden, der sich in guten und bösen Zeiten leidlich bewährt hat.
Allerdings kam später noch einiges andre dazu.
Zunächst jahrelang das unablässige Bestreben, kleine Eisenhämmer aus Holz zu bauen, die, wenn sie an heimlichen Bächlein aufgestellt waren und zu klopfen anfingen, von andern bösen Buben entdeckt, bewundert und dann mit Steinwürfen zerstört wurden. Ernster wurde die Sache, als ich, noch etwas zu jung, im Seminar neben den vollwertigen Zöglingen hospitieren durfte und von Cornelius Nepos zu Ovid und Horaz aufgestiegen war. Eine gütige Vorsehung muß es gewollt haben, daß einer der Unterlehrer der Anstalt Mathematiker war und die Wärme einer trockenen Begeisterung für die einzigen Wahrheiten, die nie angezweifelt werden können, fühlbar um sich verbreitete. Diesem Manne verdanke ich mehr als das stille Glück meiner reiferen Knabenjahre. Schon nach den ersten Lektionen war mein Entzücken über das, was sich mir hier auftat, grenzenlos. Freudig-schlaflose Nächte lang schob ich gerade Linien und Kreisbögen und später Ellipsen und Hyperbeln im Kopfe hin und her, um selbsterfundene Probleme zu lösen, und mit jedem Tag mehr versank für mich die klassische Welt in schönem, wesenlosem Scheine. Obgleich Philologe von altem Schrot und Korn, war mein Vater ein ungewöhnlich verständiger Mann, dem ich das Beste verdanke, was der Mensch dem Menschen geben kann: meine Freiheit. Er glaubte jetzt zu wissen, was mit mir anzufangen sei, ließ die alten Zügel am Boden schleifen und dem jungen Füllen seinen Lauf.
Darauf folgte das Polytechnikum der fünfziger Jahre: Theorien auf gründlicher mathematischer Unterlage, und ein etwas nebliger Ausblick in die ferne Praxis. Die damals nur halb studentischen Freuden der Jugend zügelte ein ernstes und lebhaftes Gefühl, daß wir jungen Leute einer großen Zukunft entgegengingen, von der die Alten um uns her, die uns im allgemeinen mitleidig belächelten, keine Ahnung hatten.
Dann nach der feucht-fröhlichen Studienzeit ging es mit zusammengebissenen Zähnen durch ein herbes Jahr am Schraubstock, unnötig gequält, heilsam verhöhnt, wund an Leib und Seele. Man fühlte sich zu alt für das kleine Elend des Tages und schämte sich dabei, daß es manchmal so groß erschien. Aber man verlor trotz Rauch und Ruß, trotz Schweiß und Schwielen nicht den Ausblick in die unbekannte Zukunft mit ihrer Arbeit und ihrer Größe und ihren glücklich gelösten Aufgaben, und hielt aus.
Allerdings klang der Ruf ins Zeichenbureau wie eine Erlösung, denn man fühlte zu schmerzlich, daß man doch nie ein tüchtiger Schlosser geworden wäre. Nun aber brachte rascher und rascher jeder Schritt eine kleine Tat, ein Werk, das man sehen und greifen konnte, ein losgelöstes Stück des eignen Ichs, das fortwirkte, wenn man es selbst schon längst vergessen hatte.
Damit schließe diese Einleitung. Was mir später ein buntes Leben brachte, auf das ich heute mit wehmütiger Freude zurückblicke, erzählen, allerdings nur andeutungs-, immer nur bruchstückweise, die folgenden Auszüge aus Briefen und Aufzeichnungen, die meist mitten im Sturm der Arbeit entstanden. Mit wehmütiger Freude, sage ich, denn sie zeigen mir nur zu deutlich das Vergängliche im eignen Fühlen und Denken, und dem Leser von heute, wie alles in einer kurzen Spanne Zeit anders werden kann. Doch mag es auch manchen, wie mich, erfreuen, in einer Stunde der Muße einen Blick auf den Weg zu werfen, den wir Ältere seinerzeit hoffnungsvoll gegangen sind, und der unsre Hoffnungen, wenn wir heute um uns blicken, nicht zuschanden werden ließ.
Erster Teil - In Deutschland und England
Nicht jedem ist es beschieden, seine Lebensaufgabe ambulando, hier richtiger und deutsch gesagt wandernd, zu lösen. Nicht jedem wäre es wohl dabei. Der alte fromme Spruch: "Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt," erfreut sich nicht der allgemeinsten Anerkennung. Doch gibt es glücklicherweise Naturen, denen es aus der Seele gesprochen ist, und doppelt glücklicherweise sind sie so notwendig für das Gedeihen der Menschheit als die seßhaftere Gattung. Zu der letzteren gehörte ich nicht. So kommt es, daß die folgenden Mitteilungen – Briefe und Bruchstücke aus Briefen – schon äußerlich von der unruhigen Bewegung der Zeit erfaßt scheinen, deren Strömung wir um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auch in Deutschland zu spüren begannen.
Strohhalme zeigen, wie der Wind weht. Solche Strohhalme wehten auch durch mein junges Leben. Ich wußte zurzeit kaum, wie klein sie waren; ich wußte noch weniger, was sie bedeuteten. Beides ist mir seitdem klarer geworden, und deshalb mögen sie ihre Stelle unter Erinnerungen behalten, die manchem klein und bedeutungslos erscheinen dürften. Sie bezeichnen den Mann – einen unter Tausenden – und die Zeit, die im Werden waren.
1.
Stuttgart-Berg, den 6. Mai 1859.
"Alles begegnet dem, der wartet." Auch ein Zeichner wird schließlich in die Welt hinausgeschickt, wenn er sie lang und sehnsüchtig genug durch die mattgeschliffenen Scheiben seines Bureaus betrachtet hat. Seit gestern bin ich von meiner ersten technischen Geschäftsreise zurückgekehrt, freudig erregt und hochbefriedigt.
Schon das Ziel: Unterweißach, Oberamt Backnang, Königreich Württemberg, acht volle Stunden von Berg, nur auf Wegen zu erreichen, die meines Wissens noch kein Techniker betreten hat, war meiner Tatkraft und Erfahrung würdig. Denn je unerfahrener ein Pionier ist, um so mutiger wird er an seine Arbeit gehen, das fühle ich jetzt schon.
In Unterweißach weiß man noch nichts vom neunzehnten Jahrhundert und seinen industriellen Zielen. Ein unterschlächtiges Wasserrad in einem meist vertrockneten Bach ist der Gipfel seiner mechanischen Begriffe, eine Dampfmaschine Teufelswerk. Auch der Sägemüller, zu dem ich geschickt wurde, teilte diese Auffassung, denn er hatte sich mit einer alten oszillierenden kleinen Maschine betrügen lassen, die er uns klagend ans Herz legte. Sie wollte sich kaum rühren, geschweige denn sägen. Um so mehr rührte mich der Mann, seine Frau und vier minimale Kinder, die sämtlich bankrott gewesen wären, wenn die Maschine hätte aufgegeben werden müssen. Sie selbst war unschuldig, nur zu schwach und zu alt für ein Sägegatter. Eine teure Reparatur und die Anwendung höherer Dampfspannung waren Auskunftsmittel, an die ich mich nicht herangewagt hätte, wenn die Würmchen nicht gewesen wären. So aber dachte ich wie einst Eberhard im Bart: ›Attempto!‹ und ließ machen, was zu machen war.
Beim Montieren an Ort und Stelle hatte ich selbst Hand anzulegen, stets umgeben und ermuntert von den kleinen, drei- bis siebenjährigen Sägmüllern. Hauptergebnis: zerschlagene Finger; weshalb ich auch mit meinem Hilfsmonteur vortrefflich auskam, dem dies viel Spaß machte. Meine stillen Sorgen in betreff des Erfolgs wußte ich gut zu verstecken, wenn ich auch manchmal schauernd an dem Eichblock vorüberging, welchen der Sägmüller als Probestück bereithielt und demgegenüber das Maschinchen aussah wie ein Zwerg.
Am Mittwoch vor acht Tagen konnten wir zum erstenmal Dampf machen. Ich übernahm das Heizen – eine Kunst, die ihre überraschenden Schwierigkeiten hat. Ganz Unterweißach rannte natürlich zusammen, als der einzige Schornstein im Umkreis von drei Meilen zu rauchen anfing. Wir jagten aber alles mit ausgesuchter Grobheit wieder zum Tempel hinaus. Der erste Versuch sollte im engsten Familienkeis stattfinden. Er verlief nicht ganz unbefriedigend. Die Maschine drehte sich wenigstens, was sie früher nicht getan hatte. Doch wuchsen meine Sorgen in betreff des Eichblocks. Wir stellten wieder ab, um eine Patentsteuerung zu entfernen, welche Kohlen zu ersparen vorgab. Mit solchen Feinheiten wollte der Eichblock jedenfalls nichts zu tun haben.
Zwei Tage später war Generalprobe. Die Maschine lief wie besessen. Ich hängte aber auch Backsteine an die Sicherheitsventile, wie dies in Amerika gebräuchlich ist. Zuerst sägten wir ein tannenes Stämmchen. Der Erfolg war über Erwarten gut. Dann kam – es war um vier Uhr abends – der Eichblock an die Reihe. Um neun Uhr war er gesägt. Mit seiner Wasserkraft hätte der Mann zwei bis drei Tage dazu gebraucht. Meine Aufgabe war gelöst. Ihr könnt Euch denken, daß ich den folgenden Morgen mit leichtem Herzen Unterweißach den Rücken kehrte, fast als hätte ich neben der gelungenen Arbeit ein gutes Werk getan. Während ich Tag für Tag über meines Sägmüllers Knirpslein stolperte, war mir die Sägmühle fast zur Herzens- und Gewissenssache geworden. Jetzt erst fühlte ich dies deutlich. Orgelpfeifenartig geordnet umstanden die Kleinen die alte Postkutsche, um "den Herrn Schenier" abfahren zu sehen. Das Kleinste heulte laut. Seinetwegen hatte ich mir die Finger zerschlagen und die Hände verbrannt. So findet das Gute manchmal schon in dieser Welt seinen Lohn.
2.
Berg, den 26, Oktober 1859.
Zeichnen ist unter Umständen ein tiefes, stilles Vergnügen, Konstruieren ein hoher, aufregender Genuß. Ich bin um eine weitere Erfahrung reicher: Selbst eine Winterreise nach einem halben Jahr seßhaften Bureaulebens erwärmt das Blut. Ihr wundert Euch, was mich so spät im Jahr nach dem Schwarzwald trieb. Auch das müssen wir noch lernen: Dem Ingenieur blüht kein Frühling; auch kennt er keinen Winterschlaf. Sonne, Mond und Sterne dürfen ihn nicht aufhalten. Fährlichkeiten zu Wasser und zu Land sind sein tägliches Brot. Laßt mich erzählen!
Zu Steinen im Wiesental steht seit einem Jahre in einer der Spinnereien des Oberst Geigy von Basel eine von uns gelieferte Wolfsche Dampfmaschine mit drei gewaltigen Kesseln. Die Garantiezeit ist am Ablaufen und deshalb der Zeitpunkt kritisch. Unsre Arbeiter hatten sich voriges Jahr mit den Direktoren, Spinnmeistern und andern Personen der Spinnerei überworfen und dadurch mißliche Verhältnisse auf die Spitze getrieben. Nun will es das Unglück, daß ein Teil der Maschine bricht. Die Besitzer sind außer sich. Man schickt spornstreichs unsre besten Monteure. Der Schaden ist nach einer Woche behoben, aber, wie nichts allein kommt, so laufen wenige Tage später die kläglichsten Berichte in betreff der Dampfkessel ein, die in unerklärlicher Weise rinnen sollen. Man munkelte schon von neuen Kesseln, die man verlange, ein Verlust von zehntausend Gulden für die Fabrik!
Um neun Uhr kam der letzte bedrohliche Brief. Die Sache war rätselhaft. Man vermutete, daß ein Teil der Einmauerung vergessen worden sei, wodurch die Kessel ungleich erhitzt und durch die ungleiche Ausdehnung der Bleche das Rinnen verursacht werden konnte. Um elf Uhr war ich im Schnellzug. Meine Hoffnung war, durch Änderung des Mauerwerks dem Übel abhelfen zu können.
Freilich, eine solche Reise macht man immerhin mit einem andern Gefühl als dem einer Ferienreise. Ich durchfuhr das lange badische Land, war eine kurze Viertelstunde in Basel und kam noch bis Lörrach im Wiesental, wo ich übernachten mußte.
Den andern Morgen war in Steinen mein erster Gang nach dem Maschinenhaus. Nur einer der Kessel war in Tätigkeit. –
O meine Lieben! Kaum fang' ich an, Euch meine Not, meinen Kampf und meinen Sieg zu schildern, so geht der Jammer von neuem los. Soeben kommt ein Eilbrief mit der Nachricht, einer der Kessel fange aufs neue an zu rinnen. Morgen früh bin ich abermals auf dem Weg nach Basel.
3.
Steinen, den 29. November 1859.
Ein Tischchen und einen Stuhl, Tinte, Feder und Papier, mehr braucht's nicht, um auch in einem Kesselhaus einen Brief zu schreiben oder selbst ein rührend Liedlein zu singen. Hab' ich doch gestern sogar an meine Freunde in Berg ein solches wohlverschlossen einem gewissenhaften Kesselbericht beigelegt, so daß der Herr und Meister unsers prosaischen Daseins selbst die Güte haben mußte, dieses Fünklein aus verachteten idealen Regionen an der richtigen Stelle abzuliefern, ohne zu wissen, was er tat! O, verlaß mich nicht, du schöne Welt über dem wechselnden Mond, wenn ich in einem Heizzug meiner Kessel liege, der zwei Fuß breit und dreizehn Zoll hoch sein mag, und mir dort die heißen Tropfen in den Nacken fallen. Verlaß mich nicht, wenn mein Gewissen anfängt über dich zu schelten und zu fluchen, und wenn ich selbst dich treulos verlasse.
Wahr ist's, ich stehe knietief im kräftigenden Schmutz des praktischen Lebens und lerne Kummer und Sorgen auf dem Brot essen. Zum Glück wächst hier ein Wein, der selbst Pumpernickel hinunterspült. Auch machen eine andre Luft, andre Berge, andre Menschen um mich her vieles erträglicher.
Als ich zum erstenmal hierherkam, fand ich, daß der vermutete Fehler bei der Einmauerung nicht gemacht worden war. Ich stand somit der schwierigen Aufgabe ziemlich ratlos gegenüber und mußte es wagen, auf eigne Faust zu handeln. Verhaltungsmaßregeln einzuholen – das dauerte zu lang. Ich schrieb daher, was ich zu tun gesonnen sei, und erhielt, einen Tag nachdem mein Plan ausgeführt war, die Erlaubnis, dies zu tun. Das Ergebnis schien überaus günstig. Selbst der schlimmste Kessel ließ nach seiner neuen Einmauerung nichts mehr zu wünschen übrig und Oberst Geigy hatte schließlich die Güte, selbst mit mir nach Basel zu fahren, um mich in freundlichster Weise loszuwerden. Die persönlichen Verhältnisse hatten sich nämlich in den Tagen meines Hierseins geändert. Entweder sehe ich die Welt noch mit zu naiven Augen an, oder liegt der Fehler an den Schilderungen, die mir gemacht worden waren. Ich fand jenes böswillige, schadenfrohe Geschlecht von Maschinisten, Spinnmeistern und Direktoren nicht, mit dem ich zu kämpfen gesonnen war. Im Gegenteil erhielt ich fortwährend Beweise von wirklich freundschaftlicher Teilnahme, wie man sie hinter geschäftlichen Beziehungen gewöhnlich nicht suchen darf.
In Berg legte ich große Ehre ein mit meinem Siegesbericht und war bereit, mich aufs neue in stille Freuden am Reißbrett zu vertiefen. Da war's just wieder Samstag. Ich hatte schon mein Handwerkszeug zusammengepackt, um mit dem Gefühl der erfüllten Pflicht heimzugehen, als die Schreckenskunde eintraf. Das Ende einer langen qualvollen Besprechung, obgleich mein Herr und Meister in der Verzweiflung außerordentlich höflich war, bildete den Beschluß, daß ich morgen, statt auf den Hohenstaufen, wie ich vorgehabt, abermals nach Steinen müsse.
Nun war es erst recht keine Luftfahrt, die mich hierher brachte. Das trübe Novemberwetter, das winterliche Tal, und mehr als dies die ungewisse Zukunft der nächsten Woche, der ich amtshalber mit zuversichtlicher Miene entgegensehen mußte, fröstelten mir durch Leib und Seele. Der Oberst war in Basel. Der Hauptmann, sein Schwiegersohn, leitete mit mir die neuen Veränderungen ein, bis der alte Herr zurückkam, dem ich sogleich meine Aufwartung machte und der, wenn man berücksichtigt, daß wir unter der Traufe von drei rinnenden Dampfkesseln standen, in persönlicher Beziehung nicht liebenswürdiger hätte sein können. Mein Hauptumgang aber war damals und ist jetzt wieder ein junger Angestellter der Fabrik, namens Bohni, ein Schweizer, wie ich noch keinen von gleicher Herzensgüte und Gefälligkeit getroffen habe. Die Musik und ein Ausflug nach einer prächtigen Ruine der Umgegend führte uns zusammen und leitete ein Verhältnis ein, das mir einen gewissen Trost gewährt in der Trübsal dieses Lebens.
Denn brauchen konnt' ich ihn. Als der neu eingemauerte Kessel geheizt wurde, rann er zum Verzweifeln. Sogleich wurde ein Bube mit einem Telegramm nach Lörrach abgeordnet, um einen tüchtigen Kesselschmied herzubekommen. Abends, unter dreimal ungünstigeren Verhältnissen, hörte das Rinnen auf. Sogleich fuhr ich selbst nach Lörrach und bestellte den Kesselschmied wieder ab. Den andern Tag rann der Kessel wieder, nachmittags wieder nicht, abends wieder ein wenig, nachts gar nicht und so fort, bis mir schließlich der Verstand stillzustehen drohte. So ging's die ganze letzte Woche fort. Ich hing dabei zwischen Furcht und Hoffnung, wobei ich mir nach und nach Erklärungen für das Unerklärliche konstruierte und der Kessel sich langsam zu bessern schien. Jetzt hoffe ich wieder. Vielleicht war es nur eine Kinderkrankheit junger Kessel. Vielleicht haben auch Kessel vorübergehende Nervenzustände, die kein Mensch berechnen kann.
4.
Steinen, den 12. Dezember 1859.
Immer noch in der Verbannung! Immer noch rauscht und schnaubt hinter mir, wenn ich schreibe, die Dampfmaschine mit ihren hundert Pferden; immer noch weiß ich nicht genau, wann ich wieder im alten Neste sitzen werde, in dem mir's nachgerade doch wohler wäre als hier.
Es ist ein verzweifeltes Problem, diese Kesselgeschichte! Ich habe zwar jetzt, nach dreiwöchiger Beobachtung, für alle sinnverwirrenden Erscheinungen meine Erklärung; ob aber die einzig noch möglichen Mittel Abhilfe bringen werden, das muß ich zwar mit frecher Stirne behaupten, im stillen steht es mir aber frei, mich nach Belieben von allen Furien des Zweifels und der Sorge quälen zu lassen.
Dabei bin ich trotz alles Sorgens nicht beschäftigt, wie ich wünschte, und manchmal beschleicht mich die unangenehme Frage, ob es Pflichterfüllung sei, tagelang untätig auf das Fallen eines Tropfens zu warten. Dann skizziere ich Ruinen der Umgegend, löse mathematische Aufgaben, oder mache gar – ich gesteh's mit Erröten – Verse, die sich beim taktmäßigen Keuchen der Maschine wie von selbst einstellen. Der tiefere Grund hierfür liegt jedoch anderswo. Mein neuer Steinener Freund Bohni hat eine leidenschaftliche Vorliebe für alles, was poesieartig aussieht. Um ihm ein kleines Andenken für seine unermüdliche Gefälligkeit zu hinterlassen, schrieb ich einige meiner früheren Sachen zusammen. Dabei hat sich der alte Adam wieder ein paarmal in seinem Grabe umgedreht. Es hat mich ordentlich gewundert. Und das Ergebnis war folgende Einleitung zu dem dünnen Heftchen.
Ich bin kein Dichter
Ich bin kein Dichter und ich kann's nicht fassen, Wie man das Heiligste, was man empfunden, Wie man sein Lieben all und all sein Hassen Kann dastehn sehn, in Saffian gebunden.
Selbst nicht um Ruhm und Ehre möcht' ich werben Mit dem, was ich in stiller Nacht gelitten, Mit meiner Liebe Blühn, mit ihrem Sterben Und mit des Herzens heimlich leisem Bitten.
Ich bin kein Dichter, kann nicht Handel treiben Mit dem, was mir die Musen freundlich gaben; Verschlossen soll mein Herz und einsam bleiben, Bis man's mit seinen Blüten wird begraben.
Doch nein! – Ich will die frohen und die herben, Will jedem gerne meine Lieder schenken, Kann ich damit ein treues Herz erwerben Und, wenn ich geh', ein freundliches Gedenken. –
Der Rückfall erklärt sich. Gestern habe ich in Hausen Hebels Geburtshaus und den Talschluß des Wiesentals besucht. Eine herrliche Gegend trotz des Dezembers, wenn gleichzeitig meine drei Kessel einen guten Tag haben.
"Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ew'ger Bund zu flechten!" Eben fängt der beste des eisernen Kleeblatts an, wie eine Dachtraufe zu tropfen! O Weihnachtszeit, allen Menschen ein Wohlgefallen, wie wird dir's diesmal ergehen?
5.
Steinen, den 19. Dezember 1859.
Vom Feldberg und vom Belchen herunter wirbelt der Schnee und tanzt mir bösartig vor dem Fenster und der Nase herum, eh' er meinen Sonntag zudeckt und meinen Christtag dazu. Heute kamen Eure Weihnachtsbriefe; ich habe damit Kirche gehalten nach meiner Art und geweint mit den Weinenden. Doch ist das nicht eigentlich meine Art und soll's nicht werden. "Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern! An drei Kesseln stirbt die Liebe nicht!"
Mit einer Weihnachtsfeier zu Hause ist alles aus. Ich bekomme über die Feiertage vier Kesselschmiede zu überwachen, von denen bereits zwei hier sind, um einen Tag nach ihrer Ankunft krank zu werden. Es ist, als ob alles verhext wäre. Von Berg erhalte ich Briefe, bald mit dem Motto: "Verlieren Sie nur den Mut nicht!" bald mit der Mahnung: "Den Kopf nicht zu verlieren," – aber stets mit dem Kehrreim: "Bleiben Sie, bis alles in Ordnung ist!"
Und wenn Ihr am Samstagabend zusammensitzt im kleinen Stübchen und das große Zimmer schon ein verschlossenes Kinderparadies ist – wenn man vielleicht die Frage bespricht, ob zum altgewohnten Weihnachtsgesang das Klavier herauskommt, oder Ihr hinein – wenn morgens die Glocken läuten, und die Magd das frühe Einheizen vergißt, und all die gewohnten Ungewöhnlichkeiten angenehm fröstelnd durch Leib und Seele gehen: steh' ich vielleicht hier im öden stillen Maschinenhaus, lasse Nieten warm machen und hauche die Blumen von den Scheiben, wenn ich einen Augenblick Zeit zum Träumen habe. – Ihr müßt darüber nicht traurig sein. Denket an mich, aber vergnügt. Das ist das Leben. Ich wollte es nicht anders, und es ist mir lieb, daß es so ist.
Aber ich muß zu meinen Kesselschmieden zurück. Ich vermute und hoffe, daß ihre Krankheit nichts ist als ein ungeheurer Katzenjammer. Sie waren den Markgräfler noch nicht gewöhnt. Das ist schon wieder ein Trost.
Tausend Grüße! Hängt sie an den Christbaum, wenn ihm die Nadeln abfallen!
6.
Steinen, den 31. Dezember 1859.
Schon seit einer Woche fühlte ich, daß die Last der Verantwortung, die seit zwei Monaten auf mir lag, lächelnd nicht mehr viel weitergeschleppt werden konnte. Und lächeln mußte ich, sonst war alles verloren. So kam mir endlich auf meine dringende Bitte unser Bureauchef und Oberingenieur besuchsweise zu Hilfe. Not schweißt groß und klein zusammen. Unsre heimlichen Beratungen boten ein Bild rührender Eintracht. Wenn wir allein waren, jammerten wir mit vereinten Kräften über den Oberst, über uns, das Wiesental und die ganze Welt. Standen wir unsern Gegnern gegenüber, so machten wir ein möglichst keckes Gesicht, als ob alles so sein müßte. Drei bis vier Tage blieb er da, machte mit dem Hauptmann, seinem Landsmann und Busenfreund, ein paar Ausflüge, tröstete mich, so gut er konnte, und fuhr wieder ab.
Der Christabend, der erste, den ich in der kühlen Fremde verlebte, war die Wehmut selbst. Ich sah Weihnachtsbäume mit ihren Lichtern durch Türspalten und durch halbgeöffnete Läden, als ich aus der Fabrik kam. Während man in der Frühe bei Euch das Fest einläutete, stand ich am öden Maschinenhaus und traf Vorbereitungen für das widerwärtigste aller Geschäfte. Man feiert Weihnachten in der Schweiz und ihrer Umgegend nicht wie bei uns, und so hatte der Magistrat von Steinen das Arbeiten selbst am Festtag erlaubt, das sich unter den obwaltenden Umständen kaum vermeiden ließ. Die dröhnenden Hammerschläge klangen hoffentlich in der Ferne wie ein etwas wunderliches Glockengeläute. Jedenfalls ist noch nie das ora et labora so verwirrt durch ein Schneegestöber geschmettert worden wie von uns an diesem trübsten aller Christtagsmorgen.
Und doch scheint der Segen des Himmels darauf zu ruhen. Der letzte Versuch einer Radikalkur hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Damit liegt das alte Jahr mit seinen Freuden und Leiden hinter uns. Nun muß sich alles wenden.
7.
Berg, den 22. Januar 1860.
Meine letzte Woche in Steinen machte das Briefschreiben zur Unmöglichkeit. Wie Menschen hatten auch die Kessel das neue Jahr mit guten Vorsätzen begonnen, die sie, anders als Menschen, bis heute gehalten haben. Alles lief wie am Schnürchen, so daß ich mich, vielleicht mehr als billig, der Geselligkeit widmen konnte. Ich hielt dies halb und halb für meine Pflicht, da die gute Laune um mich her in manchen widerwärtigen Punkten auch geschäftlich von Nutzen war. Dabei wurde ich, ohne mir schmeicheln zu wollen, fast der Hahn im Korb von Steinen. Kaum ein Tag verging, ohne daß ich schon morgens Billette antraf, die entweder eine Einladung oder die Auflösung meiner gestrigen Scharade – diese Spielerei wurde zur förmlichen Manie – oder etwas Ähnliches enthielten. Es war eine phäakische Woche!
Sie schloß mit einem festlichen Abschiedsforellenessen bei dem einst gefürchteten Hauptmann. Höchst überrascht wurde ich hier durch die poetische Erwiderung auf ein Gedicht, das ich meinen Freunden in Berg geschickt und das also begonnen hatte:
Fort von Steinen, fort von Steinen Führe gnädig Du die Deinen, Gott, der Eisen wachsen ließ, Wo ein Oberst und ein Hauptmann Mich in grauser Wut, so glaubt man, Lieber gleich in Stücke riß'.
Fort von Steinen, fort von Steinen, Wo dem Zeichner unter Weinen Fast das müde Herze bricht, Wo als bied'rer Maurermeister Er und hundert böse Geister Mit der Stang' im Nebel ficht! u. s. w.
Dieses Karmen war schließlich in die Hände des Zeichenmeisters gefallen, wie wir unsern Bureauchef zu nennen pflegten, der es seinem Freunde, dem Hauptmann in Steinen, zusandte! Zu meinem nicht geringen Entsetzen begann nun bei obbemeldetem Forellenessen plötzlich dieser Herr:
"Fort von Steinen, fort von Steinen!"
In der Folge aber nahmen seine Verse eine Wendung, die mich förmlich rührte.
Der Abschied fand morgens drei Uhr statt, an den Postwagen kamen noch der junge Geigy, der Hauptmann, der Doktor und verschiedene andre Scharadenlöser, um mir das Geleite zu geben. Wem mein Gehen wirklich weh tat, das war mein guter Bohm, von dem ich im Strudel der letzten Woche am wenigsten gehabt hatte. Zum ewigen Andenken besorg' ich ihm auf seinen besonderen Wunsch eine Äolsharfe, bei deren Klagen er meine Gedichte lesen will.
Vierzehn Tage sind seitdem verflossen. Sie waren ein Wirbeln von der Szylla in die Charybdis, in geschäftlichen Dingen. Doch habe ich Zeit gehabt, mich wieder anzugewöhnen, was nicht abging ohne ein paar Augenblicke – fast muß ich sagen: des Heimwehs nach dem lieben, fröhlichen Steinen, dem ich wohl den besten Teil meines Dankes für immer schuldig bleiben werde.
###