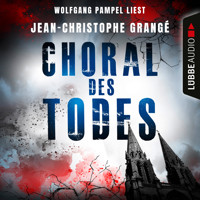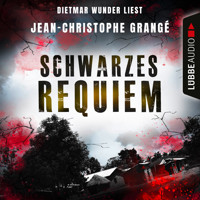7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Atemberaubende Spannung von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1
- Sprache: Deutsch
Die Schuld hat viele Gesichter ...
Die Untersuchungsrichterin Jeanne Korowa übernimmt den Fall einer grausamen Mordserie: Drei Frauen wurden brutal ausgeweidet, ihre Leichen makaber in Szene gesetzt und Teile ihrer Körper offenbar vom Täter verspeist. Bei ihren Ermittlungen stößt Jeanne auf einen besorgten Vater, der vom seltsamen Verhalten seines autistischen Sohnes berichtet. Kann der junge Mann der Täter sein? Die Suche nach der Wahrheit führt Jeanne bis in den Dschungel Argentiniens - und dort werden ihre schlimmsten Albträume Wirklichkeit ...
Autismus, archaisches Grauen und die Frage danach, was den Menschen ausmacht - In "Im Wald der stummen Schreie" verwebt der französische Bestseller-Autor Jean-Christophe Grangé Fakten und Fiktion zu einem erschreckend realen Thriller.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
I. Die Opfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
II. Das Kind
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
III. Das Volk
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Fußnoten
Weitere Titel des Autors
Choral des Todes
Das Herz der Hölle
Das Imperium der Wölfe
Das schwarze Blut
Der Flug der Störche
Der steinerne Kreis
Der Ursprung des Bösen
Die Fesseln des Bösen (Januar 2020)
Die purpurnen Flüsse
Die Wahrheit des Blutes
Purpurne Rache
Schwarzes Requiem
Über dieses Buch
Die Schuld hat viele Gesichter …
Die Untersuchungsrichterin Jeanne Korowa übernimmt den Fall einer grausamen Mordserie: Drei Frauen wurden brutal ausgeweidet, ihre Leichen makaber in Szene gesetzt und Teile ihrer Körper offenbar vom Täter verspeist. Bei ihren Ermittlungen stößt Jeanne auf einen besorgten Vater, der vom seltsamen Verhalten seines autistischen Sohnes berichtet. Kann der junge Mann der Täter sein? Die Suche nach der Wahrheit führt Jeanne bis in den Dschungel Argentiniens – und dort werden ihre schlimmsten Albträume Wirklichkeit …
Über den Autor
Jean-Christophe Grangé, 1961 in Paris geboren, war als freier Journalist für verschiedene internationale Zeitungen (u.a. Sunday Times, Observer, El Pais, Spiegel, Stern) tätig. Auf sein bravouröses Romandebüt "Der Flug der Störche" folgten weitere Veröffentlichungen, durch die er rasch zum französischen Bestseller-Autor im Thriller-Genre aufstieg. Grangés Markenzeichen: Gänsehaut pur. Frankreichs Superstar ist inzwischen weltweit bekannt für unerträgliche Spannung, außergewöhnliche Stoffe und exotische Schauplätze. Seine Thriller erscheinen in über dreißig Ländern und wurden fast alle mit prominenter Besetzung für das Kino verfilmt.
Jean-Christophe Grangé
Im Wald derstummen Schreie
Thriller
Übersetzung aus dem Französischenvon Thorsten Schmidt
beTHRILLED
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Éditions Albin Michel
Titel der französischen Originalausgabe: »La Forêt des Mânes«
Published by arrangement with Éditions Albin Michel, Paris
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2011/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Boris Heczko, München
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: andreashofmann7777 | andreiuc88 | STILLFX
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-8093-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Alma,das Licht in meiner Finsternis
I.Die Opfer
1
Das war's. Genau das.
Die Prada-Pumps, die sie in der Vogue vom letzten Monat entdeckt hatte. Die diskrete, entscheidende Note, die das Ensemble abrunden würde. Mit dem Kleid, das ihr vorschwebte – ein kleines Schwarzes, das sie supergünstig in der Rue du Dragon erstanden hatte. Ganz einfach schräg. Lächeln. Jeanne Korowa rekelte sich hinter ihrem Schreibtisch. Endlich hatte sie die passende Garderobe für den Abend beisammen. Sowohl was die Form als auch was den Geist anlangte.
Sie überprüfte ihr Handy. Keine Nachricht. Sie hatte ein flaues Gefühl im Magen, stärker noch als die bisherigen Male. Weshalb rief er nicht an? Es war schon nach vier. War es nicht zu spät, um die Verabredung zum Abendessen zu bestätigen?
Sie wischte ihre Zweifel beiseite und rief bei der Prada-Boutique in der Avenue Montaigne an. Ob sie Schuhe in 39 hätten? Sie würde vor sieben vorbeischauen. Kurze Erleichterung, auf die sogleich eine neue Sorge folgte: Sie hatte ihr Konto bereits um 800 Euro überzogen. Nach diesem Einkauf würde sie mit mehr als 1300 Euro in der Kreide stehen.
Aber heute war der 29. Mai. Ihr Gehalt würde in zwei Tagen überwiesen. 4 000 Euro. Kein Cent mehr, Prämien eingeschlossen. Den nächsten Monat würde sie also ein weiteres Mal mit einem Drittel weniger von ihrem Gehalt auskommen müssen. Sie war es gewohnt. Schon lange hatte sie ein gewisses Geschick darin, mit überzogenem Konto zu leben.
Sie schloss die Augen. Sie sah sich in ihren Lackschuhen. Heute Abend würde sie eine andere sein. Nicht wiederzuerkennen. Strahlend. Unwiderstehlich. Der Rest war nur ein Kinderspiel. Annäherung. Versöhnung. Erneutes Auseinandergehen …
Aber wieso rief er nicht an? Dabei hatte er am Vorabend den Kontakt wiederaufgenommen. Zum hundertsten Mal öffnete sie an diesem Tag ihre Mailbox und checkte ihre E-Mails.
»Die Worte lassen uns irgendetwas daherreden. Ich glaubte selbstverständlich keines davon. Wie wär's, morgen ein Abendessen zu zweit? Ich ruf dich an und hol dich am Gericht ab. Ich werde dein König sein, und du wirst meine Königin sein …«
Die letzten Wörter waren natürlich eine Anspielung auf Heroes, einen Song von David Bowie. Ein Sammlerstück, wo der Rockstar mehrere Strophen auf Französisch singt. Sie sah die Szene wieder vor sich – der Tag, an dem sie die Schallplatte in einem Spezialgeschäft im Pariser Hallenviertel entdeckt hatten. Die Freude in seinen Augen. Sein Lächeln … In diesem Moment wünschte sie sich nichts weiter, als immer wieder dieses Leuchten in seinen Augen hervorrufen zu können oder es einfach nur zu bewahren. Wie die Vestalinnen im antiken Rom das heilige Feuer im Tempel hüten mussten.
Das Telefon klingelte. Nicht ihr Handy. Das stationäre.
»Hallo?«
»Violet.«
In einem Sekundenbruchteil schlüpfte Jeanne wieder in ihre offizielle Rolle.
»Was haben wir in der Hand?«
»Nichts.«
»Hat er gestanden?«
»Nein.«
»Hat er sie nun vergewaltigt – ja oder nein?«
»Er sagt, dass er sie nicht kennt.«
»Ist sie denn nicht die Tochter seiner Geliebten?«
»Er sagt, dass er die Mutter auch nicht kennt.«
»Wir können doch leicht das Gegenteil beweisen, oder?«
»In diesem Fall ist nichts leicht.«
»Wie viele Stunden haben wir noch?«
»Sechs. Also so gut wie nichts. In achtzehn Stunden hat er nicht einmal mit der Wimper gezuckt.«
»Mist!«
»Kannst du laut sagen. Ich werde ihn mir nochmals vorknöpfen und ihn etwas härter rannehmen. Aber wenn kein Wunder geschieht …«
Sie legte auf und wurde sich ihrer Gleichgültigkeit bewusst. Zwischen der Schwere der Vorwürfe in diesem Fall – Vergewaltigung und Körperverletzung bei einer Minderjährigen – und der Bagatelle, um die es in ihrem Privatleben ging – mit ihm zu Abend essen oder nicht –, klaffte ein Abgrund. Trotzdem konnte sie an nichts anderes denken als an ihre Verabredung.
Auf der Nationalen Hochschule für das Richteramt hatte man ihnen gleich zu Beginn der Ausbildung eine Videosequenz gezeigt: Ein Täter wurde beim Begehen einer Straftat von einer Überwachungskamera gefilmt. Anschließend wurde jeder angehende Richter aufgefordert, zu erzählen, was er gesehen hatte. Jeder berichtete etwas anderes. Die Marke und die Farbe des aufgebrochenen Autos änderten sich. Die Zahl der Täter schwankte. Die Abfolge der Ereignisse war nie gleich. Die Lektion dieser Übung war klar: Es gibt keine objektive Wahrheit. Die Gerechtigkeit ist eine menschliche Angelegenheit. Unvollkommen, Schwankungen unterworfen, subjektiv.
Unwillkürlich betrachtete Jeanne noch einmal das Display ihres Handys. Nichts. Sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Schon seit dem Morgen konnte sie den Anruf kaum erwarten. Sie hatte nicht aufgehört, in Phantasien zu schwelgen, immer wieder dieselben Gedanken, dieselben Hoffnungen wiederzukäuen, um schon in der nächsten Sekunde in totaler Verzweiflung zu versinken. Mehrmals stand sie kurz davor, selbst anzurufen. Aber nein. Niemals. Sie musste durchhalten …
Halb sechs. Plötzlich wurde sie von Panik ergriffen. Alles war vorbei. Dieses vage Versprechen, gemeinsam zu Abend zu essen, war das letzte Zucken des Leichnams. Er würde nicht zurückkommen. Sie musste es sich eingestehen. »Abtrauern.« »Wieder zu Kräften kommen.« »Sich um sich selbst kümmern.« Dumme Sprüche, mit denen sich vom Pech verfolgte junge Frauen wie sie über ihre Verzweiflung hinwegzutrösten suchten. Die ewig Sitzengelassenen und Zukurzgekommenen. Sie warf ihren Stabilo auf den Schreibtisch und stand auf.
Ihr Büro befand sich im dritten Stock des Gebäudes, in dem das Landgericht von Nanterre seinen Sitz hatte. Zehn Quadratmeter, vollgestopft mit Akten, die nach Staub und Druckertinte rochen – zehn Quadratmeter, auf denen sich zwei Schreibtische drängten: ihrer und der ihrer Mitarbeiterin Claire. Sie hatte Claire um vier freigegeben, um ungestört vor sich hin zu träumen.
Sie stellte sich ans Fenster und betrachtete den Park von Nanterre. Sanft geschwungene Hügel, die von kümmerlichem Rasen überzogen waren. Siedlungen in Regenbogentönen rechter Hand und, weiter weg, die »Wolkenkratzer« von Émile Aillaud, dem Architekten, der sagte: »Der Fertigbau ist eine ökonomische Notwendigkeit, aber er darf den Menschen nicht den Eindruck vermitteln, dass sie selbst vorgefertigt sind.« Jeanne gefiel dieses Zitat. Aber sie war sich nicht sicher, ob das Ergebnis den Hoffnungen des Architekten entsprach. Tag für Tag landeten die »Produkte« dieser heruntergekommenen Viertel auf ihrem Schreibtisch: Diebstahl, Vergewaltigung, Körperverletzung, Drogenkriminalität … Nichts Vorgefertigtes, das war sicher.
Sie setzte sich wieder an ihren Schreibtisch. Ihr war übel. Sie fragte sich, wie lange sie wohl noch ohne eine Lexotanil durchhalten würde. Ihr Blick fiel auf einen Block Briefpapier. Berufungsgericht Versailles. Landgericht Nanterre. Dienststelle von Frau Jeanne Korowa. Ermittlungsrichterin beim Landgericht Nanterre. In ihrem Geist hörte sie die Formeln widerhallen, mit denen sie gewöhnlich charakterisiert wurde. Die jüngste Absolventin ihres Jahrgangs. Die »aufstrebende junge Richterin«, der eine große Karriere bevorstehe. Das war die offizielle Version.
Die private Version war eine Katastrophe. Fünfunddreißig Jahre alt, unverheiratet, kinderlos. Einige Freundinnen, ebenfalls Singles. Eine gemietete Dreizimmerwohnung im 6. Arrondissement. Keine Rücklagen. Kein Vermögen. Keine Perspektive. Das Leben war ihr wie Wasser zwischen den Fingern zerronnen. Und im Restaurant begann man sie »Madame« und nicht mehr »Mademoiselle« zu nennen. Mist.
Vor zwei Jahren hatte sie den Boden unter den Füßen verloren. Das Leben, das bereits einen bitteren Geschmack hatte, machte ihr schließlich gar keine Freude mehr. Depression. Krankenhausaufenthalt. Damals vegetierte sie nur noch vor sich hin. Leben war für sie gleichbedeutend mit »Leiden«. Seltsamerweise behielt sie ihren Aufenthalt in der Psychiatrie in guter Erinnerung. Drei Wochen Schlaf, mit Medikamenten und Gläschen Babynahrung gefüttert. Eine behutsame Rückkehr in die Realität. Antidepressiva. Psychoanalyse … Die damaligen Erlebnisse hinterließen ein unsichtbares schwarzes Loch in ihr, das sie im Alltag mit Hilfe von Psychotherapie, Medikamenten und Ausgehen zu umschiffen versuchte. Aber das schwarze Loch war immer sehr nah, und es übte fast eine magnetische Anziehungskraft aus.
Sie kramte in ihrer Tasche nach ihren Lexotanil und legte eine ganze Tablette unter ihre Zunge. Früher hatte sie nur ein Viertel genommen, aber aufgrund der Macht der Gewohnheit zog sie sich jetzt immer eine ganze rein. Sie ließ sich in ihren Sessel sinken und wartete. Sehr rasch löste sich die Anspannung in ihrer Brust. Ihr Atem ging wieder regelmäßiger. Ihre Gedanken wurden verschwommener …
Jemand klopfte an die Tür. Sie schreckte auf. Sie war eingeschlafen.
Stéphane Reinhardt stand in seinem Jackett mit Hahnentrittmuster in der Tür – mit zerzaustem Haar, zerknitterter Miene, unrasiert. Einer der sieben Ermittlungsrichter am Landgericht. Man nannte sie die »sieben Söldner«. Reinhardt besaß bei weitem den meisten Sexappeal. Vom Typ her eher Steve McQueen als Yul Brynner.
»Hast du Bereitschaftsdienst für Steuerstrafsachen?«
»Gewissermaßen.«
Vor drei Wochen hatte man ihr dieses Sachgebiet übertragen, auf dem sie keine Expertin war. Genauso gut hätte sie die Zuständigkeit für Schwerkriminalität oder Terrorismus bekommen können.
»Ja oder nein?«
»Ja!«
Reinhardt schwenkte eine Mappe aus grünem Karton.
»Die Staatsanwaltschaft hat sich vertan. Sie haben mir diesen Antrag auf Einleitung des Ermittlungsverfahrens zugesandt.«
Ein Antrag auf Einleitung des Ermittlungsverfahrens wird von einem Staatsanwalt nach der ersten Prüfung eines Falles gestellt. Ein amtliches Dokument, das an die ersten Unterlagen der Akte angetackert ist: Protokolle der Polizisten, Bericht des Finanzamtes, anonyme Briefe … Alles, was die ersten Verdachtsmomente erhärten kann.
»Ich habe eine Kopie für dich gemacht«, fuhr er fort. »Du kannst sie sofort durcharbeiten. Ich schicke ihnen das Original noch heute Abend zurück. Sie werden dir die Sache morgen übertragen. Oder ich warte ein paar Tage und übergebe die Akte dem nächsten Richter, der Bereitschaftsdienst hat. Willst du, oder nicht?«
»Worum handelt es sich?«
»Ein anonymer Bericht. Ein schöner kleiner politischer Skandal, wie es scheint.«
»Welches Lager?«
Er führte die rechte Hand an seine Schläfe und tat so, als würde er salutieren.
»Ganz rechts, Herr General!«
Binnen einer Sekunde hatte Jeanne Feuer gefangen. Denn ihr Beruf war tatsächlich ihre Berufung. Sie war erfüllt von ihrer Aufgabe. Dem Bewusstsein ihrer Macht. Ihrer Stellung als Richterin kraft präsidialem Dekret.
Sie streckte den Arm über ihren Schreibtisch aus.
»Gib her.«
2
Sie hatte Thomas auf einer Vernissage kennengelernt. Sie erinnerte sich noch an das genaue Datum: 12. Mai 2006. An den Ort: ein weitläufiges Appartement auf dem linken Seineufer, in dem damals eine Fotoausstellung gezeigt wurde. Ihr typischer Look: indischer Kasack, graumoirierte Jeans, Stiefel mit Silberschnallen nach Art von Motorradfahrerstiefeln. Jeanne hatte keine Augen für die Fotos an den Wänden gehabt. Sie hatte sich auf ihr Ziel konzentriert: den Fotografen selbst.
Sie hatte so viel Champagner getrunken, bis sie völlig enthemmt war. Wenn sie ihr Opfer ausgewählt hatte, liebte sie es, sich gehen zu lassen und selbst Opfer zu werden. Killing me softly with his song. Die Version der Fugees übertönte das Stimmengewirr. Die perfekte Musik für ihren mentalen Striptease, bei dem sie sich nach und nach von ihren Ängsten, ihrer Scheu und Schamhaftigkeit befreite. All dies schwebte über ihrem Kopf wie ein Bustier oder ein String-Tanga, bis sie endlich die wahre Freiheit erreichte: die des Begehrens.
Gleichzeitig hörte Jeanne die Warnungen von Freundinnen: »Thomas? Ein Schürzenjäger. Ein Weiberheld. Ein Dreckskerl.« Sie lächelte. Es war schon zu spät. Der Champagner betäubte ihr seelisches Abwehrsystem. Er hatte sich ihr genähert. Hatte mit seiner Verführungsnummer begonnen, die im Grunde recht erbärmlich war. Aber jenseits der Scherze glühte sein Verlangen. Und in ihrem Lächeln spiegelte sich ihre Antwort wider.
Schon bei dieser Begegnung hatten die Missverständnisse angefangen. Der erste Kuss war zu schnell gekommen. Noch am selben Abend im Auto. Und wie ihre Mutter zu sagen pflegte, ehe sie durchdrehte: »Für die Frau ist der erste Kuss der Anfang einer Affäre. Für den Mann ist es der Anfang vom Ende.« Jeanne machte sich Vorwürfe, weil sie so schnell nachgegeben hatte. Weil sie es nicht verstanden hatte, die erotische Spannung langsam wachsen zu lassen.
Um das Maß voll zu machen, hatte sie sich ihm anschließend mehrere Wochen verweigert und so für unnötige Spannungen zwischen ihnen gesorgt. Ihre Rollenverteilung war klar: Er war der Fordernde, sie die Abweisende. Vielleicht schützte sie sich bereits … Sie wusste, dass sie mit ihrem Körper auch ihr Herz hingeben würde. Und dass damit die echte Abhängigkeit begann.
Thomas war ein guter Fotograf, keine Frage. Aber ansonsten war er eine Null. Er war weder schön noch hässlich. Bestimmt nicht sympathisch. Geizig, egoistisch und feige, wie die meisten Männer. Tatsächlich hatten Jeanne und er nur eine Gemeinsamkeit: zwei Stunden Psychotherapie pro Woche. Und ihre tiefen seelischen Wunden, die sie zu behandeln versuchten. Wenn sie darüber nachdachte, konnte sie sich die Tatsache, dass sie sich auf den ersten Blick verliebt hatte, nur durch die äußeren Umstände erklären. Der richtige Ort. Die richtige Zeit. Sonst nichts. Sie wusste dies alles, und dennoch hob sie ihn weiterhin in den Himmel und unterzog sich in einem fort einer Selbsthypnose. Die Liebe der Frau: die einzige Domäne, wo das Ei die Henne legt …
Das war nicht ihr erster Fehlgriff. Sie hatte eine sichere Hand für Nieten und sogar für Verrückte. Wie etwa diesen Anwalt, der jedes Mal den Boiler ausschaltete, bevor sie bei ihm übernachtete. Er hatte bemerkt, dass Jeanne nach einer heißen Dusche einschlief, ohne mit ihm zu vögeln. Oder diesen Informatiker, der sie über seine Webcam zum Striptease aufforderte. Sie hatte die Sache sofort beendet, als ihr aufging, dass er nicht der Einzige war, der ihr zusah. Oder diesen unbekannten Verleger, der bei Fahrten mit der U-Bahn weiße Filzhandschuhe trug und in Buchhandlungen Sonderangebote stahl. Es hatte noch andere gegeben. So viele andere … Womit hatte sie nur all diese Typen mit durchgebrannter Sicherung verdient? All diesen Fehlgriffen lag eine einfache Wahrheit zugrunde: Jeanne war in die Liebe verliebt.
Als Mädchen hatte sich Jeanne an einem Lied nicht satthören können: »Lass sie nicht fallen / sie ist so zerbrechlich / eine emanzipierte Frau / hat es nicht leicht …« Damals hatte sie die verborgene Ironie dieser Worte nicht verstanden, doch sie ahnte, dass dieses Lied auf geheimnisvolle Weise ihre Zukunft besiegeln würde. Sie hatte Recht behalten. Heute war die Pariserin Jeanne Korowa eine unabhängige, emanzipierte Frau. Und ja … es war nicht leicht.
Sie eilte von Prozess zu Prozess, von Haussuchung zu Zeugenvernehmung und fragte sich dabei immer, ob sie auf dem richtigen Weg war. Ob dies das Leben war, von dem sie geträumt hatte. Manchmal hatte sie das Gefühl, einem riesigen Betrug aufgesessen zu sein. Man hatte ihr eingeredet, sie müsse den Männern ebenbürtig sein. Bei der Arbeit ihr Bestes geben. Mit ihren Gefühlen zurückstecken. Aber war das auch wirklich das, was sie wollte?
Was sie wütend machte, war die Tatsache, dass diese Situation von Männern diktiert worden war. Die Männer in den Städten hatten die Ernüchterung in Sachen Liebe so weit getrieben, dass sich die Frauen gezwungen sahen, ihren Traum von der großen Liebe und ihren Kinderwunsch aufzugeben. Und wozu dies alles? Um im Berufsleben zu bestehen und abends vor der Glotze ihren Träumen nachzuhängen, während sie ihr Lexotanil mit einem Glas Wein hinunterspülten. Das nannte man dann Fortschritt.
Anfangs waren sie und Thomas das perfekte moderne Paar gewesen. Zwei Wohnungen. Zwei Konten. Zwei Steuererklärungen. Einige gemeinsam verbrachte Abende pro Woche und, um das Maß voll zu machen, ab und zu ein Wochenende in trauter Zweisamkeit in Deauville oder andernorts.
Als Jeanne es gewagt hatte, gewisse heikle Dinge anzusprechen – »Verlobung«, »Zusammenziehen« oder auch »Kind« –, war sie abschlägig beschieden worden. Ein Bollwerk des Zauderns, der Ausflüchte und des Hinauszögerns … Und da ein Unglück selten allein kommt, war sie argwöhnisch geworden. Was machte Thomas eigentlich an den übrigen Abenden, wenn sie sich nicht trafen?
Bei Bränden kommt es gelegentlich zu einem Phänomen, das Experten flashover nennen. In einem geschlossenen Raum zehren die Flammen den gesamten Sauerstoff auf, ehe sie die Luft von außen ansaugen – durch die Spalten unter den Türen und in den Fensterrahmen sowie durch Mauerrisse. Der im Innern entstehende Unterdruck wird so groß, dass er sogar Zwischenwände, Fensterrahmen und Scheiben verformt, bis alles zersplittert. Die jähe Sauerstoffzufuhr von außen nährt den Brand, der immer stärker wird, bis er in einem Feuerball explodiert. Das nennt man flashover.
Genau dies war Jeanne passiert. Da sie ihr Herz gegen alle Hoffnung abgeschirmt hatte, hatte sie ihre Ressourcen aufgebraucht. Jede Tür, jeder Riegel, den sie in ihren bangen Erwartungen vorgeschoben hatte, war schließlich weggefegt worden und hatte grenzenlose Wut, Ungeduld und maßlose Ansprüche freigesetzt. Jeanne war zu einer Furie geworden. Sie hatte Thomas unter Druck gesetzt. Sie hatte ihm Ultimaten gestellt. Das Ergebnis war absehbar gewesen: Der Mann war ganz einfach verschwunden. Dann war er wieder aufgetaucht. Erneut verschwunden … Die Diskussionen, die Ausflüchte, die Trennungen hatten sich wiederholt, bis ihre Beziehung nur noch ein Schatten ihrer selbst war.
Und wo stand sie heute? Nirgendwo. Sie hatte nichts gewonnen. Weder Versprechen noch Gewissheit. Im Gegenteil, sie war nur noch ein Stück einsamer. Bereit, sich mit allem abzufinden. Mit einer anderen zum Beispiel. Alles besser als die Einsamkeit. Alles besser, als ihn zu verlieren. Und sich selbst zu verlieren. So sehr war dieser Mensch zu einem Teil von ihr geworden, so sehr peinigte er sie …
Seit etlichen Wochen erledigte sie ihre Arbeit nur mit halber Kraft; die kleinste Geste, der geringste Gedanke erforderte übermenschliche Anstrengung. Sie bearbeitete ihre Akten, ohne richtig bei der Sache zu sein. Sie tat so, als würde sie existieren, arbeiten, atmen, aber ihre Angst hatte sie völlig im Griff. Ihre verkohlte Liebe. Ihr Tumor.
Und dann diese quälende Frage, ob es eine andere gab.
Jeanne Korowa kehrte gegen Mitternacht in ihre Wohnung zurück. Zog ihren Mantel aus, ohne das Licht einzuschalten. Legte sich auf das Sofa im Wohnzimmer, mit Blick auf die Straßenlaternen, deren Licht gegen die Finsternis ankämpfte.
Dort masturbierte sie, bis sie der Schlaf übermannte.
3
Name. Vorname. Alter. Beruf.
»Perraya. Jean-Yves. Dreiundfünfzig Jahre. Ich leite eine Hausverwaltungsgesellschaft, die COFEC.«
»Die Anschrift?«
»Rue du Quatre-Septembre 14, im 2. Arrondissement.«
»Ihre Privatadresse?«
»Boulevard Suchet 117, 16. Arrondissement.«
Jeanne wartete, bis ihre Mitarbeiterin Claire diese Angaben notiert hatte. Es war zehn Uhr morgens. Und es war schon heiß. Nur selten führte sie vormittags Vernehmungen durch. Gewöhnlich verbrachte sie die ersten Stunden ihres Arbeitstages damit, Akten zu studieren und für die anstehenden gerichtlichen Maßnahmen am Nachmittag – Anhörungen, Vernehmungen, Gegenüberstellungen – Telefonate zu tätigen. Aber diesmal wollte sie ihren Besucher überrumpeln. Sie hatte ihm die Vorladung am Vorabend zukommen lassen. Sie hatte ihn lediglich als Zeugen geladen. Ein klassischer Trick. Ein Zeuge hat keinen Anspruch auf einen Rechtsbeistand oder auf Akteneinsicht. Ein Zeuge ist doppelt so verwundbar wie ein Verdächtiger.
»Monsieur Perraya, muss ich Ihnen noch einmal darlegen, weshalb Sie vorgeladen wurden?«
Der Mann antwortete nicht. Jeanne fuhr mit sachlicher Stimme fort:
»Sie werden hier zu den Geschehnissen vernommen, die sich in der Avenue Georges-Clemenceau 6 in Nanterre ereigneten. Auf Anzeige von Monsieur und Madame Assalih, Staatsbürger des Tschad, wohnhaft in der Cité des Fleurs, Rue Sadi-Carnot 12 in Grigny. Eine weitere, mit der ersten verbundene Anzeige wurde von Médecins du Monde und der Vereinigung der Opfer von Bleivergiftungen (VOB) gestellt.«
Perraya rutschte nervös auf seinem Stuhl hin und her, während er seine Schuhe anstarrte.
»Es geht um folgende Sachverhalte. Am 27. Oktober 2000 wird die sechsjährige Goma Assalih, die mit ihren Eltern in der Avenue Georges-Clemenceau 6 wohnt, in die Klinik Robert-Debré gebracht. Sie klagt über heftige Bauchschmerzen, und sie leidet an Durchfall. Die Bleikonzentration in ihrem Blut ist stark erhöht. Goma hat eine Bleivergiftung. Sie muss sich einer einwöchigen Entgiftungstherapie unterziehen.«
Jeanne hielt inne. Ihr »Zeuge« hielt den Atem an und starrte noch immer auf seine Treter.
»Am 12. Mai 2001 wird der zehnjährige Boubakar Nour, ebenfalls wohnhaft Avenue Georges-Clemenceau 6, seinerseits in die Necker-Kinderklinik aufgenommen. Die gleiche Diagnose. Er muss sich einer zweiwöchigen Entgiftungstherapie unterziehen. Die Bleivergiftungen dieser Kinder sind auf die Farbe zurückzuführen, mit der die Wände der Wohnungen gestrichen wurden, in denen sie leben – echte Elendsbehausungen. Die Familien Assalih und Nour wenden sich an Ihre Hausverwaltung mit der Bitte, Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Sie reagieren nicht auf ihre Aufforderung.«
Sie sah auf. Perraya schwitzte.
»Am 20. November desselben Jahres wird ein weiteres Kind, das in der Avenue Georges-Clemenceau 6 wohnt, der siebenjährige Mohamed Tamar, ins Krankenhaus eingewiesen. Wieder ein Fall von Bleivergiftung. Der kleine Junge, der an schweren Krämpfen leidet, stirbt zwei Tage später in der Necker-Klinik. Bei der Obduktion finden sich in seiner Leber, seinen Nieren und seinem Gehirn Bleispuren.«
Perraya lockerte seine Krawatte und rieb sich die Hände an den Hosenbeinen trocken.
»Diesmal wollen die Bewohner des Mietshauses mit Unterstützung der VOB die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zivilrechtlich einklagen. Sie reagieren noch immer nicht. Stimmt das?«
Der Mann räusperte sich und murmelte:
»Diese Familien hatten Anträge auf Neuunterbringung gestellt. Die Stadt Nanterre sollte sich um sie kümmern. Wir wollten mit den Sanierungsarbeiten beginnen, sobald sie ausgezogen waren.«
»Wissen Sie, wie lange die Bearbeitung solcher Anträge dauert? Wollten Sie warten, bis alle tot sind, ehe Sie etwas unternehmen?«
»Wir verfügten nicht über die notwendigen Mittel, um sie anderweitig unterzubringen.«
Jeanne musterte ihn einen Augenblick. Hochgewachsen, breite Schultern, Markenanzug, lockiges graues Haar, das in alle Richtungen von seinem Kopf abstand. Ungeachtet seiner stattlichen Erscheinung wirkte Jean-Yves Perraya unscheinbar und farblos. Ein Rugbyspieler, der sich am liebsten unsichtbar gemacht hätte.
Sie öffnete eine zweite Aktenmappe.
»Zwei Jahre später, 2003, wird ein Gutachten erstellt. Das Ergebnis ist besorgniserregend. Die Wände der Wohnungen sind mit Bleiweißfarbe gestrichen, die seit 1948 verboten ist. Unterdessen sind vier weitere Kinder des Mietshauses in die Klinik eingewiesen worden.«
»Die Arbeiten waren geplant! Die Stadt sollte uns helfen.«
»In dem Bericht ist auch von Gesundheitsgefährdung die Rede. Sämtliche Sicherheitsvorschriften wurden missachtet. Keine der Wohnungen, bei denen es sich in Wirklichkeit um Einzimmer-Appartements handelt, ist größer als zwanzig Quadratmeter und keine verfügt über sanitäre Einrichtungen. Und dies bei Mieten, die über 600 bis 700 Euro betragen. Wie groß ist Ihre Wohnung am Boulevard Suchet, Monsieur Perraya?«
»Darauf möchte ich nicht antworten.«
Jeanne bereute diesen persönlichen Angriff. Sich immer an die Fakten halten. Sie fuhr fort:
»Einige Monate später, im Juni 2003, stirbt ein weiteres Kind aus der Avenue Georges-Clemenceau 6 an Bleivergiftung. Sie haben die Wohnungen noch immer nicht besichtigt, um den Sanierungsaufwand abzuschätzen.«
»Wir waren vor Ort.«
Sie breitete die Arme aus.
»Wo sind die Berichte? Wo sind die Kostenvoranschläge der Firmen? Von Ihrem Büro haben wir nichts dergleichen bekommen.«
Perraya fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Trocknete sich abermals die Hände an seiner Hose ab. Grobe, schwielige Hände. Dieser Typ kommt vom Bauhandwerk, dachte Jeanne. Er wusste also, worum es ging.
»Wir haben die Giftbelastung nicht als so gravierend eingeschätzt«, log er.
»Obwohl Ihnen das Gutachten und die Laborbefunde der Opfer vorlagen?«
Perraya knöpfte sein Hemd auf.
Jeanne blätterte eine Seite um und fuhr fort:
»›Wegen dieser Todesfälle und der lebenslänglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat das Berufungsgericht von Versailles in seinem Urteil vom 23. März 2008 den Opfern eine finanzielle Entschädigung zuerkannt.‹ Die betroffenen Familien wurden endlich entschädigt und anderweitig untergebracht. Gleichzeitig gelangten die Sachverständigen zu dem Schluss, dass es sich nicht lohne, an Ihrem Gebäude Renovierungsarbeiten durchzuführen, da es zu alt sei. Im Übrigen kam heraus, dass Sie in Wirklichkeit die Absicht hatten, es abzureißen, um dort ein Bürogebäude zu errichten. Ironischerweise wird Ihnen die Stadt Nanterre beim Abriss und Wiederaufbau des Gebäudes in der Avenue Georges-Clemenceau 6 finanziell unter die Arme greifen. Diese Angelegenheit hat Ihnen also ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen.«
»Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin nur der Chef der Hausverwaltung.«
Jeanne ging nicht auf diese Bemerkung ein. In ihrem Dienstzimmer war es mittlerweile brütend heiß. Die Sonne brannte durch das große Glasfenster, die Wärme breitete sich im Zimmer aus wie Öl in einer Fritteuse. Am liebsten hätte sie Claire gebeten, die Jalousie herunterzulassen, aber die Gluthitze war ein Element der Vernehmung …
»Es hätte damit sein Bewenden haben können«, fuhr sie fort, »aber mehrere Familien haben mit Unterstützung zweier Organisationen, der Médecins du Monde und der VOB, Anzeige gegen Sie und die Eigentümer erstattet. Es geht um fahrlässige Tötung.«
»Wir haben niemanden umgebracht!«
»Doch. Das Gebäude und die Anstriche waren die Tatwaffe.«
»Das haben wir nicht gewollt!«
»Fahrlässige Tötung. Der Ausdruck ist eindeutig.«
Perraya schüttelte den Kopf und brummte dann:
»Was wollen Sie? Weshalb bin ich hier?«
»Ich will wissen, wer die wahren Schuldigen sind. Wer versteckt sich hinter diesen Aktiengesellschaften, denen das Gebäude gehört? Wer hat Ihnen Anweisungen gegeben? Sie sind doch nur ein Bauernopfer, Perraya. Sie sollen den Kopf hinhalten!«
»Ich weiß es nicht. Ich kenne niemanden.«
»Perraya, Sie riskieren mindestens zehn Jahre Gefängnis ohne Bewährung. Wenn ich wollte, könnte ich Sie schon heute in Untersuchungshaft nehmen.«
Perraya hob den Blick. Ein Glitzern unter den dichten grauen Augenbrauen. Jeanne spürte, dass er kurz davor stand, auszupacken. Sie zog eine Schublade auf und nahm einen Kraftpapier-Umschlag DIN A4 heraus. Daraus zog sie einen Schwarz-Weiß-Abzug im selben Format.
»Tarak Alouk, acht Jahre alt, gestorben sechs Stunden nach seiner Einweisung ins Krankenhaus. Er erstickte an seinen Krämpfen. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Bleikonzentration in seinen Organen den als giftig geltenden Schwellenwert um das Zwanzigfache überstieg. Wie werden diese Fotos Ihrer Meinung nach wohl auf das Gericht wirken?«
Perraya wandte den Blick ab.
»Das Einzige, was Ihnen jetzt noch helfen kann, ist es, die Verantwortung zu teilen. Uns zu sagen, wer sich hinter den Aktiengesellschaften verbirgt, von denen Sie die Anweisungen erhalten.«
Der Mann antwortete nicht. Er hielt den Kopf gesenkt, und sein Hals war schweißüberströmt. Jeanne sah, dass seine Schultern zitterten. Sie selbst zitterte in ihrer schweißnassen Baumwollbluse. Der Kampf, der entscheidende Kampf, hatte begonnen.
»Perraya, Sie werden mindestens fünf Jahre im Gefängnis vegetieren. Sie wissen doch, was man mit Kindermördern in den Gefängnissen macht?«
»Aber ich bin kein …«
»Das spielt keine Rolle. Die Gerüchteküche wird sogar dafür sorgen, dass man Sie für einen Pädophilen hält. Wer verbirgt sich hinter diesen Aktiengesellschaften?«
Er rieb sich den Nacken.
»Ich kenne sie nicht.«
»Als es brenzlig wurde, haben Sie doch mit Sicherheit die Entscheidungsträger informiert.«
»Ich hab Mails verschickt.«
»An wen?«
»Ein Büro. Eine Immobiliengesellschaft. Die FIMA.«
»Man hat Ihnen also geantwortet. Stand unter diesen Antwortschreiben keine Unterschrift?«
»Nein. Es handelt sich um einen Vorstand. Sie wollten nichts unternehmen, das ist alles.«
»Haben Sie sie nicht gewarnt? Haben Sie nicht versucht, Klartext mit ihnen zu reden?«
Perraya zog den Kopf zwischen die Schultern, ohne zu antworten. Jeanne griff nach einem Vernehmungsprotokoll.
»Wissen Sie, was das ist?«
»Nein.«
»Die Aussage Ihrer Sekretärin Sylvie Desnoy.«
Perraya wich auf seinem Stuhl zurück. Jeanne fuhr fort:
»Sie erinnert sich daran, dass Sie am 17. Juli 2003 zusammen mit dem Eigentümer das Gebäude in der Avenue Georges-Clemenceau 6 aufgesucht haben.«
»Sie irrt sich.«
»Perraya, für Ihre Fahrten benutzen Sie ein Abonnement bei der Gesellschaft G7. Ein Abonnement für Geschäftskunden. Alle Routen werden digital gespeichert. Soll ich fortfahren?«
Keine Antwort.
»Am 17. Juli 2003 haben Sie ein Taxi bestellt, einen hellgrauen Mercedes mit dem Kennzeichen 345 DSM 75. Die ersten Gutachten hatten Sie zwei Tage zuvor erhalten. Sie wollten sich selbst ein Bild von den Schäden machen. Von dem Gesundheitszustand der Mieter und den notwendigen Sanierungsarbeiten.«
Perraya warf Jeanne gehetzte Blicke zu. Er hatte glasige Augen.
»Nach Auskunft der Firma G7 haben Sie einen Umweg gemacht und in der Avenue Marceau 45 gehalten.«
»Ich erinnere mich nicht mehr.«
»In der Avenue Marceau 45 hat die FIMA ihren Sitz. Es liegt daher nahe, anzunehmen, dass Sie den Chef der Immobiliengesellschaft aufgesucht haben. Der Fahrer hat zwanzig Minuten auf Sie gewartet. Zweifellos brauchten Sie so lange, um dem Mann den Ernst der Lage zu verdeutlichen und ihn dazu zu bringen, Sie zu begleiten. Wen haben Sie an diesem Tag abgeholt? Wen decken Sie, Monsieur Perraya?«
»Ich kann Ihnen keinen Namen nennen. Berufsgeheimnis.«
Jeanne schlug auf den Tisch.
»Quatsch. Sie sind weder Arzt noch Anwalt. Wer ist der Chef der FIMA? Wen haben Sie abgeholt, verdammt noch mal?«
Perraya schwieg. In seinem teuren Anzug sah er wie ein Häufchen Elend aus.
»Dunant«, murmelte er. »Er heißt Michel Dunant. Er ist Mehrheitseigner von mindestens zwei Aktiengesellschaften, denen das Gebäude gehört. Tatsächlich ist er der wahre Eigentümer.«
Jeanne nickte ihrer Mitarbeiterin Claire zu – ein Hinweis, dass der Zeuge jetzt mit seiner Aussage beginnen würde.
»Hat er Sie an diesem Tag begleitet?«
»Ja. Diese Geschichte stank zum Himmel.«
Sie stellte sich die Szene vor. Juli 2003. Sonne. Hitze. Wie heute. Die beiden Geschäftsleute, die in ihren Hugo-Boss-Anzügen schwitzten, weil sie befürchteten, dass eine »Negerbande« ihr Wohlleben, ihren Erfolg, ihre Machenschaften bedrohte.
»Hat Dunant denn keine Entscheidung getroffen? Er musste doch reagieren.«
»Er hat reagiert.«
»Wie das?«
Der Mann zögerte abermals. Jeanne betonte:
»Mir liegt nicht das kleinste Dokument vor, das belegen würde, dass Sie sich damals mit dem Problem beschäftigt haben.«
Erneutes Schweigen. Ungeachtet seiner kräftigen Statur schien Perraya immer mehr in sich zusammenzusinken.
»Wegen Tina«, murmelte er schließlich.
»Wer ist Tina?«
»Die älteste Tochter der Assalihs. Sie ist achtzehn.«
»Ich verstehe nicht.«
Jeanne spürte, dass eine wichtige Enthüllung bevorstand. Sie beugte sich über ihren Schreibtisch und sagte mit weniger strenger Stimme:
»Monsieur Perraya, was war mit Tina Assalih?«
»Dunant ist auf sie abgefahren.« Der Mann wischte sich die Stirn mit dem Ärmel ab und fuhr fort: »Er wollte sie vögeln.«
»Was hat das mit den Sanierungsarbeiten zu tun?«
»Es war eine Erpressung.«
»Eine Erpressung?«
»Tina widersetzte sich. Er wollte … Er hat versprochen, die Arbeiten durchzuführen, wenn sie ihm zu Willen wäre.«
Jeanne spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte. Es gab also ein Motiv. Mit einem Blick überprüfte sie, ob Claire immer noch schrieb. Die Hitze wurde immer unerträglicher.
»Hat sie eingewilligt?«, hörte sie sich mit heller Stimme fragen.
Ein düsterer Schimmer glomm in Perrayas Augen auf.
»Die Arbeiten wurden doch durchgeführt, oder?«
Jeanne antwortete nicht. Ein Motiv. Totschlag.
»Wann hat er Tina kennengelernt?«, fragte sie.
»An diesem Tag. Im Jahr 2003.«
Mehrere Fälle von Bleivergiftung hätten also verhindert oder zumindest früher behandelt werden können. Jeanne wunderte sich nicht über die Niedertracht des Eigentümers. Ihr waren schon ähnliche Fälle untergekommen. Sie wunderte sich eher darüber, dass sich die junge Frau widersetzt hatte. Es ging um die Gesundheit ihrer Brüder, ihrer Schwestern und der anderen Kinder, die in dem Haus wohnten.
»War sich Tina über die Folgen ihrer Weigerung im Klaren?«
»Klar. Aber sie hätte nie eingewilligt. Ich habe es Dunant gesagt.«
»Wieso?«
»Sie ist eine Toubou. Ein sehr stolzer, harter Volksstamm. In ihrer Heimat tragen die Frauen ein Messer in der Achselhöhle. In Kriegszeiten lassen sie sich von ihren Männern scheiden, wenn diese am Rücken verwundet werden. Sie sehen, was für ein Menschenschlag das ist.«
Jeanne senkte den Kopf. Die Notizen, die sie sich immer bei Vernehmungen machte, tanzten ihr vor den Augen. Sie musste weitermachen. Den Knäuel entwirren. Diese Tina Assalih finden und den wahren Mistkerl entlarven: Dunant.
»Geh ich in den Knast?«
Sie sah auf. Perraya wirkte nun völlig gebrochen. Er dachte nur daran, sich selbst, seine Familie und seinen Komfort zu retten. Ekel schnürte ihr die Kehle zu. In solchen Momenten verfiel sie wieder in den Nihilismus ihrer Depression. Nichts war lebenswert …
»Nein«, antwortete sie, ohne nachzudenken. »Ungeachtet schwerwiegender Anhaltspunkte für Ihre Mittäterschaft verzichte ich darauf, ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einzuleiten. Ich berücksichtige Ihr, sagen wir mal, spontanes Geständnis. Unterschreiben Sie Ihre Aussage und verschwinden Sie.«
Die von Claire getippten Seiten kamen bereits aus dem Drucker heraus. Jean-Yves Perraya stand auf und unterschrieb. Jeanne betrachtete die Fotos auf ihrem Schreibtisch. Kinder, die Infusionen bekamen. Ein Kind mit einer Sauerstoffmaske. Ein schwarzer Leichnam, bereit zur Obduktion. Sie steckte die Abzüge in den Umschlag und diesen in die Aktenmappe, die sie rechts neben ihren Schreibtisch legte. Perraya war gegangen. Der Nächste.
Das war der übliche Tagesablauf der beiden Frauen. Sie versuchten ein normales Leben zu führen, an gewöhnliche Herausforderungen zu denken, die Menschheit, sagen wir, in Grau zu sehen. Bis zum nächsten Schock, zum nächsten Horror.
Jeanne sah auf ihre Uhr. Elf. Sie kramte in ihrer Tasche und nahm ihr Handy heraus. Bestimmt hatte Thomas angerufen. Um sich zu entschuldigen, ihr einen anderen Termin vorzuschlagen … Keine Nachricht. Sie brach in Tränen aus.
Claire hielt ihr hastig ein Kleenex hin.
»Sie dürfen sich das nicht zu Herzen nehmen«, sagte sie, den Grund verkennend. »Es gibt viel Schlimmeres.«
Jeanne nickte. Sunt lacrimae rerum. »Es gibt Tränen für unser Unglück«, wie ihr Mentor Emmanuel Aubusson zu sagen pflegte.
»Sie müssen sich beeilen«, sagte ihre Mitarbeiterin. »Sie haben eine Verhandlung.«
»Und danach? Ein Mittagessen?«
»Ja, mit François Taine im Usine. Um eins.«
»Mist.«
Claire drückte ihr die Schulter.
»Das sagen Sie jedes Mal. Und dann kommen Sie um halb vier satt und zufrieden zurück.«
4
»Hast du sie gelesen?«
Jeanne wandte sich zu der Stimme um. Halb eins. Sie war unterwegs zum Ausgang gewesen und träumte von einer kalten Dusche, während sie die Knauserigkeit der Justizbehörden verfluchte – Tag für Tag fiel die Klimaanlage im Gerichtsgebäude aus.
Stéphane Reinhardt ging hinter ihr. Der Mann hatte ihr am Vorabend die obskure Akte angedreht. Leinenhemd, Umhängetasche: Er wirkte stets ebenso zerknittert wie sexy.
»Hast du sie gelesen oder nicht?«
»Ich hab nichts verstanden«, gestand sie und ging weiter.
»Aber dir ist klar, dass das ein heißes Eisen ist?«
»Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen. Und dann, eine anonyme Anzeige … Man muss die Fäden miteinander verknüpfen.«
»Genau das sollst du ja tun.«
»Ich kenn mich weder im Waffenhandel noch bei Flugzeugen aus. Ich wusste nicht einmal, dass Osttimor ein Land ist.«
»Es ist der Ostteil einer indonesischen Insel. Ein souveräner Staat. Einer der brisantesten Konfliktherde weltweit.«
Sie hatten die Sicherheitsschleusen erreicht. Die Halle war sonnendurchflutet, die Sicherheitsleute wirkten völlig verschwitzt. Reinhardt grinste. Mit seiner lässigen Aktentasche glich er einem coolen Lehrer, der jederzeit mit seinen Schülern einen Joint rauchen würde.
»Was eine Cessna ist, weiß ich auch nicht«, sagte sie trotzig.
»Ein ziviles Flugzeug ohne besonderes Kennzeichen, das automatische Waffen transportiert! Waffen, die bei einem Putschversuch eingesetzt wurden!«
Genau das hatte sie am Vortag gelesen, ohne sich jedoch
in den Bericht zu vertiefen. Sie hatte gar nicht erst versucht, sich einen Reim darauf zu machen. Im Moment wartete sie vor allem auf einen Anruf – wie schon den ganzen Tag lang. Alles andere …
»Die Sache mit der angeblichen Waffenlieferung«, meinte sie scheinbar interessiert, »hat mich nicht überzeugt. Wie können wir sicher sein, dass es sich tatsächlich um französische Gewehre handelt? Und wieso sollen sie ausgerechnet von dieser Firma produziert worden sein?«
»Hast du denn den Bericht nicht gelesen? Die Waffen wurden bei erschossenen Aufständischen gefunden. Halbautomatische Gewehre der Marke Scorpio. Mit Standardmunition der NATO vom Kaliber 5.56. Nicht zu vergleichen mit der üblichen Bewaffnung von Rebellen in einem armen Land. Waffen, die ausschließlich von EDS Technical Services hergestellt werden.«
Jeanne zuckte mit den Achseln.
»Hattest du nicht den Eindruck, dass der anonyme Briefschreiber bestens informiert ist?«, fuhr der Richter fort.
»Besser als ich jedenfalls. Ich habe nicht einmal von diesem Putsch gehört.«
Reinhardt zog ein betrübtes Gesicht.
»Niemand hat davon gehört. So ist es mit allem, was Osttimor betrifft. Aber im Internet findet man alles. Im Februar 2008 haben Rebellen einen Mordanschlag auf José Ramos-Horta, den Präsidenten des Landes, verübt. Der Mann wurde 1996 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ein Nobelpreisträger, der durch französische Sturmgewehre schwer verletzt wurde! Mist, ich weiß nicht, worauf du noch wartest. Einmal ganz abgesehen von dem politischen Aspekt dieses Falls. Mit den Gewinnen aus diesem Waffengeschäft wurde eine französische Partei finanziert!«
»Die ich nicht kannte.«
»Eine im Entstehen begriffene Partei – der Rechten! Das ist ein wasserdichter Fall. Du salzt, du pfefferst und du servierst ihn uns schön heiß. Das ist doch genau deine Kragenweite, oder?«
Jeanne war von jeher Sozialistin gewesen. Früher hatte ihr Aubusson wiederholt gesagt: »Wenn man jung ist, steht man politisch links. Mit den Jahren rückt man dann unwillkürlich nach rechts.« Sie war noch nicht alt genug für einen politischen Wechsel. Im Übrigen war auch Aubusson links geblieben.
Reinhardt durchschritt die Sicherheitsschleuse und löste dabei den Alarm aus. Die Wachposten grüßten ihn.
»Isst du mit mir zu Mittag?«
»Nein, tut mir leid. Ich hab schon was vor.«
Der Richter tat, als wäre er enttäuscht, aber Jeanne machte sich nichts vor: Er wollte nur weiter über Osttimor reden.
Sie passierte ihrerseits den Metalldetektor.
»Wenn dich dieser Fall dermaßen reizt, warum versuchst du dann nicht, ihn dir zu angeln?«
»Ich bin mit so vielen Akten im Rückstand, dass ich nicht einmal mehr die Tür zu meinem Büro aufmachen kann!«
»Ich werde dir mein Brecheisen leihen.«
»Du bist also dabei? Du wirst mir noch dankbar sein.«
Er gab ihr einen Kuss, nahe am Mund. Diese Berührung ließ ihr Herz höher schlagen. Sie ging Richtung Tiefgarage, leicht wie Pollen in der Sonne. Sie fühlte sich schön, strahlend und unbesiegbar. Durch den flüchtigen Kontakt mit diesen männlichen Reizen hatte sich ihre Verzweiflung in Luft aufgelöst. Sie fragte sich, ob sie nicht manisch-depressiv wurde.
Oder schlichtweg eine alte Jungfer.
5
»Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist. Ich könnte alles vögeln, was vorbeikommt.« »Entzückend.«
Jeanne versuchte sich ihre Erschütterung nicht anmerken zu lassen. François Taine starrte der fortgehenden Bedienung auf den Hintern. Er wandte den Blick von dem kleinen Po ab und fixierte lächelnd seine Gesprächspartnerin. Dieses Lächeln brachte unmissverständlich zum Ausdruck, dass dieses globale Begehren durchaus Jeanne einschloss. Sie nahm es ihm nicht übel. Ihre Freundschaft hatte vor zehn Jahren auf der Nationalen Hochschule für das Richteramt in Bordeaux begonnen. Taine hatte damals sein Glück bei ihr versucht. Nach seiner Scheidung ein paar Jahre später hatte er es noch einmal probiert. Beide Male hatte Jeanne den Antrag zurückgewiesen.
»Was nimmst du?«, fragte er.
»Mal sehen.«
Wie alle Pariserinnen tat auch Jeanne so, als würde sie seit der Pubertät essen. Sie überflog die Karte, traf ihre Wahl und sah sich dann um. Das Usine war ein angesagtes Restaurant in der Nähe der Place de l'Étoile. Mit gefirnisstem hellem Holz verkleidete Wände, lackierter Betonboden. Ein beruhigender Ort, ungeachtet des üblichen lauten Stimmengewirrs beim Mittagessen. Jeanne gefiel vor allem, dass das Restaurant zwei Gesichter hatte. Mittags verkehrten hier Geschäftsleute mit Krawatte, abends traf sich das Mode- und Kino-Völkchen. Diese Ambivalenz entsprach ihr.
Ihr Blick kehrte zu Taine zurück, der mit hochgezogenen Brauen die Speisekarte studierte, als wäre es eine feurige Anklagerede. Taines Körper war so steif wie eine Teleskopantenne. Strohiges Haar. Markante Gesichtszüge. Das Aussehen eines ewigen Studenten, das eigentlich nicht zu einem erfahrenen Richter passte. François Taine, achtunddreißig Jahre alt, Ermittlungsrichter in Nanterre – sein Büro befand sich neben dem von Jeanne –, gehörte zu jenen, die Jacques Chirac nach dem Ende seiner Amtszeit vorgeladen hatten.
Seit der Trennung von seiner Frau kleidete sich Taine mit aufdringlicher Eleganz – als Gegengewicht zu seinem jugendlichen Aussehen und seiner Steifheit. Maßanzüge von Ermenegildo Zegna. Stretchhemden von Prada. Schuhe von Martin Margiela. Jeanne hegte den Verdacht, dass er seine Klamotten in monatlichen Raten abstotterte. Wie auch seine Spielschulden.
Auch versuchte er seinem streberhaften Aussehen durch eine bewusst vulgäre Sprache entgegenzuwirken. Er hielt das für chic. Die Methode hätte in Paris, dieser Hauptstadt der Ironie, funktionieren können, aber Taine strahlte auch eine gewisse Banalität aus, was unfreiwilligerweise sehr gut zu diesem Vokabular passte. Allen Anstrengungen zum Trotz konnte Taine sein wahres Naturell zumeist nicht verbergen: ein ungehobelter Bursche aus Amiens im Sonntagsstaat. Weder besonders chic noch besonders geistreich.
Jeanne mochte ihn trotzdem. Hinter der aufgesetzten Würde, der zur Schau gestellten Eleganz und der Vulgarität verbarg sich ein schüchterner Mann, der dick auftrug, um sich durchzusetzen. Zwei Dinge verrieten diese Zerbrechlichkeit. Sein schwaches Lächeln, dem stets eine rasche Bewegung des Kinns vorausging – so wie ein Kieselstein über eine Wasserfläche hüpfte. Und sein vorstehender Adamsapfel, dessen Anblick wehtat, aber Jeanne gleichzeitig auch faszinierte.
Nachdem sie bestellt hatten, beugte sich Taine zu ihr.
»Kennst du Audrey, die Referendarin, die bei der Strafkammer arbeitet?«
»Die Dicke?«
»Nenn sie so, wenn du willst«, meinte der Richter gekränkt.
»Habt ihr was miteinander?«
Er nickte mit einem spöttischen Lächeln.
»Ich werde das nie begreifen«, seufzte Jeanne.
Taine legte die Hände aufeinander. Ein geduldiger Richter, der dem Beschuldigten eine letzte Chance gibt, ehe er ihn hinter Schloss und Riegel setzt.
»Jeanne, es gibt da eine Sache, die du kapieren musst. Die Natur des Begehrens bei uns Männern.«
»Ich platze vor Neugier.«
»Die meisten von uns sind hinter schönen, eleganten und schlanken Frauen mit Modelfigur her. Aber das tun wir, um uns in Szene zu setzen. Wenn es darum geht, Spaß zu haben, wenn uns niemand mehr zuschaut, wenden wir uns den runden, üppigen Formen zu. Männer mögen pummelige Frauen. Verstehst du?«
»Jedenfalls weiß ich, zu welcher Gruppe ich gehöre.«
Jeanne, ein Meter dreiundsiebzig groß, wog immer zwischen fünfzig und zweiundfünfzig Kilo.
»Bedauerlich. Du gehörst zu den Frauen, die man heiratet.«
»Ist mir noch gar nicht aufgefallen!«
»Du bist die Frau, die man voller Stolz ausführt. Mit der man ins Restaurant geht. Der man Kinder macht.«
»Der Muttertyp, wie?«
Taine lachte laut auf.
»Wärst du auch gern die Hure? Dafür bist du zu wählerisch.«
Halb geschmeichelt, halb verärgert fragte Jeanne:
»Was wolltest du mir gleich noch erzählen?«
»Am Sonntagnachmittag war die berühmte Audrey bei mir zu Gast. Erinnerst du dich noch, wie heiß es an dem Tag war? Wir hatten die Fensterläden geschlossen. Die Leintücher waren nass zum Auswringen. Die Atmosphäre war wirklich … Du verstehst?«
»Ich verstehe.«
»Um fünf Uhr läutet es. Meine Exfrau, Nathalie, brachte mir die Kinder. Jeden Sonntag esse ich mit den Kindern zu Abend und fahre sie am nächsten Morgen zur Schule. Normalerweise kommt meine Ex um sieben. Durch einen blöden Zufall – weil irgendeine Theatervorstellung ausfiel – tauchte sie zwei Stunden früher auf. Und Audrey in meinem Bett – da habe ich die Nerven verloren.«
»Ihr seid doch geschieden, oder?«
»Das ist alles noch ganz frisch. Nathalie kommt jedes Mal für ein paar Minuten mit rein und sieht sich um, als wolle sie rausfinden, ob es da eine Frau gibt. Sie hätte keine drei Sekunden gebraucht, um zu bemerken, dass jemand in meinem Schlafzimmer war.«
»Was hast du gemacht?«
»Ich bin in eine Unterhose geschlüpft und hab Audrey gesagt, sie soll sich schnell anziehen. Ich wohne ganz oben, im fünften Stock. Es gibt keinen Aufzug. Auf dem Treppenabsatz vor meiner Wohnung befindet sich eine Abstellkammer. Da habe ich sie reingeschoben.«
»Hat's geklappt?«
»Gerade so. Auf der Türschwelle sah ich einen Moment lang gleichzeitig die nackten Füße Audreys, die in dem Kabuff verschwanden, und die Köpfe meiner Kinder, die von unten heraufkamen.«
Taine schwieg kurz, um die Spannung zu steigern. Jeanne spielte mit:
»Und dann?«
»Dann sind die Kinder in ihrem Zimmer verschwunden, während Nathalie die Wohnung betrat und sich neugierig umsah. Sie hat mir zwei, drei Dinge zur Kleidung der Kinder gesagt und sprach mich dann noch auf den Scheck für das Schulessen an. Immer die gleichen Geschichten. Für mich war die Sache geritzt. Bis ich Audreys Sonnenbrille auf einem Bücherregal neben dem Eingang liegen sah.«
»Hat sie sie auch bemerkt?«
»Nein. Als sie auf die Uhr sah, habe ich die Gelegenheit genutzt, um die Brille in meiner Hosentasche verschwinden zu lassen.«
»Wenn sie nichts bemerkt hat, wo ist dann das Problem?«
»Ich habe sie zur Tür begleitet. Als ich sie schon hinter ihr schließen wollte, fragte sie: ›Hast du nicht meine Sonnenbrille gesehen? Ich muss sie irgendwo hingelegt haben.‹«
Jeanne lächelte.
»Klingt spannend! Wie hast du dich aus der Affäre gezogen?«
»Fünf Minuten lang haben wir die Brille gesucht, die ich in der Tasche hatte. Dann habe ich sie diskret herausgezogen und so getan, als hätte ich sie auf einem Regal aufgestöbert.«
Die Vorspeisen wurden aufgetragen. Kürbissalat für Jeanne, Sushi mit rotem Thunfisch für Taine. Sie begannen zu essen. Das Gemurmel der Geschäftsleute um sie herum entsprach ganz ihrer Kleidung: neutral, glatt, anonym.
»Woran arbeitest du gerade?«, fragte Taine.
»Nichts Besonderes. Und du?«
»Ich bin an einer ziemlichen üblen Sache dran.«
»Worum geht's?«
»Ein Mord. Eine Leiche, die vor drei Tagen entdeckt wurde. Eine Horrorgeschichte. In einer Tiefgarage in Garches. Das Opfer wurde zerstückelt. Spuren von Kannibalismus. Die Wände mit blutigen Zeichen bedeckt. Niemand kann sich einen Reim darauf machen.«
Jeanne legte die Gabel ab, stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und faltete die Hände.
»Erzähl!«
»Der Staatsanwalt rief vom Tatort aus an und bat mich, sofort zu kommen. Ich wurde auf der Stelle mit dem Fall betraut.«
»Und was ist mit der kriminalpolizeilichen Vorermittlungsfrist?«
»Paragraph 74 StGB ›Ermittlung der Todesursache‹. Angesichts dieses Gemetzels wollte die Staatsanwaltschaft sofort einen Richter einschalten, der die Ermittlungen koordiniert.«
Jeannes Neugier wuchs. »Beschreib mir die Umstände.«
»Die Leiche wurde im tiefsten Untergeschoss gefunden. Eine Krankenschwester.«
»Wie alt?«
»Zweiundzwanzig.«
»Wo hat sie gearbeitet?«
»In einem Zentrum für Personen mit mentalen Entwicklungsstörungen. Die Tiefgarage gehört zu der Einrichtung.«
»Und was haben die Ermittlungen am Tatort ergeben?«
»Kein Zeuge. Weder im Innern des Gebäudes noch außerhalb.«
»Überwachungskameras?«
»Keine Kamera. Jedenfalls nicht auf dieser Etage.«
»Das Umfeld der Frau?«
»Fehlanzeige.«
»Du hast von einem Zentrum für geistig Behinderte gesprochen. Könnte nicht einer der Patienten der Täter sein?«
»Es ist eine Einrichtung für Kinder.«
»Sonstige Spuren?«
»Nichts. Die Ermittler untersuchen ihren Computer, um herauszufinden, ob sie Internet-Kontaktbörsen frequentiert hat. Aber das alles wird zu nichts führen. Meiner Meinung nach war es ein Serienkiller. Sie lief zufällig einem Psychopathen über den Weg und fiel in sein Beuteschema.«
»Hatte sie besondere körperliche Merkmale?«
Taine zögerte.
»Recht hübsch. Pummelig. Vielleicht entsprach sie einem bestimmten Typ, auf den der Mörder steht. Wie immer in diesen Fällen werden wir schlauer sein, wenn er ein weiteres Mal zuschlägt.«
»Was weißt du noch?«
Jeanne hatte ihren Salat ganz vergessen. Das Stimmengewirr im Lokal. Die kühle Luft aus der Klimaanlage.
»Im Augenblick ist das alles. Ich warte auf die Ergebnisse der Obduktion und die Analysen der Gerichtsmedizin. Mache mir aber keine großen Hoffnungen. Der Tatort lässt einerseits eine bestialische Grausamkeit und andererseits eine sorgfältige Vorbereitung erkennen. Ich bin mir sicher, dass der Kerl Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat. Eigenartig sind die Fußabdrücke.«
»Von Schuhen?«
»Nein, von nackten Füßen. Die Kripo glaubt, dass er sich nackt ausgezogen hat, um sein Ritual durchzuführen.«
»Was für ein ›Ritual‹?«
»Es gibt Zeichen an den Wänden. Sie erinnern an prähistorische Zeichnungen. Und dann diese Sache mit dem Kannibalismus …«
»Bist du dir in diesem Punkt sicher?«
»Die Gliedmaßen wurden abgetrennt und bis auf die Knochen abgenagt. Reste von Organen lagen auf dem Boden herum. Die Leiche weist überall Bissspuren auf, die von menschlichen Zähnen stammen. Echt scheußlich!«
Jeanne ließ ihren Blick geistesabwesend durch den Raum schweifen. Die Beschreibung des Tatorts rief Erinnerungen in ihr wach. Bruchstücke ihrer eigenen Lebensgeschichte, sorgfältig versteckt hinter dem glatten Erscheinungsbild der vorzeigbaren Richterin.
»Und was stellen die Zeichnungen an den Wänden dar?«
»Bizarre Formen, primitive Silhouetten. Der Mörder hat Blut mit Ocker gemischt.«
»Ocker?«
»Ja. Er muss den Farbstoff mitgebracht haben. Wir haben es mit einem echten Psychopathen zu tun. Wenn du willst, zeig ich dir die Fotos.«
»Legt ihr diese Zeichnungen Anthropologen vor?«
»Die Kripo kümmert sich darum.«
»Wer leitet das Ermittlungsteam?«
»Wieso interessiert dich das? Ich …«
»Der Name!«
»Patrick Reischenbach.«
Jeanne kannte ihn. Eine der Größen der Pariser Kripo. Hart. Effizient. Einsilbig. Und zugleich ein Genießer. Sie erinnerte sich an ein Detail: Obwohl er schlecht rasiert war, trug er stets gegeltes Haar. Sie fand das widerlich.
»Wieso haben die Medien nicht darüber berichtet?«
»Weil wir unsere Arbeit machen.«
»Das Ermittlungsgeheimnis«, sagte Jeanne lächelnd. »Etwas, das zusehends höher im Kurs steht …«
»Von mir aus. In so einem Fall brauchen wir vor allem Ruhe. Wir müssen ungestört ermitteln können. Jedes Detail analysieren. Ich habe sogar einen Profiler eingeschaltet.«
»Offiziell?«
»Ja.«
»Wen?«
»Bernard Level. Tatsächlich ist er der Einzige, den wir haben … Wir recherchieren auch in den kriminalpolizeilichen Archiven. Morde, die Ähnlichkeiten mit diesem Fall aufweisen. Aber ich glaube nicht, dass wir fündig werden. So etwas hat es noch nicht gegeben.«
Jeanne überlegte, wie sie in einem solchen Fall vorgehen würde. Sie hätte das Archiv auf den Kopf gestellt, sich in die Zeitungsausschnitte vertieft, die Aufnahmen vom Tatort mit Reißzwecken in ihrem Büro befestigt. Sie senkte den Blick. Unwillkürlich zupfte sie kleine Stückchen von dem Brot ab, das sie in der Hand hielt. Trotz der Klimaanlage war sie klatschnass.
Taine lachte auf. Jeanne zuckte zusammen.
»Was ist?«
»Kennst du Langleber, den Rechtsmediziner?«
»Nein.«
»Ein Super-Intellektueller. Jedes Mal kommt er dir mit einem unglaublichen Spruch.«
Jeanne ließ die Krümel fallen und konzentrierte sich auf die Worte Taines. Sie fürchtete, von einer Panikattacke überwältigt zu werden. Wie damals, als sie an Depressionen litt. Als sie ihr Auto einfach in Tunnels stehen ließ und zu Fuß weiterging. Als sie ihre Mittagspausen heulend auf den Toiletten von Restaurants verbrachte.
»Am Tatort winkt mich Langleber zu sich. Ich erwarte einen Knüller von ihm. So ein Detail, das dich umhaut, wie in einem Fernsehkrimi. Da sagt er mir mit leiser Stimme: ›Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch.‹ Ich sage: ›Wie bitte?‹ Er fährt fort: ›Ein Seil über einem Abgrunde.‹«
»Das stammt von Nietzsche. Also sprach Zarathustra.«
»Das hat er mir auch gesagt. Aber wer außer diesem Blödmann hat schon Nietzsche gelesen?« Lächelnd fuhr er fort: »Und außer dir natürlich!«
Jeanne lächelte ebenfalls. Die Krise war vorüber.
»Du hättest ihm antworten sollen: ›Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist.‹ So geht der Absatz weiter. Aber ich gebe zu, dass Nietzsche für die Ermittlungen nicht viel bringt.«
»Mir gefällt die Geste, die du gerade gemacht hast.«
»Welche Geste?«
»Wenn du dir den Nacken massierst.«
Jeanne errötete. Taine sah sich um, wie um sicherzugehen, dass ihn niemand hören könne. Dann beugte er sich zu ihr vor:
»Wie wär's, wenn wir zusammen zu Abend essen würden?«
»Bei Kerzenschein und Champagner?«
»Warum nicht?«
Die Speisen wurden aufgetragen. Tournedos Rossini für Taine, Thunfisch-Carpaccio für Jeanne. Sie schob ihren Teller zurück.
»Ich glaube, ich werde gleich mit einem Tee weitermachen.«
»Und das Abendessen?«
»Hast du dein Glück nicht schon mal versucht? Mehrmals sogar?«
»Audrey sagt immer: ›Lassen wir die Vergangenheit auf sich beruhen.‹«
Jeanne lachte laut auf. Sie mochte diesen Typen. Er war keiner dieser abgebrühten Aufreißer, die ihre Durchtriebenheit hinter einer heuchlerischen Fassade zu verbergen suchten. Im Gegenteil, hinter seinem Lachen spürte man eine echte Freigiebigkeit. Dieser Mann hatte etwas zu geben. Dieser Gedanke zog einen anderen nach sich.
»Entschuldige.«
Sie kramte in ihrer Tasche nach dem Handy. Keine Nachricht. Verdammter Mist. Sie spürte einen bitteren Geschmack auf der Zunge und schluckte. Die eigentliche Frage lautete: Weshalb erwartete sie noch immer diesen Anruf? Alles war vorbei. Aber sie wollte es nicht wahrhaben.
6
Auf der Rückfahrt musste Jeanne an Taines Fall denken. Sie war neidisch. Neidisch auf diese Ermittlungen. Fasziniert von der Grausamkeit des Mordes. Von der Spannung und der Komplexität dieser Ermittlung. Sie war Ermittlungsrichterin geworden, weil sie Bluttaten aufklären wollte. Insgeheim wünschte sie sich nichts mehr, als Serienkiller zur Strecke zu bringen. Ihren mörderischen Wahn zu entschlüsseln. Die Grausamkeit im Reinzustand zu bekämpfen.
In den fünf Jahren, in denen sie am Landgericht Nanterre tätig war, hatte sie lediglich die schäbigen kleinen Fälle bearbeitet. Drogenhandel. Eheliche Gewalt. Versicherungsbetrug. Und wenn sie mal in einem Mordfall ermittelte, war das Motiv immer Geld, Alkohol oder gewöhnlicher Hass, der in eine Affekttat mündete …
Sie überquerte die Porte Maillot und bog in die Avenue Charles-de-Gaulle, Richtung Pont de Neuilly ein. Es herrschte dichter Verkehr. Sie kam nur langsam voran. Jeanne spürte, wie ihr Gedächtnis zu arbeiten begann. Der Fall von François Taine weckte eine Erinnerung. Die schlimmste von allen. Diejenige, die ihre Berufswahl, ihre Einsamkeit, ihre Faszination für Bluttaten erklärte.
Sie umklammerte das Lenkrad, bereit, sich der Vergangenheit zu stellen. Wenn sie an Marie, ihre ältere Schwester, dachte, fiel ihr immer ein Versteckspiel ein. Eines, das nicht zu Ende gegangen war. Im Wald des Schweigens …
Tatsächlich war nichts dergleichen geschehen, aber in ihrer Erinnerung hatte sie, Jeanne, damit angefangen. Sie zählte, die Hände vor den Augen und die Stirn an einen Baumstamm gelehnt. Und sie sah die Ereignisse noch einmal vor ihrem inneren Auge, während ihre Stimme flüsternd skandierte:
1, 2, 3 …
Eines Abends war die damals siebzehnjährige Marie nicht nach Hause gekommen. Ihre Mutter, die die beiden Mädchen allein großzog, war beunruhigt und hatte Freundinnen ihrer Tochter angerufen. Niemand hatte sie gesehen. Niemand wusste, wo sie war. Jeanne war im monotonen Rhythmus dieser Telefonate eingeschlafen. Um die Angst zu vertreiben, zählte sie mit leiser Stimme. 10, 11, 12 … Sie war acht Jahre alt. Ihre Schwester hatte sich versteckt. Es war ein Spiel, mehr nicht.
Am nächsten Morgen waren Männer gekommen. Sie hatten vom Bahnhof von Courbevoie gesprochen, von einer Tiefgarage. Marie war in dieser Schattenzone gefunden worden. Die Polizisten glaubten, die Leiche sei am frühen Morgen dort abgelegt worden, nachdem das Mädchen an einem anderen Ort ermordet wurde … Jeanne hörte nichts mehr. Weder die Schreie ihrer Mutter noch die Worte der Polizisten. Sie zählte lauter. 20, 21, 22 … Das Spiel ging weiter. Sie musste nur die Augen geschlossen halten. Wenn sie sie öffnete, würde sie ihre Schwester wiedersehen.
Sie hatte sie drei Tage später auf dem Kommissariat wiedergesehen. Ihre Mutter war ohnmächtig geworden. Die Polizisten hatten sich um sie gekümmert. Jeanne hatte heimlich die Akte aufgeschlagen. Die Fotos von der Leiche: der Körper, verdeckt vom Geländer, Arme und Beine verkehrt herum, aufgeschlitzter Bauch mit heraushängenden Eingeweiden, weiße Socken, Ballerinaschuhe für kleine Kinder, Reifen.
Jeanne hatte die Szene nicht vollständig in sich aufgenommen. Die Körnung der Abzüge. Schwarz-weiß. Die blonde Perücke, die das Gesicht ihrer Schwester bedeckte. Aber sie hatte den Bericht gelesen. Dort stand, Marie sei erdrosselt worden – sie wusste nicht, was das bedeutete. Sie sei entkleidet worden. Sie sei aufgeschlitzt worden – noch so ein unbekanntes Wort. Die Arme und die Beine seien ihr abgetrennt worden, dann seien sie verkehrt herum angesetzt worden – die Beine am Schultergelenk und die Arme an der Basis des Rumpfes. Es stand auch da, der Mörder habe eine »makabre Inszenierung« vorgenommen. Aber was sollte das heißen?
31, 32, 33 … All dies war unmöglich. Jeanne würde die Augen öffnen. Sie würde die Rinde des Baumes erblicken. Sich umdrehen und in den Wald des Schweigens eintauchen. Marie wäre da, irgendwo, im Unterholz. Sie musste weiterzählen. Die Zahlen respektieren. Ihr die Zeit lassen, um sich zu verstecken. Desto mehr Spaß würde es machen, sie aufzustöbern …
Dann fand die Beerdigung statt. Jeanne hatte sie wie in Trance erlebt. Die Besuche der Polizisten, die dreinblickten wie geschlagene Hunde, ihr Ledergeruch, ihre hohl klingenden Phrasen. Dann der Absturz ihrer Mutter. Ein Jahr später, in der langsamen, kraftlosen Redeweise, die für unheilbar Suchtkranke typisch ist, hatte sie ihr gestanden, dass sie immer ihre Lieblingstochter gewesen war. Du bist dem Chaos entsprungen, und aus diesem Grund habe ich dich immer lieber gehabt …
Jeanne und Marie hatten nicht denselben Vater. Maries Vater hatte sich aus dem Staub gemacht; nie wurde über ihn geredet. Jeannes Vater hatte sich ebenfalls davongemacht; auch ihn umgab eine undurchdringliche Mauer des Schweigens. Das Einzige, was von ihm zurückblieb, war sein Name: Korowa. Viele Jahre später hatte Jeanne ihre Mutter über ihren Vater ausgefragt. Er sei Pole gewesen, sagte sie. Ein Drogensüchtiger, der sich als Filmemacher ausgab und erzählte, er sei Mitglied der Schule von Łódź gewesen, der auch Roman Polański, Jerzy Skolimowski, Andrzej Zuławski angehörten … Ein echter Frauenheld mit einer großen Klappe. Ende der siebziger Jahre sei der Mann in seine Heimat zurückgekehrt. Sie habe nie wieder von ihm gehört …
Jeanne war die Frucht eines Hippie-Unfalls, wie er in den Seventies häufig vorkam. Zwei Drogenvögel waren sich bei LSD oder einem Heroin-Schuss nähergekommen und hatten miteinander geschlafen. Jeanne war gewissermaßen das Nebenprodukt dieses Trips gewesen. Dennoch war sie laut Aussage der Mutter immer ihr Liebling gewesen. Und das wurde ihr jetzt zum Verhängnis. Denn Marie war tot, weil man sich nicht ausreichend um sie gekümmert habe. Das glaubte zumindest ihre Mutter. Es war also die Schuld ihres »Herzchens«, Jeannes. Ihres Lieblings. Jeanne war behütet und beschützt worden, während ihre Schwester verstümmelt worden war …
43, 44, 45 …
Mehr noch als die Ermordung Maries hatten diese Worte Jeannes Berufswahl bestimmt. Sie fühlte sich schuldig. Sie hatte eine moralische Verpflichtung. Gegenüber Marie. Gegenüber allen weiblichen Opfern von Verbrechen. Vergewaltigten Frauen. Geschlagenen Ehefrauen. Unbekannten Mordopfern. Sie würde Ermittlungsrichterin werden. Sie würde die Mistkerle finden und im Namen des Gesetzes Rache nehmen. 53, 54, 55 …
Mit diesem Plan im Kopf hatte sie das Abitur gemacht. Mit dieser Obsession hatte sie ihren Master in Rechtswissenschaften erworben. Mit diesem festen Vorsatz hatte sie ein Vorbereitungsjahr am Institut d'études judiciaires verbracht, ehe sie die Nationale Hochschule für das Richteramt besucht hatte. Nach ihrem Studium war sie für ein Jahr nach Lateinamerika gegangen, um sich von diesem Druck zu befreien, aber das hatte nicht funktioniert. Sie war nach Frankreich zurückgekehrt. Sie hatte zwei Jahre in Limoges verbracht und drei in Lille, ehe sie in Nanterre gelandet war.
Zurück in der Île-de-France hatte sie die Ermittlungsakte zum Mord an ihrer Schwester ausgegraben – alles war in Courbevoie geschehen, dem Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Nanterre. Sie hatte die Registratur aufgesucht, wo die Archivunterlagen der Staatsanwaltschaft aufbewahrt werden.
Sie hatte die Akte gelesen, wiedergelesen, studiert. Aber der Groschen war nicht gefallen. Naiverweise glaubte sie, ihre kurze Erfahrung als Ermittlungsrichterin würde ihr helfen, die Hintergründe zu verstehen. Ein Indiz zu erkennen. Aber nein. Nicht der leiseste Hinweis. Und der Mörder war nie wieder aufgetaucht.
Der einzige Punkt, der ihr aufgefallen war, war die Bemerkung eines Journalisten des Magazins Actuel. Ein in die Akte hineingeschobener Zeitungsausschnitt vom Oktober 1981. Dem Mann waren Ähnlichkeiten zwischen der Inszenierung des Mörders und den »Puppen« des Künstlers Hans Bellmer aufgefallen. Das gleiche »verkehrte« Ansetzen der Gliedmaßen am Torso. Die gleiche blonde Perücke. Die gleichen weißen Söckchen und schwarzen Schuhe. Der gleiche Reifen …