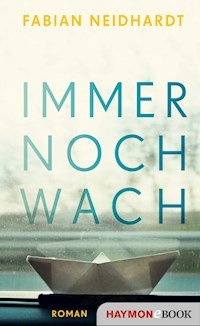
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
WAS WÜRDEST DU TUN, WENN DEINE ZEIT FAST ABGELAUFEN IST - UND DANN STELLT JEMAND DIE UHR ZURÜCK? Noch ein paar Wochen Glück Alex ist gerade 30 geworden, hat mit seinem besten Freund ein Café eröffnet, plant die Zukunft mit seiner Freundin Lisa. Und jetzt muss er sterben. Die Diagnose verändert alles, und Alex trifft eine überraschende Entscheidung: Er will die verbleibende Zeit auskosten, sich dann verabschieden und in ein Hospiz gehen. Er schreibt eine Liste, steht vor der großen Frage, was wirklich wichtig ist, wenn die Lebenszeit abläuft. Mit wem möchte er seine letzten Tage verbringen? Was noch klären? Und was macht ihn eigentlich glücklich? Sein bester Freund Bene und seine Freundin Lisa sind zunächst gar nicht einverstanden mit Alex' Weg, möchten lieber bis zum Schluss beim ihm bleiben. Trotzdem versuchen sie, möglichst viele dieser kleinen Alltagsmomente mit ihm zu erleben, die plötzlich so kostbar sind – bis er sein Leben hinter sich lässt und sich auf den Weg macht an den Ort, an dem er sterben möchte. Das Licht vor dem Ende des Tunnels Im Hospiz bezieht Alex sein letztes Zimmer. Er knüpft Kontakte, lernt Menschen kennen, die den kleinen Rest ihres Lebens hier verbringen, und er knüpft Freundschaften; vor allem zu Kasper, jenem störrischen alten Mann, der so gerne noch einmal die Welt umsegelt hätte. Doch der Tod lässt auf sich warten; und dann überlegt das Schicksal es sich einmal mehr anders und schenkt Alex Lebenszeit. Aber wo anfangen, wenn man bereits abgeschlossen hat? Wenn man nicht einfach zurück kann ins alte Umfeld, weil man für die Menschen dort tot ist? Es ist der sterbenskranke und doch so lebendige Kasper, der Alex schließlich auf eine Idee bringt … Beglückende Momente in dunkeln Stunden Du wirst sie von der ersten Seite an ins Herz schließen, Alex und seine Lieblingsmenschen Bene und Lisa. Und du wirst mit ihnen fühlen bis ins Innerste; die Verzweiflung, die Liebe, die Wut und die Hoffnung. Fabian Neidhardts Debüt stellt dich vor große Fragen und große Trauer. Und es tröstet dich damit, dass es die kleinen Dinge sind, die am Ende wirklich bedeutsam sind. Und vielleicht auch gerade die, die dir selbstverständlich erscheinen: Wie dich deine Freundin weckt, wenn du schlecht träumst. Wie sie mit dir tanzt, auch wenn du bei der Verteilung des Rhythmusgefühls leer ausgegangen bist. Und wie dich dein bester Freund im Arm hält, wenn die Tränen kommen. In leiser, eindringlicher Sprache erzählt Fabian Neidhardt eine Geschichte von Liebe, Freundschaft und der Kraft des Zusammenhalts – tieftraurig, herzerwärmend schön und vor allem immer: Mut machend. **************************************************************************** Einen Augenblick lang fühlst du mit Alex, denkst: Es ist allein meine Entscheidung, wie ich mit dieser Krankheit umgehe. Sekunden später empfindest du wie Lisa, willst Alex schütteln, ihn anschreien: Kämpfe! Versuch es doch wenigstens! Beides tut weh, macht aber zugleich eine unbändige Lust aufs Leben. Linda Müller – Programm/Lektorat *****************************************************************************
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabian Neidhardt
Immer noch wach
Roman
Für die, denen du wichtig bist.
Und jetzt sind es beinah auf den Tag sieben Jahre, dass weggegangen ist, nein, dass hat weggehen lassen – und nun stürzen die Erinnerungen nur so herunter, alle zusammen. Ich weiß, was ich in Ihm und an Ihm beklage: unser ungelebtes Leben.
[…] Wäre die Zeit normal (und ich auch), so hätten wir jetzt ein Kind von, sagen wir, 12 Jahren haben können, und, was mehr ist, die Gemeinsamkeit der Erinnerungen.
Kurt Tucholsky in seinem letzten Brief an Mary Gerold, 19. Dezember 1935
And if you get into a jam – call me. I stay up late.
Lester Bangs in „Almost Famous“
1
Die Geräusche des Regens und der vorbeifahrenden Autos sind längst Grundrauschen. Die Sonne ist schon seit Stunden nicht mehr durch die Wolkendecke gekommen, als die Bremslichter eines Wagens aufleuchten und er ein paar Meter hinter mir am Straßenrand stehen bleibt. Ich betrachte das Auto für einen Moment, die Tropfen zwischen uns reflektieren das rote Licht. Ich bin mir sicher, dass es nicht für mich gehalten hat. Dann aber lasse ich den Daumen sinken, packe meinen Rucksack und den Koffer und laufe los, vollkommen durchnässt und ausgekühlt.
Ein weißer Passat, Kombi, relativ neu. Nach unten hin verläuft die Wagenfarbe ins Graue. Nur die Fingerabdrücke am Kofferraum lassen erkennen, dass es Dreck ist. Der Deckel gleitet auf, ich schmeiße mein Gepäck hinein und gehe zur Beifahrertür. Bei jedem Schritt spüre ich das Wasser in den Schuhen und meine Boxershorts unter der Anzughose, die zwischen den Beinen klebt. Ich öffne die Tür, zwänge mich durch den Spalt und lasse mich in den Sitz sinken. Hemd und Hose drücken sich klamm und kalt an den Körper und ich bin froh, raus aus dem Regen zu sein.
Der Fahrer ist um die 60, das hellgraue Haar kurz, bis auf eine geflochtene Strähne, die er sich hinters Ohr schiebt. Er sieht mich durch die eckigen Gläser seiner Nickelbrille an und hebt eine Augenbraue.
„Vielen Dank! Entschuldigung, ich bin ganz schön nass.“
Er macht eine wegwerfende Handbewegung.
„Den Sitzen ist das egal. Deinem Anzug tut das nicht gut.“
„Ich hatte das anders geplant.“
„Wo willst du denn hin?“
„So weit in den Süden, wie Sie fahren. Ich muss nach Stuttgart.“
Ich wische mir das Wasser aus dem Gesicht und die Hand an der Hose ab. Aber die Hose ist genauso nass und macht die Hand nicht trockener.
„Was sind das? 700 Kilometer? Das ist eine ganz schöne Strecke.“
Mein Blick verliert sich in den Tropfen auf der Windschutzscheibe, die immer nur kurz alleine bleiben, sich dann sammeln und abfließen.
„Ich wollte weit weg.“
„Scheint ja geklappt zu haben.“
Ich nicke langsam.
„Wenn Sie wüssten.“
Ich leere meine Hosentaschen. Die Ränder des Notizbuches sind aufgeweicht und ein Teil der Schrift hat sich in dunkle Schlieren verwandelt. Scheiße. Ich lege es vorsichtig auf meinen Schenkel und krame den Rest heraus, zwei nasse Fünfer und ein paar Münzen. Ich zähle und reiche es ihm.
„So viel habe ich noch, das kann ich Ihnen geben.“
Er betrachtet meine ausgestreckte Hand, dann schüttelt er den Kopf, legt den Gang ein und setzt den Blinker.
„Einmal hat mir eine Frau einen Blowjob angeboten, damit ich sie mitnehme. Anschnallen, bitte.“
Ich sehe ihn irritiert an, er blickt über die Schulter und gibt Gas.
„Aber ich bin mit einer Coke Light und einem Kaffee zufrieden.“
2
Haus Leerwaldt war einmal ein Gehöft. Zwei Gebäude aus rotem Backstein, ein alter Schuppen und ein Stall drängen sich um den Innenhof, in dem das Auto hält. Es liegt vielleicht zwei Kilometer außerhalb der Gemeinde, inmitten von Wiesen und direkt an einem Wäldchen. Die Luft ist kalt und frisch, der Wind fährt mir in den Kragen und bläht die Jacke auf. Auf der Wiese neben der Zufahrt stehen Pferde, ich kann kilometerweit sehen, die Sonne scheint und ich habe einen metallisch-salzigen Geschmack im Mund.
Hier lässt es sich sterben.
3
Ich rede eine Weile mit Doktor Münchenberg, bis er einlenkt und mir ermöglicht, in ein Hospiz zu gehen.
Wir sitzen in seinem Sprechzimmer, zwischen uns die Ergebnisse der Untersuchungen und die Röntgen- und CT-Aufnahmen. Er hört sich meine Beschreibungen der Symptome an, die schlimmer werden. Der Druck unter den Rippen, der mittlerweile ständig spürbar ist. Die Übelkeit, das Übergeben, die Kopfschmerzen und die Müdigkeit, die trotz viel Schlaf nicht nachlässt. Er schiebt die Brille nach oben und fährt sich mit Daumen und Zeigefinger über die Augen.
„Herr Fink. Ich sage Ihnen, lassen Sie sich helfen. Wir haben immer noch viele andere Möglichkeiten. Ich kann das nicht gutheißen, was Sie sich antun.“
„Das ist meine Entscheidung.“
Er verschränkt die Arme vor der Brust.
„Wollen Sie nicht wenigstens in Ihrem gewohnten Umfeld … viele Patienten empfinden es als heilsam, von Familie und Freunden umgeben zu sein.“
„Sie wollen mir helfen? Dann helfen Sie mir dabei.“
„Ich sage Ihnen ausdrücklich, dass Sie gegen meinen ärztlichen Rat handeln.“ Widerwillig wendet er sich dem Computer zu. „Ich gebe Ihnen eine vorläufige Bescheinigung, damit Sie mit einem Hospiz in Kontakt treten können. Falls Sie einen Platz bekommen, kommen Sie nochmal zu mir, dann kriegen Sie die richtigen Papiere.“
~
Frau Renninger leitet Haus Leerwaldt und ist am Telefon genauso skeptisch wie mein Arzt. Aber ich habe sie, die ärztliche Bescheinigung zur Feststellung der Notwendigkeit vollstationärer Hospizversorgung nach § 39a Abs. 1 Sozialgesetzbuch, fünftes Buch. Mein Ticket fürs Hospiz. Schließlich setzt Frau Renninger mich auf die Liste. Für meine letzten zwei Monate darf ich hier sein. Wenn ich überhaupt so lange lebe.
~
Der Wagen wendet und verlässt die Zufahrt. Es ist früher Abend und ich habe den ganzen Tag gesessen. Ich strecke mich in den Wind und bemerke kaum, wie Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand instinktiv die Stelle unter den Rippen suchen und ich einatme.
Es war lange Zeit nicht klar, ob zum richtigen Zeitpunkt überhaupt ein Zimmer frei ist. Viele Menschen sterben, die Warteliste ist lang. Jetzt stehe ich hier und sehe niemanden. Aus ein paar Fenstern scheint Licht, hinter einigen Gardinen flimmert das Fernsehblau. Aber niemand ist auf dem Hof, niemand steht auf den kleinen Balkonen oder sieht aus dem Fenster.
Etwas streicht an meinen Beinen entlang und ich zucke zurück. Die Katze wirft mir einen lauernden Blick zu und läuft um die Ecke des Hauses. An der Wand hängt ein Schild, in pastellfarbenem Braun und Türkis, eine Silhouette der Gebäude, die mich umgeben, darunter der Name.
Haus Leerwaldt. Den letzten Tagen Leben geben.
Zwischen meinen Schulterblättern kribbelt es. Ich räuspere mich, nehme den Rucksack und ziehe den Koffer über den Schotter zur Eingangstür.
~
Der Mann hinter der Theke ist Anfang 20 und sieht mich so freundlich und vertraut an, dass ich mir sicher bin, dass er mich mit jemandem verwechselt. Er steht auf und ich lege meine Hände auf die Holzfläche des Tresens. Später werde ich wissen, dass Martin zu jedem so freundlich ist.
„Herzlich willkommen in Haus Leerwaldt. Was kann ich für Sie tun?“
„Alexander Fink. Ich möchte … einchecken? Sagt man das so?“
Er lächelt und beugt sich zu der Tastatur.
„Die meisten sagen gar nichts. Aber die meisten kommen hier auch nicht alleine reingelaufen. Hallo Herr Fink, ich bin Martin. Nehmen Sie gerne Platz, ich sage Frau Renninger Bescheid, dass Sie da sind.“
Indirektes, warmes Licht beleuchtet den Raum, ein heller, türkisfarbener Streifen verläuft in einem Meter Höhe über die Wände. Die Lehnen des Sofas und der Sessel sind aus dunklem Holz, daneben steht eine Pflanze, die aussieht wie eine Palme.
Auf dem kleinen Tisch vor einem Sofa steht eine Schale mit Süßigkeiten, daneben liegen ein paar Zeitschriften. Der Spiegel, die Glamour, die AutoMotorSport, die Landlust.
Die Tür neben dem Empfang öffnet sich und Martin tritt mit Frau Renninger heraus. Sie ist älter als auf dem Foto im Internet, die Haare sind kürzer und grauer und das Gesicht hat eine rundere Form, die Brille ist neu. Sie ist nur ein wenig kleiner als ich und hat einen überraschend kräftigen Händedruck.
„Haben Sie gut hergefunden? Kommen Sie. Brauchen Sie Hilfe mit dem Gepäck? Ich gehe davon aus, dass Sie müde sind. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer und lasse Ihnen das Abendessen bringen. Sie können in Ruhe ankommen und wir unterhalten uns morgen. Dann zeige ich Ihnen auch den Rest unseres Hauses.“
Der Gang ist mit dem gleichen warmen Licht beleuchtet, der Holzboden schimmert und knapp über dem türkisfarbenen Streifen verläuft ein Handlauf an den Wänden. Rechts sind die Fenster zum Hof, auf der linken Seite des Flurs gehen Zimmer ab, jedes mit eigener Klingel samt Messingschild, eingravierter Nummer und einem Feld, auf das eine geübte Hand Namen gemalt hat. Über jeder Tür ist eine unauffällige, zweifarbige Ampel angebracht. Manche Türen sind nur angelehnt und eine so weit geöffnet, dass ich den laufenden Fernseher und ein kleines Nachtlicht in Mondform sehen kann.
Wir kommen an einer Nische vorbei, in der weitere Sessel stehen und von der eine Glastür nach draußen führt. Der Gang steigt sanft an und ich verstehe, dass wir von einem Haus ins nächste gehen. Kurz darauf bleibt Frau Renninger an einem Aufzug stehen.
„Wir befinden uns nun im Matthiasflügel. Ihr Zimmer liegt im zweiten Stock. Wir haben zwar seit vorgestern noch ein Zimmer im Erdgeschoss frei, aber Sie gehören zu den agileren Gästen. Da können Sie noch ein paar Stockwerke überwinden. Sobald sich das ändert, bekommen Sie einen Rollstuhl.“
„Okay.“
Die Fahrstuhltüren öffnen sich und ich folge Frau Renninger durch einen weiteren Flur.
„Wie gesagt, morgen werden Sie durch das Haus geführt, und dann finden Sie sich auch bald zurecht.“
„Okay.“
Vor einer Tür steht eine kleine rote Kerze auf dem Boden, deren Flamme sich sanft bewegt. Wir gehen daran vorbei und ich drehe mich nach ihr um.
„Die Kerze?“
„Der Gast ist heute Nacht verstorben. Im Gemeinschaftsraum brennt eine weitere. So weiß jeder Bescheid.“
„Okay.“
Wir biegen um eine Ecke und bleiben vor einer offenen Tür stehen, Zimmer 208. Frau Renninger zeigt in den offenen Raum.
„Bitte sehr. Ihr Zimmer.“
Durch die beiden Fenster sehe ich die ersten Bäume des Waldes, eine Glastür führt auf einen kleinen Balkon. Das Bett steht unter der Dachschräge, gegenüber ein Tisch und zwei Stühle, darüber ein Fernseher an der Wand. Direkt neben der Zimmertür eine Schiebetür aus Milchglas, die ins Bad führt. Auf der anderen Seite ein in die Wand eingelassener Schrank.
„Falls Sie Fragen haben, neben dem Bett steht das Telefon. Im Notfall können Sie auch den Knopf drücken.“
„Okay.“
„Kommen Sie gut an. Haben Sie eine gute Nacht.“
Sie streckt mir ihre Hand hin und geht. Ich ziehe den Koffer in das Zimmer. Mein Zimmer. Mein letztes Zimmer.
4
Ich habe keine Erinnerung an ein Leben ohne Bene. Wir kennen uns, seit wir mit zwei Jahren das erste Mal zusammen in einem Sandkasten gespielt haben. Wir haben uns gegenseitig Schaufel und Formen ausgeliehen, ich habe einen Sandkuchen gebacken und Bene ein Eis gemacht, die Waffel aus Plastik, der Rest aus Sand. Bene hat alles probiert. Danach haben unsere Mütter die Spielsachen nach den aufgemalten Nachnamen geordnet und sich lächelnd verabschiedet. Bene und ich jedoch haben uns seither nicht mehr aus den Augen gelassen. Er ist ein Teil meines Lebens. Linke Hälfte meiner Seele.
Wir waren zusammen im Kindergarten und in der Schule, ich habe bei ihm übernachtet, als mein Vater gestorben ist, und wir haben uns gemeinsam fürs Studium beworben. Wir haben zusammengewohnt, er stand bei der Beerdigung meiner Mutter neben mir, durch ihn habe ich Lisa kennengelernt und wir haben uns gemeinsam über unsere Jobs aufgeregt. Über monotone Arbeitszeiten, über nervige Chefs und über dieses beschissene Gefühl, Lebenszeit für etwas zu verschwenden, das einem überhaupt nicht am Herzen liegt.
5
Die wenigen Erinnerungen, die ich an meinen Vater habe, als er noch gesund war, ähneln sich alle. Er sitzt am Tisch in der Küche und isst, was meine Mutter gekocht hat. Ich sitze neben ihm, meine Mutter mir gegenüber. Ich bin als Erster fertig, ich schlinge, denn dann kann ich meinem Vater erzählen, was ich an diesem Tag gemacht habe.
Er isst bedächtig und betrachtet dabei die Tischplatte zwischen uns. Manchmal fallen ihm die Augen für einen Moment zu, manchmal sinkt sein Kopf ein wenig in Richtung Brust, dann zuckt er, sieht mich an und lächelt sein halbes Lächeln, zu müde für ein ganzes.
Ich mache immer wieder Pausen in meinen Berichten und warte auf sein Nicken. Manchmal isst er stoisch weiter, den Blick immer auf das gleiche Stück Tischplatte gerichtet. Dann rutsche ich auf meinem Stuhl ein wenig nach vorne und lege meinen Kopf so auf den Tisch, dass er mich ansehen muss. Er grinst dann und fährt mir durch die Haare. Obwohl er sich die Hände jeden Abend schrubbt, bevor er sich an den Tisch setzt, sind die Ränder seiner Fingernägel immer ein wenig verfärbt. Weil das Motoröl sich nach all den Jahren in der Haut festgefressen hat. Die Furchen und Rillen in seinen Händen sind tief, und wenn meine Mutter erfolglos versucht, ein Glas von Omas Marmelade zu öffnen, dann nimmt mein Vater das Glas in eine Hand, verdeckt mit der anderen den gesamten Deckel und bewegt ihn nur ein kleines Stück. Danach kann selbst ich den Deckel abschrauben.
Manchmal müssen wir mit dem Essen auf ihn warten. Meistens essen wir dann trotzdem allein, aber wir fangen nicht sofort an. Wenn mein Vater so spät kommt, dann flucht er über alles. Ich denke, wenn er so viel länger arbeiten muss, dann müsste er doch eigentlich noch müder sein. Stattdessen erzählt er, von seinem Chef und den Kunden und den Ersatzteillieferanten und wie scheiße einfach alles ist. Ich sehe ihn mit großen Augen an und nach einem Schwall von Schimpfwörtern, die meine Mutter nicht mal mehr kommentiert, schaut er zu mir.
„Alex, du darfst später arbeiten, was du willst. Aber geh auf die Uni. Lern was Richtiges. Mach es nicht so wie ich.“
~
Das ist der einzige Ratschlag, von dem ich sicher weiß, dass ich ihn von meinem Vater bekommen habe. Bis ich studieren kann, ist er schon lange tot. Aber natürlich studieren Bene und ich. Die Leute sagen, mit BWL stünde uns die Welt offen. Die Welt, das sind in diesem Fall Büros, in denen wir unsere jahrelang erlernten Fähigkeiten nutzen, um Zahlen aus der einen Tabelle in eine andere zu übertragen. Aber wir wohnen in unserer eigenen Wohnung und ich habe mein eigenes Zimmer.
6
Eine fremde Umgebung, ein fremdes Bett, die Geräusche der Nacht sind vollkommen andere und wahrscheinlich habe ich mich doch noch bei Lisa angesteckt. Trotz der Decke wird mir immer kälter, bis ich irgendwann stöhnend mit den Zähnen klappere und mein ganzer Körper zittert.
Ich zerre einen Pullover aus meinem Koffer und wickele mich in ein großes Handtuch, ziehe zwei Paar Socken übereinander und drehe die Heizung auf, dann krieche ich wieder unter die Decke.
Mehr Wahn als Traum, ausgefranste Bilder von Lisa und mir, von Bene, Sandra, Lea, meinem Vater, der darum weint, dass jetzt ich den Krebs bekommen habe und wie gern er ihn wieder zurücknehmen will, und der schwarze Klumpen unter den Rippen, der immer härter und größer wird, sodass sich die Haut dunkel verfärbt und ausbeult, die Rippen brechen und durch die Haut stechen, sie sehen aus wie die Grabsteine meiner Eltern.
Irgendwann wache ich verschwitzt auf, alles klebt, alles ist eng. Ich ziehe mir den Pullover über den Kopf und befreie mich aus dem Handtuch, in dem sich mein Körper verheddert hat. Und erst, als es wieder hell wird, realisiere ich, dass ich mein Lieblingskissen zwar dabei, aber noch nicht ausgepackt habe. So konnte es keine gute Nacht werden.
Helen ist eine der Schwestern, sie hat mir am Abend zuvor das Essen gebracht und sich vorgestellt. Jetzt klopft sie wieder. Ich bin wach, aber meine Glieder schmerzen, mein Kopf pocht dumpf, ein konstanter Druck hinter den Augen, und mir ist so schlecht, dass ich mich kaum aufsetzen kann. Seit ihrem letzten Besuch scheint eine höllische Ewigkeit vergangen zu sein. Ich stöhne auf und lasse mich wieder zurückfallen.
„Wie war die erste … Oh, wohl nicht so gut. Bleiben Sie ruhig liegen.“
Sie stellt das Tablett auf den Tisch und kommt zum Bett, greift an eine versteckte Leiste am Kopfende und ich spüre, wie mein Oberkörper sich hebt. Als ich aufrecht sitze, stellt sie das Tablett auf den ausgeklappten Beistelltisch, den sie mir über die Beine schiebt.
„Sie sehen nicht gut aus. Aber Frau Renninger müsste sowieso nach dem Essen kommen. Dann schauen wir mal, ob das nur die erste Nacht in einer neuen Umgebung war.“
„Ich befürchte nicht. Meine Freundin war krank, als ich gefahren bin, und ich glaube, ich habe mich angesteckt.“
„Frau Renninger wird sich das ansehen. Guten Appetit.“
Sie nimmt das Geschirr vom Abendessen, schließt die Tür hinter sich und ich muss niesen.
~
Es klopft, ich schrecke aus meinem Dämmern und Frau Renninger steht im Zimmer, in ihren Händen verteilt sie das Desinfektionsmittel.
„Wie fühlen Sie sich?“
Ich wische mir die Spucke aus dem Mundwinkel und verziehe das Gesicht, als ich den Kopf hebe. Meine Nackenmuskeln schmerzen, mein Kopf ist heiß und mein Magen flau. Mein Körper führt einen Krieg gegen sich selbst.
„Nicht gut.“
Sie betrachtet mich, sieht zum kaum angerührten Frühstück und nickt nach einem kurzen Moment.
„Ich schicke gleich jemanden vorbei. Und ich schlage vor, wir verschieben den Rundgang, bis Sie wieder fit sind. Alles andere genauso. Kommen Sie erstmal an und erholen Sie sich. Einzig die Bescheinigung bräuchte ich. Nein, bleiben Sie liegen, sagen Sie mir einfach, wo sie ist.“
Sie findet die Mappe, stellt das Tablett auf den Tisch und zeigt mir, wie das Bett funktioniert. Ich drehe mich auf die Seite, höre, wie die Tür zugeht, und schließe erschöpft meine Augen.
~
Als ob mein Körper nur darauf gewartet hat, hier anzukommen, holt er nach, was ich die letzten Wochen wohl unterdrückt habe. Fieber, Husten, Schnupfen und schmerzende Glieder, Kopfschmerzen sowieso, und immer wieder übergebe ich mich in die Tüten, die Martin mir gebracht hat. Weißes, undurchsichtiges Plastik mit einem festen Ring an der Öffnung, sodass man sie direkt verwenden kann. Und immer, wenn ich die Augen schließe, das Bild von Lisa und Bene und den andern am Bahnhof, das nicht schwächer wird. Ich dachte eigentlich, das Schlafshirt von Lisa würde mich beruhigen. Es macht genau das Gegenteil. Seit ein paar Tagen liegt es ganz hinten im Schrank.
Martin und Helen und die anderen Mitarbeiterinnen kommen mehrmals am Tag, bringen die Mahlzeiten und unterhalten sich mit mir. Aber ich will nicht sprechen. Ich bin erschöpft, ich schmerze, ich will, dass alles vorbei ist. Bin ich nicht deshalb hier?
Ich schleppe mich ins Bad und sitze mit hängendem Kopf auf der Schüssel oder verbringe in die Decke eingepackt ein paar Minuten auf dem Balkon. Das Zimmer stinkt nach Erbrochenem, der Geruch setzt sich fest.
Ich hab es schon immer gehasst, mich übergeben zu müssen. Ich hasse es, wenn sich der Magen und all die Muskeln um ihn herum zusammenziehen, wie etwas meine Speiseröhre in falscher Richtung durchquert und mein Rachen und mein Mund sich anspannen. Hasse den Geschmack, den ich auch durch mehrmaliges Ausspülen nicht aus dem Mund bekomme. Hasse das Brennen in der Speiseröhre und die eklige Erschöpfung, wenn die Muskeln sich beruhigen. Allein der Gedanke daran verpasst mir eine Gänsehaut. Und der Geruch erst. Jeder Atemzug ein Aufglimmen der Erinnerung, die ich nie verdrängen konnte.
7
Als mein Vater zum ersten Mal mehrere Wochen im Krankenhaus liegt, bin ich fast immer bei ihm. Ich gehe nicht mehr in die Schule, weil was bringt die Schule, wenn der Vater nicht mehr da ist? Nur wenn eine Schwester ihm hilft, aufs Klo zu gehen, ohne das Bett zu verlassen, schleiche ich beschämt aus dem Raum.
Immer wieder darf ich sogar bei ihm übernachten. Manchmal auf dem Stuhl, meist neben ihm im Bett, mein Gesicht an seiner Brust, sein Arm um meinen Körper. Das Bett ist viel zu schmal und ich passe auf, dass ich nicht herausfalle, immer höchstens im Halbschlaf. Die Nächte sind voller blinkender Lichter und dem sterilen Geruch von Desinfektionsmittel, oft sind Schritte auf dem Gang zu hören. Im Zimmer stehen weitere fünf Betten. Jemand hustet, jemand stöhnt auf oder kratzt sich schmerzhaft lange. Und für eine Nacht ist dieser eine Mann da.
Hager, das Haar bis auf wenige Millimeter geschoren, die Wangen extrem eingefallen und voller roter Flecken. Keine rosige, lebendige Farbe, mehr der Anblick von offenen Wunden, an denen helle Hautschuppen hängen. Auf seinem Schoß liegt eine Nierenschale aus Edelstahl, die er mit beiden Händen umfasst. Ich sitze auf dem Stuhl und beobachte, wie er auf den Platz zwischen meinem Vater und dem Fenster geschoben wird. Er sieht erschöpft aus, er atmet tief und kontrolliert und starrt in die silberne Schale. Dann hebt er den Kopf und sieht zu mir. Mein Vater schläft oder döst mit geschlossenen Augen. Seine Hand umschließt meine, immer noch rau, aber mittlerweile ist kein Dreck mehr in den Rillen, so lange ist er schon im Krankenhaus.
Der Mann lächelt mich an und legt einen Finger an die Lippen. Ich sehe, dass auch seine Hände die Flecken haben. Als löse sich die Haut von ihm. Ich senke erschrocken den Blick und starre auf die Bettdecke. Aus den Augenwinkeln beobachte ich, wie er noch einen Moment länger zu mir schaut und dann den Kopf in die andere Richtung dreht. Ich hebe meinen und betrachte ihn, wie er aus dem Fenster sieht. Er ist vielleicht so alt wie mein Vater, aber er hat diese Flecken überall, die Haut ist rissig und faltig. Er wirkt älter. Plötzlich zuckt er zusammen und ich kann sehen, wie eine Welle von unten nach oben durch seinen Körper bebt. Er hebt die Schale, würgt, reißt den Mund auf und verzerrt das Gesicht, dann platscht der erste Schwall aufs Metall. Mein Vater bewegt sich unruhig und der beißende Gestank von Erbrochenem erfüllt das Zimmer. Ich spüre, wie sich auch in mir alles zusammenzieht. Aber ich kann nicht wegsehen.
~
In der Nacht übergibt er sich immer wieder. Er isst nichts, und bald füllt er die Schalen nur noch mit Galle und Spucke. Ich verbringe die Nacht neben meinem Vater, ich habe ihm das versprochen, bevor der Mann reinkam. Liege an seiner Seite, sein Körper zwischen mir und dem Mann, aber wenn ich die Geräusche höre, die den nächsten Schub ankündigen, hebe ich vorsichtig den Kopf, so weit, dass wenigstens ein Auge ihn sieht, und beobachte, wie er mit seinem Körper kämpft, wie er sich immer wieder verkrampft, den Mund offen und voller Spuckefäden, die Muskeln am Hals angespannt, wie er immer erschöpfter zurücksinkt und tief durchatmet. Die Hände zittern, wenn er eine Schale auf dem Beistelltisch abstellt und sich eine neue nimmt. Manchmal schwappt schaumige Galle auf den Tisch. Alle paar Stunden kommt eine Schwester, nimmt die benutzten Schalen mit, putzt und lüftet.
Der Mann wird nach dieser einen Nacht wieder aus dem Zimmer geschoben, aber ich habe den Geruch noch Wochen später in der Nase.
Bald darauf geht es meinem Vater schlechter und er beginnt selbst, sich zu übergeben.
8
Die ersten beiden Wochen bleibe ich in meinem Zimmer. Martin und Helen duze ich mittlerweile, was selten ist, weil die Menschen, die hier arbeiten, sich durch das Sie eine gesunde Distanz bewahren. Intimität und Nähe gibt es hier genug. Es gibt noch fünf oder sechs andere, hauptsächlich Frauen, die regelmäßig vorbeisehen. Freundliche, meist gemütliche Menschen, die mir das Gefühl geben, willkommen zu sein. Deren Freundlichkeit und Anteilnahme echt scheint. Sie haben ein sanftes Klopfen und stecken immer erst den Kopf rein, entscheiden jedes Mal neu, ob sie im Rahmen stehenbleiben oder bis ans Bett treten. Sie wissen die Dinge, die ich ihnen erzähle, auch beim nächsten Mal noch. Ihre Namen habe ich sofort vergessen. Und zu fragen traue ich mich nicht.
~
Irgendwann ist der Infekt vorbei. Ich bin zwar immer noch schwach, habe ein paar Kilo verloren und der Druck unter den Rippen ist mittlerweile permanent spürbar, genauso wie das Stechen hinter den Augen, aber ansonsten bin ich einigermaßen fit. Trotzdem will ich nicht raus.
Mein Essen wird mir gebracht, der Fernseher lenkt mich ab, und für frische Luft stelle ich mich kurz auf den Balkon. Mehr brauche ich nicht.
Mein Zimmer ist fünf durchschnittliche Schritte breit und sieben Schritte lang. Die Decke ist abgehängt, sie klingt hohl, wenn ich auf dem Bett stehe und dagegen klopfe. In der Ecke hinter dem Bett ist ein dichtes Spinnennetz, von dem ich niemandem erzähle. Manchmal sehe ich der Spinne zu, wie sie gefangene Fliegen umgarnt. Ich nenne sie Lukas.
Alle paar Tage kommt Frau Renninger vorbei. Wie es mir gehe, ob ich etwas brauche, ob sie mir den Rest des Hauses zeigen solle. Gut, danke. Alles in Ordnung. Mein Zimmer reicht mir. Dann nickt sie.
„Sagen Sie einfach Bescheid. Es lohnt sich, glauben Sie mir.“
~
Manchmal sehe ich Helen oder Martin oder einer der anderen Mitarbeiterinnen von meinem Balkon aus zu, wie sie einen Rollstuhl nach draußen schieben oder neben jemandem gehen, der sich mit einem Rollator oder einem Stock vorwärtsquält. Manche sitzen auf den Bänken und lesen, immer wieder raucht jemand, die Fitteren machen einen Spaziergang in den Wald. Durch den gepflasterten Weg ist das auch für die Gäste im Rollstuhl möglich. Trotz September sind die meisten Leute schon warm eingepackt und unter den Mützen ahne ich oft haarlose Köpfe.
Manchmal schreit jemand in der Nacht, dann eilen Schritte über den Flur. Und natürlich weint immer wieder jemand. Es ist schön hier, wir sind alle Gäste und Liebe und Frieden und so. Aber fast jeder Mensch, den ich hier treffen könnte, wird demnächst sterben.
Mein eigener Tod ist mir erstmal genug.
9
Wir sind sowieso jeden Tag im Café, aber nach der Eröffnung sind wir fast rund um die Uhr dort. Wir arbeiten mehr als jemals zuvor und ich merke, wie ich an meine Grenzen komme. Ich bin immer erschöpft und müde, habe regelmäßig Kopfschmerzen und manchmal ist mir so übel, dass ich denke, mich übergeben zu müssen. Und trotzdem bin ich glücklich.
Jeden Tag gibt es diesen einen Moment, in dem ich irgendwo lehne und die Leute beobachte. Unsere Gäste. Und das wiegt alles auf. Ich tue, was ich immer tun wollte. Warum soll ich mich beschweren?
~
Es ist Dienstagnachmittag, ich stehe im Verkaufsbereich hinter der Theke und lasse die Rechnung für Tisch sieben raus, einer der runden Tische vor den Fenstern. Lisa kommt demnächst, um mich abzuholen, Bene zieht sich für seine Schicht um. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, höre ein Fiepen im linken Ohr und spüre mal wieder dieses Ziehen im Magen, das seit Wochen nicht weggeht. Oft bemerke ich es nicht, aber in ruhigeren Momenten meldet es sich. Ein Druck, ein Völlegefühl, obwohl ich nichts gegessen habe.
Ich freue mich auf Lisa, freue mich auf unsere Couch. Der Drucker summt und der Streifen Papier kommt heraus. Ich will ihn abreißen, greife daneben und spüre, wie meine Beine nachgeben. Meine Sicht verschwimmt.
~
Dann ein pochender Schmerz am Hinterkopf und das bedrängende Gefühl, von mehreren Menschen umgeben zu sein. Ich verziehe das Gesicht, sauge die Luft zwischen den Zähnen ein, und noch bevor ich die Augen öffne, greife ich mir an den Hinterkopf. Eine große Beule, aber meine Finger bleiben trocken, kein Blut. Dann höre ich meinen Namen, wie im Nachhall, als ob jemand schon länger zu mir spricht, aber meine Ohren erst jetzt wieder zu hören beginnen.
Ich liege hinter der Theke, die Beine verwinkelt und gegen die Schränke gepresst. Vor mir knien die beiden Gäste von Tisch sieben und hinter ihnen steht Lisa. Sie muss gekommen sein, ohne dass ich sie bemerkt habe. Oder ich bin länger ohnmächtig gewesen. Benes Gesicht vor meinem, kopfüber, er hält mich davon ab, mich aufzusetzen.
„Bleib liegen! Mach ganz langsam. Kannst du deinen Kopf bewegen?“
Langsam neige ich den Kopf.
„Ich habe ’ne fette Beule am Hinterkopf, ansonsten scheint alles zu funktionieren.“
„Na, dann komm.“
Bene packt mich unter den Armen, richtet meinen Oberkörper auf und lehnt mich an den Schrank. Lisa hält mir ein Glas Wasser hin.
„Alles okay? Was ist passiert?“
Ich trinke vorsichtig in kleinen Schlucken und sehe sie dabei an.
„Ich habe keine Ahnung. Ich wollte die Rechnung holen und plötzlich bin ich zusammengesackt. Knie weich, nichts mehr gesehen und dann auf dem Boden aufgewacht.“
Ich sehe zu den Gästen und versuche ein Lächeln.
„Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit, ich wollte Sie nicht warten lassen. Ihre Rechnung geht aufs Haus. Danke, dass Sie da waren.“
„Schwachsinn.“
Bene steigt über meine Beine, reißt den Zettel vom Drucker und reicht ihn weiter.
„Hören Sie nicht auf ihn, er hat sich den Kopf gestoßen. 17,50, bitte.“
Lisa nimmt mir das Glas ab.
„Kannst du aufstehen? Ich helfe dir.“
Ich halte mich an der Theke fest und ziehe mich nach oben. Lisa lässt mich los, aber ihr Körper bleibt angespannt, bereit, mich aufzufangen. Für einen Moment stütze ich mich, dann lasse ich den Kopf kreisen und betaste meinen Hinterkopf. Mir geht’s gut, bis auf die Beule. Und das ungute Gefühl im Magen. Und dann zieht er sich zusammen. Ich spüre, wie ich versteife, wie die Erinnerung daran mich erstarren lässt. Abrupt drehe ich mich um, dränge mich an Lisa vorbei und renne aufs Klo.
10
„Schließen Sie das rechte Auge und halten Sie den Kopf still, folgen Sie dem Stift nur mit dem linken Auge.“
Ich sitze auf der Liege des Arztes und verfolge den Kugelschreiber, den er senkrecht nach oben hält und auf einer horizontalen Linie nach links und rechts bewegt. Ich habe ihm erzählt, was passiert ist und dass es das erste Mal war, er tastet meinen Hinterkopf ab und lässt mich auf einer Linie durchs Zimmer laufen. Ich muss die Augen schließen, mit dem Finger meine Nase berühren und eine Weile auf einem Bein stehen.
~
Das letzte Mal habe ich all diese Sachen machen müssen, als wir auf unserer Deutschlandtour waren. Wir haben ein Festival besucht und das Gelände gerade hinter uns gelassen, als wir auf die Polizeikontrolle stoßen. Sie stehen so in der Auffahrt zur Autobahn, dass ich sie vorher nicht sehen konnte und an ihnen vorbeimuss. Der Polizist sieht uns und winkt mich mit der Kelle an den Straßenrand. Am Fenster beugt er sich nach unten, sieht zu Lisa und dann zu Bene, der sich auf dem Rücksitz zwar aufgesetzt hat, aber definitiv nicht nüchtern aussieht.
„Guten Tag. Kommen Sie vom Festival?“
Ich nicke und reiche ihm die Papiere aus dem Fenster. So, wie ich es schon oft genug in irgendwelchen Filmen gesehen habe. Der Polizist betrachtet sie kurz.
„Wären Sie so freundlich und würden für einen Moment aus dem Fahrzeug steigen?“
„Klar.“
Ich bin nüchtern, ich muss mir also keine Sorgen machen. Aber trotzdem spüre ich die Angst, vielleicht doch irgendwas falsch gemacht zu haben. Er fragt mich nach Alkohol- und sonstigem Konsum und ich verneine. Dann lässt er mich auf dem Seitenstreifen laufen, auf einem Bein stehen und mit dem Zeigefinger meine Nasenspitze treffen. Er leuchtet mir in die Augen.
„Ihre Reaktionen sind ein wenig langsam. Und Ihre Pupillen reagieren verzögert.“
„Ich habe vier Tage Festival hinter mir, ich bin müde.“
„Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass Sie unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen stehen.“
Das waren seine Worte. Der Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen. Das Ganze ist fast 15 Jahre her und bei vielen anderen Sachen muss ich überlegen, wie das genau war. Diese Worte aber, die sind da.
Ich schüttele den Kopf.
„Ich habe nichts genommen.“
„Wären Sie bereit, einen Urintest zu machen? Ich unterstelle Ihnen nichts, das ist nur zur Überprüfung.“
Ich weiß, ich kann das verweigern und so. Aber ich bin müde und will weiter. Er drückt mir einen transparenten Plastikbecher in die Hand und schickt mich zu einem Busch. Ich lasse es gerade laufen, als neben mir ein anderer Kerl auftaucht und ebenfalls in einen Becher pinkelt, in einem Strahl, der seinen Becher in Sekunden füllt.
Wir stehen nah beieinander, es wäre ein Leichtes, Becher zu tauschen. Aber ich habe ja nichts genommen. Oder ist es möglich, passiv zu kiffen? Der Polizist schraubt den Deckel auf den Becher, schiebt ein Stück Pappe durch den vorgesehenen Schlitz und stellt den Becher auf einem Pfosten ab.
„Wir müssen kurz warten, dann bekommen wir das Ergebnis.“
Auf der Pappe sind mehrere Streifen zu sehen, auf denen nun rote Linien erscheinen.
„Was genau passiert jetzt?“
„Jeder Streifen ist für eine andere Droge. Cannabis, Koks, Opium, Speed und Ecstasy. Wir können den Urin gleich auf mehrere Drogen untersuchen. Sobald die Streifen zwei rote Linien bekommen, ist alles in Ordnung. Ich sehe schon, Sie sind sauber.“ Er hält mir meine Papiere hin. „Danke. Haben Sie eine gute Fahrt und schlafen Sie sich aus.“
Ich sehe noch nicht bei jedem Streifen zwei rote Linien und ich weiß nicht, welcher das THC misst. Aber wer bin ich, ihm widersprechen zu wollen? Lisa beobachtet mich. Ich kehre zum Auto zurück, überrascht, dass das alles war, setze mich, drücke ihr die Papiere in die Hand und schnalle mich an.
„Alles gut?“
„Alles gut.“
Ich grinse und will den Motor starten, als der Polizist wieder am Fenster auftaucht.
„Einen Moment noch.“
Er hält mir den Becher hin und ich denke, das war ja klar. Also gibt es doch Passivkiffen und eine rote Linie fehlt.
„Normalerweise machen wir das nicht, aber nehmen Sie den Becher mit, ausnahmsweise. Sie werden an ein bis zwei weiteren Kontrollen vorbeikommen, in jeder Richtung. Sagen Sie den Kollegen Grüße und zeigen Sie ihnen den Becher, vielleicht müssen Sie nicht nochmal pinkeln.“
~
Der Arzt nickt.
„Jetzt das andere.“
Ich wechsele das Auge und muss schmunzeln.
„Soll ich auch pinkeln?“
„Nein, aber ich werde Ihnen Blut abnehmen. Wie ist Ihr genereller Gesundheitszustand? Trinken oder rauchen Sie übermäßig? Haben Sie sonstige Beschwerden?“
„Kein Trinken, kein Rauchen. Ich habe seit Tagen Kopfschmerzen und bin übermüdet. Und jetzt eben die Ohnmacht und das Übergeben. Wir haben vor kurzem ein Café eröffnet und ich arbeite zu viel. Mir geht’s gut, ich muss nur schlafen.“
Er nickt, klickt mit dem Kugelschreiber und schreibt auf den Block vor sich.
„Die Bauchschmerzen.“





























