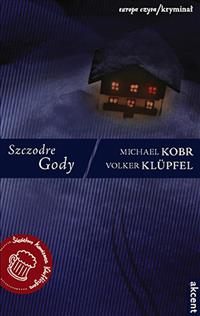Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OSTERWOLDaudio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Teutonengrill trifft Dolce Vita Mensch, war das schön: Im Morgengrauen ging's los, eingepfercht auf der Rückbank der vollbeladenen Familienkutsche. Zehn Stunden Fahrt an die Adria, ohne Klimaanlage und Navi, dafür mit Modern Talking aus dem Kassettenradio. Am Strand ein Duftgemisch aus Tiroler Nussöl und Kläranlage, und statt Cappuccino gab's warme Limo. Willkommen zurück im Urlaubsparadies der 80er Jahre. Darin findet sich Familienvater Alexander Klein wieder, als er über einem Fotoalbum einnickt und als pickliger Fünfzehnjähriger erwacht – dazu verdammt, die Italien-Premiere seiner Jugend noch einmal zu erleben. Und zwischen Kohlrouladen und Coccobellomann die beste Zeit seines Lebens hat. »Klüpfel und Kobr steigern sich von Buch zu Buch.« Denis Scheck, Druckfrisch, ARD "Ein phantastisches Buch um eine Familienzusammenführung der besonderen Art. Um Urlaub an der Adria, gute Laune, volle Strände und Sonnenbrände. Ein Urlaubsbuch, wie Sie es mögen, aber auch ein traumhaftes Buch, wie Sie es lesen sollten." Bastian Pastewka
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Klüpfel / Michael Kobr
In der ersten Reihe sieht man Meer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Erinnern Sie sich noch? Die anstrengenden Urlaubsreisen ins gelobte Land jenseits der Alpen … Morgens um fünf ging es los, eingepfercht auf der Rückbank des bis unters Dach beladenen Ford Sierra. 15 Stunden Fahrt ohne Klimaanlage und Smartphone, dafür mit »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Und im Urlaubsparadies wurden Pizza und Espresso misstrauisch beäugt. Rückblickend betrachtet ist so ein Familienurlaub in Bella Italia doch eine Riesengaudi: Volker Klüpfel und Michael Kobr lassen uns den ganzen Spaß mit ihrem Helden Alexander nochmal richtig nacherleben.
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Voyage, Voyage
Forever Young
Strada del Sole
Azzurro
Our House
Vamos a la Playa
Like Ice in the Sunshine
Spaghetti Carbonara
Sunshine Reggae
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt
Macho, Macho
Sternenhimmel
Santa Maria
Tretboot in Seenot
Ring, ring
Zuppa Romana
Ich kauf mir was, kaufen macht so viel Spaß
Männer
Es geht voran
Africa
Ti sento
Zu nah am Feuer
Guten Morgen, liebe Sorgen
Der Kommissar
Gente di mare
Workin’ 9 to 5
The Winner Takes It All
And When the Rain Begins to Fall
Insieme
Felicità
The Final Countdown
Una festa sui prati
Dreams are my Reality
Grazie
Bildnachweis
Vorbemerkung
Die Urlaubsfotos in diesem Buch stammen aus den privaten Alben der beiden Autoren.
Voyage, Voyage
Die Geschichte meiner sonderbarsten Reise beginnt so wie alle anderen Reisen unserer Familie, an die ich mich erinnere: mit Geschrei, Gezeter und dem festen Vorsatz, nie wieder einen solchen Urlaub anzutreten.
Diesmal eröffnete meine Tochter den bunten Terror-Reigen, indem sie mir wutschnaubend ihre Kopfhörer entgegenstreckte: »Ich krieg echt die Krise, dieses Opfer hat wieder meinen iPod geklaut!« Sie sah mich fordernd an. »Alex, sag diesem Pickelgesicht, dass er mir den sofort wiedergeben soll.«
Sie nannte mich seit kurzem nicht mehr Papa, sondern bei meinem Vornamen, was mir jedes Mal einen Stich versetzte, auch wenn ich wusste, dass das in ihrer Clique gerade »in« war und es nur darum ging, cool zu sein. Ich wünschte mir das immerhin etwas herzlichere »Dad« zurück, das noch vor wenigen Wochen in Mode gewesen war.
»Ich mein’s ernst! Sonst stell ich ein Badewannenbild von dem Freak bei Facebook ein.«
Ich musste mich beherrschen, nicht einfach loszubrüllen. »Wertes Fräulein Felicitas Klein, ich habe zusammen mit deiner Mutter heute den ganzen Tag die Koffer gepackt, das Haus aufgeräumt, eingekauft, Nachsendeanträge gestellt, die Zeitung für karitative Zwecke umbestellt und den Rasen gemäht. Hättest du die Güte, die Problemchen mit deinem Bruder selbst zu lösen und nicht mich damit zu behelligen?«
Felicitas setzte gerade zu einer ihrer berüchtigten Verteidigungsreden an, in denen sie immer irgendeinen Passus der UN-Menschenrechtscharta als Kronzeugen zitierte, da kam meine Frau dazu und stellte ein weiteres Gepäckstück in den bereits mit Koffern und Reisetaschen angefüllten Flur. »Du hast gehört, was Papa gesagt hat. Jakob ist in seinem Zimmer, frag ihn selber. Außerdem weiß ich nicht, wozu du diesen mp3-Player überhaupt brauchst, du hast doch zum Geburtstag das sündteure Smartphone bekommen.«
Felicitas zog maulend ab: »Und? Trotzdem gehört der iPod mir und nicht dem Schwammkopf. Und zu dem ins Zimmer geh ich nicht, da hol ich mir ja weiß Gott was!«
Ich schrie ihr hinterher: »Ich weiß nicht, was mit euch los ist, meine Schwester und ich waren ein Herz und eine Seele. Besonders im Urlaub haben wir uns immer ganz toll …«
Ihre Zimmertür fiel krachend ins Schloss.
Trotzdem rief meine Frau: »Und pack den Sunblocker ein, den ich dir bestellt habe, ich kümmere mich da nicht mehr drum, du bist alt genug!«
Dann wandte sich Mona mir zu: »Und du stehst nur rum, oder was? Ich hab das Gefühl, ich bin die Einzige, die hier alles am Laufen hält. Wir brauchen die Ausweise und die Impfpässe, und jemand sollte den Anrufbeantworterspruch ändern. Das ist jetzt echt mal dein Job.«
Ich wusste, dass es wenig Sinn hatte, am Vorabend unserer Abreise in den – aus mir inzwischen nicht mehr erfindlichen Gründen lang ersehnten – Jahresurlaub noch einen Streit vom Zaun zu brechen. Und meine Frau hatte in den letzten Tagen neben ihrem Job als Gitarrenlehrerin in der Musikschule wirklich ein paar Kleinigkeiten erledigt, zu denen ich beim besten Willen nicht mehr gekommen war.
»Mach ich, Schatz, kein Problem, ich fliege«, flötete ich und verkniff mir den Hinweis auf das Kick-off-Meeting mit einem der größten Kunden unserer Werbeagentur, das mich trotzdem nicht davon abgehalten hatte, die Hauptlast unserer Reisevorbereitungen zu tragen. Außerdem hatte ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um für meine ältere Schwester Nicole noch ein Feriendomizil neben unserem zu bekommen, weil sie sich vor einer Woche spontan entschlossen hatte, uns in den Urlaub zu begleiten. Niki, nach einer Scheidung wieder Single, kinderlos und auf der Suche nach dem tieferen Sinn in ihrem Leben, fiel vor allem zu Urlaubszeiten und Weihnachten ein, wie wichtig es doch sei, dass man als Familie zusammenhielt.
Die Zimmertür meines Sohnes öffnete sich. Jakob stand in Shorts und T-Shirt vor mir, die halblangen Haare im Nacken zusammengebunden. »Kann ich meine Wii mitnehmen?«
Ich bekam Schnappatmung: »Du willst eine Spielkonsole in den Urlaub mitschleppen? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Wir sind direkt am Strand, da gibt’s andere Dinge zu tun, junger Mann.«
Die Miene meines dreizehnjährigen Sohnes verfinsterte sich. »Ach ja?«, kiekste er stimmbrüchig. »Was denn?«
»Na ja, schwimmen, surfen, segeln, lesen, man kann sogar einen Kite-Kurs machen, heißt es. Ich bin als Jugendlicher gar nicht hinterhergekommen mit meinen ganzen Urlaubsaktivitäten.«
»Du warst eben ein ganz toller Hecht. Wie sieht’s mit Jetski aus?«
»Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die schon an Kinder vermieten, aber wir können ja zusammen …«
»Ich bin kein Kind mehr, Papa. Und Parachute? Abufasel aus meiner Klasse hat erzählt, dass sein Onkel an der Türkischen Riviera so ’nen Schirm hat und an Touristen vermietet. Kann ich das dann auch mal machen?«
»Jakob, darüber zerbreche ich mir erst den Kopf, wenn wir wissen, ob es das dort überhaupt gibt. Wird auch nicht ganz billig sein, könnte ich mir denken.«
»Toll, wenn wir uns das nicht mal mehr leisten können …«
»Sag mal, was soll das jetzt? Ihr könnt euch nicht beschweren, glaube ich!«
»Und warum müssen wir wieder deine ekligen Reste-Sandwiches mitnehmen? Nur damit ja nichts vergeudet wird! Können wir nicht unterwegs was kaufen?«
»Das hat nichts mit unserer finanziellen Lage zu tun. Wär einfach schade um die teuren Biosachen.«
Jakob seufzte betrübt. »Klar, Hauptsache, gesund, ob’s schmeckt, ist egal.«
»Ach ja? Wem muss ich denn ständig vegane Wraps machen, hm?«
»Meiner Schwester! Aber würd dir vielleicht auch nicht schaden, wirkst ein wenig verkalkt in letzter …«
»Das! Geht! Zu! Weit! Ab jetzt ins Bett, ich will heute nichts mehr hören von dir, sonst ist der Urlaub gestrichen.«
»Leere Versprechungen!« Jakob knallte seine Zimmertür zu.
»Muss das sein, dass du deinen Stress an dem Jungen auslässt?« Mona stand mit einer weiteren Tasche hinter mir. »Sei doch nicht immer so ungeduldig mit ihm. Er macht eine schwierige Zeit durch.«
»Ach ja? Kannst den verwöhnten Schnösel ja ein bisschen trösten.«
»Falsch, ich geh jetzt ins Bett.« Sie zog mich zu sich und flüsterte mir versöhnlich ins Ohr: »Und eines sag ich dir, versuch dich zu entspannen, wir wollen mit dem guten alten Alex Ferien machen, nicht mit diesem abgespannten Nervenbündel, das du in den letzten Wochen warst, verstanden? Gute Nacht, Schatz.«
Ich nickte und drückte ihr einen Schmatz auf die Wange. Obwohl ich mich auch nach meinem Bett sehnte, unternahm ich noch eine kleine Tour durch die Wohnung, um alle Elektrogeräte auszustecken, wobei ich natürlich den Receiver aussparte, dessen Festplatte bei unserer Rückkehr mit herrlichen Arte-Reportagen aus aller Welt angefüllt sein würde.
Gerade als ich im Arbeitszimmer den Rechner herunterfahren wollte, erschien auf dem Bildschirm ein Skype-Fenster mit der Meldung frauenpower ruft an. Ich setzte mich mit einem Seufzen. frauenpower war der Alias-Name meiner Schwester.
Niki saß in einer Art Batikkleid auf dem Boden, ihre Haare standen struppig in alle Richtungen, was sie eigentlich immer taten, seitdem sie nur noch Wasser und Pflanzenseife verwendete, um nicht Gefahr zu laufen, Tierversuche der Kosmetikindustrie zu fördern.
»Hey Bro!«
Ich hasste es, wenn sie sich dieser Pseudojugendsprache bediente, überging die Anrede aber einfach. »Tag, Niki, na, schon im Reisefieber?«
»Bitte, Alex, du weißt, dass diese Art des Urlaubs himmelweit von dem entfernt ist, was ich unter nachhaltigem Tourismus verstehe. Ich wär lieber wieder nach Nepal geflogen als in ein tumbes Ferienghetto am Teutonengrill, das kannst du mir glauben.«
»Aber?«, hakte ich nach. Immerhin hatte sie sich uns geradezu aufgedrängt.
»Aber ich habe mich aus Gründen der Nostalgie und des Familienzusammenhalts bereit erklärt mitzufahren. Auch, um euren Kindern und vor allem unseren Eltern einen Gefallen zu tun.«
Ich grinste in mich hinein. Wie gnädig von ihr.
»Ich bin allein und frei, könnte machen, was ich will, aber na ja, wer weiß, wie lange noch alle zusammen fahren können …«
»Ach, Niki, komm, Sonne, Strand und Meer hat dir doch früher auch Spaß gemacht.«
»Mir? Von wegen. Und ihr könnt euch von vornherein abschminken, dass ich mit an den Strand gehe. Ich bin doch nicht wahnsinnig und lass mich da verbrutzeln. Du weißt, wie empfindlich meine Haut ist. Ich hab mir schließlich früher, wenn ihr euch verbrennen habt lassen, lieber ein schattiges Plätzchen gesucht und ein gutes Buch gelesen.«
»Hab ich anders in Erinnerung, aber sei’s drum. Kannst dafür ausgiebig im Meer schwimmen.«
»Nee, danke, Bruderherz, macht ihr das mal, ich werd mir wahrscheinlich ein Fahrrad leihen und ein paar Kirchen anschauen. Und ich nehme meine Aquarellfarben mit, ich wollte schon immer mehr malen.«
Klar, immer.
»Sonst noch was, Niki? Ich müsste die letzten Vorbereitungen …«
»Ja, sonst noch was. Du kennst ja Mama und Papa. Die werden sicher wieder so Bemerkungen machen, du weißt schon: Triffst du dich mit jemandem? Lernst du auch mal nette Männer kennen? Ich kann das nicht mehr ab. Ich zähle da auf deine Solidarität, ja? Rede doch mal mit denen und sag ihnen, dass mich das verletzt.«
»Wieso machst du das nicht selber?«
»Weil ich mit denen nicht darüber reden kann.«
Ich zog die Brauen zusammen.
»Versprochen?«
»Triffst du dich denn mit jemandem?«, fragte ich grinsend.
»Alex!«
»Ja oder nein?«
»Vielleicht. Geht aber niemanden was an.«
»Sag schon! Ist er jünger als du?«
»Hör auf jetzt!«
»Verheiratet?«
»Hätte ich bloß nichts gesagt! Also im Ernst: Ich zähl auf dich, ja? Ich komm nur euch und Mama und Papa zuliebe mit, vergiss das nicht!«
Wie könnte ich das vergessen, so oft, wie sie es erwähnte.
»Also, ich verspreche, dass ich …«
Nikis Bild verschwand. Aufgelegt. »Ja, ich wünsch dir auch eine gute Nacht«, ätzte ich in Richtung Bildschirm.
Kopfschüttelnd erhob ich mich und versuchte mich zu erinnern, was ich vor dem Anruf meiner Schwester eigentlich hatte tun wollen – da klingelte es an der Tür.
»Kann man denn hier nicht mal irgendwas in Ruhe erledigen?«, schimpfte ich, während ich die Haustür aufriss und in die erschrockenen Augen meines Vaters blickte.
»Junge, was ist denn mit dir los?«
»Mit mir? Was soll mit mir los sein? Ich bin doch der Einzige hier, der den Überblick behält.« Ich klang ein wenig hysterisch, das musste ich einräumen.
»Na, ich verstehe das ja, vor so einer großen Reise können einem schon mal die Nerven durchgehen.«
»Große Reise? Papa, weißt du eigentlich, wie viel ich beruflich durch die Welt jetten muss? Da ist so eine kleine Tour mit dem Auto …«
»Genau deswegen bin ich hier«, unterbrach er mich und schob sich an mir vorbei in die Wohnung.
»Weswegen?« Ich lief ihm hinterher bis ins Esszimmer, wo er eine Aldi-Tüte auf den Tisch legte und mich erwartungsvoll ansah.
»Und?«, fragte ich genervt. »Hast du wieder ein Elektrogerät in der Schnäppchenecke gekauft, das du nicht bedienen kannst? Das ist jetzt nicht gerade der beste Zeitpunkt für …«
»Kein Elektrogerät. Ganz im Gegenteil.« Mit großer Geste griff er in die Tüte und zog einen roten Wälzer heraus, den er feierlich auf dem Tisch plazierte. »Der große Shell-Atlas« stand darauf. Und darunter: »89/90«.
»Was soll ich damit?«
»Ich wollte mit dir die Route noch mal durchgehen und vielleicht den einen oder anderen Zwischenhalt planen. Wir wollen doch Konvoi fahren, nicht wahr?«
»Nein, Papa, das wollen wir nicht. Außerdem hab ich ein Navi!«
»Eben, und wenn das mal ausfällt, dann seid ihr jungen Leute aufgeschmissen. Ihr könnt doch gar keine Karten mehr lesen. Und nach dem Gefühl fahren, so wie ich früher, das könnt ihr auch nicht mehr.«
Auch das hatte ich anders in Erinnerung.
»Na, egal, jedenfalls kannst du den Atlas haben, ich kenn die Strecke wie meine Westentasche. Was ich noch wissen wollte: Haben wir eigentlich feste Plätze am Strand? Ich hab das ja immer alles vorreserviert, früher. Weißt du, in den hinteren Reihen sieht man nämlich viel weniger.«
Ich atmete tief durch und wechselte einfach das Thema: »Nicole hat eben angerufen.«
Er biss sofort an: »Ja? Wie geht es ihr denn? Hat sie endlich wieder einen Partner in Aussicht?«
»Papa!«
»Man wird wohl fragen dürfen.«
»Eben nicht.«
»Mutti und ich, wir machen uns nun mal Sorgen. Das ist doch nichts, so allein in ihrem Alter. Da wird man schnell wunderlich und bekommt Schrullen.«
»Vielleicht solltest du darüber im Urlaub mit ihr reden«, sagte ich, und fühlte mich nur ein klein wenig schuldig wegen dieses Verrats.
»Meinst du, ja? Hast vielleicht recht. Da haben wir genügend Zeit, das alles gemeinsam in großer Runde zu diskutieren. Wir fahren ja sowieso nur deiner Schwester zuliebe mit. Der Familienanschluss wird ihr guttun.«
»Ja, Papa, ganz bestimmt, das seh ich genauso. Schlaf gut, grüß Mama und bis morgen dann.« Mit diesen Worten schob ich ihn aus der Tür.
Genervt und erschöpft ging ich zurück in mein Büro, warf den Atlas in die Altpapierbox und nahm wieder auf meinem Gymnastikball am Schreibtisch Platz. Ich musste noch unsere Ausweise zusammensuchen, von denen ich sicher gewesen war, sie in der Dokumentenmappe zu finden. Da sie dort nicht waren, begann ich, in den Schubladen zu wühlen. Schon bald aber hatte ich die eigentliche Suche vergessen und schwelgte in Erinnerungen, denn immer wieder stieß ich auf Spuren unserer Vergangenheit: Liebesbriefe, Glückwunschkarten, nutzlose kleine Geschenke und Fotos. Es waren sogar ein paar Alben dabei, die irgendwer irgendwann mal geklebt hatte.
Einem plötzlichen Impuls nachgebend, zog ich eines dieser Alben heraus. Fast ehrfürchtig blätterte ich den blauen Weichplastikeinband auf und musste bereits beim ersten Bild grinsen: Mama, Papa, meine Schwester, ich – und nicht zu vergessen Oma bei unserem ersten Halt unseres ersten Italienurlaubs an der ersten Raststätte nach dem Grenzübergang.
Wie hatte man nur so in Urlaub fahren können: fünf Leute in einen bis zum Bersten vollgepackten Ford Sierra gepfercht.
Ich holte mir die angebrochene Flasche Rotwein aus der Küche, goss mir ein Glas ein und fläzte mich mit dem Album in den Sitzsack. Die letzten Tage in der Agentur, dazu die Reisevorbereitungen, all das hatte mich ganz schön geschlaucht.
Der schwere Rotwein und die Bilder verschwammen zu einem sentimentalen Strudel, einzelne Momente blitzten vor meinen Augen auf, verbanden sich mit meinen Erinnerungen, das Tretboot, die Strandverkäufer, die Feuerqualle, die Vaters Arm so erwischt hatte, dass die Narbe bis heute zu sehen war, die Fahrt, Oma …
So viele Erinnerungen. Der Wein. Die bleierne Müdigkeit. Ich schloss die Augen. Nur ein kurzes Nickerchen, die seltsamen Badehosen, ein kleines Schläfchen, die Hitze, unsere Ferienanlage, und dann gleich wieder aufwachen.
Wieder aufwachen.
Aufwachen …
Forever Young
Aufwachen!«
Ich fuhr ruckartig hoch und blickte in das erschrockene Gesicht meiner Mutter, das im Schein der funzeligen Nachttischlampe nur schemenhaft zu erkennen war. Sie hatte sich über mich gebeugt und … Moment! Meine Mutter?
»Mama, was machst du denn schon hier?«, krächzte ich mit irritierend hoher Stimme. Ich hätte die Weinflasche besser doch nicht angerührt.
»Na, was werd ich wohl hier machen? Allein kommst du doch nicht aus den Federn«, gab sie zurück, was ich durchaus anmaßend fand, immerhin klappte das seit nunmehr über zwanzig Jahren ganz gut ohne sie. Mehr noch: War nicht ich es, der sie ständig an wichtige Termine erinnerte, die sie und Papa ansonsten regelmäßig verschwitzten?
»Mama, du behandelst mich wie ein …« Ich räusperte mich vernehmlich. Meine Stimme klang noch immer viel zu hoch.
»Kind?«, vervollständigte meine Mutter den Satz. »Was schlägst du denn vor, wie ich dich behandeln soll? Wie einen jungen Mann? Das mache ich, sobald du deine Wäsche selbst wäschst, dir dein Mittagessen kochst und dein Zimmer aufräumst.«
»Jetzt mach mal halblang, Mama, ich …« In diesem Moment schaltete sie das Deckenlicht an, und ich erstarrte. »Wie siehst du überhaupt aus?«, kreischte ich.
»Wieso? Hab ich was im Gesicht?« Besorgt wischte sie sich über den Mund.
»Im Gegenteil … ich meine, so jung.«
Ihre Wangen wurden rot. »Hast du das gehört, Norbert? Dein Sohn macht mir schon im Morgengrauen Komplimente. Das schaffst du nicht mal während eines Abendessens bei Kerzenschein.«
»Ist er krank? Bitte nicht jetzt, wo wir aufbrechen wollen!« Mein Vater streckte seinen Kopf zur Tür herein – und verstärkte mein Erstaunen dadurch nur noch. Sein Gesicht zierte ein ausladender Schnurrbart, wie er ihn schon Jahrzehnte nicht mehr getragen hatte, ebenso wie seine uralte Brille, ein riesiges Ding aus Metall.
»Krank? Weil er mir ein Kompliment macht?«, gab meine Mutter schnippisch zurück.
»Ach komm, Renate, willst du so kurz vor der Abfahrt noch einen Streit vom Zaun brechen? Dazu haben wir doch jetzt zwei Wochen ausgiebig Gelegenheit.«
»Kommt das Faultier wieder nicht aus dem Bett?«
Diese Stimme kannte ich. Aber sie durfte eigentlich auch noch nicht hier sein … »Nicole? Du?«
Ein genervtes Seufzen. »Anscheinend hat es dir endgültig dein Resthirn verstrahlt, du Pissnelke.« Mit diesen Worten schob sich meine Schwester an meinem Vater vorbei ins Zimmer. Der Schreck darüber, dass sie hier war, wich dem puren Entsetzen, als ich sie erblickte: Sie hatte ihre Haare zu asymmetrischen Zöpfen geflochten, die ihren Kopf aussehen ließen wie einen vom Sturm zerpflückten Haselnussstrauch. Dazu trug sie einen gelb-grünen Jogginganzug, halbhohe Basketballstiefel und Strickstulpen. Sie wirkte wie ein Teenager, allerdings einer aus den Achtzigern.
»Was ist denn das wieder für ein Ton, Nicole?« Mama klang kaum entsetzt, unsere Auseinandersetzungen war sie ja gewohnt. Ich wusste aber, dass sie Nicole später, als die sich nach der Pubertät wieder in einen Menschen zurückverwandelt hatte, anvertraute, sie habe stets sehr darunter gelitten. Aber das war vor dreißig Jahren gewesen. Vor dreißig Jahren? Eine schreckliche Ahnung packte mich wie eine kalte Hand im Nacken. Ich schlug die Bettdecke mit den Bussibär-Motiven zurück, wankte zum Spiegel, atmete ein paarmal tief durch und hob dann den Blick.
Nein, das konnte nicht wahr sein! Das war einfach nicht möglich, das war … »Entsetzlich!« Aus dem Spiegel blickte mich das pummelige Gesicht mit dem Oberlippenflaum an, über das sich meine Frau immer lustig machte, wenn wir alte Fotoalben ansahen.
»Was für ’ne kranke Scheiße geht denn hier ab?«, schrie ich, wobei meine Stimme noch eine weitere Oktave nach oben rutschte.
»Jetzt reicht es aber, junger Mann«, schimpfte meine Mutter. »Sag du doch auch mal was, Norbert.«
»Ich? Ach so, ja: Jetzt reicht es dann aber wirklich, junger Mann.«
»Danke, sehr hilfreich.«
Mein Vater zuckte die Achseln.
Nur meiner Schwester schien die Situation mächtig Spaß zu bereiten. »Ha, ich wusste es, jetzt hat der Freak endgültig den Verstand verloren. Das kommt vom vielen Wichsen, du Warzen…«
»Junge Dame«, unterbrach sie meine Mutter empört, »solche Ausdrücke dulde ich in meinem Haus nicht!«
Immer, wenn meine Mutter uns junge Dame oder junger Herr genannt hatte, war Gefahr in Verzug gewesen. Gewesen! Das war lange vorbei. Fassungslos folgte ich der Diskussion zwischen meinen Eltern und meiner Schwester.
»Was für Ausdrücke?«, fragte Nicole und stemmte provozierend eine Hand in die Hüfte. »Warzenschwein?«
»Nein … das andere.«
»Was?«
»Das … ich werde das jetzt nicht wiederholen.«
»Oh, ihr seid so verklemmt. Stimmt doch, dass er den ganzen Tag nur …«
»Schluss jetzt, sonst wird sofort alles abgeblasen«, brüllte mein Vater.
Da rauschte Nicole ab, und ich fand endlich meine Sprache wieder. »Wie könnt ihr einfach so zusehen bei dem, was hier gerade passiert?«
»Ach komm, deine Schwester ist eben gerade in einem Alter …«
»Nicht das mit Niki. Ich meine das andere!«
»Was denn?«
»Na … das alles.« Ich deutete mit einer vagen Handbewegung auf mich.
»Ich glaube, er meint die Pubertät«, mischte sich mein Vater ein. »Mach dir nichts draus, Junge. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Manches fühlt sich jetzt erst mal komisch an, aber das vergeht wieder. Du wirst allmählich ein Mann.«
»Vielleicht solltet ihr im Urlaub mal ein Gespräch führen«, schlug meine Mutter vor. »So von Vater zu …«
»Mama! Bitte, so ein Gespräch ist wirklich das Letzte, was ich jetzt brauche.«
»Kein schlechter Gedanke, Renate. Weißt du, mein Sohn, dein Körper verändert sich. Es ist eine Phase des Umbruchs.«
»Ja, aber er wird doch nicht auf einen Schlag dreißig Jahre jünger.«
»Schatz, hast du Fieber?«
Meine Mutter legte mir besorgt die Hand auf die Stirn, mein Vater hielt erschrocken die Luft an. Doch sie schüttelte beruhigt den Kopf. »Vielleicht die Aufregung wegen der Fahrt. Wahrscheinlich hat er nur schlecht geträumt.«
Geträumt? War das alles nur ein Traum? Ich versuchte, den Abend zu rekonstruieren: Ich war eingeschlafen mit den Fotos von uns am Adriastrand in der Hand. Hatte mein Unterbewusstsein sich meiner Erinnerungen bemächtigt und …
»Was für eine Fahrt?«, murmelte ich.
»Na, die nach Italien, an die Adria«, antwortete meine Mutter. »Du hast dich doch so darauf gefreut. Versuch einfach, im Auto noch ein wenig zu schlafen.«
»Wir fahren … nach Italien?«
»Ja, glaubst du, wir stehen zum Vergnügen nachts um drei auf?« Kopfschüttelnd ging mein Vater aus dem Zimmer.
Ich stand also kurz vor der Abfahrt in den Urlaub, wie gestern Abend, als ich eingeschlafen war. Ich entspannte mich etwas. Natürlich war das ein Traum. Vielleicht hatte mich die bevorstehende Reise doch mehr beschäftigt, als ich es mir selbst eingestanden hatte. Es war ja auch etwas Besonderes, was wir vorhatten – der erste generationenübergreifende Großfamilienurlaub. Und genau darin lag wohl die Erklärung. Allerdings war das der seltsamste und detailreichste Traum, den ich je gehabt hatte.
»Alles wieder gut?«, fragte meine Mutter.
Ich sah sie an: Ihr braunes, dauergewelltes Haar war nackenlang geschnitten und zu dieser frühen Stunde noch etwas zerzaust. Zu dieser frühen Stunde? Mein Bewusstsein war offenbar auf dem besten Wege, sich in sein Schicksal, besser gesagt, meinen Traum zu fügen. »Jaja, null Problemo«, erwiderte ich – und zog die Brauen hoch. Hatte ich wirklich gerade null Problemo gesagt? Junge, Junge, der Wein hatte es wirklich in sich.
»Also, dann mach dich fertig, wir wollen gleich fahren. Nicht, dass wir noch in einen Stau kommen. Du weißt, wie sehr Papa das hasst.« Sie gab mir einen Kuss auf die Stirn und verließ das Zimmer.
Ja, ich wusste, wie sehr mein Vater es verabscheute, im Stau zu stehen. Besser gesagt: Ich erinnerte mich. Inzwischen nahm er eigentlich nur noch die Bahn oder ließ Mama fahren.
Mir schwirrte der Kopf. Ich setzte mich auf die Bettkante und schaute mich um. Irgendwo in einer abgelegenen Ecke meines Gehirns musste jedes Detail der Einrichtung meines Jugendzimmers gespeichert sein, denn das hier war ein perfektes Abbild davon: der Nena-Starschnitt an der Stirnseite des Bettes, der antiquierte Commodore-Computer, der an Uromas ausgemustertem Schwarzweißfernseher angeschlossen war, die pastellfarbenen Klamotten, die überall herumlagen. Mit einem Schlag wurde mir klar: Ich war gefangen in der Achtzigerjahre-Hölle. Im »entstellten Jahrzehnt«, der schlimmen Zeit der Neonleggins und Tennissocken, der Vokuhilas, der Musik von Modern Talking – und der Adria-Urlaube.
Mit weichen Knien erhob ich mich. Mein Magen fühlte sich flau an, denn wie es schien, war keiner der psychischen Schocks, die sich im Minutentakt einstellten, dazu geeignet, mich aufwachen zu lassen. Was bedeutete, dass ich bis auf weiteres dazu verdammt war, wieder mit meinen Eltern in den Urlaub zu fahren. Nach Italien. An den Strand. Den Teutonengrill.
Niedergeschlagen und verwirrt schlurfte ich über den Flur, wo wenigstens noch alles so aussah wie in der Gegenwart, allerdings nur, weil meine Eltern in den letzten dreißig Jahren so gut wie nichts verändert hatten. Um mich herum herrschte aufgekratzte Aufbruchsstimmung: Meine Mutter schmierte in der Küche die letzten Brote und füllte Filterkaffee in eine Thermoskanne um, während mein Vater mehrere Landkarten vor sich ausgebreitet hatte, um wie ein Skiläufer vor dem Rennen die Strecke noch einmal im Geiste durchzugehen. Dabei putzte er feinsäuberlich seine Brille und versah sie mit abklappbaren Sonnengläsern. Danach schaltete er das Radio ein, um die neuesten Verkehrsfunkdurchsagen zu hören, die eventuell eine Modifikation der Route nötig gemacht hätten. Tatsächlich sind wir aber in all den Jahren nie von unserem Standardweg abgewichen: A7 bis zum Autobahnende – Fernpass – Brenner – und dann auf der Autostrada 22 auf direktem Weg zu unserer Ferienanlage.
»Hier, iss eine Kleinigkeit, wenn du was im Magen hast, geht’s dir gleich wieder besser.« Meine Mutter hielt mir einen Teller mit einer seltsam anmutenden Zusammenstellung hin: Neben einem Stück Kuchen lagen darauf eine Essiggurke und eine Scheibe Schwarzbrot mit Schinkenwurst.
»Das muss alles noch weg«, erklärte sie und löffelte selbst ein Schälchen Fleischsalat aus.
»So, jetzt wird eingeladen, hilf doch bitte mal«, sagte mein Vater und schob sich ein letztes Stück kaltes Schnitzel in den Mund.
Ich starrte weiterhin mit offenem Mund in die Gegend.
»Ist bei dir jemand zu Hause? Ich hab gesagt, du sollst mit anpacken.«
»Ach so, ja, sicher. Welchen Koffer soll ich nehmen?«
Mein Vater schüttelte den Kopf. »Mensch, Alexander, die Koffer haben wir doch gestern schon ins Auto gebracht. Wir brauchen nur noch das hier.« Er zeigte in den Flur, wo zwei Kisten mit Konservendosen, Keksen, Salzletten und anderem Proviant standen.
»Wozu brauchen wir das denn?«, fragte ich und wunderte mich selbst darüber, dass ich mich mit der Situation so langsam abzufinden schien.
»Na, zum Essen vielleicht? Oder willst du dir da unten am Ende mit Tintenfischen und Muscheln den Magen verderben?«
Strada del Sole
So, alles bereit?« Mein Vater drehte sich mit vor Vorfreude gerötetem Gesicht zu uns auf der Rückbank um. Er erwartete wohl ein enthusiastisches »Ab in den Süden!« oder zumindest ein zackiges »Jawoll!«, doch seine Frage blieb unbeantwortet. Meine Schwester hatte sich bereits ihre Walkman-Kopfhörer aufgesetzt und sich in die innere Emigration mittels Embryonalstellung zurückgezogen. Ich versuchte derweil, im engen Fond unseres Autos eine Position zu finden, in der ich die nächsten acht Stunden ohne körperliche Folgeschäden überstehen würde. Nur meine Mutter beantwortete die Frage ihres Mannes, indem sie ihn auf sehr wirkungsvolle Art und Weise zur Eile antrieb: »Guck mal, die Richters sind noch am Einpacken, wenn wir uns beeilen, sind wir noch vor denen auf der Autobahn.«
Die Richters. Unsere Nachbarn waren seit Jahren so etwas wie die fleischgewordene Messlatte unseres Urlaubs, die Richterskala, ob unsere Reise gelang oder nicht: Wir fuhren oft an ähnliche Ziele, mit ähnlichen Autos, in ähnliche Unterkünfte, allerdings niemals zusammen. Früher nach Südtirol und irgendwann eben zum ersten Mal an die Adria, weil Papa Richter auf einmal die Auffassung vertrat, Südtirol sei doch eher was für Langweiler im Rentenalter. Das hatte Papa Klein natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollen und ebenfalls erstmals »richtiges Italien« gebucht. Auch die Richters hatten Kinder, allerdings war der Junge, Kai, älter als seine Schwester Yvonne, weswegen ich sie oft als die Bizarro-Version unserer Familie bezeichnete. Die Bizarro-Welt kommt aus den Superman-Comics, die ich als Kind so gerne gelesen hatte, und darin ist alles genau andersherum als in unserer Realität – und vor allem: böse. Die gesamte Richter-Sippschaft entsprang also diesem bösen Universum, und wir mochten sie alle nicht. Deswegen liefen die Reise-Planungsgespräche zwischen den Richters und den Kleins stets nach demselben Schema ab: »Ach, ihr fahrt wieder nach Bozen? Wir ja diesmal nach Meran, das soll viel schnuckliger sein.« Und: »Wie, euer Bungalow ist nur einstöckig?« Oder, am schlimmsten: »Nein, wir hatten keinen Stau, müssen gerade noch durchgerutscht sein. Immer besser, wenn man früh loskommt.«
Mein Vater legte also sofort kommentarlos den Rückwärtsgang ein, drehte seinen Kopf nach hinten, obwohl ich nicht wusste, wo er zwischen den bis unter den Dachhimmel reichenden Gepäckstücken noch die Straße erblicken wollte, und rauschte aus der Einfahrt. Zu einem gemurmelten »Wollen doch mal sehen, wer schneller am Strand liegt!« fuhr er mit quietschenden Reifen davon.
Ich war immer noch dabei, eine halbwegs erträgliche Position zu finden – Beine angewinkelt und Füße links neben mir auf der Bank, Kopf in die Armbeuge gestützt ans Fenster gelehnt –, als meine Mutter sich zu mir umdrehte: »Brauchst dich gar nicht so breit zu machen, Oma steigt doch gleich zu.«
Oma. Jetzt wurde mir wieder ein wenig mulmig, denn meine Großmutter war vor einigen Jahren im biblischen Alter von achtundneunzig Jahren gestorben. Auf ein Wiedersehen mit ihr, das nicht zu Harfenklängen auf einer Wolke stattfand, war ich nicht vorbereitet. Wie hatte ich sie nur vergessen können, wo sie doch immer mit uns in Urlaub gefahren ist? Ich schämte mich ein bisschen und machte mich schuldbewusst ganz klein in meinem Sitz.
Die Fahrt zu den Eltern meiner Mutter dauerte nur wenige Minuten; sie wohnten im gleichen Ort in einem kleinen Häuschen mit einem Garten, in dem jeder Quadratzentimeter zur Gemüse- oder Obsterzeugung genutzt wurde, wahrscheinlich weil sich Opa im Falle eines erneuten Krieges autark versorgen wollte. Die beiden standen schon mit gepackten Koffern vor der Tür, als wir kamen. Opa hatte ich aufgrund seines früheren Ablebens schon länger nicht mehr gesehen als Oma, aber unser Verhältnis war ohnehin nie sehr innig gewesen.
Als mein Vater das Auto vor dem Gartentürchen parkte, schaute Großvater missbilligend auf die Uhr: »Wolltet ihr nicht schon vor fünf Minuten los?«
»Fünf Minuten zählen noch als pünktlich«, erklärte mein Vater.
»Ja, das hat mein Kriegskamerad Herrmann auch immer gesagt, und was war? Erschossen haben sie ihn.«
Ich erstarrte, doch außer mir schien niemand sich an Opas drastischem Bild zu stoßen. Kriegsanalogien gehörten zu seinem Sprachgebrauch, nur war ich sie eben nicht mehr gewohnt.
»Hier, lad mal ein, aber Vorsicht, das ist echtes Leder«, sagte mein Opa, als er meinem Vater Omas Koffer in die Hand drückte. Mir war schleierhaft, wie Papa dieses Ungetüm noch ins Auto bringen wollte. Jeder Winkel war mit irgendetwas vollgestopft, selbst den Platz unter den Sitzen hatte meine Mutter genutzt und dort die Bettwäsche für unsere Ferienwohnung verstaut.
»Könnte ein Problem geben«, unkte Opa und baute sich mit auf dem Rücken verschränkten Händen hinter meinem Vater auf, als der den Kofferraum öffnete. Doch mit einigem Ächzen, wobei ich mir nicht sicher war, ob es von meinem Vater oder vom völlig überladenen Auto kam, fand das Gepäckstück seinen Platz. Mein Vater drückte die Heckklappe schließlich unter Anwendung roher Gewalt zu und schloss sie ab, wohl um sicherzugehen, dass der Kofferraum nicht während der Fahrt explodieren würde.
»Ja, verrammel die Karre gut, bei den Itakern weiß man nie. Wärt ihr doch in den Schwarzwald gefahren und nicht zu … denen.« Ich hätte gerne gegen die Worte meines Großvaters protestiert, aber es wäre sinnlos gewesen. Soweit ich mich erinnerte, hatte er es bis zu seinem Tod nicht verwunden, dass die Italiener im Zweiten Weltkrieg die Seiten gewechselt hatten, weswegen er beteuerte, sein ganzes Leben keinen Fuß in dieses Land zu setzen. Womit sowohl die Italiener als auch wir ganz gut leben konnten.
Ich stieg aus und hieß meine Großmutter willkommen. Als sie so vor mir stand, fühlte es sich völlig normal an, auch wenn ich wusste, dass es eigentlich unmöglich war. »Danke, Alex, das ist lieb von dir«, sagte sie, und drückte mir einen ihrer gefürchteten feuchten Schmatzer auf die Backe, die auch dadurch nicht angenehmer wurden, dass sie dabei ihre stoppelige Wange an einem rieb.
Dann stiegen wir wieder ein, wobei mir als jüngstem Teilnehmer der Reisegruppe der ungeliebte Mittelplatz zugeteilt wurde. Kaum hatten wir uns mehr schlecht als recht eingerichtet, reichte Opa seiner Frau noch eine Tüte und einen Kohlkopf herein.
»Das hat aber wirklich keinen Platz mehr, Vati«, sagte meine Mutter vorwurfsvoll, worauf Oma nur mit den Schultern zuckte: »Die kommt aber mit, Renate, oder wollt ihr etwa keine Marmelade zum Frühstück? Und der Kohl muss weg, sonst schießt er aus.«
Ich verkniff mir angesichts der an eine humanitäre Hilfslieferung erinnernden Proviantmenge im Kofferraum die Bemerkung, dass auch die Italiener sich über die Jahrhunderte ein funktionierendes System der Lebensmittelversorgung aufgebaut hatten, das wie bei uns auf dem Tausch von Geld gegen Waren basierte. Stattdessen schaute ich Oma dabei zu, wie sie sich die Tüte entschlossen zwischen die Beine klemmte und den Weißkohl zwischen die Koffer schob: »Von mir aus könnte es losgehen.«
Papa ließ sich nicht zweimal bitten und wir fuhren an meinem erleichtert wirkenden Opa vorbei, der stramm dastand, als würde er eine Parade abnehmen.
»Und, freut ihr euch auf den Urlaub?«, wollte meine Oma wissen und kniff mir in die Wange. Bei meiner Schwester traute sie sich das nicht mehr, jetzt war ich das einzige Opfer ihrer schmerzhaften Liebesbekundungen.
»Mhm«, erwiderte ich nur, immer noch benebelt von dem, was gerade alles auf mich einstürzte.
Das Ortsschild war schon in Sichtweite, da begann Oma mit ihrem traditionellen Fragenkatalog: »Renate, habt ihr auch die Kaffeemaschine ausgeschaltet?«
»Ja, Mutti.«
»Und den Herd?«
»Natürlich.«
»Die Wohnungstür abgeschlossen?«
»Klar.«
»Garage?«
»Die … hm. Bestimmt.«
»Das klang jetzt aber nicht so sicher.«
»Ich … doch, ich glaube schon, dass …«
»Du glaubst? Meinst du, glauben reicht, wenn die zwei Wochen offen steht, so dass jeder reinspazieren und sich im Haus bedienen kann?«
Zehn Minuten später passierten wir das Ortsschild zum zweiten Mal. Die Garage war tatsächlich abgeschlossen gewesen, wie wir bei der Nachkontrolle festgestellt hatten, Richters waren inzwischen aufgebrochen und mein Vater dementsprechend geladen, so dass sich keiner mehr etwas zu sagen traute. Die gespannte Stille wich allerdings bald dem gleichmäßig entspannten Rhythmus der Atemgeräusche, als nacheinander alle bis auf mich und meinen Vater wegdösten. Mir ging einfach zu viel durch den Kopf.
Eingelullt vom monotonen Nageln des Dieselmotors und den Schlagerklängen aus dem Autoradio, breitete sich in meinem Bauch ein warmes Gefühl aus. Ich war lange nicht mehr bei meinem Vater mitgefahren. Und wenn doch, hatte ich meist schon bei der ersten Kurve mit dem Leben abgeschlossen oder zumindest zu beten angefangen. Ganz anders in diesem Moment: Papa kam mir vor wie der König der Straße. Und obwohl nur ich hinten angeschnallt war, schlummerten die anderen in der Gewissheit, dass er uns sicher durch die Nacht ans Ziel bringen würde. Dieses Gefühl der Geborgenheit, das ich so nur aus meiner Kindheit kannte, umfing mich wie eine flauschige Decke: Mir konnte nichts passieren, mein Papa war ja da. Mit diesem wohligen Gedanken dämmerte ich weg …
»Junge, nun wach doch bitte endlich auf!«
Ich öffnete die Augen und sah in das erschrockene Gesicht meiner Oma. Was war das nur für ein seltsam verschachtelter Traum, innerhalb dessen man offenbar schlafen und wieder aufwachen konnte, ohne in die Realität zurückzukehren. Aber anders als vorher, als mich meine Mutter geweckt hatte, wäre ich nun fast ein wenig enttäuscht gewesen, wenn meine Traumreise geendet hätte, noch bevor sie richtig losgegangen war. »Was ist passiert? Hatten wir einen Unfall?«
»Unsinn«, versetzte meine Großmutter fahrig, »wir sind in Pfronten.«
»Na und?« Ich verstand ihre Aufgeregtheit nicht.
»Komm, nimm deinen Ausweis und mach dir die Haare ein bisschen ordentlich. Wir wollen doch keine Scherereien mit den Beamten …«
»Was denn für Beamte?«
»Na, die an der Grenze!«
»Oma, wir wohnen nicht in Nordkorea, es gibt seit Jahren keine …« Ich verstummte. Natürlich gab es damals noch Grenzen. Also jetzt. Schließlich war es gar nicht so lange her, dass die Schlagbäume in Europa abgebaut worden waren. Warum meine Oma allerdings so einen Wind machte, war mir nach wie vor nicht klar.
»Du solltest schon einen einigermaßen wachen Eindruck machen«, mahnte nun auch mein Vater. Wir hatten angehalten und standen am Straßenrand, am Horizont konnte man die Lichter der Grenzstation erkennen. Nun erst bemerkte ich, dass sich alle, sogar meine Schwester, die Kleidung zurechtzupften und den Schlaf aus den Augen wischten.
Kopfschüttelnd drückte mir meine Oma den grauen Kinderausweis in die Hand, der schon an mehreren Stellen mit Tesa geklebt war. Dann nahm sie ihr Taschentuch, befeuchtete es mit Spucke und wischte mir irgendetwas von der Wange. Angewidert verzog ich das Gesicht.
»So, also, ich fahre jetzt weiter. Schlagt alle eure Pässe auf und haltet sie ans linke Fenster«, befahl mein Vater. »Renate, du gibst mir meinen, wenn ich am Grenzer anhalte, ja?«
»Haben wir denn Schmuggelware dabei? Zigaretten, Gras oder so?«, fragte ich belustigt.
»Wie?«, kiekste Papa mit blassem Gesicht. »Was faselt der Junge, Renate? Der hat doch was, so komisch, wie der sich neuerdings benimmt.«
»Ja, Pubertät heißt die Seuche!«, warf meine Schwester ein. »Eine mehrjährige Reise ins Land der Schwachsinnigen und Gesichtsbaracken.«
»Ich mein ja bloß, weil ihr so nervös seid«, verteidigte ich mich. »Könnte ja sein, dass ihr was Illegales dabei habt.«
Nun drehte sich Mama um, ihre Augen hatten sich zu drohenden Schlitzen verengt. »Alexander, darüber macht man keine Witze. Wenn das der Beamte hört und wir das Auto ausladen müssen, dann kommen am Ende noch die Holländer und überholen uns. Also: Lass jetzt den Unsinn!«
»Renate, ich sehe hier drei Fahrspuren, was meinst du, die linke Pkw-Spur, die mittlere oder die kombinierte Wohnwagen-Lkw-Pkw-Spur? Ich will denen keine Angriffsfläche bieten. Also, ich höre?«
Meine Mutter sah ihren Mann hilflos an.
»Schnellschnell jetzt, bitte.«
»Ist doch egal, Papa. Wir sind weit und breit das einzige Auto«, erlaubte ich mir einen Kommentar, was mein Vater aber nur mit einem Kopfschütteln quittierte.
»Nehmen wir die Mitte, da kann man am wenigsten falsch machen, oder?«
Der Vorschlag meiner Oma wurde ohne weitere Gegenstimmen angenommen.
Wir hatten uns bereits bis auf Sichtweite dem Grenzposten genähert, als mein Vater plötzlich mit voller Wucht in die Eisen stieg: Im Lichtkegel unseres Wagens überquerte ein Fuchs seelenruhig die Fahrbahn, sah gelangweilt in unsere Richtung und trabte noch eine Weile am Straßenrand entlang.
»Ich fahre langsam weiter, ihr behaltet das Vieh im Auge. Wilde Tiere sind unberechenbar und können jederzeit ihre Laufrichtung ändern. Ich habe keine Lust auf einen Totalschaden.«
Mit Schrittgeschwindigkeit fuhren wir kurz darauf an das Zöllnerhäuschen heran. Alle Augen richteten sich auf die Glastür in der Grenzstation, hinter der ein Mann zu erkennen war, der uns jedoch keines Blickes würdigte.
»Nur ja keine Eile, gnädiger Herr«, zischte Papa wie ein Bauchredner zwischen den Zähnen hervor, worauf Mama ihm den Ellbogen in die Seite stieß.
Der Schatten hinter der Tür setzte eine Uniformmütze auf, kam aus seinem Kämmerchen und baute sich mit der ganzen Autorität der österreichischen Gendarmerie vor uns auf.
»Guten Morgen«, rief ihm mein Vater ein bisschen zu laut entgegen.
»Ist Ihnen wohl zu dunkel hier an unserer Grenze?«, fragte der Beamte, ohne unseren Gruß zu erwidern.
»Ich … nein, es ist sehr schön hell.«
»Dann schalten Sie zuerst mal Ihr Fernlicht aus, bittschön. Oder wollen S’ mich absichtlich blenden?«
Papa fingerte am Armaturenbrett herum und erklärte: »Es ist nur, wissen Sie, vielleicht fünfzig Meter von hier hat ein Fuchs die Straße überquert, und durch das grelle Licht wollte ich eine Kollision verhindern.«
»Hm.«
»Übrigens: Es könnte sein, dass das Tier unter Tollwut leidet, nur so als Hinweis. Wenn sich Wildtiere freiwillig so nahe beim Menschen aufhalten, stimmt oft etwas nicht. Da sollte man Vorsicht walten lassen, nicht dass es zu Übergriffen kommt.«
Das Gesicht des Grenzbeamten verfinsterte sich, und wir hielten die Luft an.
»So, na ganz fein, dass uns die deutschen Urlauber schon sagen, was wir mit unseren Viechern machen sollen. Wir haben hier keine Tollwut, nur zu Ihrer Information. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob mit Ihnen alles in Ordnung ist!« Er trat einen Schritt zurück. »Machen Sie bitte den Motor aus, das kann jetzt ein bisserl dauern. Die anderen Ausweise sind in Ordnung, Ihren brauche ich mal bitte, danke.«
Mit diesen Worten nahm er sich Papas Pass und steuerte wieder sein Kabuff an.
Leichenblass kurbelte mein Vater seine Scheibe wieder hoch.
»Prima gemacht, Herr Oberordnungshüter!«
»Renate, ich sag’s dir schon lang, dein Mann redet sich noch mal um Kopf und Kragen«, zischte Oma.
»Toll, jetzt sperren sie Papa ins Gefängnis, und wir verbringen unseren Urlaub im Besucherraum«, meckerte Nicole.
Ich sparte mir einen Kommentar, um die Panik meiner Eltern nicht noch zu befeuern.
»Ach was, der kann mir doch nichts wegen eines Hinweises, der ja durchaus gerechtfertigt ist. Dankbar sollte der mir sein, dieser Alpen-Schupo. Notfalls verlange ich einen deutschen Grenzer, dem werde ich dann schon erklären, wie hier der Hase läuft!«
»Der Fuchs«, entfuhr es mir.
»Das einzige Problem könnte jetzt sein, dass mein Ausweis unter Umständen möglicherweise abgelaufen ist.«
»Dein Ausweis ist … was?«, kreischte meine Mutter. Ich sah ins Grenzerhäuschen, wo der Schatten von vorhin eine grelle Schreibtischlampe anknipste, sich setzte und offenbar über den Personalausweis meines Papas beugte.
»Renate, wenn wir Norbert hierlassen müssen, setz ich mich zu dir vor und mache die Beifahrerin. Wir beide bekommen das schon hin, mein großes Mädchen.«
»Noch bin ich da, Oma«, brummte mein Vater in Richtung seiner Schwiegermutter.
»Norbert, Mutti, bitte fangt nicht wieder an zu streiten. Wir wollen uns erholen.«
Die österreichische Staatsgewalt beendete die familieninternen Scharmützel. Papa kurbelte die Scheibe wieder herunter.
»So, Herr Klein, wo soll es denn hingehen?«, fragte der Mann, der nun doch weniger grimmig aussah als befürchtet.
»Nach Italien. Wir fahren zur Adria«, sprudelte es aus meinem Vater heraus. »Also, wir passieren den Brenner, wollten im Anschluss an der Europabrücke abfahren, aber man könnte da sicher noch mal drüber nachdenken, das bisschen Maut ist es doch wert, nicht wahr? Ja, und dann haben wir ein kleines Häuschen gemietet bei der Agenzia Europa, direkt …«
»So genau wollt ich es eh nicht wissen. Wie lange sind Sie denn dort?«
»Zwei Wochen, wobei wir mit dem Gedanken spielen, aufgrund der zu erwartenden Rückreisewelle bereits am Freitag wieder aufzubrechen.«
»Soso. Ich wünsche gute Fahrt und spannen Sie ein bisserl aus, gell? Sie scheinen’s brauchen zu können. Ach so, und wenn Sie wieder daheim sind, holen Sie sich einen neuen Ausweis, der ist nämlich schon abgelaufen, aber das nur so als … Hinweis. Habe die Ehre!«
Er machte kehrt und verschwand wieder im Häuschen. Völlig perplex sah Papa ihm nach.
»Heißt das, wir können jetzt fahren?«, beendete Oma die Stille im Wagen. Sie schien ein wenig enttäuscht, vielleicht hatte sie sich tatsächlich schon einen Urlaub ohne ihren Schwiegersohn ausgemalt.
Nicole setzte wieder ihre Kopfhörer auf, kaute gleichgültig ihren Hubba Bubba und ließ ab und zu eine Blase platzen.
»Sonst hätte er wohl kaum ›Gute Fahrt‹ gesagt«, bemerkte ich genervt.
»Der Junge hat recht. Das war eindeutig«, stimmte Papa mir zu, doch meine Mutter schien noch Bedenken zu haben.
»Weißt du, Norbert, wenn die uns in Italien dann nicht reinlassen, stehen wir zwischen zwei fremden Grenzen, fernab der Heimat …«
»Genau, dann sind wir im Niemandsland gefangen und kommen nicht mehr raus bis zum Schengener Abkommen«, konnte ich mir eine kleine Spitze nicht verkneifen.
»Schengener … was?«
»Nichts, Papa, fahr einfach.«
Vater ließ den Motor an und schaltete umgehend das Fernlicht wieder ein. »So, wisst ihr was? Genug gezaudert, auf ins Abenteuer! Wir wollen nach Italien, und ich bringe uns nach Italien. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue! Pack die Pässe weg, Renate. Tschau Alemannja und allividerce Italia! Noch eine läppische Grenze, und wir haben’s geschafft.«
Er gab Gas und innerhalb einer knappen Minute hatte unser Wagen seine Reisegeschwindigkeit von einhundertfünf Stundenkilometern erreicht. Auch wenn die Anspannung meiner Eltern wieder ein wenig wuchs, als wir uns dem Brenner und damit der alles entscheidenden Hürde näherten: Mit unbewegten Gesichtern hielten wir, mittlerweile grenzerfahren, den beiden Carabinieri unsere Dokumente hin, und die Genehmigung der Einreise nach Italien wurde durch die kaum wahrnehmbare Bewegung eines südländischen Polizistenfingers erteilt.
Mein Vater hatte das Fenster noch nicht wieder ganz hochgedreht, da sagte meine Mutter mit verklärtem Blick, aber auch ein wenig Angst vor der Fremde in der Stimme: »So, jetzt sind wir in Italien.«
»Ist das wahr?«, antwortete meine Schwester gelangweilt.
»Na ja, streng genommen erst mal Südtirol, aber selbst hier ist der Himmel gleich viel blauer«, erklärte mein Vater, worauf ich meinen Blick durch die Seitenscheibe nach oben richtete, wo sich der Hochnebel immer mehr verdichtete.
Weit kamen wir nicht in diesem so gelobten Land: Mein Vater steuerte die erste Raststation hinter der Grenze an und stoppte den Wagen. Ich stieg aus, gerädert vom langen, unkomfortablen Sitzen, blinzelte ins Morgengrauen unseres ersten Ferientages – und musste unwillkürlich lächeln. Denn obwohl dieser Ort nur aus Beton und Asphalt zu bestehen schien, obwohl links und rechts die schweren Lastwagen und die Autos der anderen Touristen vorbeidonnerten, obwohl sich über die Steinwüste ein ungemütlich nasskalter Nebel gelegt hatte, der so gar nicht nach Sommer, Sonne und Strand aussah – ich fühlte mich sofort im Urlaub. Allen Widrigkeiten zum Trotz verströmte dieser Ort ein heimeliges Gefühl. Dabei hatte ich die bisherigen Versuche meiner Eltern, mich zusammen mit meiner eigenen kleinen Familie zu einer erneuten Fahrt an die Urlaubsstätten meiner Kindheit zu bewegen, allesamt abgeschmettert. Ich fuhr doch nicht mehr mit dem Auto nach Italien, quälte mich über verstopfte Autobahnen, wenn ich in derselben Zeit die exotischsten Orte mit dem Flugzeug erreichen konnte. Und wo war ich nicht überall gewesen: Dubai, Kuba, New York, sogar eine Kreuzfahrt hatten wir schon gemacht.
Doch nirgends hatte ich ein solches Gefühl des Ankommens gehabt wie hier im Transitbereich einer italienischen Autobahn, auf dem Asphalt der Brenner-Raststation. Meine Mutter hatte völlig recht gehabt: Hier begann Italien. Hier begann der Urlaub, den man sich das ganze Jahr herbeiwünschte, wenn man morgens durchs deutsche Schmuddelwetter zur Arbeit fuhr. Und die richtige Erholung setzte ein mit dem ersten Espresso im Autogrill. Schon beim Gedanken spürte ich die feinporige Crema auf der Zunge.
»Kaffee!« Mutter schien meine Gedanken gelesen zu haben, und ich freute mich über dieses stille Einvernehmen. Ich stapfte also los in Richtung Eingang, aber sie rief mich zurück: »Wo willst du denn hin?«
»Na, du hast doch gesagt, es gibt …« Ich verstummte, als ich sah, wie sie den vor Stunden zu Hause aufgebrühten Kaffee in den Deckel der Thermoskanne goss und diesen dann wie einen Wanderpokal von einem Erwachsenen zum nächsten reichte. »Guck nicht so, nimm lieber was zu essen.« Sie zeigte auf die Salami-Butterbrote in der Tupperdose. Ich zuckte die Achseln und nahm mir eines heraus. Warum auch nicht? So schmeckte Italien eben für deutsche Urlauber: nach Jacobs Krönung und Kochsalami. Da ich mit meinem Wunsch, auch etwas vom Kaffee abzubekommen, nur auf ungläubige Gesichter stieß, leerte ich zur Feier des ersten Urlaubstages eine Packung Sunkist Kirsch im himmelblauen Tetrapack.
Benebelt von diesen Sinneseindrücken meiner Kindheit sah ich meinem Vater dabei zu, wie er mit ausladenden Dehnübungen begann, bei denen er nicht nur lächerlich aussah, sondern auch Gefahr lief, sich eine böse Zerrung zu holen. Als er mit seinen schlaksigen Beinen schließlich in eine Art Hopserlauf verfiel und uns alle darauf hinwies, wie wichtig ein wenig »Trimm-dich« auf langen Autofahrten sei, verdrehte meine Schwester die Augen und stellte sich demonstrativ ein paar Schritte abseits. Eine reichlich sinnlose Aktion, denn sie war weiterhin umzingelt von deutschen Urlaubern, deren Autos ebenso bis unter den Rand vollgepackt waren und die ebenfalls in Trainingskleidung neben dem Auto standen und in mitgebrachte Brote bissen. Auf dieser deutschen Urlauberinsel mitten im Verkehrstrubel der italienischen Autobahn waren wir alle gleich.
»Ahh, riecht ihr das?«, rief Papa, zündete sich eine Zigarette an und atmete tief ein. »Das ist Italien!« Ich war eigentlich nicht der Ansicht, dass Italien nach ungefiltertem Diesel und alten Reifen stank, aber ich wusste, was er meinte. »Das ist schon was anderes als daheim«, schwärmte er und zog Mama an sich. Auf Reisen gingen sie zum Leidwesen von uns Kindern immer besonders zärtlich miteinander um.
Plötzlich dröhnte hinter uns eine durchdringende Lkw-Hupe und wir spritzten auseinander. Ein ziemlich mitgenommener Lastwagen mit italienischem Kennzeichen rollte langsam an uns vorbei. Der Fahrer hatte das Fenster heruntergelassen und musterte uns mit verächtlichem Blick, den er mit italienischen Flüchen begleitete. Er schien uns klarmachen zu wollen, dass er es schöner fände, wenn seine Fahrspur nicht von deutschen Sommerfrischlern verstopft würde.
»Gewöhn dich dran«, brüllte ich ihm hinterher. »Wir kommen wieder. Alle. Und jedes Jahr werden wir mehr.«
»Nanana, mein Sohn«, sagte mein Vater mit erhobenem Zeigefinger, »wir wollen es uns doch nicht gleich mit den Eingeborenen verscherzen, hm?«
»Nein, mit den Eingeborenen natürlich nicht, Papa.«
»Was hat er denn eigentlich gesagt, Renate?«
Mama wippte unsicher mit dem Kopf hin und her.
»Renate, du lernst doch Italienisch.«
»Aber erst seit ein paar Monaten.«
»Schon, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt wie eben, solltest du sie unbedingt nutzen. Nirgends lernt man eine Sprache so schnell wie im Ursprungsland.«
Mama schien bereits jetzt zu bereuen, dass sie sich zu dem Italienischkurs angemeldet hatte. »Jaja. So, jetzt gehen noch alle nacheinander aufs Klo, und dann können wir weiter«, lenkte sie vom Thema ab.
»Wieso denn nacheinander?«, wollte Niki wissen.
»Na, wir können das Auto ja schlecht unbewacht lassen, Dummerchen.«
»Wieso denn nicht?« Ich schaute mir unseren bordeauxroten 82er Ford Sierra Fließheck mit seinen Fellsitzbezügen und Zierstreifen aus dem Zubehörhandel an. Ein Dieb hätte diese Familienkutsche im Leben nicht angefasst.
Meine Eltern wechselten einen verständnislosen Blick, da schaltete sich Oma ein: »Junge, jeder weiß doch, dass der Italiener gern mal …« Sie machte dabei eine Handbewegung, als würde sie nach etwas greifen und es dann hinter ihrem Rücken verschwinden lassen.
»Ach so, verstehe, die Eingeborenen. Sind ja alles Gangster und Straßenräuber.«