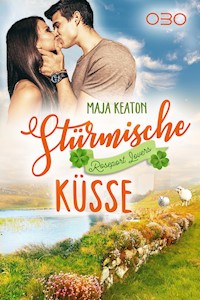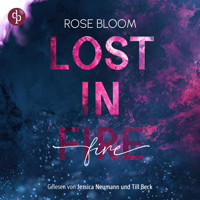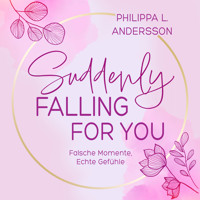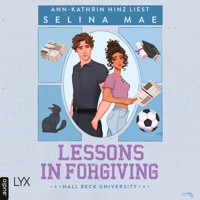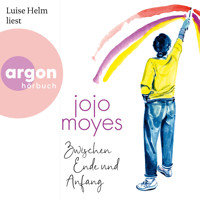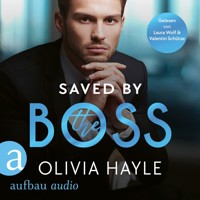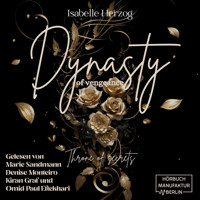15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt mit einem ebenso allgegenwärtigen wie zumeist überhörten Stöhnen: Die Mitarbeiter in der »mittleren Ebene« des IT-Konzerns McWorthy leiden still unter den Zumutungen ihres Jobs. Nie können sie sicher sein, wo sie sich befinden und wohin sie unterwegs sind (oder sein sollten). Letztes Mittel der Selbstbewahrung: die Flucht ins Irrationale. Das Upgrade in die First Class wird zum Lebenszweck; die Opferung eines USB-Sticks zum Karriere-Boost, der eigene Unfalltod im geliebten Cabrio zum irgendwie erleichternden Wunschtraum.
Mit allen möglichen Einbildungen und Fiktionen versuchen die Figuren dieser Erzählungen, sich das Arbeitsleben erträglich zu machen, oder überwinden sich zu neuen Verbiegungen und Unterwerfungen. Unausgesprochen steht hinter allem die Frage: Warum haltet ihr das alles aus?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alles beginnt mit einem ebenso allgegenwärtigen wie zumeist überhörten Stöhnen: Die Mitarbeiter in der »mittleren Ebene« des IT-Konzerns McWorthy leiden still unter den Zumutungen ihres Jobs. Nie können sie sicher sein, wo sie sich befinden und wohin sie unterwegs sind (oder sein sollten). Letztes Mittel der Selbstbewahrung: die Flucht ins Irrationale. Das Upgrade in die First Class wird zum Lebenszweck; die Opferung eines USB-Sticks zum Karriere-Boost, der eigene Unfalltod im geliebten Cabrio zum irgendwie erleichternden Wunschtraum.
Mit allen möglichen Einbildungen und Fiktionen versuchen die Figuren dieser Erzählungen, sich das Arbeitsleben erträglich zu machen, oder überwinden sich zu neuen Verbiegungen und Unterwerfungen. Unausgesprochen steht hinter allem die Frage: Warum haltet ihr das alles aus?
Frank Jakubzik, 1965 in Kassel geboren, übersetzte unter anderem Colin Crouch, Zygmunt Bauman, Gilbert Keith Chesterton und David Foster Wallace. In der mittleren Ebene ist sein Erzähldebüt im Suhrkamp Verlag.
Foto: © Marianne Schneider, Mainz
Frank Jakubzik
In der mittleren Ebene
Erzählungen aus den kapitalistischen Jahren
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der edition suhrkamp 2707.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept
von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
Umschlagabbildung: buenck+fehse, Berlin
eISBN 978-3-518-74886-2
www.suhrkamp.de
Führung
In Feindesland
Epitaph für Hans-Günter Kremers
Oben
Tanzbär
Typologie
Aus dem internationalen Luftverkehr
Regen
Das fliederfarbene Cabriolet
Statement
Die Brücke im Wald
Schrumpfende Margen
Wie Wasser
Lili
Abenteuer in Südamerika
Ein Schwächeanfall
Großvater erzählt vom Krieg: Jakob und Elvira in der globalen Welt
Führung
Damals stellte ich mir Kessler immer in einer Landschaft vor, wie man sie von Wandkalendern kennt, die in Hinterräumen von Tankstellen über in Zetteln zerfließenden Schreibtischen hängen. Prachtvoll blühende Sommerfelder, kobaltblauer Himmel. Der goldene Weizen mannshoch! Im Vordergrund eine frisch asphaltierte Landstraße, auf der ein sportlicher Wagen unaufhaltsam in nie berührte Fernen schießt. Kessler, das Steuer fest in der Hand, die Landschaft kaum beachtend, reibt sich mit dem Zeigefinger die Nasenspitze und denkt natürlich über Schiffner-Sender nach.
Der neue Deutschlandchef war hochgewachsen, schlank und schlaksig, und hatte mit Ende dreißig immer noch mehr von einem Jungen als von einem Mann. Seine Dynamik und sein Selbstvertrauen hatten ihn hochgebracht; er hatte eine Art, den Kopf merkwürdig raubvogelhaft seitlich vorzustrecken und einen mit schiefgehaltenem Gesicht anzusehen, daß einem – ganz gleich, ob er gerade redete oder zuhörte – irgendwie blümerant wurde (und sei es, daß man fürchtete, über seine schlaksige Ungelenkheit lachen zu müssen, was Schiffner-Senders Position keineswegs angemessen und daher kaum ratsam gewesen wäre). Seine Augen blitzten hell, aber auch immer irgendwie verwundert, hinter den Brillengläsern. Er verkörperte geradezu so etwas wie die Leidenschaft für Genauigkeit, und das mußte ihren Vorgesetzten gefallen haben – zumal kein übertriebenes Interesse an tatsächlicher Genauigkeit dahinterstand, sondern nur deren Gestik aufschien. Das sah zugleich versponnen und überzeugend aus – so einen Mann konnten sie gut brauchen!
Wie Kessler selbst war auch Schiffner-Sender ursprünglich Ingenieur gewesen und hatte es vermutlich immer sein wollen, seit er denken und mit Fischertechnik spielen konnte. Aber das Ingenieursein hatte sich als etwas vollkommen anderes herausgestellt, als sie zuvor geglaubt hatten. Fachfremde Aufgaben noch und noch – sie hatten sich als für höhere Zwecke geeignet erwiesen, wie es schien, und es lag nicht in ihrer beider Natur, solchen Rufen zu widerstehen. Im Gegenteil, die Neugierde packte sie wie bei der Erkundung des Funktionierens irgendeiner anderen Maschine, die auf optimalere Werte zu trimmen war. Sie spitzten die Ohren, machten die Augen auf und fanden sich kaum fünf Jahre und ein paar Querversetzungen später im gehobenen Management wieder, wo sie mit anderen halblaut die Köpfe über die Verbohrtheit der Altvorderen schüttelten (ohne es je an Respekt fehlen zu lassen).
Dann war Schiffner-Sender urplötzlich an die Spitze gerückt worden und hatte gleich die Vertriebsmannschaft ganz neu aufgestellt, alte Gebietsschutz-Pfründe hinweggefegt mit nüchterner Rechnerei, und den Saleslemmingen Beine gemacht mit einer Quotierung, die selbst Halbgötter im Vizepräsidentenrang (Murphy zum Beispiel) die Augenbrauen heben ließ.
Jahrelang war, wie die von Schiffner-Sender veranlaßten Erhebungen gezeigt hatten, die Softwaresparte mit gerade mal fünfhundert Kunden ausgekommen, fünfhundert alteingesessenen (zugegeben oft größeren) Kunden bei einer annähernd gleichgroßen Anzahl von Vertriebsmitarbeitern. Wirklich peinlich, mußte man sagen – ein Account pro Salesmann. Selbst wenn es ein größerer war – Mannomann! Man lebte von alter Substanz, alter Größe – während jüngere, schlankere Mitbewerber links und rechts vorbeizogen, indem sie billigere und leichter vermittelbare Lösungen vertickten (und das Geld mit deren nachträglicher Justierung verdienten).
Am Produktportfolio hatte Schiffner-Sender nichts ändern können, das folgte weltweiten Vorgaben. Aber er hatte den Vertrieb in Coldcall-Aktionen gejagt mit einer knallharten Darstellung der Fakten, die allemal wirksamer war als der Wir-sind-aus-Tradition-die-Größten-Quatsch von anno dunnemals. All die arrivierten Vertriebler in ihren schmucken Pullundern und gepflegten Sakkos hatten wochenlang über Kaltakquisen schwitzen dürfen, und die Marketingleute, an deren Spitze Schiffner-Sender Kessler berufen hatte, wurden endlich auf den Mittelstand losgelassen, den sie mit bunteren und zupackenderen Kampagnen befeuern durften.
Seit sie die vornehme Zurückhaltung abgelegt hatten, war die Kundenzahl immerhin auf sechshundertfünfzig gestiegen, viel Kleinzeug darunter, aber das machte ja bekanntlich auch Mist. Es ging schlicht um Marktdurchdringung, um Präsenz. Geld wurde verdient mit Leuten, die sich einmal auf McWorthy-Middleware einließen, hard- und softwareseitig, die sie einmal installierten und jahrelang, jahrzehntelang Kunden waren. Und seine Mittelständler wuchsen ja womöglich, und dann würde man bei denen mehr als nur einen Fuß in der Tür haben und auch mit ihnen richtiges Geld verdienen können.
Wir sind jetzt am Zug, denkt oder jedenfalls empfindet Kessler, legt zur Bekräftigung auch die zweite Hand ans Lenkrad und drückt beide Arme durch. Die goldenen Felder ziehen ungerührt vorbei, schimmern in der Sonne, worin auch, so scheint ihm, eine gar nicht geringe Portion Respekt ihm gegenüber liegt.
Darüber: Himmel, blau wie auf Postkarten, ab und an ein Wölkchen. McWorthy-Land, wenigstens früher mal, in den Sechzigern, als die Firma unangreifbar gewesen war. Und das sollte sie jetzt wieder werden. Und diesmal war er dabei, und zwar vorne dabei, bei einem neuen Aufbruch, der einiges verhieß, auch wenn zugleich an allen Ecken und Enden gespart werden mußte und er den Agenturen Daumenschrauben anlegte, damit sie ihre euphorischen Ideen in seine immer knapperen Budgets einzirkelten. Irgend jemand mußte am Ende immer zahlen; und er wollte es jedenfalls nicht sein. Im Gegenteil: für ihn sollte es noch ein bißchen aufwärts gehen, und da war Schiffner-Sender günstig, wenn auch keiner, an den man sich bedingungslos dranhängen sollte.
Er sieht kurz auf die Armbanduhr, Viertel vor eins, naja, vielleicht Zeit, einen Happen zu essen. Das Radio schaltet sich für eine Stauwarnung ein. Anschließend wird eine Telefonnummer durchgesagt, unter der man sich ein klassisches Musikstück wünschen kann.
Plötzlich verspürt er den Wunsch, anzurufen und Sacre du printemps zu verlangen. Das Stück jagt ihm immer einen Schauer den Rücken hinunter, seit er es letztes Jahr mit Idil in Prag gesehen hat. Aber dann fällt ihm ein, daß er im Handschuhfach eine CD davon hat und es jederzeit selbst abspielen kann. Draußen huscht ein Hase in ein Feld. Oder etwas, das wie ein Hase aussieht. Braunes, wuschiges Fellknäuel. Er schaltet das Radio aus. Ach, Idil!
Wenn er seinen Mann in die New Yorker Büros bekam, würde er demnächst das Gras wachsen hören und die Zukunft aus dem Kaffeesatz der Cappuccinotasse lesen, die er zu jedem Telefonat mit Übersee hinzuziehen würde. Er würde zu nachtschlafender Zeit im Homeoffice sitzen, während der Lichtschein der Straßenlaterne tief in ihren Garten drang und Juttas Zierkirschen in die Skyline Manhattans verwandelte.
Er war da durchaus optimistisch – aber es war alles ungewiß. Bei denen da drüben wußte man nie … Da für die Amis geschäftlicher Erfolg Ausweis des richtigen, gottgefälligen Lebens war (wie Burton ihn vor einem Vierteljahr in Las Vegas in diese billige, neonleuchtende Kapelle gezogen hatte, um ihm wie im Beichtstuhl eine neue unfehlbare Medienstrategie einzuschärfen), bekam man bei dessen Ausbleiben ungebremst die sieben Todsünden an den Kopf geworfen, Faulheit und Trägheit voran. Und zwar in plötzlich gar nicht mehr professionellem, sondern höchst persönlichem Ton, und das war alles andere als lustig. Er hatte das bei seinem Vor-Vorgänger einmal mitbekommen, Steguweit, einem ältlich-freundlichen Bürokraten, dem unter der maßlosen Strafpredigt fast die Sinne geschwunden waren.
Im Grunde waren diese Leute Fundamentalisten einer merkwürdigen (und eigentlich bloß skurrilen) Geld-Religion, die so blöd war, wie es aussah, wenn die CxOs beim Kickoff in Cesar’s Palace mit geballten Fäusten zu Rockmusik über die Bühne hüpften. Aber sie waren eben auch sehr, sehr mächtige Männer.
Draußen schwirren zwei Hasen auf einem schon abgeernteten Feld vorbei. Vielleicht waren das er und Schiffner-Sender. Nach oben gespült als letzte, weil sonst keiner mehr da war. Irgendwie ratlos, irgendwie gefährdet. Vielleicht aber auch nicht, und das Feld erblühte noch einmal von neuem! Und sie waren keine Hasen, sondern Löwen!
Vor ihm taucht eine Tankstelle auf, grün erhoben aus einem Meer wogenden Gesträuchs. Da gab es sicher was zu essen, und telefonieren konnte er auch mal in Ruhe. Sein mobile hatte sich schon seit mehr als einer Stunde nicht mehr zu Wort gemeldet, und so gern er Ruhe hatte und die Landstraße bevorzugte, weil man da besser nachdenken konnte, so gut würde es ihm tun, mal wieder unter Menschen zu kommen.
Als er vorfährt und hält, tritt ein Mann in der Uniform der Tankstellenkette aus dem Verkaufsraum und schlendert zur Kante der Betonschwelle an der Ecke des Gebäudes hinüber. Im gleichen Augenblick durchfährt Kessler die Erinnerung an eine Fahrt mit Dr. Wagner vor zehn oder mehr Jahren. Wagner hatte ihn als Fachreferenten mitgenommen zu einem Meeting mit einem Bankvorstand – damals hatte er schon geglaubt, sein Aufstieg habe begonnen, was sich dann aber als vorläufiger Irrtum erwies. Obwohl alles glattgegangen war, hatte Wagner ihn danach ebenso willkürlich und ungerührt wieder in die Reihen der Subalternen absinken lassen, wie er ihn zuvor herausgegriffen hatte. Auf der Fahrt zu jenem Termin hatte er eindrucksvoll mitbekommen, wie damals Führungsarbeit ging. Sie beruhte auf purer Intuition, reinem Geschwafel, freischwebend eingebildeten Visionen, von denen er sich schon länger gefragt hatte, wo sie eigentlich herkamen, aus welchen Geheimunterlagen die Führungsspitze sie herauslas.
Der Tankwart verschwindet in einem Anbau. Eine Werkstatt vermutlich. Eine Wolke verdunkelt die Sonne und taucht das Tankstellengelände in Halbschatten.
Dr. Wagner war damals bei einem Tankstopp mit einem ölbespritzten Mechaniker im Blaumann ins Gespräch gekommen (das heißt: er hatte es bewußt gesucht), der mit den Händen unablässig an einem Tuch herumfummelte, das kein bißchen sauberer war als seine Finger (ein gleichberechtigter Austausch von hoher Redundanz). Dr. Wagner war unter das Vordach getreten, hatte sich in Männerpose neben den Mann gestellt (der standhaft seinen Lappen knüllte) und hatte in die gleiche Richtung wie dieser (und in eine ganz ähnliche Landschaft wie diese hier) geschaut. Dann hatte er den Mann in beiläufigem Ton gefragt – Kessler hatte mehr oder weniger zufällig nahebei gestanden und es kaum geglaubt –, wie seiner Meinung nach das Wetter werden würde. Und aus der Antwort des Mechanikers, der die schwarzen Schlieren um Nase und Mund seines runzligen Gesichts gelegentlich mit dem Tuch auffrischte, hatte Dr. Wagner dann tatsächlich das entnommen, womit er kurz darauf dem Bankvorstand seinen Weitblick, seine Kenntnis der nahen Zukunft vorzumachen suchte.
Kessler erinnert sich, wie er fassungslos am Tisch saß, als die meteorologische Skepsis des verschmierten Nuschlers im Konferenzraum der Bank als Marktprognose wiederkehrte. Sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit Regen geben, hatte der Mann mit tellurischer Bedenkenträgermiene in derbem Dialekt verkündet – nun machte Dr. Wagner daraus, daß ihnen wirtschaftlich dürre Zeiten bevorstünden, weshalb es nötig sei, die Software zu erneuern, um die Kosten zu senken.
Er hatte damals, so unauffällig es ging und so direkt, wie er es sich traute, über den großen runden spiegelblanken Konferenztisch hinweg in Dr. Wagners sphärisch durchglühtes Gesicht geschaut und gesehen, daß sein Vorgesetzter den phantastischen Unsinn selber glaubte – als säßen überall im Volk schlichte Handwerker mit prophetischen Gaben und visionärem Blick, erdbehaftete delphische Orakel, aus deren Gefasel sich die beste Unternehmensstrategie ableiten ließ.
So also, hatte er damals gedacht – wenn auch erst drei Monate später, als es ihm endlich gelungen war, dem verstörenden Ereignis Sinn zu geben –, so also treffen große Wirtschaftsführer ihre Entscheidungen: aus dem Bauch wildfremder Leute heraus, denen sie zufällig auf der Straße begegnen. – Das war etwas, hatte er beschlossen, das er nie tun würde: Er würde sich an Zahlen und beweiskräftige Unterlagen halten, nicht an Hokuspokus und idiotenbasierte Intuition.
Und entsprechend war es ja für Dr. Wagner auch gekommen, nicht wahr, und jetzt war Schiffner-Sender dran, der bestimmt nicht mit hergelaufenen Leuten quatschte – oder doch, schon, aber ohne aus ihrem Geschwafel Rückschlüsse auf die kommende Marktlage zu ziehen. Ihnen kam dergleichen gar nicht in den Sinn, sie waren ganz anders aufgewachsen, anders geschult. – Er schüttelt den Kopf und läßt den Motor an. Er hat nicht mal Lust, sich dem Mann, der jetzt vor dem Nebengebäude steht und einen Schokoriegel schält, auch nur zu nähern – wer weiß, am Ende sagte der etwas, das sich interpretieren ließ, und dann fiele er schließlich auch noch auf so was herein.
Nein nein, er schlägt das Lenkrad ein und hält auf die Einmündung der Landstraße zu. Im gleichen Augenblick verzieht sich oben die Wolke, flammt der Asphalt um ihn auf wie eine unbezweifelbare Erkenntnis: Es war die Stunde der Ingenieure! Die große Zeit der Nüchternen brach an! Zahlen logen nicht! Da brauchte man nichts zu interpretieren und wie das Hexenwerk sonst noch hieß. Keine Visionen. Außer dem blanken Rausch der Nüchternheit. Kalt wie die Sterne! Er gibt Gas, zügig und entschlossen, wie es sich für eine Führungskraft gehört, und schaltet das Radio ein, um die blödsinnigen Gedanken zu verscheuchen, die verstörende Erinnerung an Dr. Wagner und seine Methoden, und schießt unter dem blauen Himmel mit reichlich hundertzwanzig davon, auf seine nächsten Termine zu, während sich der Uniformierte (stellte ich mir vor) kauend in seine Tankstelle begibt, in deren Hinterraum über einem flüchtig unaufgeräumten Schreibtisch der Kalender eines Reifenherstellers hängt, dessen aufgeschlagenes Blatt (aufgrund einer Nachlässigkeit der italienischstämmigen Putzfrau, deren älterer Sohn an Astigmatismus leidet, noch das vom letzten Monat) eine schnittige Limousine ziert, die vor einem jahreszeitlich passenden Sonnenuntergang davonschießt.
In Feindesland
Die bronzenen Kinne der Taxifahrer, die morgens um halb sechs im Rückspiegel schweben, stehen symbolisch für das, was ich aufbringen muß in diesem Job: eiserne Entschlossenheit. Sie halten sie mir vor, wie um mich an das zu erinnern, was mir fehlt (und trotz aller Kinnigkeit haben es ihre Besitzer nur zum Taxifahren gebracht).
Am dämmrigen Bahnhof immer wieder dieselben Typen: Grobis im Blaumann, picklige Jungs in ihrer verwaschenen Art. Ich kaufe mir ein Frühstück, ich quäle mich in den Zug. Eine junge Frau bückt sich und zieht im Inneren ihrer Stiefelette eine unsichtbare Socke hoch. Ich muß mich beeilen, will pünktlich an meinem Platz sein. Erwarte die Abfahrt des Zuges mit Ungeduld: Schon gleich fangen wir uns (auf der riesigen Bahnhofsuhr) ein paar Sekunden Verspätung ein.
Auch im Zug immer dieselben Typen. Langweiler, die mit dem Leben nichts anzufangen wissen (die nirgendwo wichtig sind). Sitzen sie eben in Zügen. Ich bin der einzige hier, der zittert und brennt, die anderen scheinen vor Ruhe zu platzen. Ich nehme eben gefährliche Jobs auf mich, ich riskiere was! Die andern fahren bloß zur Arbeit.
Mein Gefühl, etwas Besonderes zu tun, etwas, das nur ich tun kann, füllt mich bis zum Kragen. Trotzdem ist daneben noch jede Menge Platz für Unsicherheit, Zweifel, Ängste, Erwartung. Ja, ich bin voller Erwartung: Daß sie gut finden, was ich gemacht hab. Ab-so-fort einen unwiderstehlichen Fachmann in mir sehen. Und dann, sag ich mir, leg ich erst richtig los. Dann ist Schluß mit den Zweifeln (draußen zieht Landschaft vorbei), dann kommt restlos alle Energie dem Produkt zugute.
Habe ich nicht längst schon bewiesen, daß ich in allem gut bin, was sie von mir verlangen? Irgend etwas scheint sie noch abzuhalten, irgend etwas läßt sie zögern. Vertraut mir nur, möchte ich sagen (wortlos am liebsten, durch verständigen Augenaufschlag), und dann sollen sie einander ansehn, nicken und ventilieren: Weißt du was, der Mann hat recht! Und dann geben sie mir die Unterlagen und gehen raus und lassen mich machen. Und dann komm ich mit einer blendenden Lösung und sie klopfen mir auf die Schulter und drängen mir Geld auf.
So in etwa stell ich mir das vor: Sie mit ihren Problemen und Wünschen und Bedürfnissen, und ich in meinem stillen Kämmerlein, wo ich Lösungen ausarbeite. Nach Monaten komme ich wieder hervor und sie staunen und freuen sich (und bewundern mich ein bißchen). So wäre ich gern: ein Genie. Aber dazu gehören natürlich immer zwei. Einer, der es ist, und einer, der es erkennt. Kannst noch so genial sein, wenn es keiner sieht, bleibt es eine einsame Sache!
Bei der Einfahrt in die Tunnel (es gibt viele auf der Strecke) hebe ich manchmal den Kopf, aber nicht immer. Kommt drauf an, ob ich noch Unterlagen lese. Dann rauscht das Dunkel über mich hinweg und ich zieh ganz unbewußt den Kopf ein (oder es kommt mir so vor) und denke: Hoffentlich erwischen sie mich nicht. Bei einer Unkenntnis oder den kleinen Fouls, die man immer begeht. Dann träume ich eine Zeitlang, ich wäre ein Agent mit geheimem Auftrag, der in einem gefährlichen Zug durch die Welt rast und wegen seines hellwachen Scharfsinns von niemandem zu fassen ist. Und dann ist der Tunnel vorbei, die Welt hellt wieder auf und ich schrumpfe noch ein bißchen zusammen, weil mir einfällt, daß ich ihnen jetzt wieder ein Stück näher gekommen bin (worauf ich mich den Rücken durchzustrecken zwinge).
Das Wichtigste wäre mir die Zuneigung und das Vertrauen des Kunden (nicht etwa Professionalität). Sie müssen mich ja nicht persönlich mögen (bin manchmal kratzbürstig, um meine Glaubwürdigkeit zu erhöhen), sie sollen nur meine Arbeit bewundern! Aber sie zeigen das nicht. Es scheint zu ihrer Vorstellung von Professionalität zu gehören, weder Zuneigung noch Vertrauen zu zeigen. Ich denke, sie spiegeln da einfach wider, wie der Weltkonzern, bei dem sie arbeiten, ihnen begegnet.
Irgendwann sind wir in Stuttgart: Aussteigen, umsteigen! Letztes Gerenne über einen hochflinken vollgelaufenen Bahnhof. Danach kommt nur noch Provinz. Gern flanierte ich hier weiter unter all den Busineßmännern mit weißen Hemden und Aktentaschen und verschwände in irgendeinem namenlosen Büro, wo mich niemand kennt. Aber ich muß in die Provinz, weil es für den Weltkonzern billiger ist.
All diese Leute, die sich da in dem Meetingraum versammelt haben, hätte ich in der Schule gehaßt, denke ich. Es sind genau die Selbstverständlichtuer, die die Oberstufe überfluteten. Ich tat erfolgreich so, als existierten sie nicht, strich sie als völlig unbedeutend aus meinem Bewußtsein – und hier erwarten sie mich wieder. Sie sind der Auftraggeber, ich der Lieferant, sie schwelgen in Sicherheit, ich bin ein kleines buckliges Männlein, das um Anerkennung kämpft. Die ganze Oberstufe über ihre an nichts Anstoß nehmenden Gesichter, ihre Klamotten, in denen sich nur eins ausdrückte, dafür aber immer wieder: die Bereitschaft, alles normal finden zu wollen. Die Arbeit an ihrer Sensibilisierung gab ich früh auf: Da war nichts zu machen. Jetzt sitze ich ihnen wieder gegenüber, und sie sind noch genau die unempfindlichen Sieger, die sie immer waren. Wahrscheinlich fühlen sie dumpf, daß sie die Mehrheit sind und man ihnen deshalb nichts anhaben kann. Und mühen sich nach Kräften, immer in der Nähe der Mehrheit zu dümpeln, unbeweglich bis zum Rand völliger Starre. Nur manchmal verfallen sie in hektische Scheinaktivität, wenn sie das Gefühl haben, sich von der Mehrheit zu entfernen. Rudern mit allem, was sie haben, zu ihr und in sie zurück. In ihren sicheren, mutterleibsartigen Schutz, wo sie dann weiterdämmern und alles normalfinden können.
Vor allem nehme ich ihnen übel, daß sie mich damals nicht beachtet und heute recht damit gehabt zu haben scheinen. Und mich abermals nicht beachten. Alles, was ich tue, ist ihnen scheißegal. Solange es ihnen nicht hilft, in ihrer Scheiß-Herde zu bleiben, in der sie multiplizierte Einzelwesen sind und bleiben, die einander zutiefst mißtrauen – weil sie dieselben Ziele haben, für die sie einander brauchen und die sie gemeinsam nie erreichen werden – und die einander niemals wirklich begegnen, da sie immer nur angstvoll den Blick abwenden und sich einzureden suchen, sie selbst bestimmten, wo sie sind und was sie tun. Und jetzt stehe ich hier vor lauter solchen Leuten, die mich skeptisch ankucken und argwöhnisch erst mal alles anzweifeln, was ich ihnen auftischen will, weil ich Lieferant bin – und Lieferanten sind faul und genügsam, verständnislos und betrügerisch, sie suchen einen reinzulegen, wo sie können, man kann ihnen keinen Schritt weit über den Weg trauen.