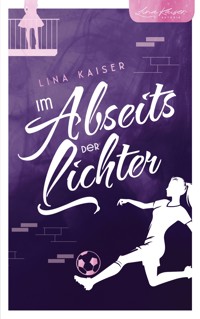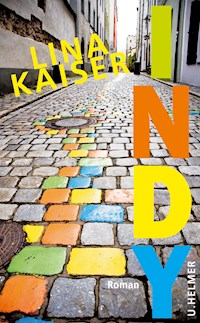
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Früher hat Maya von einem Leben als Abenteuerin geträumt, doch nun, mit Mitte zwanzig, steckt sie in einer Sinnkrise. Da steht plötzlich Pia vor ihrer Tür – mit beängstigenden Nachrichten von Noemi, einer gemeinsamen Freundin aus Kindheitstagen. Die Suche nach Noemi führt die beiden jungen Frauen auf verschlungenen Wegen bis nach Rom und zu überraschenden Erkenntnissen … LINA KAISER (frauverliebt) erzählt vom Abenteuer, den eigenen Platz in der Welt zu finden. Ihre ›Heldinnenreise‹ sorgt für Spannung und Herzklopfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
0 Narr
I Magier
II Hohepriesterin
III Herrscherin
IV Herrscher
V Hohepriester
VI Die Liebenden
VII Der Wagen
VIII Gerechtigkeit
IX Eremit
X Rad des Schicksals
XI Kraft
XII Der Gehängte
XIII Tod
XIV Mäßigkeit
XV Teufel
XVI Turm
XVII Stern
XVIII Mond
XIX Sonne
XX Das Gericht
XXI Die Welt
ISBN (eBook) 978-3-89741-949-0
ISBN (Print) 978-3-89741-428-0
© 2019 eBook nach der Originalausgabe© 2019 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Roßdorf b. DarmstadtAlle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NLunter Verwendung der Fotografie »Bunte Steine in der Stadt«, © Copyright Astonishing / photocase.de
Druck und Bindung: cpi, Leck
www.ulrike-helmer-verlag.de
Für alle guten Freundinnen,die mit mir ein Stück gegangen sind oder es noch immer tun.
0 Narr
Hier war das Ende. Ihr Blick folgte dem weißen Markierungsstreifen, der sich an der Bahnsteigkante entlangzog. Als Warnung vor einem möglichen Sturz, vor dem harten Aufschlag, gebrochenen Knochen und dem unaufhaltsamen Zug. Die junge Frau trat einen halben Schritt vor, bis ihre Schuhspitzen die Linie berührten, die dazu noch geriffelt war, damit auch Blinden der unmissverständliche Hinweis nicht entging.
Wie sagte Hesse? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und dem Ende? Nur ein kurzer Blick über die Schulter genügte, um die Antwort zu wissen: Desillusion.
Hektische Menschen in der Bahnhofshalle, Penner, die in Mülleimern nach Pfandflaschen stocherten, wenige Meter von ihr entfernt eine zankende Familie. Der Vater, dickbäuchig und kahlköpfig, die Mutter mit Schweiß auf der Stirn und Flecken unter den Achseln, einen quengeligen kleinen Jungen an der Hand. Daneben ein Mädchen, vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Sie trug einen pinkfarbenen Rucksack, darauf eine dieser Disney-Prinzessinnen mit riesigen Augen und blonden Haaren. Eine dieser Figuren, die Mädchen glauben machten, ihrem Leben stünden spannende Abenteuer und die wahre Liebe bevor. Große Geschichten eben, Happy End inklusive.
Überall waren Geschichten. Jede hatte einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Die des Obdachlosen, der gerade seinen kompletten rechten Arm in einem Altglasbehälter versenkte, erzählte vom sozialen Absturz, von Aufgeben und trotzdem Weiteratmen. Wer wusste schon, wie nah sie ihrem Ende war oder eventuell eine dramatische Wendung nehmen würde: Läuterung der gescheiterten Existenz. Oder doch Tod in einer Winternacht nahe dem Bahnhof Zoo? Sie konnte es vor ihrem inneren Auge sehen. Genauso wie die Geschichte der beiden Streithälse, die in der Hitze ihres Wortgefechts ignorierten, dass ihr Sohn schrie und weinte. Im Geist sah sie, wie die beiden sich früher geliebt hatten, vorsichtig und darauf bedacht, das zarte Band zwischen ihnen nicht versehentlich zu zerreißen. Sie malte sich aus, wie dann der Alltag gekommen war mit all seiner Langeweile, und wie verlockend es plötzlich wurde, nicht mehr vorsichtig zu sein. Als versuchter Aufbruch in wieder innigere Zeiten kamen schließlich die Kinder. Und in ein paar Monaten folgte vermutlich die Scheidung.
Das Mädchen mit dem Rucksack schnappte ihren Blick auf. Etwas in der Brust der Frau zog sich schmerzhaft zusammen. Sie sah in die blauen Kinderaugen, sah einen Anfang in reinster Blüte und sie sah – nichts. Rein gar nichts. Warum legten andere ihr ganzes Glück in Kinder? Warum bürdeten sie ihnen so viel Hoffnung auf? Sie selbst hatte als Kind auch solche Rucksäcke getragen und an fiktive Helden geglaubt. Erwachsene machten Kindern Illusionen, nur um ihnen später zu sagen, dass sie sich von ihren naiven Vorstellungen verabschieden sollten. Dass sie der Realität ins Auge zu blicken hatten. Dass ihre geliebten Geschichten nicht echt waren. Was waren Kinder anderes als Träume, die zerplatzen mussten?
Ihre Füße schoben sich über die weiße Linie. Während ein Rauschen den einfahrenden Zug ankündigte und sich ihre Augen von dem Mädchen lösten, spürte die junge Frau mehr denn je, was sie an den Rand des Abgrunds getrieben hatte.
Hier war das Ende.
I Magier
Die Sonne durchdrang den milchigen Film aus Schmutz und Wasserflecken. Mayas halbgeöffnete Augen folgten ihren hellen Strahlen. Freundliches Licht fiel durchs Fenster, erfasste die feinen Staubkörner in der Luft, erhellte die vielen zerknüllten Taschentücher auf dem Dielenboden und tauchte alles in den warmen Schein ätzender Ironie.
Mayas Blick schweifte langsam über das Chaos um sie herum und blieb an der Jack-Daniels-Flasche hängen. Der Anblick machte ihr den pappigen Geschmack auf der Zunge erklärlich. Auch neben der Flasche lagen Taschentuchknäuel. Zwischen der roten Couch und dem Tisch neben der Wohnküche glänzten Glasscherben. Vor ein paar Stunden war das noch ein Rotweinglas gewesen. Inmitten der Splitter: ein Fotorahmen mit dem Gesicht nach unten. Immerhin, die zu dem Weinglas gehörende Flasche stand vollkommen intakt, wenn auch fast leer neben der Couch, auf der Maya auf dem Bauch lag und sich umsah. Ihre Augen schielten über die Flasche hinweg zum CD-Regal, vor dem ein Haufen schwarzer Splitter lag, ursprünglich eine Schallplatte.
Maya wälzte sich auf den Rücken. Das Sofa knarrte unter ihrem Gewicht. Mit einer Hand fuhr sie sich über die klebrig-feuchte Stirn. Ein Stöhnen schlich sich über ihre Lippen. Sie würde aufstehen müssen. Würde den ganzen Mist wegräumen müssen. Langsam richtete sie sich auf, mehr ging nicht. Es war furchtbar warm hier unter dem Dach, die Wohnung heizte sich im Sommer auf wie ein Backofen. Ein Ofen zum Menschengaren. Das Haar pappte im Nacken, die Haut war von einer schmierigen Schweißschicht bedeckt. »Widerlich«, murmelte sie leise, während sie an sich herabschaute. Auf dem weißen Top saßen Rotweinsprenkel. Sie sah weg, als erstes wieder den Fotorahmen auf dem Boden.
Plötzlich wurde ihr Körper von einer ungeheuren Wut erfasst. Mehr oder minder schwungvoll erhob sie sich von der Couch und humpelte zwischen den Scherben hindurch zu dem Bild. Das Glas lag in tausend Teilchen vor ihren Füßen, aber der Rahmen war ganz geblieben. Als sie ihn aufhob, sah sie sich selbst in die Augen. Ihre Haut war gebräunt und das blonde Haar sommerlich ausgeblichen. Mit ihrem Reiserucksack auf dem Rücken wirkte sie regelrecht sportlich. Und glücklich.
Anders als die Person neben ihr. Chris stand da, die Hände in den Taschen der Shorts, eine teure Sonnenbrille im Gesicht, aber trotz der heißen Sonne von Rhodos schien das Lächeln wie gefroren. Maya bemerkte das zum ersten Mal. Bisher stand dieses Lächeln immer für Coolness, vielleicht hatte sie es deshalb als schön erachtet. So unantastbar. So kalt.
So eisigkalt.
»Hast du es damals schon gewusst?«, zischte Maya Chris’ Abbild entgegen. Doch das lächelte stur weiter. »Hast du damals schon gewusst, dass dir meine Welt zu klein ist?!« Nun brüllte Maya und ehe sie sich versah, begannen ihre Finger das Foto zu zerreißen, erst einmal quer durch, dann in immer kleinere Stücke, bis von dem Lächeln nichts mehr übrig war. Die Fotoschnipsel flogen zu den Scherben am Boden. Ein paar Tränen tropften hinterdrein. »Verdammte Scheiße!« Maya wischte sich mehrfach durchs Gesicht. Langsam sank sie hinunter und hockte sich mitten zwischen die kaputten Dinge.
Die Klingel riss sie aus ihrer Lethargie. Irritiert fuhr sie herum und starrte durch den Flur zum Eingang. Wer konnte das sein? Die Post? Nein, die kam freitags früher. Ein Nachbar? Hoffentlich nicht. Sie blieb stumm auf den Dielenbrettern sitzen und hoffte, der Mensch, der da klingelte, habe sich nur vertan.
Es läutete erneut. Ein Ziehen fuhr durch ihren Bauch. Und wenn es Chris war? Konnte das sein? Nein, es war gerade mal zwölf, für Chris also viel zu früh.
Nun klopfte es auch noch. Maya hielt die Luft an. Da wollte irgendjemand offenbar wirklich zu ihr und stand schon vor der Wohnungstür. Das versetzte sie in eine Art Schockstarre. Sie durfte keinen Mucks machen. Sie war gar nicht zu Hause.
»Hallo?«
Es folgte erneutes Klopfen. Die Stimme gehörte einer Frau. Nicht Chris. Kein Grund, sich aus der Starre zu lösen.
»Ich könnte schwören, ich habe gerade jemanden da drinnen gehört«, sagte die Stimme. Wie aufdringlich, ging es Maya durch den Kopf. »Vielleicht bist du ja auch nicht da. Keine Ahnung«, redete die Frau weiter, ganz dumpf, als würden ihre Lippen fast das Holz berühren. Dann vernahm Maya ein Rascheln, ein Knacken und kurz darauf ein kratzendes Geräusch. Unter der Wohnungstür wurde ein Zettel durchgeschoben. Mit pochendem Herzen verfolgte sie, wie Schritte sich entfernten. Sie wartete noch ein paar Sekunden, dann kroch sie leise zu dem gefalteten Papier, das unter dem Türschlitz hervorlugte.
Ruf mich mal an, es geht um Noemi, stand in flüchtiger Schrift auf dem Bogen, darunter eine Telefonnummer. Unterzeichnet mit Pia. Ungläubig schüttelte Maya den Kopf und erhob sich. Die Bewegung entlockte den alten Dielen ein verräterisches Knarren, das ihr durch Mark und Bein fuhr.
»Aha!«, hörte sie da auch schon aus dem Hausflur schallen. Wieder klopfte es an der Tür. »Du bist wohl doch da!«
Innerhalb einer Sekunde überschlug Maya ihre Möglichkeiten. Konnte sie sich weiter tot stellen, bis die Person endlich verschwunden war, oder musste sie aufmachen? Obwohl hier alles so furchtbar aussah, sie und die ganze Wohnung, in der es stank wie in einer gammeligen Kneipe?
Aber dieser Zettel. Noemi und Pia.
Langsam legte sie die Hand auf die Klinke und während sie sich noch schnell ein paar Strähnen aus dem Gesicht wischte, öffnete sie schließlich die Tür – einen kleinen Spalt zumindest.
Dort stand eine junge Frau in knallrotem T-Shirt, brauner kurzer Hose und Flip-Flops. Etwas größer und auch in sichtlich besserer Verfassung als sie, mit einem breiten Grinsen im leicht geröteten Gesicht, das umringt war von einer beachtlichen Mähne hellbraunem Haar.
»Maya Haak – du bist es wirklich!«, rief die Frau in einer Mischung aus Erstaunen und Freude.
»Pia Leutmann«, stellte Maya trocken fest.
»Und du erkennst mich sogar noch! Nach all den Jahren!«
Wie auch nicht, schoss es Maya durch den Kopf. Zwar trug Pia die Haare nicht mehr rot gefärbt, aber dieses volle Lachen und diese markante, laute Stimme lösten sofort das Gefühl aus, um zehn Jahre zurückversetzt worden zu sein.
»Du siehst mich an, als wäre ich ein Geist«, sagte Pia, öffnete ihre Umhängetasche und zog einen Briefumschlag hervor. »Tut mir auch leid, dich so zu überfallen, holterdiepolter, ohne Vorwarnung – aber ich hab Wichtiges mit dir zu besprechen!« Sie wedelte mit dem Umschlag. »Lässt du mich rein?«
Rein? Die Verwirrung, mit einem Schlag Pia gegenüberzustehen, wich akuter Nervosität.
»Eigentlich ist gerade total schlecht«, stotterte Maya. Ihr Blick huschte kurz in Richtung Wohnzimmer.
»Du siehst ziemlich verpennt aus«, kicherte Pia. »Aber das macht überhaupt nichts. Lass uns einfach kurz reden.«
Das Grinsen schwand aus dem Gesicht ihrer unerwarteten Besucherin, als Maya den Türspalt spontan verengte, aber was blieb ihr übrig? Pia war drauf und dran, einfach in die Wohnung zu spazieren.
»Also mir geht es gerade nicht so gut«, sie musste sich um ein Krächzen ihrer Stimme nicht mal bemühen.
Pia ließ nicht locker. »Okay, tut mir leid – aber es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss mit dir reden. Jetzt. Ich konnte keinen Tag später kommen. Dieser Brief ist von Noemi. Er geht auch an dich.«
Maya schielte auf den Umschlag. Wer verschickte denn heutzutage noch Briefe? Wobei … zu Noemi würde das vielleicht sogar passen.
Pia trat noch einen Schritt vor und Maya gab auf. Sie ließ die Tür angelehnt, huschte voraus ins Wohnzimmer, riss die Fenster auf, klaubte ein paar Taschentücher vom Boden und schmiss sie in den Mülleimer. Dann kramte sie das Kehrblech unter der Spüle hervor und begann die Scherben zusammenzufegen. »Ich war gerade am Aufräumen. Guck dich bitte einfach nicht um«, bat sie, ohne aufzuschauen. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn.
»Hast du eine Party gefeiert?«, hörte sie Pia lachen, die ihr ohne Zögern gefolgt war und sehr wohl den Blick durch den Raum schweifen ließ. Maya beantwortete die Frage lieber nicht, sondern beeilte sich mit dem Kehren. »Abrissparty, scheinbar«, murmelte Pia und blieb vor dem CD-Regal neben dem Fernseher stehen. »Gar nicht schlecht, deine Auswahl!«
»Hm?«
»Du hörst auch The Smiths, ich liebe die! There is a light that never goes out …«
»Sind nicht meine CDs.«
»Oh.« Als Pia sich von dem Regal wegdrehte, trat sie auf die Überbleibsel der Schallplatte. »Hupps! Ich hoffe, das war auch nicht deine!«
Maya winkte ab. »Möchtest du was trinken?«, spulte sie die passende Höflichkeitsformel ab, während sie das Blech in den überquellenden Müll leerte. »Ich habe allerdings nur Wasser. Leitungswasser«, fügte sie leise an.
»Ich nehme das da!« Pia zeigte auf den Whiskey. Maya rang sich ein Lächeln ab, während sie die Flasche schnell ins Regal räumte. »Im Ernst, ich nehme ein Gläschen!« Schwungvoll ließ Pia sich in die Lederpolster fallen. »Ein Sofa am Küchentisch. Witzig! Und überhaupt – was für eine tolle Wohnung! Altbau, total hell, mitten in Köln. Wie hast du die nur bekommen?«
»Beziehungen«, antwortete Maya. Mit zittriger Hand schenkte sie erst ein Glas Whiskey und dann eines mit Wasser ein.
»Und da hinten sind noch zwei Räume! Du wohnst bestimmt nicht alleine hier?«
»Doch.«
»Das kannst du dir leisten?«
»Eigentlich nicht.«
»Wie geht das dann?«
»Bis vor ein paar Tagen habe ich hier noch nicht alleine gewohnt.« Sie stellte Pia den Whiskey hin und blieb unschlüssig neben dem Tisch stehen. Pia nickte bedächtig, ihre Mundwinkel zeigten leicht nach oben. Maya schaute weg. Ihr war heiß, sie fühlte sich ausgedörrt, stinkig und überaus erbärmlich.
»Chris ist also ausgezogen.«
Die Bemerkung ließ Mayas Gesichtszüge entgleiten. »Woher …?« Bevor sie weiterfragen konnte, wies Pia auf die Schiefertafel, die an der Küchenwand hing. »Chris holt Sachen um 15 Uhr«, las sie vor. »Totenkopf und gebrochenes Herzchen.«
Peinlich berührt schaute Maya zu der Kreidenotiz und den beiden schlechten Kritzeleien.
»Deswegen geht es dir nicht so gut und deswegen liegt neben mir ein Haufen benutzter Tempotaschentücher.«
Maya antworte nicht, griff aber schnell nach den Tüchern und stopfte sie auch noch in den Müll.
»Na, dann erst einmal Prost«, durchbrach Pia das Schweigen und reckte den Whiskey in die Höhe. Maya leerte ihr Wasserglas in einem Zug, dann entschuldigte sie sich schnellen Schrittes in Richtung Bad.
Es fühlte sich verboten gut an, den Schlüssel herumzudrehen. Sie würde hier auf dem Klo sitzen bleiben und erst wieder herauskommen, wenn ihr ungebetener Gast weg war. Keine Sekunde früher.
Nach dem Toilettengang wusch sich Maya umständlich die Hände, dann das Gesicht, ließ sich kaltes Wasser über die Unterarme laufen und trank noch einige Schlucke direkt aus dem Hahn. Regungslos verfolgte sie im Spiegel, wie ihr ein paar Tropfen über Stirn und Wangen liefen.
Sie sah einfach schauerlich aus. Ihre Lider waren geschwollen, die Lippen spröde. Die kleine Narbe über der Oberlippe, die an guten Tagen kaum sichtbar war, hob sich weißlich von der Haut ab. All das hätte sie gar nicht weiter gestört, wäre sie nicht überfallen worden. Aber in diesem Augenblick saß Pia Leutmann dort drüben in ihrem Wohnzimmer, sah sich schamlos alles an und hatte angeblich wichtige Nachrichten im Gepäck.
Pia Leutmann!
Eine Person, die sie jahrelang nicht mehr gesehen hatte; und dabei hätte es auch gut bleiben können. Selbst damals hatte sie sie nicht gerne gesehen. Eigentlich hatte Pia schon immer dem Leben angehört, das Maya hinter sich lassen wollte.
Wie anders sie heute aussah.
Ob sie dasselbe von ihr dachte? Wahrscheinlich hatte Pia sich bei ihrem Anblick erschrocken. Woher wusste sie überhaupt die Adresse? Völlig skurrile Situation.
Schnell putzte Maya die Zähne, bürstete sich das strähnige blonde Haar, band es zu einem kurzen Zopf zusammen und prüfte erneut ihr Bild im Spiegel. Da war nichts zu machen. Sie sah immer noch aus wie eine traurige Gestalt, die die vergangene Nacht mit Jack Daniels und Co. verbracht hatte. Bis Chris später hier aufkreuzen würde, war noch einiges tun.
Als sie in einem frischen Tanktop und Shorts zurück ins Wohnzimmer kam, begutachtete Pia gerade die Fotos im Regal. Maya trat mit verschränkten Armen neben sie.
»Deine Eltern«, kommentierte Pia und zeigte auf ein Bild von einem bebrillten Mann mit grauem Schnauzer und einer kleinen Frau mit geröteten, rundlichen Wangen. »Von ihnen habe ich übrigens deine Adresse.«
Maya blinzelte verwirrt. »Du hast mit meinen Eltern gesprochen?«
»Nur kurz. Woher sollte ich sonst wissen, wo du wohnst.«
»Aber …«
»Ich hab mich noch erinnert, dass dein Vater Professor hier an der Uni ist. Einmal googeln und du kriegst alles, was du brauchst. Übrigens finde ich es megacool, dass deine Mama Yoga-Lehrerin ist. Yoga wollte ich immer schon machen.«
Pia schenkte ihr ein zufriedenes Lächeln und wandte sich wieder den Fotos zu.
Ihre auskunftsfreudigen Eltern hatten es nach der Herausgabe ihrer Anschrift also nicht einmal für nötig gehalten, sie vorzuwarnen. Typisch!
»Und das ist?« Pia zeigte auf das Foto eines jungen Mannes mit Bart, Pferdeschwanz und dichten Augenbrauen, der ihnen fröhlich entgegenzwinkerte.
»Titus. Mein Bruder«, gab Maya Auskunft, ohne den genervten Tonfall aus ihrer Stimme zu filtern.
»Ach, warte! Wart ihr nicht die beiden Kinder, die danach benannt wurden, wo sie gezeugt worden sind?«, lachte Pia.
»So in etwa … Ich habe meinen Namen der alten Maya-Kultur zu verdanken, meine Eltern waren bei Ausgrabungen in Chiapas dabei. Titus ist der Name eines römischen Kaisers.«
»Also stammst du aus Südamerika und dein Bruder ist Italiener«, feixte Pia. Maya ließ den Brüllwitz unbeantwortet. Schon zu Schulzeiten hatte sie es bereut, diese Anekdote über ihre Familie je erzählt zu haben. Dabei hatte sie damals nicht ahnen können, dass der alte Schulhof-Schlager ihr noch zehn Jahre später nachgesungen würde. Mayas Augen huschten von den strahlenden Gesichtern ihrer Familie hinüber zu Pias. Es hatte eine beneidenswerte Bräune. Dagegen sehe ich richtig käsig aus. Kein Wunder, so selten, wie sie diesen Sommer vor die Tür gekommen war.
Aber es war nicht nur die Hautfarbe, die ihr auffiel. Pia hatte in den vergangenen Jahren offensichtlich einige Veränderungen durchgemacht. Ihr Gesicht war schmaler und weniger pauswangig, das Kinn fügte sich weicher ins Gesamtbild ein. Zudem fehlten die beiden Piercings in Augenbraue und Nase, die sie zu einem besonders coolen Teenager gemacht hatten – zumindest hatten andere das so empfunden. Maya hingegen war keine Freundin zerstochener Körperteile. Doch während sie Pia so von der Seite beobachtete, tat es ihr fast ein wenig leid um den verschwundenen Brauenschmuck. Er hatte Pias fein geschnittene Augenpartie schön betont.
Wie diese Augen in diesem Moment jedoch private Schnappschüsse studierten, löste in Maya Unbehagen aus. Demonstrativ wandte sie sich ab und ging zurück zum Küchentisch.
»Also warum genau stehst du wie aus dem Nichts vor meiner Tür?«
»Ich muss mit dir über diesen Brief von Noemi reden. Er liegt auf dem Tisch.« Pia machte keine Anstalten, sich von Mayas Familienfotos abzuwenden.
»Ich habe aber ewig nichts von Emi gehört«, antwortete Maya, die Pia immer noch unwirsch beäugte.
»Ich auch nicht. Der Brief kam völlig überraschend. Oh cool, seid ihr da in Ägypten?«
Maya ließ die Hoffnung fahren, dass Pia endlich aufhören würde, ihre Sachen zu beglotzen. Sie angelte sich den Brief, zog ihn aus dem Umschlag und begann zu lesen.
Liebe Pia!
Du wunderst Dich sicher, einen Brief von mir zu bekommen. Es muss sich anfühlen, wie die Nachricht eines Geists zu lesen.
In meinem Kopf bist auch Du nicht mehr als ein Geist aus vergangenen Tagen. Ein Mädchen von sechzehn Jahren, den Kopf voller Quatsch und fliegender Träume. Bist Du heute noch so?
Stell Dir vor, ich sitze an meinem Schreibtisch und habe vor mir zwei Fotos liegen. Eines von Dir und mir, nach dem Sommerkonzert der Musikschule 2005. Weißt du noch? Wir sehen schrecklich aus, so überschminkt und in viel zu engen Kleidern. Aber wie wir strahlen … Wir waren damals ziemlich fröhlich, oder?
Das andere Bild zeigt mich mit Maya Haak. Der Name sagt Dir doch noch was? Kindergarten, 1995. Wir haben uns verkleidet in der Puppenecke und lachen vergnügt. Maya hätte ich auch gerne geschrieben, aber ihre Adresse habe ich leider nicht. Vielleicht kannst Du ihr irgendwie weiterleiten, was ich Euch wissen lassen möchte? Es wäre eine schöne Botschaft, wenn der Anlass nicht so ein trauriger wäre.
Ich denke heute noch manchmal an den Abend am Dom. Lies jetzt bitte keinen Vorwurf darin. Wir waren so jung. Alles lag noch vor uns. Seitdem sind bald genau zehn Jahre ins Land gezogen, und ich wünsche Euch sehr, dass Eure Bilanz besser ausfällt als meine! Um ehrlich zu sein, liebe Pia, habe ich nichts von dem wahrgemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Gar nichts. Und jetzt schaue ich hinab auf ein Scherbenmeer, in dem ich glaube, ertrinken zu müssen.
Da ich davon ausgehe, dass wir uns in diesem Leben nicht noch einmal wiedersehen werden, wisst bitte: Ihr beide wart die besten Freundinnen, die ich jemals hatte.
Lebt wohl! Eure Noemi
Mayas Augen wanderten ein zweites Mal über Noemis schön geschwungene Handschrift. Die paar Zeilen waren der Grund, warum Pia ihr die Tür einrennen musste? Sie fühlte ihre Schläfen pochen. Langsam ließ sie das Papier auf den Tisch sinken.
»Und?« Pias Blick hing auf ihr.
»Na ja, sie drückt ein bisschen auf die Tränendrüse.«
»Ein bisschen? Das liest sich total dramatisch!«
»Aber war Noemi nicht immer schon dramatisch?«, murmelte Maya.
Pia schüttelte vehement den Kopf. »Das ist ein Abschiedsbrief«, sagte sie, kam mit großen Schritten auf Maya zu und stellte ihr leeres Glas so hart auf die Tischplatte, dass Maya zusammenzuckte.
»Warum sollte sie nach zehn Jahren Funkstille einen Abschiedsbrief schreiben?«
Pia trat nah heran, eine Hand in der Hüfte. »Keine Ahnung!«, sagte sie in einem Ton, als läge darin eine wichtige Botschaft.
Maya massierte sich bedächtig den Nasenrücken. Sie hatte einmal gehört, das helfe bei Kopfschmerzen.
»Auf jeden Fall hört sich das traurig an, verzweifelt – am Ende. Was ist, wenn Noemi sich was antun will?«, fuhr Pia fort.
»Meinst du nicht, du übertreibst?«
»Jetzt schaue ich hinab auf ein Scherbenmeer, in dem ich glaube, ertrinken zu müssen!«, zitierte Pia. »Da ich davon ausgehe, dass wir uns in diesem Leben nicht noch einmal wiedersehen werden …«
»Ja, dramatisch. Aber doch keine Selbstmordankündigung!«
»Was macht dich da so sicher?«
Maya zuckte die Schultern und ließ sich auf dem Ledersofa nieder. Sie sank gleich einige Zentimeter in der Polsterfederung ein und legte seufzend den Kopf in den Nacken. »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine, die so verzweifelt ist, dass sie sich das Leben nehmen will, ausgerechnet Leuten schreibt, mit denen sie seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesprochen hat. Da gibt es doch andere, an die man sich wenden würde …«
»Hast du nicht richtig gelesen?«, kam prompt von Pia und sie tippte auf den Brief. Maya quittierte dies mit einem fragenden Blick.
»Ich denke heute noch manchmal an den Abend am Dom, steht da!« Pia setzte sich ihr gegenüber auf einen Stuhl. »Du weißt doch noch, welchen Abend sie meint?«
Maya starrte vor sich hin, dann nickte sie langsam. Vor ihrem inneren Auge sah sie die angestrahlten Türme des Doms weit über sich und darüber ein Sternenmeer. War es wirklich ein so romantischer Abend gewesen, oder hatte die Zeit die Erinnerung geschönt?
»Wir sind stundenlang durch die Innenstadt gewandert und haben geredet, geredet, geredet …«, raunte Pia. »So ein intensives Gespräch hatte ich, glaube ich, seitdem nie mehr!«
»War auch eine schlimme Zeit«, ergänzte Maya seufzend.
Damals waren sie als sechzehnjährige Naivchen erstmals mit der Grausamkeit des Lebens konfrontiert worden. Maya kam es heute noch vermessen vor, sich in diesem Zusammenhang als irgendwie betroffen zu empfinden – letztlich hatte das Schicksal nur Noemi übel mitgespielt. Und doch fühlten sich die Ereignisse auch zehn Jahre später noch wie ein dunkles Kapitel ihres eigenen Lebens an. Es war ein unscheinbarer Freitagabend, als Noemis Eltern bei einem Autounfall in den Tod gerissen wurden. Sie wollten von der Feier eines Freundes nach Hause fahren. Ein betrunkener Fiat-Fahrer war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und hatte den Wagen von Emis Eltern frontal gerammt, sodass er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Maya hatte bis zu dem Tag, als die schlimme Nachricht sie erreichte, noch geglaubt, solche Dinge würden immer nur in der Zeitung stehen oder im Fernsehen passieren, aber doch nicht in ihrem direkten Umfeld und erst recht nicht den freundlichen Mazurs, bei denen sie so oft nach der Schule zu Mittag gegessen hatte. Doch nicht Herrn Mazur, der immer über seine eigenen Polen-Witze lachte und der mit Maya so gerne über europäische Geschichte sprach! Doch nicht Frau Mazur, die am Nachmittag immer in ihrem Sessel am Fenster saß, Arztromane las und sich ein wenig schämte, wenn man sie fragte, was dort stand! Maya musste von heute auf morgen verstehen, dass es Ereignisse gab, die man nicht verstehen konnte. Sie waren und blieben sinnlos. Die ersten Stunden und Tage erschrak sie jedes Mal, wenn die Realität ihr wieder zu Bewusstsein kam: Sie waren tot, sie würden nie wiederkommen.
Von Noemi hörte sie zunächst nichts – zu sehr war die Freundin eingespannt in all die schrecklichen Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Eine Beerdigung musste organisiert werden und es war zu regeln, wo sie von nun an leben sollte. Maya vermochte sich nicht vorzustellen, wie Noemi es schaffte, diese Tage zu überstehen. Eine Woche nach dem Unglück rief sie dann an. Sie wollte sich mit Maya und Pia treffen. Den erstickenden Kloß, mit welchem sie zu der Verabredung gegangen war, fühlte Maya noch heute im Hals.
Sie trafen sich draußen vor dem Hauptbahnhof. Von Noemi fehlte noch jede Spur, aber zwischen den Menschen, die auf der Treppe unterhalb des Doms saßen, blitzte Pias orangefarbene Jacke auf. Wie konnte sie zu diesem Treffen und diesem Anlass nur in Orange erscheinen? Bei Trauer trug man Schwarz. Überhaupt erschien es Maya eine Zumutung, dass nicht auch all die anderen Menschen um den Dom herum Schwarz trugen. Wenn einer von ihnen auflachte, zuckte sie zusammen, während sie sich ihren Weg zu Pia bahnte. Jedes Zeichen von Fröhlichkeit fühlte sich falsch an – wie sollte es da erst Noemi gehen?
Noemi stand neben Pia, natürlich in Schwarz, und wirkte noch zierlicher als sonst, obgleich sie dick vermummt war. Sie hatte eine Mütze tief ins Gesicht gezogen, ihr langes dunkles Haar verschwand hinter einem dicken Wollschal. Bevor sich Maya für irgendeine Form von Begrüßung entscheiden konnte, die doch alle gleichermaßen unangebracht und unangenehm waren, kam Emi auf sie zu und warf sich in ihre Arme.
Maya hatte die ganze Woche über nicht eine Träne vergossen, doch in diesem Moment brachen alles Unverständnis, Leid und Überforderung aus ihr heraus. Während sie heftig schluchzte, strich Noemi ihr übers Haar. »Das tut mir alles so leid«, heulte Maya und wiederholte den Satz ein ums andere Mal. Als sie sich schließlich voneinander lösten, sah sie auch Emis Wangen feucht glänzen.
»Da kann keiner was für, okay? Da kann keiner was machen«, waren Emis Worte. Dann vergrub sie die Hände tief in den Taschen und die drei Mädchen zogen los.
Ziellos streunten sie durch die Innenstadt, meist schweigend, dann redend, manchmal lachte eine sogar kurz. Jedes Mal wenn das geschah, fühlte sich Maya beklommener als vorher. Noemi selbst wirkte sehr gefasst. Sie erwähnte mit keinem Wort, was genau passiert war, auch nicht die Beerdigung oder wie es ihr mit alldem ging. Stattdessen sprach sie von Berlin. Dort würde sie hinziehen. Zu ihrer Tante und Patentante, der Schwester ihres Vaters. Maya hörte sich an, wie sie von dem großen Haus erzählte, in dem sie nun leben würde, weil ihre Tante viel Geld hatte, und von der Hauptstadt, die so viele Chancen bot. Wo neu anfangen, wenn nicht dort?
Während Pia ihr in allem zustimmte und in Begeisterungsstürme über die Schönheit Berlins ausbrach, fühlte Maya, wie sich ihr Herz verkrampfte. Ihr war klar gewesen, dass Noemi nun wegzog. Ihr war klar gewesen, welch einen gewaltigen Einschnitt dieses Unglück für Noemi bedeutete. Aber allmählich begriff sie auch, was das für sie bedeutete. Seit sie das Wort Freundschaft kannte, war es mit Noemi verbunden gewesen. Wenn sie nun nicht mehr da war … wäre alles vorbei.
Nach einer Weile kehrten sie zurück auf die Domplatte. Hinter dem römischen Nordtor waren Bänke frei, sie setzten sich auf diejenige, die dem Dom am nächsten war. »Wir müssen oft telefonieren. Und ihr könnt mich auch jederzeit besuchen kommen«, versicherte Noemi und schaute sie mit einem unsicheren Lächeln an, das ganz schnell wieder verschwand.
»Logo! Ich komme direkt in den nächsten Ferien«, stieg Pia darauf ein.
Maya starrte vor sich hin. Hatte das Leben ihnen nicht gerade erst gezeigt, dass jederzeit etwas geschehen konnte, das jeden Plan zunichtemachte? Einfach so? Und selbst wenn sie weiter telefonieren würden und sich trafen – es würde nie wieder so sein wie früher. Trotzdem fühlte sie sich schäbig, weil es ihr nicht gelang, diese Gedanken einfach zu ignorieren und Noemi Zuversicht vorzuheucheln, denn letztlich war das doch das Einzige, was sie für sie tun konnten.
Pia war meisterhaft auf diesem Gebiet. »Dann zeigst du mir die Stadt und wir besorgen uns falsche Ausweise und machen die Clubs unsicher! In Berlin gibt es so eine geile Indie-Szene, das wird der Hammer.« Noemi erzählte irgendetwas über irgendeine Band, für die beide schwärmten und von der Maya nichts weiter als den Namen kannte. »Du kannst natürlich gerne mitkommen, Maya«, bezog Pia sie schließlich mit ein. Dabei lächelte sie breit und sah aus wie ein etwas schlankerer Pumuckl. Die Haare so rot, in alle Richtungen frisiert, die Nase und Wangen von der kalten Luft gerötet. Maya sah sie an und wusste, dass sie niemals mitkäme, wenn Pia zu Noemi nach Berlin fuhr. »Klar«, hauchte sie dennoch.