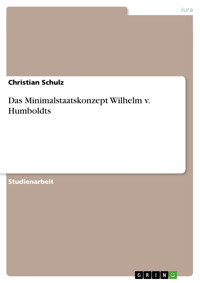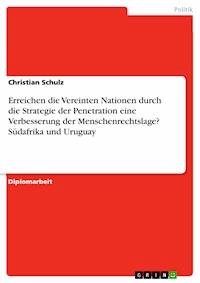40,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Soziale Medienplattformen lassen sich als Infrastrukturen der Anerkennung beschreiben. Zu diesem Ergebnis kommt Christian Schulz, der die Strukturen sozialer Netzwerke ebenso wie ihre konkreten Nutzungspraktiken vor dem Hintergrund der sozialtheoretischen Ansätze Axel Honneths und Cornelius Castoriadis' untersucht. Ausgehend von der Geschichte des Like-Buttons bei Facebook und einer damit einhergehenden Algorithmisierung, entwickelt er eine allgemeine Theorie sozialer Medien. Mit ihrer Hilfe lässt sich nicht nur erklären, wie bestimmte Dynamiken digitaler Kommunikation entstehen, sondern auch, wie sich eine plattformübergreifende Infrastruktur sozialer Netzwerke institutionalisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christian Schulz
Infrastrukturen der Anerkennung
Eine Theorie sozialer Medienplattformen
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Soziale Medienplattformen lassen sich als Infrastrukturen der Anerkennung beschreiben. Zu diesem Ergebnis kommt Christian Schulz, der die Strukturen sozialer Netzwerke ebenso wie ihre konkreten Nutzungspraktiken vor dem Hintergrund der sozialtheoretischen Ansätze Axel Honneths und Cornelius Castoriadis’ untersucht. Ausgehend von der Geschichte des Like-Buttons bei Facebook und einer damit einhergehenden Algorithmisierung, entwickelt er eine allgemeine Theorie sozialer Medien. Mit ihrer Hilfe lässt sich nicht nur erklären, wie bestimmte Dynamiken digitaler Kommunikation entstehen, sondern auch, wie sich eine plattformübergreifende Infrastruktur sozialer Netzwerke institutionalisiert.
Vita
Christian Schulz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Kulturen der Digitalität an der Universität Paderborn.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Einleitung
1.
Die Einführung des Like-Buttons
1.1
Was sind soziale Medien und wie werden sie theoretisiert?
1.1.1
Virtuelle Gemeinschaften
1.1.1.1
Bulletin Board Systems (BBS)
1.1.2
Weblogs
1.1.2.1
Moblogs
1.1.3
Social Web 2.0
1.1.3.1
Der Begriff des Web 2.0 und die Rolle der mobilen Fotografie
1.1.3.2
Soziales wird technisch wird ökonomisch
1.2
Exkurs I: »Welterzeugende« Zahlen
1.3
Von Hits, Links und Likes
1.3.1
Hits
1.3.2
Links
1.3.3
Likes
1.3.3.1
Social Bookmarks
1.3.3.2
Cookies
1.3.3.3
Facebooks Like-Button und die Rolle des Smartphones
1.3.3.4
FEED, RSS, Slashdot und Digg
FEED
RSS
Slashdot
Digg
1.3.3.5
Facebooks News Feed
1.3.3.5
Facebooks vergessener Super-Like
1.3.3.6
Semantische Schließung des Like Buttons
1.4
Zwischenfazit
2.
Infrastrukturen der Anerkennung
2.1
Exkurs II: Das Interface als Schwelle
2.2
Anerkennung und Reziprozität als Prinzipien von Vergesellschaftung
2.3
Die Organisationsprinzipien sozialer Medien: Liste, Reziprozität und Affekt
2.4
Von der Plattform zur Plattforminstitution
2.4.1
Der Plattform-Begriff
2.4.2
Der Institutionen-Begriff
2.4.2.1
Das Institutionelle in der Anerkennungstheorie
2.4.2.2
Institutionstheoretische Ansätze
2.4.2.3
Was sind Institutionen?
2.4.2.4
Institutionen und Reziprozität
2.5
Die Rolle des Imaginären in den Plattforminstitutionen
2.5.1
Der Begriff und die Formen des (algorithmisch) Imaginären
2.5.2
Ontologische Unbestimmtheit
2.5.2.1
Das Imaginäre nach Castoriadis und die Feed-Interface-Relation
2.5.2.2
Das Imaginäre und die Intersubjektivität in der Feed-Interface-Relation
2.6
Zusammenfassung und Fazit
3.
Affektive Praktiken: Selfie-Gesten, situierte Sichtbarkeiten und das Story-Format
3.1
Affektives Arrangement
3.2
Affektive Praktiken
3.3
Exkurs III: Flickr, Tagging und der foto-soziale Graph
3.3.1
Flickr und Tagging
3.3.2
Der foto-soziale Graph
3.4
Die affektive Praktik der Selfie-Fotografie
3.4.1
Das Selfie als affektive Geste
3.4.2
Die Plattform Instagram
3.4.3
Die Algorithmisierung Instagrams
3.4.4
Methodische Bemerkung zur Auswahl des Samples
3.4.5
Fallstudie I: Direkte und vertikale Reziprozitätsformen in situ
3.4.5.1
Gefühlszeichen Selfie
3.4.5.2
#bittekeinmitleid
3.4.6
Fallstudie II: Das algorithmisch Imaginäre zwischen (Un)Sichtbarkeiten und eingekauften Likes
3.4.6.1
»Das ist der Algorithmus! Der macht manchmal einfach was er will«
3.4.6.2
»Ich sag’ euch: jeder macht das!«
3.4.7
Fallstudie III: Die Geburt des Story-Formats aus dem Geiste des Selfies
3.4.7.1
Snapchat Stories
3.4.7.2
Die Institutionalisierung des Story-Formats
3.4.7.3
Affekt ohne Anerkennung? TikTok und der Interest Graph
Schluss
Literatur
Abbildungen
Dank
Einleitung
Soziale Medien bestimmen nicht nur unsere Lage, vielmehr gibt es um soziale Medien auch eine Art Lagerbildung. Auf der einen Seite stehen Untergangserzählungen, die einen Kulturverfall betonen und von Apologeten wie beispielsweise dem Ulmer Hirnforscher und Psychiater Manfred Spitzer mit vermeintlich seriösen Erkenntnissen hinsichtlich einer durch soziale Medien induzierten »Smartphone-Epidemie«1 oder gar einer »digitalen Demenz oder Depression«2 bespielt werden. Auf der anderen Seite lassen sich demgegenüberstehende Empowerment-Narrative ausmachen, wie sie etwa in Form eines neuen »Netz- oder Selfie-Feminismus«3 auf den Plan treten. Obgleich mit dieser schematischen Gegenüberstellung keinesfalls die den jeweiligen Lagern (und darüber hinaus unterschiedlichen Disziplinen) angehörenden Autor:innen gleichgesetzt werden sollen, ist diese Zweiteilung in der Rezeption rund um soziale Medien auch relativ symptomatisch für einen dezidiert kommunikations- und medienwissenschaftlichen Diskurs hinsichtlich sozial-medialer Phänomenbereiche in den letzten Jahren. Auch hier lassen sich Lager ausmachen, die sich mitunter und relativ schematisch zwar in ähnliche Dichotomien von Kontrolle einerseits und Empowerment andererseits aufteilen lassen.
Vor allem aber zeigen sich diese Gegenpole im Kontext von im weitesten Sinne medienkulturwissenschaftlichen Zugängen aber auch insbesondere im methodisch-theoretischen Forschungsdesign. Während es auf einer strukturellen, häufig kulturkritisch geprägten und/oder marxistisch orientierten Forschungsebene in erster Linie darum geht am Begriff der »Produktion« ausgerichtete Ideologiekritik zu betreiben oder etwa eine damit verbundene Ausbeutung von Datensubjekten zu thematisieren4, gibt es auf der anderen Seite eine ganze Reihe von ethnografisch oder im engeren Sinne praxistheoretisch ausgerichteten Arbeiten, die sich sehr genau mit entsprechenden (und mitunter auch ermächtigenden oder gar subversiven) Nutzer:innenpraktiken auf oder mit bestimmten sozialen Medienplattformen beschäftigen und diese oft äußerst präzise sowie für Außenstehende nachvollziehbar zu schildern vermögen.5 Beiden Forschungszugängen fehlt häufig jedoch nicht nur eine dezidierte Auseinandersetzung mit den technologischen Infrastrukturen solch sozialer Medienplattformen (und damit ist nicht nur die Ebene des Codes oder der Software gemeint), die im Zuge einer ökonomischen oder eben auf die Praktiken fokussierten Engführung meist nur am Rande Erwähnung finden. Es zeigt sich anhand dieser Studienlage im Bereich sozialer Medienforschung vielmehr eine augenscheinliche Zweiteilung in strukturelle Ansätze auf der einen und in vorwiegend an der Beschreibung von Praktiken interessierte Ansätze auf der anderen Seite, die nicht zufällig auch mit den eingangs genannten dystopischen oder utopischen Narrativen korrespondieren.
Für eine Theoretisierung sozialer Medien ist diese Zweiteilung allerdings auch deshalb wenig aufschlussreich, weil strukturelle Ansätze oft wenig bis nichts über die eigentlichen Nutzer:innenpraktiken verraten und insofern die daraus abgeleiteten Theoretisierungen auch wenig präzise sind, weshalb dann auch eben häufig eine übergeordnete Engführung, etwa auf das Primat des Ökonomischen, erfolgt. Demgegenüber vermögen ethnografisch oder praxistheoretische Ansätze oft nichts Substantielles zu einer nach wie vor fehlenden allgemeinen Theorie sozialer Medien beizutragen, die über die beschreibende Ebene von singulären Praktiken oder die sozial-medialen Logiken einzelner Dienste und Plattformen hinausreicht. Zudem kann diese Zweiteilung nicht einfach in einer Dialektik von System und Praktiken aufgelöst werden, wie verschiedene, dem praxistheoretischen Lager zuzurechnende Autor:innen postulieren6, da damit ganz im Sinne einer binären Logik, diese Dialektik einfach abstrahiert wird und sich diese Dichotomie damit implizit nichtsdestotrotz in die an der Beschreibung von Praktiken orientierten ethnografischen oder praxistheoretischen Arbeiten einschreibt beziehungsweise in diesen reproduziert wird, wie konkret auch ein Blick auf die Entstehungsgeschichte dieser hier vorliegenden Studie zeigt.
Ausgangspunkt der vorliegenden Studie war die Beschäftigung mit dem sozial-medialen Phänomen des Selfies um das Jahr 2016 herum, das zu gleichen Teilen Bild wie (sozial-mediale) Praktik darstellt.7 Nach einem medialen Hype um Selfies in der breiten Bevölkerung in den Jahren zuvor (das Oxford Dictionary kürte etwa Selfie bereits im Jahr 2013 zum Wort des Jahres), gab es neben der um das Jahr 2015 verstärkt einsetzenden wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Phänomen (zusätzlich zu medien- oder kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen vorwiegend aus dem heterogenen Bereich der Bildwissenschaften), wohl insbesondere auch wegen dieser breitenwirksamen Durchdringung des Phänomens künstlerisch-kuratorische Auseinandersetzungen damit, wie zum Beispiel die von Alain Bieber kuratierte Ausstellung Ego Update in den Jahren 2015/2016 im Düsseldorfer NRW-Forum gezeigt hat. Nichtsdestotrotz zeigt sich in unter anderem im zu dieser Ausstellung publizierten Katalog sowie den weiteren in diesem Zeitraum der Jahre 2014–2017 entstandenen wissenschaftlichen Publikationen zu Selfies nicht nur die ganze Heterogentität der Ansätze aus den unterschiedlichsten Disziplinen.8 Vielmehr lässt sich in ebendiesen Publikationen auch eine ganz ähnliche und wie eingangs beschriebene Zweiteilung in ein mitunter bis zum Narzissmus überhöhtes Selbstdarstellungsbedürfnis von Selfies schießenden Nutzer:innen einerseits und sich in im Zuge der subjektkonstitutiven Elemente des Selfies entfaltende Empowerment-Narrative andererseits ausmachen.9 Es ist fast überflüssig zu betonen, dass diese Gegenpole auch in diesem Zusammenhang maßgeblich mit den jeweiligen methodisch-theoretischen Ansätzen zur Erforschung von Selfies korrespondieren und darüber hinaus die infrastrukturelle Verwobenheit von solch mobilen Selbstfotografien mit den entsprechenden sozialen Medienplattformen zumeist, und wenn überhaupt, nur auf Ebene der für die Erzeugung eines Fotos wichtigen Technologien verorten.10 Dabei klingt schon in den Selfie-Definitionen der ersten Arbeiten dezidiert medienkulturwissenschaftlicher Prägung an, dass der Aspekt des Teilens – und damit die für die Zirkulation verantwortlichen technologischen Infrastrukturen der jeweiligen Plattformen – ein wesentlicher und nicht zu trennender Bestandteil von Selfies ist.11 Allerdings gibt es auch hier keine konkreten Analysen, die über das Postulat einer fundamentalen Aufeinanderbezogenheit von Infrastrukturen und Praktiken hinausgehen, was nicht zuletzt in dem konstatierten Desiderat einer allgemeinen Theorie sozialer Medienplattformen begründet liegt, die über die Beschreibung einzelner (und mitunter plattformspezfischer) Praktiken oder sozial-medialer Einzellogiken hinausgeht. In Anbetracht dieser Dichotomie von Forschungszugängen lag es für die vorliegende Studie nicht nur nahe von einem fundamentalen Zusammenhang von der Infrastruktur sozialer Medienplattformen und ebensolchen Selfie-Praktiken auszugehen, sondern diesen Zusammenhang zunächst einmal ganz konkret mit Blick auf technologische Funktionen und Akteur:innen im Plattformkontext zu präzisieren. Für die Zirkulation innerhalb sozialer Medienplattformen sind nämlich neben den Handlungen verschiedener Nutzer:innen in erster Linie diverse Plattformfunktionen verantwortlich zu denen neben Kommentarfeldern oder Hashtags insbesondere der Like-Button gehört. Letzterem wird von einer breiten Öffentlichkeit immer wieder eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit Selfies zugeschrieben (vgl. etwa den geläufigen Ausspruch It’s all about the likes) samt einer in diesem Zusammenhang häufig bemühten Diagnose eines gesteigerten Bedürfnisses nach Aufmerksamkeit und Anerkennung.12 So verweist auch der Medientheoretiker und Aktivist Geert Lovink in einem Vortrag, den er 2017 im Frankfurter Museum für moderne Kunst gehalten hat, auf die untrennbare Verwobenheit von Like-Button und Selfie13, und fordert dementsprechend »[…] philosophische Antworten auf den Kult der Selfies, ohne die Software-Features zu vergessen und ihre Funktionsweisen zu verdeutlichen beziehungsweise deren Infrastrukturen in den Blick zu nehmen.«14 Damit war die zentrale Ausgangshypothese dieser Studie markiert. Denn das Selfie als Praktik markiert gewissermaßen nicht nur eine der populärsten medialen Formen der letzten Jahre. Vielmehr ist es genau diese irreduzible Verwobenheit von Like-Button und Selfie, die auch symptomatisch für das herausgestellte und tiefer liegende Problem in der Erforschung sozialer Medienplattformen zwischen strukturellen und praxistheoretischen Zugängen ist und insofern potentiell auch die Möglichkeit bietet anhand dieser Verwobenheit so etwas wie eine allgemeine Theorie sozialer Medienplattformen zu entfalten.
Doch wie nun weiter vorgehen, wenn auch das Selfie als genuin sozial-mediale Praktik von einer durch und durch hohen Dynamik und Kontextabhängigkeit in und um das sogenannte Social Web geprägt ist, wie insbesondere Praxistheoretiker:innen mit Blick auf dieses nicht müde werden zu betonen?15 Nicht zuletzt durch diesen durchaus berechtigten Einwand hinsichtlich der genauen Beschreibung von Praktiken, der sich zum Zeitpunkt der frühen Planungsphase der vorliegenden Studie mit Bezug auf Selfies auch in den ersten Journal-Veröffentlichungen zeigte, die vorwiegend aus kleineren empirischen Explorationen bestanden16, lag es nahe als methodisch-theoretischen Ausgangspunkt einen Zugang zu wählen, der gleichermaßen das Desiderat der technologischen Infrastrukturen zu adressieren vermag, wie auch die Situiert- und Kontextgebundenheit solcher von der Zirkulation abhängigen Selbstfotografien mikroperspektivisch in den Blick zu nehmen weiß. Insofern bildete die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) mit ihrem heuristischen Progamm einer empirischen Praxis und einem grundständigen Postulat einer Symmetrie zwischen menschlichen und nicht-menschlischen Aktant:innen in einer medienwissenschaftlichen Ausrichtung als Akteur-Medien-Theorie (AMT) zunächst einen fundierten methodisch-theoretischen Ausgangspunkt.17 In der Perspektive einer solchen Akteur-Medien-Theorie werden Medien kooperativ mittels sogenannter Operationsketten, das heißt der Verknüpfung von materiellen, personalen und/oder medialen Elementen, erst hervorgebracht, wie diese Medien gleichsam aber auch als Bedingung für Handlungsmacht dienen.18 Der Vorteil solch einer Perspektive eines kooperativen Apriori liegt darin, dass mit ihr die einzelnen Mediatisierungsschritte (d. h. das Medien-Werden) sowohl in Form von mikroanalytischen Medienethnografien, als auch medienhistorischen Makroanalysen beschreibbar werden und sie sich insofern auch für eine Analyse der technologischen Infrastrukturen sozialer Medienplattformen eignet.19 Dieser Aspekt ist einerseits wichtig, weil er gewissermaßen die methodisch-theoretische Grundhaltung des ersten Kapitels und damit den Ausgangspunkt der Studie darstellt. Andererseits wird am Ende des ersten Kapitels allerdings auch deutlich werden, dass sich die Akteur-Medien-Theorie zwar für eine historische Beschreibung des Zusammenspiels verschiedener Akteur- und Aktant:innen innerhalb eines heterogenen (Plattform-)Gefüges eignet und insofern auch die Stabilisierungen verschiedener Funktionen, wie etwa dem Like-Button, nachzuzeichnen vermag. Allerdings ist damit die Reichweite dieses theoretisch-methodischen Ansatzes, insbesondere für eine allgemeine Theorie sozialer Medienplattformen, auch ausgeschöpft, denn die ANT beziehungsweise die AMT erklärt sämtliche Strukturbildungen bottom-up aus den Netzwerkprozessen verschiedenster Entitäten heraus, womit sie den Unterschied von Struktur und Praxis als eine Frage der Skalierung auffasst. Damit lassen sich so etwas wie Normativitäten, die, wie schon eine oberflächliche Betrachtung von verschiedenen Selfies zeigt (ausgestreckter Arm, stereotype Mimiken usw.), auch bei diesen eine entscheidende Rolle spielen, schwerlich in den Blick nehmen. Und auch mit Blick auf das Software Plug-In des Like-Buttons stellt sich vorgreifend auf die Ergebnisse des ersten Kapitels diese Perspektive als reduktionistisch heraus, da der Button mittlerweile plattformübergreifend institutionalisiert ist, und dieser Umstand nur um den Preis der Ausklammerung von für mit der Einführung des Buttons einhergehenden affektiven Kompononten als Stabilisierung beschrieben werden kann. Eben deshalb ist eine an der AMT orientierte Perspektive dann auch lediglich der Ausgangspunkt dieser Studie und die methodisch-theoretische Grundlage des ersten Kapitels.
In ebendiesem ersten Kapitel wird die Einführung des Like-Buttons, ganz im Sinne einer durch die AMT informierten Perspektive, in gewisser Weise sowohl mikroanalytisch, als auch medienhistorisch in den Blick genommen, indem die Implementierung dieses Buttons zum einen im historischen Kontext des Social Web, und damit letztlich auch mit Blick auf die sozio-technischen Grundlagen des World Wide Web (WWW) verortet wird. Zum anderen wird insbesondere mikroperspektivisch das Zusammenspiel von verschiedensten Akteur:innen wie etwa Software-Entwickler:innen, Blogger:innen, Software Plug-Ins wie Web Countern, Algorithmen wie dem PageRank, Nutzer:innen, aber auch Mobiltelefonen beziehungsweise Smartphones in den Blick genommen. Am Ende dieses ersten Kapitels werden anhand dieser nachgezeichneten Implementierungsgeschichte des Like-Buttons mit der Liste, Reziprozität und dem Affekt drei zentrale Organisationsprinzipien sozialer Medienplattformen herausdestilliert, die allerdings auch die Grenzen von ausschließlich an der Beschreibung sozio-technischer Praktiken und Stabilsierungen orientierten methodisch-theoretischen Ansätzen aufzeigen.
Das zweite Kapitel verabschiedet sich dann von der mikroperspektivischen Ebene und nimmt ausgehend von den im ersten Kapitel herausgestellten drei Organisationsprinzipien eine Theoretisierung sozialer Medienplattformen als Infrastrukturen der Anerkennung vor. Dieses Kapitel bildet das Herzstück der vorliegenden Studie und bringt mit der Schwelle, der Plattforminstitution und dem Imaginären drei zentrale Begrifflichkeiten in Stellung, die nicht nur eine allgemeine Theorie sozialer Medienplattformen jensetis von Dichotomien zwischen Struktur und Praxis oder deren binärer Reproduktion in Form dialektischer Auflösung ermöglicht. Vielmehr wird damit und im Verbund mit den drei Anerkennungsebenen des Affekts, des (Be-)Wertenden/Wertschätzenden und dem Institutionell-Instituierenden auch ein konkreter Analyserahmen geschaffen, der imstande ist das Verhältnis von eher statisch anmutender Infrastruktur und den mitunter hochdynamischen Praktiken der daran beteiligten sozio-techischen Akteur:innen (Algorithmen, Software-Plug-Ins, Nutzer:innen usw.) auf den unterschiedlichen Ebenen zu adressieren.
Das dritte Kapitel nimmt ausgehend von den im zweiten Kapitel definierten Infrastrukturen der Anerkennung wieder eine Mikroperspektive ein und widmet sich schießlich der affektiven Praktik des Selfies. Hier kann nun nicht nur die Ausgangshypothese dieser Studie und der fundamentale Zusammenhang von Like-Button und Selfie vollumfänglich beantwortet werden. Vielmehr wird ausgehend von den im zweiten Kapitel herausgearbeiteten Anerkennungsebenen des Affekts, des (Be-)Wertenden/Werzschätzenden sowie dem Institutionell-Instituierenden und anhand von empirischen Fallstudien gezeigt, wie aus der sich situiert und kontextspezifisch unterschiedlich ausgestaltenden affektiven Praktik des Selfies ein plattformübergreifender Prozess der Institutionalisierung entspinnt und schließlich in dem 2013 eingeführten Story-Format sowie einer neuen um diese Praktik herum gebauten Benutzer:innenoberfläche mündet. Damit wird nicht nur gezeigt, wie aus einer Nutzer:innenpraktik konkret Infrastruktur wird. Darüber hinaus zeigt sich in diesem Kapitel auch, warum die in dieser Arbeit entwickelte allgemeine Theorie sozialer Medienplattformen eine notwendige Perspektive für ein tiefergehendes Verständnis von Phänomenen in und um soziale Medien darstellt.
1.Die Einführung des Like-Buttons
Spricht man über soziale Medien und soziale Netzwerke im Speziellen, so führt weiterhin kein Weg an der immer noch größten all dieser Plattformen vorbei: Facebook. Facebook hat seit seiner Gründung 2004, dessen Geschichte 2010 mit The Social Network von Hollywood-Regisseur David Fincher auch prominent verfilmt wurde, das Netz in vielerlei Hinsicht geprägt. Die Plattform fungiert als Mutterschiff für diverse andere Plattformen und Dienste, wie zum Beispiel Instagram und WhatsApp und hat darüberhinaus auch in Bezug auf Plattform-Funktionen maßgebliche Standards gesetzt, wie nicht zuletzt das Plug-in des Like-Buttons zeigt. Die Geschichte von sozialen Netzwerken im engeren Sinne beginnt jedoch keineswegs erst mit Social-Media-Plattformen wie Facebook oder einem davor ausgerufenen Web 2.0, sondern reicht, auch wenn es die entsprechenden Begrifflichkeiten wie etwa Social Web, Social Software und nicht zuletzt Social Media erst seit einigen Jahren gibt, bis zu den historischen Vorläufern des Internets zurück.20
Seitdem Computer in den 1960er Jahren erstmals auch als Kommunikationsmedien verstanden wurden – bis dahin galten Computer ausschließlich als Rechenmaschinen und wurden vorwiegend in den Bereichen des Militärs und der Wirtschaft eingesetzt – bildeten sich auch die ersten Communities oder Gemeinschaften heraus, wie insbesondere die E-Mail-Kommunikation, die Einrichtung des dezentral organisierten ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) oder ab Ende der 1970er Jahren entsprechende Mailing-Listen zeigen. Mit der Vorstellung des ersten Personal Computers 1981 durch IBM und insbesondere dem knapp zwei Jahre später, am 1. Januar 1983, eingerichteten Standard in Form des Internetprotokolls TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) war dann auch erstmals vom »Internet« die Rede, womit schlicht die Menge der mittels TCP/IP verbundenen Netzwerke gemeint war. Diese Internetprotokolle stellen somit in gewisser Weise Medien dar, auf deren Basis (soziale) Netzwerkbildungen erst möglich werden, weshalb sie auch als »Grammatik der Netzwerkbildung« bezeichnet werden können.21 Technisch ist damit die Grundlage für jenes Hypertextsystem geschaffen, das Tim Berners-Lee Ende der 1980er Jahre am CERN in Genf erfand, welches heute unter dem Namen World Wide Web (WWW) bekannt ist sowie Vorläufer unter anderem in Paul Otlets Mundaneum, Vannevar Bushs Memex und Ted Nelsons Xanadu hatte.22 Das WWW sattelt auf einem auf TCP/IP basierenden Protokoll, dem Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und dem Universal Resource Locator (URL), einem Adressierungsschema, das offenließ welches Protokoll die adressierte Stelle im »Docuverse« handhaben sollte.23 Mit dem WWW, das technisch gesehen auf dem Internet als Dienst aufsattelt, wurde das Internet Anfang der 1990er Jahre mittels neuer grafischer Benutzer:innenoberflächen und den Web-Browsern Nexus und Mosaic zum Massenmedium, dessen zentrale Organisationseinheit der aus dem Hypertextsystem stammende Hyperlink war.
Diese knappe Vorgeschichte von den Ursprüngen des Netzes ist insofern unumgänglich, als dass sich der Like-Button, wie er von Facebook im Jahr 2009 eingeführt wurde, im technologischen Sinne auch aus ebenjenen Verlinkungspraktiken eines sogenannten Web 1.0 speist, die wiederum bis zu den Anfängen des Netzes zurückreichen beziehungsweise zu dessen technischer Grundausstattung gehören. Insofern gilt es in diesem ersten Kapitel zunächst ganz kategorisch zu fragen, was soziale Medien überhaupt sind, wie man sie bisher theoretisiert hat und wie sie sich von den Anfangstagen des Netzes bis hin zum sogenannten Web 2.0 ganz praktisch gestaltet haben (1.1). Ausgehend davon werden zentrale Begrifflichkeiten wie die virtuelle Gemeinschaft, Weblogs oder auch Moblogs geklärt und mit den Bulletin Board Systems (BBS) die technologische Infrastruktur früher Formen sozialer Medien einer genauen Analyse unterzogen. Mit der Liste wird abschließend ein erstes dienstübergreifendes Organisationsprinzip von ebensolchen frühen sozialen Medien innerhalb des Web identifiziert.
Im Laufe der Geschichte von »Weblogs« erweisen sich in erster Linie die allumfassenden Metriken, wie sie mittlerweile in Form von Views, Follower:innen und insbesondere Likes so ziemlich auf jeder sozialen Medienplattform zu finden sind, und die dahinterliegenden Algorithmen als zentral. Man könnte sagen, diese Metriken sind spätestens mit dem Like-Button zu einem zentralen plattformübergreifenden Charakteristikum von Social-Media-Plattformen avanciert. Deshalb schließt sich in Form eines Exkurses eine historische Betrachtung von Messungen, statistischen Erfassungen und Kategorisierungen unter dem Banner des Prinzips einer »Welterzeugung durch Zahlen« an (1.2), die als zentrales Charakteristikum bei der Entwicklung der sogenannten Moderne gelten können, und darüber hinaus auch für das Funktionieren von auf Algorithmen basierenden sozialen Medienplattformen unabdingbar sind. Zahlen und Metriken erweisen sich in diesem Zusammenhang nicht nur als repräsentativ oder real hinsichtlich bestimmter Sachverhalte, weshalb sie oftmals als objektiv und wertneutral beschrieben werden. Vielmehr sind Zahlen und Metriken gleichermaßen ganz konkret konstruiert beziehungsweise konstruierend, was sie damit zu »welterzeugenden« und alles andere als wertneutralen Akteuren macht.
Mit Bezug auf das Social Web gilt es diese Metriken im Folgenden nun genauer in den Blick zu nehmen (1.3) und sie im Kontext früher sozialer Medien zu verorten. Seit Mitte der 1990er Jahre setzen etwa Webmaster:innen entsprechende Zähler auf den von ihnen erstellten Webseiten ein, womit die Zahl der Seitenaufrufe oder Hits genau dokumentiert und der Webtraffic quantifiziert wird. Dies ging allerdings auch mit der zunehmenden Ausbreitung von Manipulations- und Spamtechniken einher, die in Anbetracht der rein quantitativen Einflussfaktoren für das Ranking ebensolcher Hit-Counter einfach anzuwenden waren. Ab Ende der 1990er Jahre führt der zunehmende Einfluss von Suchmaschinen wie Google und damit Algorithmen wie dem PageRank, die ebendieses Problem des Spams adressierten, zur Ergänzung der quantitativen Hits durch den relationalen Link, indem auf Grundlage der Soziometrie und nach Vorbild des wissenschaftlichen Zitationssystems Webseiten unterschiedliche Relevanz zugesprochen wird.
Hiermit gesellt sich zur Liste mit der Reziprozität ein zweites zentrales Organisationsprinzip, das auch am Anfang dessen steht, was Carolin Gerlitz und Anne Helmond im Anschluss an Richard Rogers zweistufiges Modell der Hit- und Link-Ökonomie als Like-Ökonomie bezeichnet haben.24 Um 2005 kommt es zur Einführung sogenannter Social Buttons, die nicht nur wiederum ein qualitatives Defizit von Suchmaschinenalgorithmen wie eben dem PageRank adressieren, sondern im Kontext von Bookmarking-Diensten wie Digg und Reddit es Nutzer:innen ermöglichen anderen Nutzer:innen einfache Empfehlungen auszusprechen und mittels derer Inhalte aus dem gesamten Web mit wenigen Klicks zur Plattform zurückgeführt werden können.
Schließlich führte Facebook über den Umweg des Share-Icons beziehungsweise des Share-Buttons 2009 den sogenannten Like-Button ein, der eine neue Form der Web-Ökonomie einläutet, die spätestens mit einer sich daraus speisenden Diversifizierung in emotional aufgeladene Social Buttons 2016 auch den Übergang von einer Aufmerksamkeitsökonomie zu einer Affektökonomie markiert.25 Diese gleichsam verkürzt affektiven wie emotional aufgeladenen Reaktionen der Nutzer:innen mittels dieser Buttons sind schließlich eng mit der Einführung von algorithmischen Empfehlungssystemen verknüpft, wie sie in sozialen Medienplattformen heute prominent in Form von sogenannten (News-)Feeds Anwendung finden und markieren letztlich nicht weniger als einen Strukturwandel sozialer Medien, der darüberhinaus, so wird der weitere Gang der Studie zeigen, auch fundamental mit den Praktiken einer sozial-medialen Fotografie verbunden ist.26
Bevor jedoch dieser Aspekt im dritten Teil der Arbeit in den Fokus rückt, werden ausgehend von der Geschichte des Like-Buttons und der Etablierung einer sogenannten Like-Ökonomie mit der Liste, der Reziprozität und dem Affekt in diesem Kapitel drei zentrale Organisationsprinzipien sozialer Medien herausdestilliert, die ich im darauffolgenden zweiten Teil als Infrastrukturen der Anerkennung theoretisieren möchte. Hieran wird auch deutlich, dass bisherige Ansätze zur Erforschung und Theoretisierung sozialer Medien(-plattformen), wie sie insbesondere im Gabe-Paradigma lange vorherrschend waren und heute in einer ganzen Reihe von Plattform-Ethnografien im- und explzit weiter fortgeschrieben werden, längst nicht mehr ausreichen, um adäquate Antworten auf die drängenden Probleme zu finden, die von sozialen Medienplattformen ausgehen oder diesen zumindest zugeschrieben werden. Nicht zuletzt, da diese ethnografischen Ansätze und deren mikroperspektivische Beschreibungen kaum plattformübergreifende Schlüsse zulassen und damit letztlich einer sozial-medialen Einzellogik verhaftet bleiben.
Demgegenüber möchte diese Arbeit ausgehend von der Implementierungsgeschichte des Like-Buttons als einem der zentralen Plattformakteure den Versuch wagen eine Theorie sozialer Medienplattformen zu formulieren, die einerseits sowohl die technischen Infrastrukturen plattformspezifisch wie plattformübergreifend einzuordnen versteht, aber andererseits auch die damit verwobenen, an bestimmte soziale Medienplattformen gebundenen Praktiken ernst zu nehmen vermag, um so ausgehend von mikroperspektivisch genauen Beschreibungen theoretisch belastbare Schlüsse zu ermöglichen, die über spezifische Einzelplattformlogiken hinausreichen.
1.1Was sind soziale Medien und wie werden sie theoretisiert?
Zunächst gilt es jedoch zu fragen, was soziale Medien überhaupt sind. Diese Frage erscheint gleichermaßen banal wie komplex. Natürlich sind soziale Medien in erster Linie Medien, mit denen das Soziale verhandelt wird, also Beziehungen mit anderen Menschen aufgebaut oder ebendiese auf Distanz gehalten werden. Als solche lassen sich soziale Medien bis in die ältesten menschlichen Gesellschaften zurückverfolgen, man denke nur an die wechselseitigen Tauschpraktiken der Trobriander mit Muscheln im Kula-Ring, die Bronislaw Malinowksi untersucht hat und die in Form des Gabe-Paradigmas seit den Anfängen eines sogenannten Social Web auch für verschiedene Diskurse sozialer Medien immer wieder herangezogen werden.27
Kula ist hierbei eine Form des Tauschhandels zwischen den Stämmen eines großen Gebietes, die in einem geschlossenen Kreislauf beständig zwei Arten von Gegenständen miteinander tauschen: einerseits Armreifen aus Muscheln (mwali) und andererseits Halsketten aus roten Muscheln (soulava).28 Nach Marcel Mauss vollzog sich in frühen Gesellschaften die Vergesellschaftung durch ebensolche Gaben in Form von Geschenken, die theoretisch freiwillig sind, denen jedoch ein Zwang zur Erwiderung inhärent ist. Nicht zuletzt deshalb bezeichnet Mauss in seinem berühmten Essay die Gabe auch als eine »totale soziale Tatsache« und damit als den Ursprung von jeglicher Form von Sozialität.29 Wie bereits in einer zentralen Quelle von Mauss – eben Malinowskis Argonauten des westlichen Pazifiks – erwähnt, kommen in der Gabe Logiken des Sozialen und des Ökonomischen zusammen, obgleich Malinwoski zu gleichen Teilen zwischen kula, dem vergesellschaftenden Tausch, und gimwali, dem Tauschhandel mit anderen Stämmen, die nicht zur Kula-Inselgruppe gehören, unterscheidet.30 Dass beide Sphären jedoch nicht so ohne weiteres getrennt werden können, macht Malinowski ebenso unmissverständlich klar:
»Ich habe absichtlich eher von Formen des Tauschs, der Gaben und Gegengaben gesprochen als von Tauschgeschäften oder Handel, denn es existieren zwar reine und einfache Formen des Tauschhandels, aber zwischen diesem und einfachen Gaben gibt es so viele Übergänge und Abstufungen, daß es unmöglich ist, eine klare Abgrenzung zwischen Handel auf der einen Seite und dem Gabentausch auf der anderen zu ziehen.«31
Wohl nicht zuletzt aufgrund dieses Zusammenfallens sozialer und ökonomischer Logiken, die je nach Perspektive und Zugang oder auch zu analytischen Zwecken getrennt voneinander betrachtet werden können, ist das Konzept auch immer wieder für die Erforschung von Online-Sozialität herangezogen worden. Und so nennt selbst Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg als Vorbild für Facebook eine an den Gabentausch angelehnte Schenkökonomie.32
Angefangen bei Howard Rheingold und seinen virtuellen Gemeinschaften, der das utopisch konnotierte kommunitaristische Prinzip von Gabe-Praktiken betont33, über Henry Jenkins et al., die eine Verbindung solch das Soziale konstituierender Praktiken zu den Kategorien der Relevanz und des Einflusses herstellen34, bis hin zu den Ethnografien von Daniel Miller und Johannes Paßmann zu Facebook und Twitter, die über die Nichterwiderung der Gabe Hierarchien auf Facebook sichtbar machen, wie im Falle von Miller35, oder denen das Konzept dazu dient zwischen sozio-historischer Kontinuität und Medienumbruch zu vermitteln, wie im Falle von Paßmann.36 All diesen Ansätzen gemeinsam ist, dass sie auf Marcel Mauss rekurrieren und dessen sozio-ökonomische Überlegungen zur Gabe mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung als Ausgangspunkt für die jeweiligen und zum Teil höchst heterogen erfolgenden Untersuchungen von sozialen Medien(-plattformen) nehmen. Insofern, so könnte man polemisch sagen, stellt die von Mauss proklamierte »totale soziale Tatsache« nicht nur für die Erforschung von sozialen Medien eine ebensolche dar, sondern auch für soziale Medien selbst.
In gewisser Weise trifft diese Definition jedoch auf jedes Medium zu, denn Medien sind qua ihrer Definition immer im Dazwischen von mindestens zwei Entitäten zu verorten. Folglich lässt sich, frei nach John Hartley, auch argumentieren, dass alle Medien immer schon sozial gewesen sind.37 Eine entsprechende Liste solcher sozialer Medien wäre dementsprechend gleichermaßen lang wie sinnlos, weshalb es im Folgenden auch nicht darum gehen soll, eine auf Vollständigkeit abzielende Mediengeschichte sozialer Medien(-plattformen) zu schreiben, die zu großen Teilen eben eine Mediengeschichte aller Medien wäre, sondern vielmehr zentrale Charakteristika im Kontext der Entwicklung des sogenannten Social Web herauszudestillieren. Denn das Social Web stellt für Praktiken, wie etwa die der im dritten Teil dieser Studie eingehender untersuchten sozial-medialen Fotografie, im Grunde die infrastrukturelle Voraussetzung oder nochmals leicht abgewandelt mit Mauss gesprochen: eben eine totale sozio-technische Tatsache dar. Insofern eignet sich Mauss’ Gabe-Theorem zwar durchaus als Ausgangpunkt für die anstehende Expedition zu den Anfängen des Social Web, zumal er bereits explizit materiale Aspekte mitdenkt.38 Diese müssen im vorliegenden Kontext aber einerseits auf (medien-)technologische und infrastrukturelle Voraussetzungen ausgedehnt werden. Andererseits gilt es die Verflechtung von sozialen und ökonomischen Logiken, die im Gabe-Paradigma zusammenkommen, beständig mitzureflektieren und wo notwendig zu analytischen Zwecken auch zu trennen.39
An diesem kurzen, anthropologisch gefärbten Abriss wird bereits klar, dass dann auch die wenigsten Praktiken von Nutzer:innen innerhalb des Social Web als gänzlich neu zu verstehen sind, sondern eher als Re-Arrangements bestimmter Praktiken betrachtet werden müssen. So knüpft beispielsweise auch die mobile Selbstfotografie, wie sie in den letzten Jahren prominent in Form des Selfies immer wieder thematisiert wurde, innerhalb einer sozial-medialen Zirkulation zwar mitunter an ältere darstellungstechnische Konventionen an. Gleichzeitig ändert und transformiert sich durch die medientechnischen Endgeräte und Distributionsformen aber natürlich auch der Sinn und Zweck solcher Praktiken.
Wirft man also in dieser Perspektivierung nochmals einen genaueren Blick auf das sogenannte Social Web, so verkürzt sich die Liste sozialer Medien zwar auf den ersten Blick ungemein, was jedoch nicht über ein anderes Problem hinwegtäuscht: das der präzisen Kategorisierung. Anja Ebersbach et al. beispielsweise stellen in ihrem Einführungsbuch zum Social Web mit den Kategorien Wikis, Blogs, Microblogging, Social-Networking-Dienste und Social Sharing fünf zentrale Kategorien heraus, die sich in dieser Form und angesichts zunehmender Angleichungen von Plattform-Funktionen bei Facebook, Twitter oder Instagram nur noch schwerlich treffen lassen.40 Insbesondere die ursprünglich von Snapchat eingeführte Story-Funktion, also nur maximal vierundzwanzig Stunden sichtbare Beiträge bestehend aus Bildern, Screenshots und/oder kurzen Videoclips, die sich mittlerweile sowohl bei Facebook und Instagram, als auch WhatsApp finden lassen, verdeutlicht diesen Punkt. Aber auch Twitter als ein in erster Linie Microblogging-Dienst ist gemäß dieser Kategorisierungslogik natürlich ebenso den Bereichen Social-Networking-Dienste wie Social Sharing zuzuordnen. Insofern scheint eine solche von Ebersbach et al. vorgeschlagene Kategorisierung ebenso wenig treffsicher und hilfreich zu sein, wie der Versuch einer Definition sozialer Medien an sich.
Zielführender für das hier verfolgte Anliegen einer mikroperspektivisch genau informierten Theoretisierung sozialer Medienplattformen erweist sich medienhistorisch ebenjene plattformübergreifenden Entwicklungen sozialer Medien nachzuzeichnen, die von der vernetzten Kommunikation der frühen Bulletin Board Systems und anderer virtueller Gemeinschaften, über Weblogs und deren auf Vertrauen und technischen Standardisierungen basierenden Empfehlungsleistungen, bis hin zur in Bewertungspraktiken eingebundenen Plattform-Sozialität von Facebook, Instagram, Twitter und Co. geführt haben. Hieran soll einerseits nochmal deutlich gemacht werden, dass soziale Medien, wie sie heute größtenteils definiert werden, keineswegs erst mit sozialen Medienplattformen wie Facebook und Twitter im Jahr 2004 beziehungsweise 2006 auf den Plan treten, sondern vielmehr schon vor dem WWW eine mehr oder weniger entscheidende Rolle in dessen Vorläufer-Technologien eingenommen haben. Noch entscheidender aber gestaltet sich andererseits der Umstand, dass sich auf diese Weise historisch stabilisierte Organisationsprinzipien und mediale Logiken von sozialen Medien(-plattformen) identifizieren lassen. Aus diesem hier zu explorierenden Zusammenspiel unternehmerischer und ökonomischer Interessen, medientechnologischer Entwicklungen sowie alltagspraktischer Nutzungsweisen schälen und stabilisieren sich beständig auch neue Praktiken und Formen von sozialen Medien heraus, womit auch die Grundlage für eine Theoretisierung von ebensolchen geschaffen wird, wie sie der zweite Teil dieser Studie dann in den Fokus rücken wird.
Im weiteren Verlauf dieses ersten Teils der Studie gilt es deshalb zunächst speziell ebenjenes Zusammenspiel von Software und Unternehmen einerseits, sowie Medientechnologien und Praktiken andererseits, anhand des Software-Plug-In des Like-Buttons genauer unter die Lupe zu nehmen. Anhand der Implementierungsgeschichte dieses zentralen Plattformakteurs, der sich mittlerweile über fast alle großen und damit kommerziell ausgerichteten sozialen Medienplattformen erstreckt, lässt sich nicht nur eine Plattform-Biographie (in diesem Fall von Facebook) schreiben, wie dies etwa Jean Burgess und Nancy Baym in ihrem Buch zu Twitter vorschlagen.41 Vielmehr lässt sich anhand dieser Implementierungsgeschichte auch eine Theorie sozialer Medienplattformen entfalten, so werde ich zeigen, die sowohl über ethnografische Feinanalysen von einzelnen Diensten des Social Web und dort vorherrschenden Praktiken hinausreicht, als auch sich nicht in dualistisch operierenden und kulturkritisch gefärbten Depolitisierungs- und Verdinglichungsproklamationen erschöpft.42 Obgleich eine differenzierte und vor allem genau vorgetragene Kritik natürlich ein wesentlicher Bestandteil so einer Theorie sein muss.
1.1.1Virtuelle Gemeinschaften
Sowohl die Feststellung, dass sich soziale Medien immer in Wechselwirkung mit einer jeweiligen Öffentlichkeit herausbilden als auch die eingangs bereits erwähnte Tatsache, dass soziale Medien in Anlehnung an Friedrich Kittlers berühmtes Zitat unsere Lage bestimmen, sind im Grunde ein Allgemeinplatz geworden.43 Im Zuge der kommerziellen Veröffentlichung des WWW durch Tim Berners-Lee am 6.8.1991, mit dem sich die infrastrukturelle Basis für eine vernetzte Kommunikation breitenwirksam bot, gab es seit Ende der 1970er-Jahre und vor allem ab den frühen 1990er-Jahren zunächst meist relativ kleine und lokal beschränkte virtuelle Gemeinschaften wie etwa das EchoNYC, das auf New York beschränkt war und von Stacy Horn 1990 gegründet beziehungsweise in einem lesenswerten Buch von ihr detailliert beschrieben wurde.44 Vor allem ab den 1990er-Jahren erstreckten sich diese sogenannten virtuellen Gemeinschaften45 aber auch über die gesamten USA oder gar Kontinente hinweg und bildeten zum Teil verschiedene Überkategorien aus, wie etwa das insbesondere unter Afroamerikaner:innen populäre AfroNet zeigt, bei dem es sich gewissermaßen um eine Sammlung von verschiedenen virtuellen Gemeinschaften handelte, die ganz überwiegend Themen der afro-amerikanischen Community gewidmet waren.46
Das wohl populärste Beispiel eines solch frühen sozialen Computernetzwerks dürfte jedoch THE WELL (Whole Earth’Lectronic Link) sein. Dieses wurde 1985 gegründet und war originär in der Region San Francisco Bay angesiedelt. Es stellte in gewisser Weise eine Fortsetzung des berühmten in der Gegenkultur der späten sechziger Jahre verorteten Whole Earth Catalogues47 dar und basierte technisch wie das bereits erwähnte Echo NYC oder auch die Boards des AfroNet auf dem System sogenannter Bulletin Board Systems (BBS), was zu deutsch so viel wie elektronisches schwarzes Brett bedeutet.48 Frei nach Netzpionier Howard Rheingold verstand sich THE WELL als selbstdefiniertes elektronisches Netzwerk interaktiver Kommunikation in dessen Zentrum gemeinsame Interessen oder gemeinsame Zwecke standen, was in der frühen Phase des Netzwerks in erster Linie technikaffine early adopter und Nerds anzog, später sich dann aber durchaus diverser und heterogener gestaltete. So diente THE WELL Anfang der 1990er-Jahre dann unter anderem auch zur Organisation von Dates oder dem Verkauf von allerlei Utensilien oder Gerätschaften wie etwa Rasenmähern.49 Dabei waren und wurden die einzelnen Threads und Gruppen innerhalb des WELL sowohl formalisiert, das heißt sie fanden als moderierte Konferenzen statt, als auch spontan von Nutzer:innen gebildet, die sich immer wieder ins Netzwerk eingeloggt und entsprechend eines vorgegebenen Zeitrasters senden und empfangen oder Kommentare abgeben konnten.50Interessanterweise wird das WELL mit steigender Anzahl von Nutzer:innen nicht nur immer globaler und inhaltlich diverser, sondern geht dabei auch mit zunehmender Skalierung immer mehr mit einer klaren Trennung in On- und Offline-Räume einher51, weshalb der Schwerpunkt zur Hochphase des Netzwerks Anfang der 1990er-Jahre auch fast ausschließlich auf den virtuellen Räumen lag, während im Gegenzug dazu etwa das EchoNYC von Beginn an lokal auf New York beschränkt war und ganz klar auf Begegnungen in Offline-Räumen ausgerichtet war.52
In beiden Fällen wird diese Dichotomie von On- und Offline-Räumen aber keineswegs umgangen, wie man vielleicht geneigt wäre anzunehmen, was genau genommen in einem technischen oder gar medienökologischen Sinne53, damals auch schlichtweg noch nicht im Bereich des Möglichen lag. Viel eher stellt sich die Frage der Trennung von On- und Offline-Räumen durch diesen Fokus auf die Begegnungen im echten Leben54 dann mit Blick auf das EchoNYC gar nicht erst, womit aber auch die Eigenlogiken und –dynamiken sozialer Medien, etwa im Bereich von durchaus in diesen Netzwerken schon beobachtbaren Hate Speech- oder Trolling-Phänomenen, in den Beschreibungen von Horn lediglich angedeutet werden können. Dies macht einerseits ein frühes soziales Medium wie das EchoNYC auf einer individuellen Ebene zwar gleichsam potentiell heimeliger wie bedrohlicher, weil sich immer ganz konkret reale Konsequenzen aus den Online-Handlungen der Nutzer:innen zu ergeben scheinen.55 Andererseits werden mit diesem Understatement von Horn, dass es sich beim EchoNYC lediglich um einen Platz wie jeden anderen in der realen Welt handele56, auch die spezifisch sozial-medialen Logiken unterschätzt und geraten gerade deshalb, obgleich der spannenden ethnografischen Beobachtungen die ihr Buch bietet, gar nicht erst richtig in den Blick.
Damit verhält es sich im Falle von EchoNYC genau konträr zu den utopischen Erzählungen wie sie etwa um THE WELL gesponnen wurden und wie sie in dieser Zeit nicht nur das dominante Narrativ in der Diskursivierung von frühen Formen sozialer Medien waren, sondern den gesamten Diskurs über das Internet bestimmten, wie etwa die berühmte Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace von John Perry Barlow, aber auch wissenschaftliche Arbeiten wie Sherry Turkles psychoanalytische Studie zu den Multi User Dungeons (MUDs) zeigen, die von »Übungsräumen für das reale Leben« spricht.57
Das spezfisch Sozial-Mediale aber gerät sowohl in solch utopisch konnotierten und dabei latent mediendeterministisch operierenden Perspektivierungen, als auch in den Texten, die zwar ebenso die sozial-ermächtigenden Aspekte betonen, dabei aber einen »real life bias«58 mit sich herumtragen, nicht in den Blick. Nicht zuletzt deshalb scheint es im Kontext des hier verfolgten Vorhabens sinnvoll einen genaueren Blick auf die hinter solchen »virtuellen Gemeinschaften« wie EchoNYC oder THE WELL stehenden Technologien der BBS zu richten.59 Schließlich handelt es sich hierbei um nicht weniger als die technologischen Grundlagen der ersten auf Computern basierenden sozialen Medien, was auch aufschlussreich für die hier zu entfaltende Geschichte des Like-Buttons ist.
1.1.1.1Bulletin Board Systems (BBS)
Die Entwicklung des ersten Bulletin Board Systems reicht ins Jahr 1978 zurück als Ward Christensen und Randy Suess, beides Mitglieder des Chicago Area Computer Hobbyist’s Exchange-Netzwerks (CACHE), einem Zusammenschluss von Computerbastler:innen, die die Idee hatten, eine Art Archiv des Club-Newsletters aufzubauen, der über eine Mailing-Liste versendet wurde.60 Das System dieses Archivs sollte auf dem bestehenden Telefonnetz aufbauen. Hierbei griffen Christensen und Suess auf einen selbst gebastelten Rechner mit Hayes-Modem61 zurück, das eine automatische Antwort-Funktion enthielt, und schalteten hierfür eine Tastatur zwischen Modem und Rechner, sodass fortan immer wenn das Telefon geklingelt hat, der eingehende Anruf vom Modem erkannt wurde und direkt einen cold boot des Systems ausgelöst hat, das in Assemblersprache62 auf einem Intel 8080 programmiert wurde.63 Der beständige Neustart bei jedem Anruf verlieh dem System eine gewisse Robustheit bei auftretenden Fehlern wie Kevin Driscoll in einem kurzen Abriss über die Geschichte der BBS schreibt.64
Das heißt die Einwahl in ein BBS beziehungsweise das Herstellen einer Verbindung mit einem solchen, erfolgte also wie bei einem Telefon über die Eingabe einer bestimmten einem BBS zugeordneten Nummer über das Interface eines Software-Terminals.65 Hierin liegt dann auch der zunächst lokale Charakter der BBS begründet, denn Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre zahlten viele Amerikaner:innen bereits einen monatlichen Abschlag (Flatrate) für unbegrenztes lokales Telefonieren.66 Demgegenüber waren die Telefongebühren, die sich über große Distanzen erstreckten oft entsprechend teuer, weshalb manche Networking-BBS, die mehrere Leitungen gleichzeitig anboten, von den Betreiber:innen in erster Linie genutzt wurden, wenn die Gebühren hierfür am günstigsten waren, was oft zu nächtlichen Uhrzeiten der Fall war.67 Wichtig zu betonen ist hier, dass die meisten Boards gerade deshalb single-user BBS’s waren. Das heißt, dass sich in den meisten Boards jeweils nur eine Person für eine bestimmte Zeitdauer in das Board einwählen konnte, da ansonsten eben mehrere Telefonleitungen nötig gewesen wären und die Systemoperator:innen andernfalls wohl hätten Gebühren für die Nutzung der Boards erheben müssen. Auch diese kostenpflichtigen Boards gab es Anfang der 1980er-Jahre, gleichwohl diese nur eine kleine Minderheit darstellten, und wenn dann in erster Linie für Chats oder simple Spiele genutzt wurden.68 Die User:innen jedenfalls konnten so bei den allermeisten BBS nicht direkt miteinander kommunizieren, wie dies etwa bei Chats der Fall war, sondern reagierten vielmehr mit einiger Zeitverzögerung auf die jeweiligen Beiträge der anderen.
Entscheidend für die Einwahl in ein BBS waren neben den Hard- und Software-Voraussetzungen, bestehend aus einem Telefonanschluss, einem Rechner samt Software-Terminal und Tastatur, in erster Linie die richtigen Nummern zu den jeweiligen Boards. Diese Nummern wurden in Listen gesammelt, die einerseits über einschlägige Zeitungen und Zeitschriften verbreitet wurden, andererseits aber in den allermeisten Fällen auch über die Software-Terminals innerhalb der BBS selbst aufrufbar waren oder über einschlägige Mailing-Listen verschickt wurden.69 Versehen waren diese Listen oft mit zusätzlichen Angaben wie der dem BBS zugehörigen Stadt, den verantwortlichen Sysops (Systemoperator:innen), Informationen über Art und Status der Boards (T/S) und die jeweiligen Stunden des Betriebs (BdHrs), nicht zuletzt wegen der Telefon-Tarife (siehe Abb. 1).
Abb. 1:Software-Terminal der IBM-Bulletin Boards aus dem Jahr 1987
Quelle: https://www.pinterest.de/pin/meade-modification-helpful--423479171204010488/
Den zentralen Zugang zu den Boards markieren für die Nutzer:innen also diese Listen mit den entsprechenden Nummern, wodurch der Liste im Kontext von BBS eine klassisch administrative Funktion zukommt, die letztlich nicht nur sortiert und zirkulieren lässt, wie dies etwa Cornelia Vismann als zentrale Charakteristika der Liste herausgearbeitet hat, sondern auch ganz konkret über In- und Exklusion von Nutzer:innen (mit-)entscheidet.70 Was nicht zuletzt auch Relevanz erfährt durch den Aspekt, dass diese Listen in den einzelnen Regionen eigentlich nie ganz vollständig waren und somit keinen umfassenden Überblick über alle Boards einer Region bieten konnten.71
Dies gilt selbst noch für heutige Boards wie sie etwa über den Telnet BBS Guide72 zugänglich gemacht werden, bei dem ganz im Stile von nostalgischem Retrocomputing nach wie vor von BBS-Nerds zusammengestellte Listen verschiedener Boards zirkulieren, deren Einwahl allerdings nicht mehr wie noch Anfang der 1990er-Jahre über Modems funktioniert, sondern über das Telnet-Netzwerkprotokoll erfolgt.73 Die Liste stellt für die Boards allerdings nicht nur auf der Ebene des Zugangs das zentrale Element dar. Darüber hinaus bestimmt sie, nicht zuletzt durch den textbasierten Charakter der Boards, auch deren User:innen-Interfaces, wie ein Blick auf die Menüs der klassischen BBS zeigt. Hier ordnet sie insbesondere alphabetisch (»System Commands«, siehe Abb. 2) und numerisch, aber auch geographisch, wenn man an den lokativen Charakter der einzelnen Boards und die Zugangslisten denkt (siehe Abb. 1). Obgleich spätere Systeme wie The WELL dann auch zunehmend global genutzt werden.
Abb. 2:Menü des »Peoples Message Systems« mit Command-Zeile
Quelle: Dewey: Essential Guide to Bulletin Board Systems, S. 109.
Zwar kommt es mitunter vor, dass diesem Start- oder Hauptmenü ganz einfache und frühen Computerspielen nachempfundene Pixelgrafiken vorgeschaltet sind, wenn man sich gerade frisch eingeloggt hat. Allerdings dienen diese ausschließlich ästhetischen oder repräsentativen und nicht funktionalen Zwecken. Nicht nur die System Commands sind bei den BBS alphabetisch und listengleich auf der Benutzeroberfläche angeordnet, wie zum Beispiel G, das für Goodbye. Leave system steht.74 Auch die Hauptmenüs und einzelnen Sub-Boards werden durch das Prinzip der Liste organisiert (siehe Abb.3)75, womit die Liste als zentrales Interface-Element definiert werden kann.76 Und dies eben in zweierlei Hinsicht: einerseits ordnet und strukturiert sie die Elemente auf der grafischen Benutzer:innenoberfläche. Andererseits regelt und organisiert sie aber auch den Zugang zu den BBS, womit sie gewissermaßen auch die Backend-Ebene des Interface strukturiert und so gleichermaßen zwischen beiden Ebenen, Front- und Backend, prozessiert.
Nicht zuletzt deshalb kann die Liste auch als zentrale mediale Form dieser frühen sozialen Medien beschrieben werden, da sie unabhängig von den Ordnungsparametern (alphabetisch, numerisch usw.) auf der Benutzer:innenoberfläche als grundlegende Verkettung zwischen Front- und Backend fungiert.77
Abb. 3:Hauptmenü des Sub-Boards »The Writers Guild Quill«
Quelle: Dewey: Essential Guide to Bulletin Board Systems
Ganz ähnlich operierten das parallel enstandene Usenet, das erstmals 1979 zwei Unix-Rechner der University of Carolina und der Duke University miteinander verband und das in Frankreich ab 1982 nahezu in sämtlichen Departements eingeführte Minitel-System. Usenet griff dabei auch und gerade in der Anfangszeit nicht auf das Internet zurück, womit einerseits eine ganz ähnliche Infrastruktur wie bei den BBS vorlag, und andererseits die grafische Benutzer:innenoberfläche den Zugriff auf die Newsgropus ähnlich listenförmig regelte und damit in vergleichbarer Weise angeordnet war.78
Dies gilt auch für das Minitel-System in Frankreich, das insbesondere durch die staatliche Förderung und mit der fast schon als legendär zu bezeichnenden Einwahl 3615 von 1982 an stetig steigende Nutzerzahlen verzeichnete und dabei ganz wie die BBS nichr nur auf dem Telefonnetz aufsattelte, sondern ebenfalls mit einer nahezu identisch angeordneten grafischen Benuzer:innenoberfläche aufwartete.79
Das mit der Liste also ein erstes zentrales Organisationssprinzip sozialer Medien markiert ist, zeigt dann nicht nur die weitere Geschichte des etwa zeitgleich ebenfalls öffentlich werdenden WWW, wo die Liste als struktureller Baustein der Hypertext Markup Language (HTML) mit den Elementen der ordered (OL) und unordered lists (UL), MENU (list of smaller paragaphs) und DIR (list of short elements) eine entscheidende Funktion erfüllt.80 Vielmehr lässt sich ihre zentrale Rolle als mediale Form und ordnungsstiftendes Prinzip ganz konkret bis in die neuesten sozial-medialen Plattformen und Apps verfolgen, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels deutlich werden wird und weshalb in dieser Studie auch auf das Organisationsprinzip der Liste immer wieder zurückzukommen sein wird. Umso erstaunlicher mutet es daher an, dass dieser Aspekt weder in der Forschung zu den sogenannten »virtuellen Gemeinschaften« in den 1990er und frühen 2000er-Jahren, noch in der heutigen Forschung zu sozialen Medienplattformen bisher angemessen reflektiert wurde.81
Während die frühe Forschung sich in erster Linie an den vergemeinschaftenden Aspeken unter Rekurs auf das Gabe-Theorem abarbeitet und sich dort dem Paradoxon eines Technikdeterminismus bei gleichzeitig vorhandener Technologievergessenheit hingibt, überwiegt in neueren einschlägigen Arbeiten eine Engführung mit dem Prinzip der Quantifizierung, die von der Ausbeutung unbezahlter Arbeit der Nutzer:innen durch die Plattformen, bis hin zu Überwachungspraktiken im digitalen Panoptikum reicht.82 Wobei die Liste in diesem Kontext, wenn überhaupt, in erster Linie als Popularitätsindex thematisiert wird.83
Obgleich dieser Verweis auf die Quantifizierung ein wichtiger ist, auf den auch noch einzugehen sein wird, sind die dominanten Narrative in dieser Gemengelage aber häufig nach wie vor dualistischer Natur, seien es nun auf der einenen Seite utopische Narrative und damit einhergehende soziale Ermächtigungsfantasien oder auf der anderen Seite dystopische Narrative, häufig unter Rekurs auf ökonomische Verdinglichungsdiskurse. Wohl nicht zuletzt deshalb wird in diesem Kontext auffällig oft auf das schon kurz angeschnittene Gabe-Konzept, und damit implizit einen Praxeozentrismus rekurriert, was zu großen Teilen auf Howard Rheingolds einflussreiches Buch zurückzuführen ist. Obgleich dieser selbst keinerlei theoretische Referenzen anführt, also weder explizit auf Malinowski noch Mauss verweist, sondern lediglich in einem Kapitel von einer Schenkökonomie spricht.84 Die Attraktivität dieses Konzepts für die Beschreibung sozialer Medien liegt dann aber wohl genau darin begründet, dass der Diskurs um Gabe-Praktiken wie sie zuerst von Malinowski beschrieben wurden, eben durch dieses Spannungsverhältnis von sozialen und ökonomischen Logiken bestimmt ist und die Gabe dadurch gleichermaßen als Grundkonstituente von Sozialität definiert, wie auch zur Erklärung von wirtschaftlichen Formen des Tauschs herangezogen werden kann.85 Gerade deshalb scheint auch die Forschung zu sozialen Medien im Nachgang zu Rheingolds Buch und bis heute immer wieder auf dieses Konzept zu rekurrieren.86 Nichtsdestotrotz sind die meisten dieser Arbeiten aber auch durch eine eigentümliche Abwesenheit oder die unzulängliche Reflektion der technischen und infrastrukturellen Aspekte der sozial-medialen Räume gekennzeichnet, in denen sich die jeweiligen untersuchten Praktiken vollziehen, wodurch nicht zuletzt mitunter einem Technikdeterminismus Tür und Tor geöffnet wird, da eine tiefergehende Reflektion der Technologien ausbleibt, und soziale Medien dadurch gleichermaßen in positiver wie negativer Wirkmächtigkeit überschätzt werden.
In theoretischer Hinsicht ist dies dann sicherlich einerseits darauf zurückzuführen, dass Mauss selbst die materialen Aspekte der Gabe lediglich in den ausgetauschten Gegenständen verortet und somit die Praktiken ganz klar im Fokus stehen. Andererseits liegt vielleicht genau in diesem blinden Fleck einer weitgehenden Technologieblindheit einer der Gründe, weshalb die zentrale Rolle, die das Prinzip des Listens für soziale Medien spielt, in der Regel nicht weiter thematisiert wird. Insofern scheint es für eine Theoretisierung sozialer Medien(-plattformen) geboten, den in diesem Absatz erprobten Ansatz weiterzuverfolgen, denn das Prinzip der Liste ist nicht nur für die sich in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre langsam entwickelnden Weblogs und eine daraus resultierende sogenannte Blogosphäre87 (womit die Gesamtzahl an sogenannten »Weblogs« im Internet gemeint ist) ein entscheidendes Element. Vielmehr lässt sich dieses Organisationsprinzip bis in die (News-)Feeds der neuesten sozial-medialen Plattformen und Apps verfolgen, die auf der grafischen Benutzer:innenoberfläche schließlich nichts anderes als nie endende Listen darstellen.
1.1.2Weblogs
Auch die Ursprünge des sogenannten Weblogs lassen sich gewissermaßen bis an die Anfänge des WWW zurückverfolgen. Der Begriff stellt hierbei eine Kombination aus Web und Logbuch dar und wurde 1997 vom US-amerikanischen Blogger Jorn Barger geprägt, dessen Blog Robot Wisdom einen der einflussreichsten frühen Weblogs darstellte, geprägt. Grundsätzlich ist ein Weblog nach der Definition von Rebecca Blood eine »Web page where a Web logger ›logs‹ all the other Web pages she finds interesting.«88
Der oder die Weblog-Betreiber:in spricht also Empfehlungen für andere Webseiten und Weblogs aus und greift im Zuge dessen vorwiegend auf Text zurück, womit Weblogs in erster Linie als Informationsfilter fungieren wie auch Jodi Dean betont: »Blogging responds to the problem of finding what one wants by offering something like a relationship, a connection.«89 Explizit betont Dean hier den sozialen Aspekt des Bloggens, der sich jedoch im Kontrast zu den Vorläufern von Weblogs, den persönlichen oder institutionellen Webseiten, wie sie zum Beispiel auch von Tim Berners-Lee oder dem National Center for Supercomputing Applications (NCSA) in den Anfangstagen des WWW betrieben wurden, in einer mehr auf Aktualität fokussierten Weise ausgestaltet.
Gleichwohl natürlich auch diese Webseiten für ein Publikum beziehungsweise eine Leser:innenschaft erstellt wurden und werden und insofern sozial sind, ist hier anzumerken, dass gerade zu dieser frühen Phase des WWW der Unterschied von eigener Webseite und Weblog noch nicht hinreichend ausdifferenziert ist. Ignacio Siles differenziert zwar in dieser Phase zwischen Online diaries, Personal publishing journals und Weblogs.90 Dennoch sind Online diaries, bei denen es oft um die Darstellung von einschneidenden Lebensereignissen wie etwa schweren Erkrankungen ging, und die Personal publishing journals, die durch eine erstaunliche Heterogenität charakterisiert sind und gleichsam journalistische Texte wie auch Prosa, Essays oder Gedichte beinhalten konnten, noch klassische Webseiten.91
Graduell lässt sich dennoch sagen, dienten persönliche Webseiten eher einer abgeschlossenen Präsentation der eigenen Person oder einem bestimmten Aspekt des Lebens wie etwa dem Schreiben, während Weblogs in erster Linie auf die tägliche oder zumindest wöchentliche Aktualisierung von tendenziell kurzlebigeren Inhalten angewiesen sind.92 Da auch die frühen Weblogs mittels herkömmlicher HTML- oder Web-Editoren von den Betreiber:innen erstellt wurden, wurde für die Erstellung beziehungsweise Einrichtung eines Weblogs auch ein bestimmtes Maß an praktisch erworbenen Software-Kenntnissen vorausgesetzt.93 Jene Webseiten beziehungsweise selbst mit Software-Editoren erstellten Weblogs erfüllten zwar auch den Zweck der Informationsfilterung, was in Anbetracht des schnell wachsenden WWW alles andere als überraschend ist. Neben der anderen Aktualisierungsfrequenz gab es allerdings einen weiteren entscheidenden Unterschied: Denn wo diese frühen Weblogs in erster Linie der (rein subjektiven) Informationsfilterung dienten, funktionieren die späteren Blogs maßgeblich über den Mechanismus des Vertrauens.
Über das Vertrauen in den oder die Blogger:in wird gleichzeitig Vertrauen in den jeweiligen publizierten beziehungsweise empfohlenen Inhalt gesetzt. Dean schreibt hierzu: »It focuses on the person providing the link, offering the searcher the opportunity to know this person and so determine whether she can be trusted.«94 Damit ist der zugeschriebene Wahrheitsgehalt eines Blog-Posts und somit der Informationswert in entscheidender Weise abhängig vom »elementaren Tatbestand sozialen Lebens« als den Niklas Luhmann Vertrauen einmal definiert hat.95 Dieses Vertrauen allerdings müssen sich Blogger:innen erst in Form von bestimmten sozialen Praktiken erarbeiten (im Unterschied zu Institutionen wie etwa der NCSA). Diese Praktiken beziehen sich zum einen natürlich auf den jeweiligen verlinkten Inhalt. Vielmehr aber noch wird Vertrauen durch die persönliche Interaktion, sowohl mit den Leser:innen der Blogs, zum Beispiel in Form von Reaktionen auf Kommentare, als auch mit anderen Blogger:innen der Blogosphäre, etwa durch Praktiken des Verlinkens und Zitierens, gewonnen. Insbesondere letzteres kann als Vertrauensbonus charakterisiert werden, wenn die von einem oder einer Blogger:in verlinkten Blogger:innen ein entsprechendes Ansehen in der Blogosphäre genießen oder diese angesehenen Blogger:innen gar den Blog des oder der sie zitierenden weniger angesehenen Bloggers oder Bloggerin verlinken.
Obgleich die Kommerzialisierung von Weblogs in der Anfangsphase quasi nicht vorhanden war beziehungsweise nur mäßig voranschritt (1999 zählte die Blogosphäre gerade einmal dreiundzwanzig Weblogs, die zumeist von Leuten aus der Tech-Branche betrieben wurden96), so gewinnen diese Praktiken der Vertrauensbildung erst ab der standardisierten Einführung von Weblog-Vorlagen mittels vorgefertigter Skripte durch Anbieter wie Pitas‚ LiveJournal und Blogger ab 1999 richtig an Bedeutung. In diesem Kontext bezeichnet man solche bei den Diensten erstmals automatisierten Verlinkungspraktiken auch als Trackback.97 Der Trackback entstand erstmals im Rahmen der Software Movable Type, die diesen im Anschluss an die im Oktober 2001 freigeschaltete Kommentarfunktion einführte98, und benachrichtigte User:innen, wenn andere Nutzer:innen auf sie verwiesen.99 Da die URL des zu verlinkenden Blogs bei Trackbacks zumeist noch manuell eingegeben werden musste, also beispielsweises in Form eines Verweises von Blogger:in A auf Blogger:in B, der bei Veröffentlichung des Beitrages durch Blogger:in A nun auch auf dem Blog von Blogger:in B als Referenz angezeigt wird, hebt sich die Unidirektionalität des Verweises auf.
Nicht nur stieg durch die damit einhergehende generell vereinfachte Handhabung der Technologie bei der Einrichtung eines Weblogs fortan die Anzahl der persönlich betriebenen Blogs stark an. Vielmehr vereinfachten die Anbieter von vorgefertigten Blog-Skripten einerseits via Kommentarfunktion auf die Beiträge anderer Blogger:innen zu reagieren, wie das in etwas umständlicherer Form bereits von den BBS der virtuellen Gemeinschaften bekannt war. Und andererseits waren erstmals eine Reihe von Statistiken für Nutzer:innen zugänglich. Diese beinhalteten Informationen darüber welche Blogs die höchste Zahl von Einträgen hatten oder die neuesten Beiträge oder die höchsten Besucherzahlen aufweisen, womit erstmals Metriken integriert werden, die man bis dato nur von entsprechenden Logfiles100 beziehungsweise Hit-Countern (Seitenaufruf-Zähler) von selbst erstellten Webseiten kannte.101 Zudem gab es für einige Blog-Systeme nun auch erstmals sogenannte Bookmarklets, die es Nutzer:innen erlauben die URL einer interessanten Webseite mit einem Klick im eigenen Blogpost zu speichern. Generell konnte man hinsichtlich der Bloginhalte eine starke Zunahme an alltagsweltlichen Blog-Beiträgen konstatieren, was auch als Übergang vom sogenannten Linklog, der in erster Linie der Informationsfilterung diente, zum sogenannten Lifelog, zum Teilen persönlicher Meinungen, Kommentare oder Tagebücher, beschrieben wurde.102
Ebendieser Umstand veranlasst dann 2003 auch etwa Google Pyra Labs, das Unternehmen hinter dem Dienst Blogger zu kaufen, woraufhin auch Microsoft (MSN Spaces, 2004) und Yahoo (Yahoo 360, 2005), die beiden damaligen größten Konkurrenten von Google, mit eigenen Blog-Diensten reagierten. Diese schrittweise erfolgende Kommerzialisierung von Weblogs, angestoßen durch Google und Yahoo, erweist sich hierbei nur als allzu logische Konsequenz, stellen Suchmaschinen und von Privatpersonen betriebene Blogs bis zur Kommerzialisierung und Veralltäglichung doch zwei unterschiedliche Lösungsansätze zur Informationsfilterung von Webinhalten dar.103
Das Hinzutreten von Drittanbietern, die technologisch standardisierte Skript-Vorlagen anbieten und sich dabei größtenteils über Werbebanner finanzieren, weckt also nicht nur das Interesse von Internet- und Software-Giganten wie Google oder Microsoft, sondern führt auch zu einer Ausweitung von Blogging-Praktiken des Alltäglichen und dahingehend fast schon zu einer regelrechten Blog-Euphorie, wie nicht zuletzt die Aufnahme des Wortes Blog in das Oxford Dictionary 2003 oder des Begriffs Weblog in den Duden 2006 zeigen. Damit einher geht eine Ausdifferenzierung des Professionalitätsspektrums, das fortan nicht nur aus engagierten softwareaffinen Privatnutzer:innen und Webdesigner:innen, also sogenannten early adoptern bestand, sondern in hohem Maße publizistische Laien und Unternehmen miteinschloss. Parallel dazu führen aber auch technologische Weiterentwicklungen im Bereich der Mobilfunkbranche und des Wearable Computing zu Veränderungen im Bereich der Praktiken von Blogger:innen. Die Einführung von drahtlosen Mobiltelefonen und die Integration von Instant Messengern beziehungsweise Kurznachrichtendiensten (SMS) sowie insbesondere digitalen Kameras in diese Mobiltelefone ab Ende der 1990er Jahre ruft auch neue Formen des Bloggens auf den Plan, allen voran die Form von sogenannten mobilen Blogs, kurz Moblogs genannt.
1.1.2.1Moblogs
Der Begriff Moblog oder MoBlog wurde zuerst von Justin Hall und Adam Greenfield im Jahr 2002 beziehungsweise 2003 verwendet.104 Letzterer organisierte 2003 gar eine International Moblogging Conference (IMC) in Tokyo. Im Grunde sind Moblogs wie Weblogs regelmäßig auf den neuesten Stand gebrachte Blogs mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Inhalte meist und zum Teil ausschließlich von mobilen Endgeräten, hauptsächlich von Mobiltelefonen, aber auch Personal Digital Assistants (PDAs) oder Notebooks mit WLAN erstellt werden. Zudem bestehen Moblogs, im Gegensatz zur eher textbasierten Form des Weblogs, fast ausnahmslos aus Fotos, die zuvor mit der meist in das entsprechende Mobiltelefon integrierten Kamera aufgenommen wurden und »lediglich« um Begleit- oder Paratexte zu den geposteten Fotos ergänzt werden. Strukturell unterscheiden sich Moblogs also nicht von gewöhnlichen Weblogs, weshalb zum Beispiel einer der größten Weblog-Anbieter, Blogger, auch nicht zwischen Weblog und Moblog differenziert, sondern Moblogs folgerichtig in Weblogs integriert hat.
Die Entwicklungen im Bereich der technischen Standardisierung von Moblogs entsprechen weitgehend denen der »großen« Weblog-Szene. Auch hier gibt es Anbieter, die mittels vorgefertigter Moblog-Skripte Nutzer:innen ermöglichen einen Blog zu eröffnen.105 Durch den Einsatz von mobilen Endgeräten wird es allerdings möglich zum Beispiel über Kurznachrichtendienste direkt Beiträge per SMS/MMS vom Handy aus auf den Blog hochzuladen, womit verschiedene Anwendungen mit den Blogs verbunden werden können. Darüber hinaus können Moblogs durch ebendiese Tatsache, dass für die Beiträge überwiegend auf mobile Endgeräte zurückgegriffen wird, auch als »locative media« bezeichnet werden.106 Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Moblogs in erster Linie persönlichen Veröffentlichungsinteressen dienen und damit nicht nur den mit den Weblogs bereits angestoßenen Übergang vom Linklog zum Lifelog weiter befeuern und für einen bis dato unvergleichlichen Anstieg von privaten Fotografien im öffentlichen Raum des Netzes sorgen. Mehr als die Hälfte aller zur Hochphase von Moblogs im Jahr 2005 veröffentlichten Fotos zeigen empirischen Untersuchungen zufolge Schnappschüsse von Personen und/oder vermeintlich banale Alltagssituationen wie etwa das Mittagessen.107
Der Wortschöpfer Justin Hall charakterisiert dementsprechend den Moblog in Abgrenzung zum Weblog 2002 folgendermaßen: »Ein Weblog ist die Dokumentation von Reisen im Web, darum sollte ein Moblog die Dokumentation von Reisen in der Welt sein.«108 Interessant dabei ist, dass nicht nur der zweite Teil des Satzes wie eine Vorwegnahme vieler Instagram-Profile von Influencer:innen im Bereich Travelling klingt. Obgleich Hall Reisen im vorliegenden Kontext eher als Synonym für die Mobilität im Alltag verwendet hat. Vielmehr wird an dieser Aussage einerseits deutlich, dass auf Fotos basierende Moblogs maßgeblich zu einer Popularisierung von Blogging-Praktiken im Alltag beitrugen, es also nicht mehr nur um die technisch versierten early adopter ging, die sich in diesem Format der Welt mitteilen. Und andererseits scheint die schon Rheingolds virtuelle Gemeinschaften auszeichnende Unterscheidung zwischen On- und Offline-Räumen überraschenderweise nach wie vor gegeben. Allerdings weist Hall, gerade durch den implizit thematisierten lokativen Aspekt der mobilen Blogs, bereits auf das Bröckeln dieser Dichotomie hin. Nicht zuletzt bedingt durch die mobilen Endgeräte, wie sie insbesondere in Japan unter dem Namen keitai berühmt wurden und zuerst für eine breite Öffentlichkeit verfügbar waren sowie dem damit einhergehenden Ausbau einer Infrastruktur für mobiles Internet in Form des I-Mode-Systems, das eine Anpassung von Webseiten für die Darstellungskapazitäten der Displays von mobilen Endgeräten ermöglichte.109
In ebenjene Richtung weisen dann auch die Kommunikations- und Statistik-Funktionen von standardisierten Moblogs. Diese entsprechen zwar zu großen Teilen den Funktionen bei Weblogs und beinhalten allen voran die Kommentarfunktion, die oftmals monologisch geprägt ist und mittels derer Nutzer:innen positive oder negative Emotionen gegenüber dem geposteten Inhalt auszudrücken vermögen. Moblogs weisen jedoch, im Unterschied zu Weblogs, mit der Möglichkeit einer standardisierten Bewertung und Einstufung einzelner Bilder und Fotos bereits eine elementare Besonderheit auf: Auf einer Rating-Skala von eins bis zehn haben Nutzer:innen etwa beim Moblog-Anbieter Textamerica unter dem Beitrag des jeweiligen Bloggers oder der jeweiligen Bloggerin die Möglichkeit zu einer standardisierten Bewertung des hochgeladenen Fotos oder Bildes (Abb. 4).
Abb. 4:User:innen-Interface eines Moblogs aus dem Jahr 2003 mit Bewertungsfunktion (ohne Foto)
Quelle: https://web.archive.org/web/20041011122146/http://mobgod.textamerica.com/?_go=act.mvis.head
In gewisser Weise werden damit nicht nur bereits standardisierte Bewertungspraktiken von sozialen Medienplattformen vorweggenommen wie sie später insbesondere durch den Like-Button plattformübergreifend ubiquitär werden sollten. Auch werden die mit standardisierten Weblogs eingeführten Metriken in Form von Statistiken der Nutzer:innen, die beim Betreiben eines Blogs quasi nebenbei anfallen, nun ganz konkret mit einer bewussten sozialen Bewertungshandlung durch die Nutzer:innen gekoppelt.
Im Kontext der Entwicklung eines Social Web ist dies alles andere als unbedeutend. Denn dies heißt auch, dass die Einführung von standardisierten Bewertungspraktiken zum einen mitnichten erst mit Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Twitter im Jahr 2004 beziehungsweise 2006 beginnt. Und zum anderen, dass solch standardisierte Bewertungspraktiken im Kontext von sozialen Medien in entscheidender Weise mit dem Aspekt der Popularisierung und der Veralltäglichung von Nutzer:innen-Content einherging, wobei dem Medium der Fotografie, und hier insbesondere überwiegend privaten, und das heißt mit dem Kamera-Handy erstellten, Schnappschüssen eine zentrale Rolle zukommt.
Selbst die ebenfalls 2004 zunächst als Weblog und mit von dort übernommenen Features (Trackback, Permalink, Statistiken in Form von Views etc. pp) gestartete Foto-Sharing-Plattform Flickr verfügt in den Anfangstagen noch über keine standardisierte Bewertungsfunktion von Fotos und ist anfänglich in Bezug auf die grafische Benutzer:innenoberfläche im Grunde einer Moblog-Ästhetik nachempfunden.110
Moblogs, und damit der (mobilen) Fotografie insgesamt, muss nicht zuletzt deshalb wohl auch eine tragende Rolle bei der Etablierung von standardisierten Bewertungspraktiken im Kontext sozialer Medien eingeräumt werden. Gleichwohl Moblog-Portale diese Bewertungshandlungen im Kontext des Social Web nicht erfunden haben, sondern sich hier wiederum bei sexistischen Webseiten wie HotorNot bedienten, bei der vorwiegend Frauen von einem überwiegend männlichen Publikum nach ihrem Äußeren bewertet wurden.111 Nichtsdesotrotz ist damit ein Umstand markiert, der nicht zuletzt in Anbetracht von sozial-medialen Praktiken wie dem Selfie weiterer Reflexion bedarf und auf den es deshalb zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Studie noch zurückzukommen gilt. Mit diesen standardisierten auf Metriken basierenden Bewertungspraktiken ist damit zudem das zentrale Charakteristikum sozialer Medien seit spätestens 2009 definiert. Spätestens seit diesem Zeitpunkt, als Facebook erstmalig den Like-Button einführte, kann sich diesen Bewertungspraktiken kein:e Nutzer:in einer sozialen Medienplattform mehr wirklich entziehen112, was schließlich auch die Dichotomie zwischen On- und Offline-Räumen vollends kollabieren lässt, wie im Folgenden erläutert werden soll.