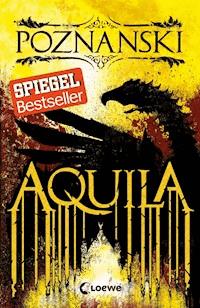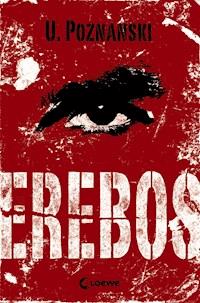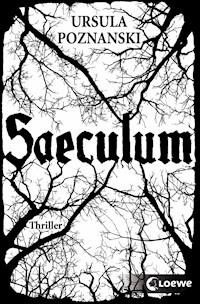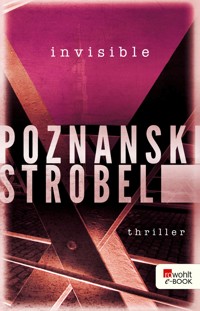
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du bist so wütend auf ihn. Du hasst diesen Menschen mehr als alles auf der Welt – obwohl du ihn gar nicht kennst. Und dann schlägst du zu … Eine Serie von grauenvollen Morden gibt den Hamburger Kriminalkommissaren Nina Salomon und Daniel Buchholz Rätsel auf: Einem Patienten wird während einer OP ins Herz gestochen, ein Mann totgeschlagen, ein anderer niedergemetzelt … Die Täter sind schnell gefasst. Nur ihre Motive sind völlig unbegreiflich, denn keiner von ihnen hat sein Opfer gekannt. Das einzige, was sie verbindet: Die unermessliche Wut auf das Opfer. Und dass sie nicht wussten, was über sie kam. Kann es sein, dass sie manipuliert wurden? Aber von wem und vor allem: wie? Was Salomon und Buchholz schließlich aufdecken, wirft ein ganz neues Licht auf die Dinge, die unser Leben so bequem machen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Ursula Poznanski • Arno Strobel
Invisible
Thriller
Über dieses Buch
Du bist so wütend auf ihn. Du hasst diesen Menschen mehr als alles auf der Welt – obwohl du ihn gar nicht kennst. Und dann schlägst du zu …
Eine Serie von grauenvollen Morden gibt den Hamburger Kriminalkommissaren Nina Salomon und Daniel Buchholz Rätsel auf: Einem Patienten wird während einer OP ins Herz gestochen, ein Mann totgeschlagen, ein anderer niedergemetzelt … Die Täter sind schnell gefasst. Nur ihre Motive sind völlig unbegreiflich, denn keiner von ihnen hat sein Opfer gekannt. Das einzige, was sie verbindet: Die unermessliche Wut auf das Opfer. Und dass sie nicht wussten, was über sie kam.
Kann es sein, dass sie manipuliert wurden? Aber von wem und vor allem: wie?
Was Salomon und Buchholz schließlich aufdecken, wirft ein ganz neues Licht auf die Dinge, die unser Leben so bequem machen …
Vita
Ursula Poznanski wurde 1968 in Wien geboren. Sie war als Journalistin für medizinische Zeitschriften tätig. Nach dem fulminanten Erfolg ihrer Jugendbücher «Erebos» und «Saeculum» landete sie bereits mit ihrem ersten Thriller «Fünf» auf den Bestsellerlisten. Bei Wunderlich folgten «Blinde Vögel», «Stimmen» und «Schatten»; gemeinsam mit Arno Strobel «Fremd» und «Anonym». Inzwischen widmet sich Ursula Poznanski ganz dem Schreiben. Sie lebt mit ihrer Familie im Süden von Wien.
Arno Strobel, 1962 in Saarlouis geboren, studierte Informationstechnologie und arbeitete lange bei einer großen deutschen Bank in Luxemburg. Im Alter von fast vierzig Jahren begann er mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, die er in Internetforen veröffentlichte, bevor er sich an seinen ersten Roman heranwagte.
Mit seinen Psychothrillern erklomm Strobel die Bestsellerlisten. Arno Strobel lebt in der Nähe von Trier.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2019
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildung Sandra Kreuzinger/Getty Images
ISBN 978-3-644-20033-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Er war schon um halb sieben da gewesen, obwohl er wusste, dass man den Patienten erst um acht Uhr in den OP schieben würde. Auf den heutigen Tag hatte er seit Monaten hingefiebert – seit er die Bestätigung bekommen hatte, dass er das letzte Drittel seines praktischen Jahres an der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie des UKE Hamburg absolvieren durfte.
Ihm war klar, dass er unfassbares Glück gehabt hatte. Es gab jeweils nur zwei Plätze in dieser Abteilung; er hatte sich bereits ein Jahr vorher beworben, um seine Chancen zu erhöhen. Herzchirurgie war für ihn immer die Königsdisziplin gewesen und der Karriereweg, den er sich mehr wünschte als jeden anderen. Heute würde er seine ersten Schritte auf diesem Weg gehen.
Natürlich noch nicht wirklich, da musste er realistisch sein. Mehr als ein paar assistierende Handgriffe würden für ihn nicht drin sein, wenn überhaupt, aber er hatte vor, sich hier so unentbehrlich wie möglich zu machen. Vielleicht bot man ihm ja eine Stelle als Assistenzarzt an, wenn er sein Studium beendet hatte.
«Tim Marold?» Eine der Schwestern, klein und füllig, winkte ihn heran. «Wir legen dann los.»
Der Patient hieß Olaf Richter, war zweiundsechzig Jahre alt und bereits anästhesiert. Tim hatte die Krankenakte genau studiert: Mitralinsuffizienz, das hintere Segel schlug durch. Damit die Pumpfunktion des linken Ventrikels sich nicht weiter verschlechterte, würde Dr. Hilbrecht die Klappe rekonstruieren. Tim bekam seinen Platz zugewiesen und hatte direkten Blick auf einen der Bildschirme, auf den das Endoskop die Aufnahmen übertrug.
Hilbrecht genoss einen ausgezeichneten Ruf als Herzchirurg, er und Dr. Paul Bremer teilten sich die schwierigen Eingriffe. Routineoperationen wie diese nahmen sie nur selten selbst vor.
Entsprechend entspannt betrat Hilbrecht den OP, grüßte in die Runde und begann dann, an der Leiste des Patienten den Zugang für die Herz-Lungen-Maschine zu legen. Arterielles Blut schoss aus dem kleinen Schnitt, hellrot. «Sie sind unser Neuzugang, nicht wahr?», fragte Hilbrecht, ohne aufzublicken. «Herr …»
«Marold», kam Tim ihm schnell zu Hilfe. «Ich bin seit gestern hier, und ich hoffe, ich kann mich nützlich machen.»
«Aber sicher», antwortete Hilbrecht gutmütig. «So. Zugang sitzt. Heparin.»
Durch die Venenkanüle setzte eine der Assistentinnen die Injektion mit dem gerinnungshemmenden Mittel. Hilbrecht griff zu einem länglichen Instrument. «Sehen Sie, Herr Marold, jetzt dilatieren wir das Gefäß, damit wir die Kanüle für die Herz-Lungen-Maschine auch gut reinkriegen.»
Tim sah ihm zu, wie er die Arterie dehnte, dann den weißen Plastikschlauch einführte und das Gegenstück hineinsteckte. «Verbindung steht», verkündete er fröhlich. «Und, Herr Marold, was passiert jetzt?»
Tim hatte gestern noch seine Lehrbücher gewälzt, zum Glück. «Jetzt legen Sie einen Zugang zur Vene und schieben einen Draht bis in die große Hohlvene», sagte er nicht ohne Stolz. «Seldinger-Technik. Dann öffnen Sie den Thorax und sehen nach, ob die Lunge frei oder mit der Thoraxwand verwachsen ist.»
Der Chirurg nickte. «Ausgezeichnet. Wir gehen von der Seite rein, das klappt genauso gut, wie wenn wir das Brustbein aufsägen, erspart unserem Patienten später aber eine Menge Schmerzen.»
Ich weiß, lag es Tim auf der Zunge, aber er schluckte es hinunter. Sich gleich zu Beginn als Klugscheißer zu präsentieren, war vermutlich keine gute Idee.
Hilbrecht nickte der OP-Schwester zu. «Messer.» Damit meinte er kein Skalpell im herkömmlichen Sinn, sondern einen Kauter. Ein Stromskalpell gewissermaßen, das nicht nur den Schnitt setzte, sondern gleichzeitig die Gefäße verödete und so die Blutung stillte.
Fasziniert beobachtete Tim über den Bildschirm, wie Hilbrecht das Brustfell durchtrennte, feststellte, dass die Lunge nicht verwachsen war, seine Assistentin anwies, sie aus dem Weg zu schieben, und dann mit einem Retraktor die Rippen so weit spreizte, dass er Zugang zum schlagenden Herzen hatte.
Dass die Tür zum OP sich öffnete, nahm Tim nur nebenbei wahr.
«Guten Morgen.» Eine leise, verhaltene Stimme. Tim warf einen schnellen Blick über die Schulter. Ein weiterer Chirurg hatte den Raum betreten, wie alle anderen trug er einen Mundschutz. «Wie läuft’s?»
«Paul!» Hilbrecht sah kurz hoch. «Was tust du denn hier? Es läuft gut, alles problemlos, sieht unkompliziert aus. Ist ja auch keine große Sache.»
Paul, das musste Dr. Paul Bremer sein, in Hamburg einer der Besten in Sachen Gefäßchirurgie. Tim beobachtete neugierig, wie er um den Instrumenten- und den OP-Tisch herumging. Merkwürdig langsam. Auf chirurgischen Abteilungen war das Tempo sonst ziemlich flott, jeder hatte es eilig.
«Ihr habt die Maschine noch gar nicht eingeschaltet?», fragte er.
Hilbrecht sah noch einmal auf. «Nein – kann sich aber nur noch um Sekunden handeln. Was ist denn los?»
Bremer stand nun hinter ihm. «Lass mich mal sehen.»
Tim kannte noch niemanden hier, aber er konnte deutlich spüren, wie befremdet alle Anwesenden waren. Was suchte Bremer überhaupt hier? Zog er Hilbrechts Kompetenz in Zweifel? Laut OP-Plan sollte er in fünf Minuten selbst am Tisch stehen und ein Wurzelaneurysma versorgen.
«Was denkst du denn, dass es hier zu sehen gibt?» Hilbrecht klang nun ungeduldig. «Es läuft alles wie immer, wenn man mal davon absieht, dass du es plötzlich für nötig hältst, dich einzumischen.»
Bremer antwortete nicht. Er warf einen Blick auf den Monitor, einen auf das Operationsfeld, einen auf Hilbrecht. Dann schob er seinen Kollegen grob zur Seite.
Tim sah etwas Silbriges in seiner Hand aufblitzen, begriff nicht, hörte nur die OP-Schwester aufschreien, und wich einen Schritt zurück, als Bremer die linke Hand auf den Brustkorb des Patienten legte.
Mit der rechten stieß er ein Skalpell in die Operationswunde, zwischen den gespreizten Rippen hindurch mitten in das offen liegende Herz.
Über den Monitor sah Tim jedes Detail. Wie das Skalpell den Herzbeutel durchstach und tiefer drang, wie das Blut herausschoss und wie Bremer weiterschnitt, bis in die Lunge hinein.
In dem Tumult, der einen Atemzug später ausbrach – eine Assistentin, die nach draußen rannte, um Hilfe zu holen; der Anästhesist, der sich auf Bremer stürzte; die OP-Schwester, die verzweifelt Unmengen von Blut absaugte; Hilbrecht, der versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war – standen nur zwei Menschen wie gelähmt im Raum. Tim, der nicht glauben konnte, dass wirklich passiert war, was er eben gesehen hatte.
Und Bremer, der fassungslos auf das Skalpell in seiner Hand starrte.
1
Daniel hat Pech gehabt, ich war diesmal einfach schneller. Als der Anruf des Herzzentrums um acht Uhr zweiunddreißig hereinkam, saß er gerade bei Magdalena Arendt im Büro und ließ sich für seine gute Arbeit im Fall Gerstner loben. Bis er sich losreißen konnte, hatte ich schon das Blaulicht aufs Autodach gesetzt und den Motor gestartet; nun leidet Daniel neben mir auf dem Beifahrersitz, demonstrativ eine Hand um den Haltegriff oberhalb des Wagenfensters geklammert, den Blick starr auf die Straße gerichtet.
Er hasst es, wenn ich fahre, obwohl dafür überhaupt kein Grund besteht, er pfeift oft genug selbst auf die Verkehrsregeln. Aber die Kontrolle abgeben – das ist nicht seine Sache. Schon gar nicht beim Autofahren.
«An der nächsten roten Ampel könnten wir tauschen», ächzt er.
«Dafür müsste ich aber stehen bleiben.» Ich umrunde einen Lieferwagen, der dabei ist einzuparken. In fünf Minuten sind wir ohnehin am UKE, bis dahin wird Daniel schon noch durchhalten.
Er gibt auf und schließt die Augen. «Sie sagen, es war einer der Chirurgen?»
«Ja. Ein Oberarzt, angeblich einer der Besten in der Abteilung. Er hatte mit dem Eingriff eigentlich nichts zu tun, das Opfer war nicht sein Patient.» Ich drücke mit aller Vehemenz auf die Hupe, damit der blaue Polo vor mir zur Seite fährt. «Das Team ist erschüttert, sagen sie, aber am fassungslosesten soll der Täter selbst sein. Sie bewachen ihn – nicht um zu verhindern, dass er abhaut, sondern damit er sich nichts antut.»
Am UKE angekommen, drossle ich mein Tempo. Die Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie befindet sich in Gebäude O70, es parken schon zwei Streifenwagen davor. Obwohl ich jetzt wirklich zivilisiert langsam fahre, entspannt Daniel sich kein Stück. Er hat eine ausgeprägte Abneigung gegen Krankenhäuser, allerdings muss man das gelassen sehen, denn die Liste der Dinge, die Daniel Buchholz inakzeptabel findet, ist lang. Ich stehe darauf ganz oben.
Am Eingang empfängt uns der Chefarzt der Herzchirurgie, er ist bleich im Gesicht, und die Hand, die er mir reicht, zittert. «Nina Salomon», sage ich. «Und das ist mein Kollege Daniel Buchholz.»
Er nickt, als hätte er das bereits gewusst. «Professor Doktor Holger Wiedmann», stellt er sich vor. «Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Bremer das wirklich getan hat.» Sein Blick wandert von mir zu Daniel und wieder zurück. «Wollen Sie … also, soll ich Sie zuerst zu dem Verstorbenen führen? Oder möchten Sie mit dem OP-Team sprechen? Oder mit Dr. Bremer?»
«Das alles», erwidert Daniel, «und genau in dieser Reihenfolge.»
Olaf Richter liegt noch auf dem Operationstisch, zugedeckt mit einer Art blauer Plane, unter der zahlreiche Schläuche herausführen. Der OP sieht aus wie ein Schlachtfeld, um den Tisch herum ist überall Blut. Verschmierte Fußspuren zeigen, wie hektisch das Team nach dem Zwischenfall herumgelaufen sein muss.
Hinter uns betritt ein großgewachsener Mann mit graublondem Haar den OP. Er muss während des Geschehens nah am Patienten gewesen sein, denn sein hellblauer OP-Kasack ist blutgetränkt, ebenso wie der Mundschutz, den er nach unten gezogen hat und nun um den Hals trägt. «Jochen Hilbrecht», sagt er leise und reicht erst mir, dann Daniel die Hand. «Sie müssen entschuldigen, ich bin noch nicht dazu gekommen, mich umzuziehen. Der Tote war mein Patient.» Hilbrecht schluckt, er ringt sichtlich um Fassung. «Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich es hätte verhindern können, ob ich schneller hätte reagieren müssen – aber ich habe das wirklich nicht kommen sehen.»
Daniel geht langsam auf den Operationstisch zu. «Ich würde Herrn Richter gerne sehen.»
Hilbrecht nickt und zieht die Plane zur Seite. Der Tote ist noch an diverse Katheter und Schläuche angeschlossen; auf der rechten Seite der Brust klafft ein Loch, das von einer Art weißem Rohr offen gehalten wird.
«Bremer hat direkt ins schlagende Herz gestochen», murmelt der Chirurg. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Er sagte: ‹Lass mich mal sehen›, das hat mich schon stutzig gemacht, weil es ein absoluter Routineeingriff war. Er ist überhaupt nicht der Typ, der sich für die Arbeitsweise von Kollegen interessiert. Wenn, dann sollen die von ihm lernen, nicht umgekehrt.» Hilberts angestrengtes Lächeln fällt auf halbem Weg in sich zusammen.
«War Herr Bremer denn in letzter Zeit anders als sonst?», frage ich. «Stand er unter besonders hohem Druck, gab es berufliche Schwierigkeiten?»
Hilbert denkt nach, bevor er antwortet, das finde ich sympathisch. «Der OP-Plan war in den letzten zehn Tagen sehr dicht», sagt er schließlich. «Das schon. Aber so außergewöhnlich ist das nicht. Und ja, Paul hat hin und wieder gereizt gewirkt. Vor zwei Tagen haben sich die Angehörigen eines Patienten beschwert, er habe sie ziemlich unfreundlich angefahren, als sie sich nach dem Ergebnis eines Eingriffs erkundigt haben.» Er zuckt mit den Schultern. «Das ist unschön, aber kein Drama, wissen Sie? Es gibt viele Kollegen, die fachlich toll, aber persönlich nicht gerade einfühlsam sind.»
Ich versuche, näher an den Patienten heranzukommen, ohne in Blut zu treten. «Hatte Dr. Bremer Streit mit Herrn Richter? Wissen Sie von irgendetwas, das die Tat ausgelöst haben könnte?»
Hilbert lacht auf, es klingt verzweifelt. «Nein, das ist ja das Groteske. Olaf Richter war nie Pauls Patient. Ich glaube nicht, dass die beiden je ein Wort miteinander gewechselt haben.»
Daniels Brauen bilden über der Nasenwurzel ein steiles V. «Ich möchte, dass wir gemeinsam den Ablauf der Ereignisse genau rekonstruieren. Es waren eine ganze Menge Leute anwesend, nicht wahr?»
«Richtig.» Der Chirurg weist auf die Bildschirme, die sich oberhalb des Operationstischs befinden. «Aber ich kann Ihnen außerdem eine Aufzeichnung des Eingriffs zeigen. Unsere Endoskope verfügen über Full-HD-Kameraköpfe, mit denen wir die Eingriffe auf die OP-Monitore übertragen. Meistens zeichnen wir die Operation damit auch auf, und wenn die Patienten das möchten, brennen wir ihnen den Film auf DVD. Manche finden das spannend.»
«Eine solche DVD hätten wir sehr gerne», erkläre ich. «Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, mit Dr. Bremer zu sprechen.»
Vor dem Untersuchungsraum, in dem Bremer wartet, steht ein Kollege in Uniform und spricht mit einer alten Frau, die sich an ihrem fahrbaren Infusionsständer festhält.
«… doch sehr komisch», sagt sie eben mit brüchiger Stimme. «Ich möchte wirklich wissen, warum die Polizei hier ist. Die beiden anderen Patientinnen in meinem Zimmer sind auch beunruhigt.»
«Dafür gibt es keinen Grund», sagt der Kollege freundlich. «Sie müssen sich keine Sorgen machen, legen Sie sich einfach wieder hin.»
Die Frau zögert, gibt sich dann aber geschlagen und schlurft mit kleinen Schritten davon.
Daniel tritt auf den Kollegen zu. «Ich bin Daniel Buchholz, und das ist Nina Salomon. Wir sind vom LKA.» Er hält dem Mann seinen Ausweis vors Gesicht. «Dr. Bremer ist da drin?»
Der Polizist nickt. «Ja. Aber Sie sollten wissen, er hat eine Beruhigungsspritze bekommen, und wir haben alle Gegenstände aus dem Raum entfernt, mit denen er sich eventuell verletzen könnte. Der Mann ist völlig verstört.»
Bremer sitzt auf der Untersuchungsliege, den Kopf gesenkt, die Hände auf den Knien ineinander verschränkt, als würde er beten. Wir treten ein und schließen die Tür hinter uns.
«Herr Bremer?», versuche ich es sanft. Auch er trägt immer noch OP-Kleidung, das Blut darauf ist größtenteils schon eingetrocknet. «Herr Bremer, wir möchten gerne mit Ihnen reden. Wir kommen vom LKA. Nina Salomon und Daniel Buchholz.»
Er reagiert nicht. Blickt einfach nur auf den Boden zwischen seinen Füßen, oder nach innen, oder ins Nichts. Vielleicht war das mit dem Beruhigungsmittel keine so gute Idee.
«Herr Bremer», versucht es nun Daniel. «Können Sie mich hören? Es ist wirklich wichtig, dass Sie mit uns sprechen.»
Immer noch keine Reaktion. Wahrscheinlich ist es am klügsten, wir nehmen ihn einfach mit und befragen ihn im Präsidium. Festnehmen werden wir ihn ohnehin, aber es wäre mir ganz recht, wenn er sich vorher noch waschen und umziehen könnte. Schon Daniel und seiner Schmutzphobie zuliebe.
«Ich hole jemanden von den anderen Ärzten, vielleicht dringen die eher zu ihm durch», schlage ich vor, und prompt hebt Bremer den Kopf.
«Meine Karriere ist vorbei», sagt er leise. «Ich habe nicht nur Olaf Richter getötet, sondern mich gleich mit.»
Ich ziehe mir einen Stuhl heran und setze mich ihm gegenüber. Er hat gerade ein Geständnis abgelegt – nicht, dass das nötig gewesen wäre, bei der Menge von Zeugen, aber es vereinfacht die Dinge.
«Warum, Herr Bremer? Was hat Sie dazu gebracht?»
Er schließt kurz die Augen. «Ich weiß es nicht genau. Gestern … wurde er aufgenommen, und ich habe ihn zweimal gesehen. Seitdem wurde dieses Gefühl immer stärker. Es war, als könnte ich nicht mehr atmen.»
Ich sehe aus den Augenwinkeln, wie Daniel näher kommt. «Welches Gefühl, Herr Bremer?»
Der Arzt legt die Stirn in die Hände, als hätte er Kopfschmerzen. «Ich habe ihn so gehasst», flüstert er. «Ich kann es überhaupt nicht beschreiben.»
Daniel und ich wechseln einen kurzen Blick. «Verstehe», sage ich, obwohl davon keine Rede sein kann. «Also haben Sie ihn gekannt? Er war aber nicht Ihr Patient, soviel ich weiß.»
«Nein. War er nicht.»
«Aber Sie haben in gewisser Form trotzdem Kontakt gehabt?»
Bremer gibt ein Geräusch von sich, das irgendwo zwischen Lachen und Schluchzen liegt. «Oh Gott. Ich habe doch Familie. Meine Frau wird nie wieder ein Wort mit mir sprechen. Und meine Kinder …»
Er beginnt zu weinen, wiegt sich vor und zurück, das Gesicht in den Händen verborgen.
Der falsche Zeitpunkt, um ihn darauf hinzuweisen, dass Olaf Richter vermutlich auch Familie hatte.
Ich räuspere mich. «Herr Bremer, also kannten Sie den Patienten doch? War er vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt bei Ihnen in Behandlung?»
Erst denke ich, er will meine Frage ignorieren, doch dann atmet er durch, wischt sich mit dem Ärmel über das nasse Gesicht und hinterlässt dabei einen Streifen Blut auf Nase und Wange. «Er hat … es ist so lächerlich, ich möchte es eigentlich gar nicht aussprechen.»
Ich kann fühlen, wie Daniel neben mir ungeduldig wird. Wie sehr ihn die Ichbezogenheit des Mannes nervt, der uns gegenübersitzt. Er verschränkt die Arme vor der Brust. «Ich glaube nicht, dass Sie es schlimmer machen, wenn Sie uns einweihen. Was verbindet Sie mit Herrn Richter?»
Bremer blickt zur Seite. «Er hat vor ein paar Monaten eine negative Kritik über meine Privatpraxis auf einer Online-Plattform geschrieben. Man kann darauf Ärzte bewerten. Es war ein niederträchtiger Text und so besonders schlimm, weil Richter nie bei mir gewesen ist. Es war also reine Boshaftigkeit, aber natürlich trotzdem kein Grund für …» Seine Stimme versagt; er kämpft darum, sie wiederzuerlangen.
«Von dem Moment an war er … ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Hinter mir her, aber ohne sich zu zeigen. Wie ein Schatten, verstehen Sie? Wie ein unsichtbarer Stalker, der versucht hat, mir zu schaden, mich zu reizen. Alles Kleinigkeiten, aber in der Summe unerträglich.»
Einen Moment lang bin ich sprachlos. Das ist lächerlich, wie er selbst gesagt hat. Er hat sich verfolgt gefühlt? Von einem zweiundsechzigjährigen herzkranken Mann, der vermutlich kaum eine Treppe hochgehen konnte, ohne unter Atemnot zu leiden?
«Und seit gestern war es, als hätte ich ständig eine rote Wolke um mich herum», fährt Bremer fort. «Wut und Hass … ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Es klingt verrückt, aber es war so. Trotzdem verstehe ich nicht – glauben Sie mir bitte, ich verstehe nicht, wieso ich dann etwas so Furchtbares getan habe.» Er hält inne. «Vielleicht bin ich krank.» Etwas wie Hoffnung schwingt in seiner Stimme mit. «Ich kann das überprüfen lassen, nicht wahr? Sie werden ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, das ist doch üblich in solchen Fällen.»
Ich will ihm antworten, aber Daniel kommt mir zuvor. Ich hatte schon befürchtet, dass es mit seiner Geduld bald vorbei sein wird.
«Wir werden Ihnen ganz genau auf den Zahn fühlen, machen Sie sich da keine Sorgen.» Er baut sich vor dem Chirurgen auf. «Dr. Paul Bremer, ich nehme Sie fest wegen Verdachts des Mordes an Olaf Richter.»
2
Der Raum ist klein, fast winzig.
Ich trete vor Nina ein und stoße fast gegen den Schreibtisch, so überladen mit Akten und Papieren, dass es mich verrückt machen würde, müsste ich daran arbeiten. Dazwischen ragt der aufgeklappte Bildschirm eines Notebooks heraus, als hätte er sich seinen Platz mühsam erkämpft. Davor ein lederner Bürostuhl, an der Wand ein Aktenschrank, ein vollgestopftes Bücherregal und zwei psychedelisch anmutende Kunstdrucke in weißen Rahmen. Das war’s.
Das Büro eines über die Grenzen Hamburgs bekannten Herzchirurgen habe ich mir anders vorgestellt.
Für die beiden uniformierten Kollegen, die uns begleiten, ist kein Platz mehr. Sie postieren sich draußen auf dem Flur neben der Tür.
«Warten Sie, ich zeige es Ihnen.» Bremer lässt sich auf den Stuhl fallen, schiebt mit dem Unterarm hektisch einen Stapel Dokumente beiseite und lässt die Finger über die Computertastatur huschen. Er wirkt nun trotz der Beruhigungsmittel, die man ihm verabreicht hat, fahrig und aufgepeitscht.
Ich trete mit zwei Schritten so nahe an ihn heran, dass ich eingreifen kann, falls er nach einem Brieföffner oder einem anderen Gegenstand greift, mit dem er sich selbst verletzen könnte. Nina rückt nach.
«Einen Moment noch … Hier, schauen Sie, da ist es. Sehen Sie?» Bremer dreht das Notebook so, dass Nina und ich den Bildschirm sehen können. «Das ist die letzte Mail, die ich von ihm bekommen habe. Das war gestern.»
Mein Blick fällt als Erstes auf die Zeile mit dem Absender.
Eine kostenlose Mailadresse, die jeder eingerichtet haben kann. Wir werden die IP-Adresse überprüfen lassen, von der aus die Mail gesendet wurde.
«Jetzt verstehen Sie, was ich meine, nicht wahr?»
«Moment», sage ich und lese die Textnachricht.
Hallo Bremer, du Quacksalber,
ich habe langsam keine Lust mehr, die Menschen wieder und wieder vor dir zu warnen, während du weiter ungehemmt vor dich hin pfuschst und deine Patienten durch deine Unfähigkeit verstümmelst und tötest. Es ist an der Zeit, dafür zu sorgen, dass du ernsthafte Konsequenzen zu spüren bekommst. Leider muss das noch ein paar Tage warten, denn – welch eine Ironie des Schicksals – ich werde mich selbst einer Herzoperation unterziehen müssen. Du kannst dir denken, dass ich alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, um von einem richtigen Chirurgen operiert zu werden, nicht von einem Idioten wie dir. Schließlich habe ich allen Grund, noch eine Weile weiterzuleben. Du verstehst, was ich meine, nicht wahr?
Also mach dich bereit, du Stümper. Morgen wird dein Kollege mich operieren, danach werde ich dafür sorgen, dass dein Pfuschen ein endgültiges Ende hat.
Dein Richter
(Ist dieses Wortspiel nicht köstlich?)
Ich wechsle einen Blick mit Nina und wende mich dann an Bremer, der mich erwartungsvoll anschaut. «Wo sind die anderen Nachrichten?»
«Welche anderen … Ach so, nein, die habe ich nicht mehr.»
«Warum?», hakt Nina nach. «Haben Sie die etwa gelöscht?»
Der Arzt schüttelt heftig den Kopf. «Es gab zwar ein paar E-Mails, aber die finde ich nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht, wohin sie verschwunden sind.»
«Das heißt, diese eine Mail ist alles, was Sie haben?»
«Ja. Aber Sie haben doch gelesen, was der Kerl mir geschrieben hat. Er wollte mich vernichten.» Nun klingt seine Stimme wieder verzweifelt.
Nach einem letzten Blick auf die Nachricht richte ich mich auf. «Wie praktisch, dass er Ihnen mitgeteilt hat, dass er heute Morgen ganz in Ihrer Nähe hilflos auf dem OP-Tisch liegt, nicht wahr?»
Bremer starrt mich an, als hätte er mich nicht verstanden. «Was?»
«Nun, finden Sie es nicht auch seltsam, dass ein Mann, der Sie so massiv bedroht, Ihnen mitteilt, wo Sie ihn in einer Situation absoluter Hilflosigkeit finden können? Und dann auch noch direkt an Ihrem Arbeitsplatz?»
«Ein Krankenhaus ist nicht einfach nur ein Arbeitsplatz.» Bremer schiebt das Notebook wie ein trotziges Kind von sich weg, was dazu führt, dass ein ganzer Stapel Dokumente über die Schreibtischkante rutscht und zu Boden fällt. Er beachtet es gar nicht. «Ein Krankenhaus ist …»
«Der ideale Platz für Sie, um Olaf Richter ganz einfach ermorden zu können», unterbricht Nina ihn scharf und nickt mir zu. «Ich denke, wir können die Vernehmung von Dr. Bremer auf dem Präsidium fortsetzen.»
«Da fällt mir noch was ein.» Bremer sagt es so ruhig, als würde er mit uns über einen medizinischen Befund sprechen. Diese extremen Stimmungsschwankungen erscheinen mir ungewöhnlich, selbst für jemanden in seiner Situation. «Richter hat auch Einträge in verschiedenen Internetforen gemacht, in denen er mich übelst verleumdet hat. Die kann ich Ihnen natürlich auch zeigen. Das heißt, sofern ich sie wiederfinde.»
«Das können Sie auch auf dem Präsidium», entscheide ich und klappe das Notebook zu. «Und das hier nehmen wir mit.»
Bremer erhebt sich und geht an mir vorbei, während ich mir das Notebook unter den Arm klemme. An der Tür dreht er sich noch einmal um und wirft einen langen Blick auf den Schreibtisch. «Ich habe so hart für meine Karriere gearbeitet, mein ganzes Leben lang. Und ich bin gut. Richtig gut. Richter hat dafür gesorgt, dass alles umsonst war. Er hat mich ganz bewusst dazu gebracht, etwas Furchtbares zu tun. Er wollte, dass ich ihn töte, wissen Sie? Er hat es darauf angelegt, da bin ich sicher.»
«Jetzt reicht es dann.» Nina macht keinen Hehl daraus, was sie von Bremers Gerede hält. «Sie haben einen vollkommen wehrlosen Mann getötet, weil er Ihnen böse Mails geschrieben hat. Daran hat niemand anderer Schuld als Sie selbst. Und jetzt los.»
Sie legt dem Arzt die Hand auf den Rücken und schiebt ihn an mir vorbei auf den Flur, wo die beiden Kollegen ihn in ihre Mitte nehmen.
Ich gehe an ihnen vorbei, Nina ist neben mir.
«Ich bestehe auf einem psychiatrischen Gutachten», sagt Bremer hinter uns, als wir gerade ein paar Schritte zurückgelegt haben. Wieder hört es sich an, als sei in Wahrheit er das Opfer in dieser Sache. «Und nur damit das klar ist, ich möchte den Arzt selbst aussuchen, der es erstellt. Ich bin ein erstklassiger Chirurg und lasse mich nicht von jedem dahergelaufenen Psycho-Fritzen begutachten. Außerdem habe ich ein Recht darauf, meinen Anwalt anzurufen. Hier geht es schließlich um mehr als einfach nur eine Verzweiflungstat, zu der man mich getrieben hat. Es geht um meine Karriere, mein ganzes Leben. Und das meiner Familie. Außerdem …»
Ich hole gerade Luft, um seinen Redeschwall zu stoppen, als Nina abrupt stehen bleibt und sich zu Bremer umdreht.
«Sie haben das Leben eines Menschen ausgelöscht. Einfach so. Was denken Sie, was Sie seiner Familie damit angetan haben? Also halten Sie jetzt endlich den Mund und hören Sie auf mit Ihrem jämmerlichen Selbstmitleid.»
Ich weiß nicht, ob ich jemals zuvor beobachtet habe, dass die Gesichtsfarbe eines Menschen so schnell von halbwegs normal in Dunkelrot wechseln kann, wie das jetzt bei Bremer geschieht. «Du kleine Polizei-Tussi möchtest mir den Mund verbieten? Mir? Ich habe schon Leben gerettet, als du noch zu Hause bei Mama und Papa nackt um den Weihnachtsbaum gerannt bist.» Mit einem wilden Ruck reißt sich Bremer von dem Griff los, mit dem einer der beiden Beamten ihn am Arm gepackt hat, und macht einen Satz auf Nina zu. Wir reagieren gleichzeitig. Während sie mit einem schnellen Schritt zurückweicht, stelle ich mich Bremer in den Weg und lasse ihn gegen mich prallen. Noch bevor er sich von seiner Überraschung erholt hat, packe ich ihn am Kragen und drücke ihn mit Schwung gegen die Flurwand. «Wagen Sie es nicht noch einmal, eine Polizistin anzugreifen», zische ich ihm zu. «Sonst könnte ich mich vergessen und Ihnen in Notwehr die Nase brechen.»
Jemand greift nach mir und zieht mich langsam, aber bestimmt zurück. «Herr Buchholz!» Die Stimme eines der beiden Uniformierten, nah an meinem Ohr. «Lassen Sie ihn los. Wir haben ihn unter Kontrolle.»
«Das sah aber gerade gar nicht so aus.» Widerwillig lockere ich meinen Griff, lasse Bremer schließlich los und wende mich ab. Ninas fragendem Blick weiche ich bewusst aus. Ich marschiere an ihr vorbei in Richtung Ausgang, aber Sekunden später ist sie schon neben mir. «Was war das denn?»
«Bitte, gern geschehen», antworte ich einsilbig, ohne sie anzusehen. Ich ärgere mich über mich selbst, weil es mir offenbar nicht gelingt zu verhindern, dass sich belastende private Dinge auf meinen Dienst auswirken. Oder besser gesagt auf die Art, wie ich meinen Dienst erledige.
«Komm, nun sei nicht blöd. Ich weiß ja, dass du mir helfen wolltest, und das finde ich auch wirklich nett, aber ‹sonst könnte ich mich vergessen und Ihnen in Notwehr die Nase brechen› ist echt keine typische Daniel-Buchholz-Reaktion, das musst du zugeben. Also: Was ist los?»
«Nichts, was hierhergehörte. Belassen wir es dabei.» Es klingt härter, als ich es beabsichtigt habe. Also füge ich freundlicher hinzu: «Es ist alles o.k. Ich hatte sein Gerede nur so satt, und als er dich dann auch noch angreifen wollte …»
«Also gut. Noch einmal: Danke, aber er hatte keine Chance.»
Sie hat recht, das ist mir klar. War es schon in dem Moment, als Bremer auf Nina losgehen wollte, und doch … irgendwie hat es gutgetan dazwischenzugehen.
Der Arzt wird mit dem Streifenwagen zum Präsidium gebracht, Nina steuert unseren Dienstwagen. Mir wird erst bewusst, dass ich sie hinters Steuer gelassen habe, als sie den Motor startet. Ich bin offenbar abgelenkter, als ich gedacht habe. Wir treffen gemeinsam mit den Kollegen und Bremer am Präsidium ein und warten am Eingang. Dort nimmt mich einer der beiden zur Seite und sagt leise: «Er hat davon geredet, sich wegen übertriebener Härte im Dienst über sie zu beschweren.»
Ich denke an Staatsanwalt Meierhofer und daran, dass das wahrscheinlich ein gefundenes Fressen für ihn ist. «Danke für die Warnung, aber das regle ich schon.»
Arendt ist nicht in ihrem Büro, also gehen wir direkt in den Verhörraum, in den Bremer gebracht worden ist, nachdem er seinen Anwalt angerufen hat. Er erklärt uns, dass er auf Anraten des Juristen bis zu dessen Eintreffen keine Aussagen mehr machen werde. Das könne allerdings noch über eine Stunde dauern, weil der gerade auf dem Weg zurück aus Köln sei. Wir wollen uns schon abwenden und den Raum wieder verlassen, als Bremer wieder zu jammern beginnt. Dass sein Leben komplett auf den Kopf gestellt sei und er letztendlich ganz alleine die Konsequenzen werde tragen müssen, obwohl ihn doch in Wahrheit nur eine Teilschuld treffe.
Wenn ich es mir recht überlege, gibt es da im Moment verblüffende Parallelen zwischen Bremer und mir. Das macht meine Sorgen nicht kleiner.
Mittlerweile ist Arendt von einer Besprechung mit Meierhofer zurück und hört sich unseren Bericht an.
«Hm …», macht sie, als ich geendet habe. «Klingt nach einer einfachen Sache. Es gibt Zeugen für die Tat, der Mörder ist gefasst und geständig, er hat ein … na ja, so was Ähnliches wie ein Motiv. Ich denke, den Fall können wir schnell abschließen.»
«Trotzdem ist das doch sehr seltsam. Ein bekannter, bisher unbescholtener Herzchirurg tötet kaltblütig einen Patienten, weil der ihn per Mail und im Netz diffamiert? Ich denke, wir sollten uns mal mit der Frau des Opfers und auch mit der des Arztes unterhalten. Vielleicht steckt doch mehr dahinter, als Bremer zugeben möchte?»
Arendt zuckt mit den Schultern. «Die Frauen sind schon von den Kollegen Janning und Müller vernommen worden, aber wenn es Sie besser schlafen lässt, bitte. Das ändert allerdings nichts an den Tatsachen: Der Fall ist geklärt.»
Das ist wahr, rätselhaft bleibt er trotzdem, also beschließen Nina und ich, die Zeit bis zum Eintreffen von Bremers Anwalt zu nutzen und uns mit einer der beiden Frauen zu unterhalten. Unsere Wahl fällt auf Richters Witwe Luise, weil ihr Haus um einiges näher am Präsidium liegt als Bremers.
Die Frau erscheint mir recht gefasst, als sie die Tür öffnet und uns hereinbittet. Ich schätze sie auf Ende fünfzig, sie ist mollig und sieht uns mit verletzlich wirkendem Blick aus geröteten Augen entgegen.
Die Einrichtung des Hauses passt zu dem Bild, das ich mir von der Frau mache. Konservativ, vielleicht sogar etwas bieder, aber sicher nicht billig. Alles ist blitzsauber und aufgeräumt.
«Frau Richter», beginne ich, nachdem wir uns im Wohnzimmer an den runden Esstisch gesetzt haben. «Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie so kurz …»
«Schon gut», unterbricht sie mich mit sanfter Stimme. «Das muss ja sein.»
«Ja, leider. Wir versuchen, so viel wie möglich über die Hintergründe der Tat herauszufinden. Kennen Sie Dr. Paul Bremer?»
Ihre Augen füllen sich mit Tränen. «Nein, den kenne ich nicht. Und Olaf hat ihn auch nicht gekannt.»
«Sind Sie da ganz sicher?», fragt Nina und legt dabei eine Wärme in ihre Stimme, die ich so bisher selten von ihr gehört habe.
«Was ist denn schon sicher?» Luise Richter zieht ein Stofftaschentuch aus dem Ärmel ihrer Strickweste und tupft sich damit die Augen ab. «Aber er hätte den Namen bestimmt mal erwähnt, wenn er den Mann gekannt hätte. Ich verstehe nicht, was einen wildfremden Arzt dazu bringen konnte, meinen Mann umzubringen. Ich wüsste überhaupt niemanden, der einen Grund gehabt hätte, Olaf zu töten. Er war ein herzensguter Mensch, der nie ein böses Wort über jemand anderen verloren hat.» Sie putzt sich die Nase, bevor sie fortfährt. «Olaf war so glücklich, seit er vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen ist. Er hat seinen Elektromontagebetrieb aufgegeben und sich endlich seinen großen Traum verwirklicht. Er hat sich ein Segelboot gekauft, das war sein ganzer Stolz, wissen Sie. Und jetzt …»
Zehn Minuten später verabschieden wir uns von Luise Richter und machen uns auf den Rückweg. Wir haben Olaf Richters Computer dabei, den seine Witwe uns bereitwillig mitgegeben hat.
«Das hat uns nicht wirklich weitergebracht», stellt Nina fest, als ich losfahre. Es tut gut, wieder am Steuer zu sitzen – wenigstens hier. Ninas Fahrweise macht mich einfach nervös. «Wahrscheinlich hat Arendt recht, und wir sollten den Fall einfach schließen …» Als ich mit den Achseln zucke, fügt sie hinzu: «Aber ich habe trotzdem ein ganz komisches Gefühl.»
Das habe ich auch. Und nicht nur, was diesen Fall angeht.
3
Wenn Bremer wirklich so naiv gewesen ist zu denken, dass er mit dem Mord an Olaf Richter jegliche Kritik an seiner Person zum Verstummen bringen würde, dann hat er sich geschnitten. Seit drei Tagen stürzen sich die Medien mit einer Heftigkeit auf den Fall, die einerseits zu erwarten war, Daniel und mich aber trotzdem immer wieder aus der Fassung bringt. Zum Beispiel gibt es ein hübsch gephotoshopptes Titelbild, das Helmut Vogelbusch mir in der Kaffeeküche unter die Nase hält und das Bremer in einem blutdurchtränkten OP-Kittel zeigt, mit einem überdimensionalen Skalpell in der Hand. Die Headline darüber lautet: Doktor Tod – Psychopathen im OP. Wie der Titel einer TV-Serie auf der Jagd nach Quote.
«Da bekommt man noch mehr Angst davor, krank zu werden», erklärt Vogelbusch und schließt schon mal vorsorglich das Fenster. «Die Pharmaindustrie tötet uns durch Gifte und Abhängigkeit, die Ärzte machen es jetzt direkt mit dem Stich ins Herz.»
Ich nehme ihm die Zeitschrift aus der Hand. «Bleib auf dem Teppich, Helmut.» Mit der Kaffeetasse in der Hand überfliege ich den Artikel, in dem es darum geht, dass Chirurgen angeblich ohnehin ein merkwürdig gestricktes Gemüt hätten und ihnen prinzipiell alles zuzutrauen sei. Dass ihr psychischer Zustand enger überwacht werden sollte.
Im Grunde weiß ich genau, dass Bremer nicht dumm ist. Ihm muss klar gewesen sein, dass er mit dieser Tat sein Leben ruiniert. Seine Reputation als Chirurg war bis zu diesem Zeitpunkt ausgezeichnet. Selbst wenn Richter ihn wirklich provoziert hat – warum ihn nicht einfach anzeigen? Warum dieser völlig übertriebene, nicht wiedergutzumachende Schritt?
Christoph Janning schiebt seine kurze Gestalt zu uns in die Kaffeeküche, woraufhin mir Vogelbusch sofort das Blatt aus der Hand reißt und es ihm hinhält. «Da! Hast du das schon gelesen? Wenn du mich fragst, dieser Bremer ist nicht grundlos durchgedreht. Ärzte haben doch so leichten Zugang zu Drogen aller Art …»
Christoph liegt mir sehr am Herzen, trotzdem tue ich so, als hätte ich ihn nicht bemerkt, seinen Blick, der mich bittet, ihn nicht mit Helmut allein zu lassen. Ich schlüpfe mit meiner Kaffeetasse nach draußen und gehe zurück ins Büro, wo ich mir Bremers Aussage noch mehrmals durchlese. Trotzdem begreife ich nicht, was in ihm vorgegangen ist. Jedes Mal muss ich an den Germanwings-Piloten denken, der sein Flugzeug gegen eine Bergwand gesteuert hat. Der war auch ein gut ausgebildeter, erfolgreicher Mann – aber er wollte dabei selbst sterben. Bremer nicht. Bremer wollte bloß eine verquere Form von Gerechtigkeit. Er sagt, er habe zu dem Zeitpunkt nicht weiter als bis zu dem tödlichen Schnitt gedacht. Kann das sein?
Die Frage lässt mich nicht los, und ich würde mich gerne mit Daniel darüber unterhalten, aber der ist ungefähr so kommunikativ wie ein Stück Holz.
«Arendt hat uns zurückgepfiffen», murmelt er, ohne dabei den Blick von seinem Computermonitor zu wenden. «Weil ja angeblich alles geklärt ist, und in gewisser Weise hat sie recht.»
«Findest du?» Dass Daniel sich so schnell geschlagen gibt, ist mir neu. «Meiner Meinung nach müssten wir …»
Die Tür springt auf, herein stürmt Andressen von der Abteilung Cybercrime. In der Hand hält er einen Computerausdruck, den er über dem Kopf schwenkt wie eine weiße Fahne. «Wollt ihr etwas wirklich Verrücktes hören?»
Zum dritten Mal an diesem Tag wischt Daniel imaginäre Krümel von seinem Schreibtisch. «Wollen wir?», fragt er mich.
«Klar», sage ich.
«Die Mail von Richter an Bremer, in der er ihm geschrieben hat, wann er operiert wird – die hat der sich selbst geschickt.»
«Wie bitte?»
Andressen beugt seine lange Gestalt zu mir herunter und hält mir den Zettel vor die Nase. Alles nur Computercodes und ziemlich viele Zahlen. «Hier, siehst du? Das hier ist Bremers IP-Adresse, und von genau dieser Adresse wurde die Mail geschickt, die ihn angeblich so aus der Fassung gebracht hat.»
Er lächelt breit, ich glaube, das sehe ich bei ihm zum ersten Mal. Gut, als wir letztens zusammengearbeitet haben, gab es dafür auch keinerlei Grund. Wahrscheinlich merke ich deshalb erst jetzt, dass seine Vorderzähne ein bisschen schief stehen, aber nicht so sehr, dass es stören würde.
«Versteht ihr, was das heißt?» Er sieht Daniel erwartungsvoll an. «Der Herr Doktor hat sich selbst kleine Drohbriefchen zugeschickt. Von wegen, er ist provoziert worden. Alles gelogen.»
«Das ist tatsächlich ein Ding», sage ich und erwidere Andressens Lächeln, während Daniel gerade mal ein Kopfschütteln zustande bringt. «Ich bin schon sehr gespannt, wie Bremer sich da rausreden will.»
Als Andressen gegangen ist, stehe ich auf, umrunde den Schreibtisch und setze mich direkt auf Daniels Unterlagen. «Sag mal, was ist eigentlich los mit dir?»
Wieder schüttelt er den Kopf. «Alles okay.»
«Nein, sorry, das kaufe ich dir nicht ab.»
«Dann lass es eben.» Er versucht, eine dünne Mappe unter meinem Hintern hervorzuziehen. Ich mache mich extra schwer.
«Weißt du, ich dachte eigentlich, es würde endlich gut laufen mit uns als Team», sage ich und lege ein bisschen Wehmut in meine Stimme. Einen Hauch Enttäuschung. «Aber da habe ich mich vielleicht doch geirrt, wenn ich mir das genauer –»
«Es hat nichts mit dir zu tun», fällt er mir gereizt ins Wort. «Überhaupt nichts.»
«Okay. Aber du könntest mir doch sagen …»
«Nein. Das heißt, doch, könnte ich. Will ich aber nicht.» Er schaut zu mir hoch, voller Wut – und da ist noch etwas anderes. Sorge? Angst? Ich rutsche zur Seite, damit er sich seine Mappe nehmen kann.
«Glaubst du, du kannst das akzeptieren?», fragt er, eine Spur freundlicher jetzt.
«Nein. Aber widerwillig hinnehmen kann ich es.» Ich kehre zu meiner Seite des Schreibtisches zurück und ordne Andressens Computerausdruck in meine Unterlagen ein. Soeben hat sich das ohnehin hauchdünne Motiv für den Mord an Richter in Luft aufgelöst. Ich bin schon sehr gespannt, was Bremer dazu sagen wird.
Für fünfzehn Uhr habe ich einen Termin im Untersuchungsgefängnis ausgemacht und werde Christoph Janning mitnehmen – wenn Buchholz gerne stumm in seinem eigenen Saft kochen möchte, dann soll mir das recht sein. Doch kurz vor vierzehn Uhr wirft ein Anruf alle meine Pläne über den Haufen. In der Gryphiusstraße liegt ein Toter, und Arendt beordert mich hin. Zusammen mit Daniel, dem Schweigsamen.
Ich stehe in meinem weißen Papieroverall am Eingang der Wohnung und beobachte die Spurensicherungsleute bei der Arbeit.
Sie haben alle Hände voll zu tun, denn die Blutspuren ziehen sich durch die halbe Wohnung. Sie beginnen da, wo ich stehe, setzen sich über den Flur bis ins Wohnzimmer fort und enden knapp vor der Schlafzimmertür. Dort liegt Martin Rauch, der Besitzer der Wohnung. Bis jetzt haben sie zweiundzwanzig Messerstiche gezählt, erklärt ein Kollege. Vielleicht sind es sogar mehr, das wird sich zeigen, wenn der Mann nackt auf dem Obduktionstisch liegt.
Daniel vernimmt die Nachbarin, die in der vergangenen Nacht Geräusche wie von umstürzenden Möbeln gehört haben will. Martin Rauch war ein netter Mann, erzählt sie stockend. Immobilienmakler, geschieden. Hat eher zurückgezogen gelebt.
«Haben Sie vielleicht auch jemanden kommen oder gehen gesehen, letzte Nacht?», will Daniel wissen.
Die Frau schüttelt den Kopf. «Ich bin nicht aufgestanden. Ich konnte doch nicht wissen, dass es so ernst ist.»
Ein Stück abseits steht Rauchs Putzfrau, zitternd. Sie war es, die den Toten gefunden hat. Ihr Schlüssel steckt immer noch an der Außenseite der Wohnungstür.
Viel kann auch sie nicht über den Mann sagen, zudem ist ihr Deutsch nicht besonders gut. Wir werden später einen Dolmetscher hinzuziehen.
Ich schaue von der Schwelle aus in den Flur. Die ersten Stiche müssen Rauch unmittelbar beim Öffnen der Tür zugefügt worden sein – da ist eine Blutlache, an den Wänden finden sich verschmierte, dunkelrote Spuren. Ich kann es förmlich vor mir sehen, wie er erschrocken zurücktaumelt, mit der Hand erst zur Wunde fährt und sich dann damit an der Wand abstützt. Wie er immer wieder Halt sucht, während er sich ins Wohnzimmer schleppt und der Täter weiter auf ihn einsticht, nun vermutlich von hinten.
Mit welcher Entschlossenheit er auf ihn losgegangen sein muss. Mit welcher Wut. Ich betrachte den Boden genauer und entdecke verschmierte Schuhabdrücke im Blut. Unsere Leute sind viel zu vorsichtig, um derartige Spuren zu hinterlassen, und Rauch selbst wird nachts in seiner Wohnung kaum Schuhe getragen haben. Ich schätze also, der Täter hat nicht besonders gut aufgepasst. Mit etwas Glück finden wir auch noch Fingerabdrücke.
Eine Stunde später ist der Tote abtransportiert, und wir haben mit den verfügbaren Nachbarn gesprochen, ohne dass es viel gebracht hätte. Es sind teure Wohnungen hier, die Wände sind nicht so dünn wie anderswo, und allem Anschein nach hat Rauch selbst seinem Mörder die Tür geöffnet. Sowohl die am Eingang als auch die zur Wohnung.
«Die Abdrücke im Flur stammen von Schuhen Größe dreiundvierzig oder vierundvierzig», erklärt uns einer der Kollegen. «Die Stiche sind mit ziemlich viel Kraft ausgeführt worden, tödlich war vermutlich der in den Hals.»
«Danke», sagt Daniel matt und dreht sich zu mir herum. «Wir sollten mit jemandem reden, der ihn einigermaßen gekannt hat. Ich schlage die Exfrau vor.»
Das Einfamilienhaus, das Susanne Rauch bewohnt, liegt in Eißendorf und ist einer dieser typischen roten Klinkerbauten mit einem kleinen Garten davor und einem Steinplattenweg, der in Form eines schmalen S zur Haustür führt.
Daniel lässt mir den Vortritt, vielen Dank auch. Während ich klingle, mustert er mit zusammengekniffenen Augen einen verdorrten Holunderstrauch, der neben der Haustür wächst.
Die Frau, die uns öffnet, sieht aus, als hätte sie sich gerade für den Sport fertig gemacht. Schwarze, knielange Leggins, Laufschuhe, blitzblaues T-Shirt. Sie ist sicher über fünfzig, wirkt aber, als könne sie aus dem Stand zum Triathlon antreten. Durchtrainiert und sehnig. «Guten Tag.» Sie sieht irritiert erst mich, dann Daniel an. Als hielte sie uns für Zeugen Jehovas.
«Mein Name ist Nina Salomon, und das hier ist mein Kollege Daniel Buchholz. Wir sind von der Kriminalpolizei», beginne ich und halte ihr meinen Dienstausweis hin. «Wir müssen mit Ihnen sprechen. Ich fürchte, wir haben schlechte Nachrichten.»
Susanne Rauch weicht zurück, legt eine Hand vor den Mund. «Meine … Tochter?», dringt es erstickt dahinter hervor.
«Nein», antworte ich schnell. «Nicht Ihre Tochter. Ihr geschiedener Mann.»
Sie lässt die Hand sinken. «Martin?», fragt sie tonlos.
«Ja. Er ist tot. Es tut mir sehr leid.»
Die Frau ist blass geworden. Sie bittet uns mit einer Handbewegung herein und führt uns in ein schlicht möbliertes Wohnzimmer, das ganz in Beige und Hellblau gehalten ist. «Ich kann das gar nicht glauben», murmelt sie und sinkt auf eines der Sofas. «Was ist denn passiert?»
Zu meinem Erstaunen ergreift tatsächlich Daniel das Wort. «Herr Rauch wurde erstochen, vermutlich in der vergangenen Nacht. Wie lange sind Sie denn schon geschieden?»
Sie denkt einen Moment lang nach. «Im nächsten Monat werden es dreizehn Jahre.»
«Oh. Das ist eine lange Zeit.»
Sie nickt. «Ich wundere mich auch ein wenig, dass Sie ausgerechnet zu mir kommen, aber andererseits hat Martin in Hamburg sonst keine Angehörigen.» Sie schließt die Augen. «Oh Gott. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Sophia beibringen soll.»
«Sophia ist Ihre Tochter?», hake ich ein.
«Ja. Bis vor einem halben Jahr hat sie noch bei mir gewohnt, jetzt studiert sie in Gießen. Veterinärmedizin.» Susanne Rauch blickt zur Seite, auf ein gerahmtes Foto an der Wand. Ein hübsches Mädchen mit dunklem Pferdeschwanz und Susanne Rauch selbst, Arm in Arm. «Es wird sie hart treffen, das weiß ich. Ermordet, sagen Sie? Aber warum? Und wissen Sie schon, wer es war?»
Ich schüttle den Kopf. «Eigentlich hatten wir gehofft, dass Sie uns da weiterhelfen könnten. Hatte Ihr Mann mit jemandem Streit?»
Sie denkt ein paar Sekunden lang nach. «Wahrscheinlich schon. Er ist Makler, da schafft man sich ganz automatisch Feinde. Aber ich weiß schon lange nicht mehr, wie sein Leben aussieht. Ob er eine Freundin hat, ob er noch Golf spielt – ich habe keine Ahnung, tut mir leid.»
Tja, das war zu erwarten gewesen. «Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen?», frage ich, einfach aus Routine.
Diesmal kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. «Vor zwölf Tagen.»
Ich muss verblüfft aussehen, denn Rauch setzt sofort zu einer Erklärung an. «Weil Sophia ausgezogen ist, möchte ich gern dieses Haus verkaufen. Es ist für mich alleine einfach zu groß. Martin hat davon Wind bekommen – er ist ja aus der Branche – und hat erklärt, dass er die Hälfte vom Erlös fordern will. Seitdem – na ja. Streiten wir wieder.» Sie lächelt angestrengt. «Ist das schon Motiv genug? Tut mir leid, ich war’s trotzdem nicht.»
Die Frau ist mir irgendwie sympathisch.
«Tja», sagt Daniel neben mir. «Ein großes Haus in dieser Lage wird auf jeden Fall einen beachtlichen Verkaufspreis abwerfen. So gesehen haben Sie tatsächlich ein Motiv.»
Sie sieht ihn an, als wüsste sie nicht genau, ob er das ernst meint. «Hätte ich weniger ehrlich sein sollen? Aber Sie finden es ja am Ende doch raus.»
«Stimmt», stellt Daniel trocken fest und blickt sich im Raum um. «War das damals der Grund für Ihre Trennung? Geld?»
Ihre Gesichtszüge erschlaffen. Sie öffnet den Mund, schließt ihn wieder. Setzt dann doch zu einer Antwort an. «Nein», sagt sie leise. «Unser Sohn ist gestorben, mit gerade einmal zwölf Jahren. Ich kenne keine Ehe, die so etwas überlebt.»
4
Ich entdecke Simone gleich, als ich die gemütlich eingerichtete Kneipe betrete. Sie sitzt an einem Zweiertisch am Fenster und schaut hinaus. Sie ist hübsch, auf eine glatte, stromlinienförmige Art. Groß, schlank, blond, mit einer kleinen Stupsnase und hellen, fröhlichen Augen. Hübsch eben. Aber nicht mehr.
Als sie mich bemerkt, lächelt sie mir eine Spur zu gekünstelt entgegen, was ich ihr nicht verübeln kann. Mein Anruf muss ihr merkwürdig erschienen sein.
«Hallo.» Ich strecke ihr die Hand entgegen. «Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.»
«Na ja …» Sie spielt mit dem Ring an ihrem Mittelfinger und beobachtet mich dabei, wie ich mich ihr gegenüber hinsetze. «Ich habe mich schon ein wenig gewundert, als du angerufen hast. Es ist immerhin das erste Mal, dass wir beide … dass wir uns treffen.»
Bevor ich etwas entgegnen kann, fügt sie schnell hinzu: «Also … allein.»
«Ja, das stimmt.» Ich beschließe, nicht lange um den heißen Brei herumzureden, doch bevor ich zu einer Erklärung ansetzen kann, steht ein junger Mann vor unserem Tisch und schaut mich auffordernd an. Ich bestelle ein Glas Auxerrois und warte, bis er außer Hörweite ist, bevor ich mich wieder Simone zuwende. «Es geht um Isabell.»
Huscht da ein leichter Schatten über ihr Gesicht, oder täusche ich mich? Nein, sie kann nicht wirklich geglaubt haben …
«Ja, das dachte ich mir schon.» Es klingt ehrlich und keineswegs beleidigt oder gar enttäuscht. Gott sei Dank. Sie lächelt wieder, und dieses Mal erscheint es mir offener als zuvor. Mal sehen, was sie weiß.
«Es scheint euch beiden ja ernst zu sein. Das freut mich.»
Ich sehe sie aufmerksam an, versuche, in ihrer Mimik etwas zu erkennen, bin mir aber nicht sicher.
«Was hat Isabell dir denn erzählt?», frage ich deshalb mit einem möglichst unbefangenen Lächeln und komme mir dabei ziemlich scheinheilig vor.
Simone zuckt die Achseln. «Eigentlich nicht sehr viel. Aber das muss sie auch nicht. Ich kenne sie gut genug, um ihr anzusehen, wie es ihr geht. Und im Moment …» Ein verschmitzter Ausdruck huscht über ihr Gesicht. «… macht sie auf mich einen sehr ausgeglichenen Eindruck.»
Der Kellner bringt den bestellten Wein und stellt ihn mit einem Kopfnicken vor mir ab. Er ist gut temperiert und schmeckt ausgezeichnet.
«Wie sieht es denn beziehungstechnisch bei ihr aus?»
Simone hebt eine Augenbraue. «Beziehungstechnisch? Was meinst du? Ich dachte, ihr beide kommt euch gerade näher?» Sie scheint über die Frage ehrlich überrascht zu sein.
Verdammt, was tue ich hier nur? Das ist doch lächerlich. Ich sollte aufstehen und gehen. Andererseits – steht zu viel auf dem Spiel.
«Glaubst du, sie ist schon bereit für eine feste Bindung? Oder ist sie noch auf der Suche?»
Nun legt sich definitiv ein Schatten über Simones Gesicht. Verständlich. Meine Fragen müssen ihr vollkommen daneben vorkommen.
«Versteh mich bitte nicht falsch, ich …»
«Das kann doch nicht dein Ernst sein.» Sie schüttelt den Kopf, schiebt ihr halbvolles Glas ein Stück zurück und steht auf. «Deshalb wolltest du dich mit mir treffen? Um mich über Isabell auszuhorchen? Findest du nicht, dass du das mit ihr selbst besprechen solltest, Herr Kommissar?»
Bevor ich etwas entgegnen kann, zieht sie ihre Tasche von der Stuhllehne und hängt sie sich mit Schwung um. «Ich werde darüber nachdenken, ob ich Isabell von dieser merkwürdigen Aktion erzählen soll.»
Damit wendet sie sich ab und verlässt Sekunden später die Kneipe. Ich starre mit einem dumpfen Gefühl im Magen auf das Weinglas vor mir und bin mir nicht sicher, ob ich mir Naivität oder einfach Dummheit bescheinigen soll. Wahrscheinlich beides.
Kurz darauf, ich bin schon auf dem Weg nach Hause, ruft Isabell selbst an.
Gegen meine Erwartung erwähnt sie mein Treffen mit Simone gar nicht, sondern erkundigt sich, wie mein Tag war. Ich deute mit wenigen Worten an, dass wir einen brutalen Mord aufzuklären haben, und bin froh, dass sie nicht weiter nachfragt. «Das klingt schlimm. Aber auch wenn du viel zu tun hast, würde ich dich gerne sehen», sagt sie.
Das möchte ich im Moment wirklich nicht. «Sei mir bitte nicht böse, aber ich muss heute Abend zu Hause noch arbeiten», wiegele ich deshalb ab.
«Das ist sehr schade.» Ihre Stimme wird kehliger. «Ich war heute ausgiebig shoppen und würde dir meine Einkäufe gerne vorführen.»
«Wie gesagt, ich …», setze ich an, werde von ihr aber unterbrochen.
«Ich war in einem sündhaft teuren Dessous-Laden.»
Ich versuche, die Bilder ihres wundervollen Körpers in Reizwäsche aus meinem Kopf zu vertreiben, was mir nicht wirklich gelingt. Trotzdem … «Das ist ein sehr verlockender Gedanke, aber ich muss wirklich arbeiten.»
Isabell stößt ein tiefes Seufzen aus. «Also gut. Dann morgen?»
«Lass uns einfach noch mal telefonieren», weiche ich aus, weil ich tatsächlich nicht weiß, ob ich morgen schon für das Gespräch bereit bin, das wir zwangsläufig führen müssen. Sei es nun vor oder nach der speziellen Modenschau.
«Gut, dann melde ich mich morgen. Und bis dahin darfst du dir gerne vorstellen, was ich mir Schönes gekauft habe.» Und verschmitzt fügt sie hinzu: «Sofern dich das nicht beim Arbeiten stört.»
«Ich befürchte, das würde es doch.»
Sie lächelt. «Das freut mich. Also dann, bis morgen.»
Ja, vielleicht bis morgen. Ich beschränke mich auf ein «Bis dann» und höre sie noch «Ich liebe dich» sagen, in der Sekunde, in der ich auflege.
Zehn Minuten noch bis nach Hause, und die ganze Zeit drehen sich meine Gedanken um die gleiche Frage, ohne, dass ich auch nur ansatzweise zu einem Ergebnis komme.
Als ich in die Einfahrt einbiege, sitzt Nina dort auf den Stufen, den Rücken an die Hauswand gelehnt, und winkt mir lässig zu. Ich stelle den Motor ab und steige verwundert aus.
«Was tust du denn hier?»
Sie stemmt sich vom Boden hoch und klopft sich mit den Händen den Staub vom Hintern – typisch. Sie schreckt nie davor zurück, sich schmutzig zu machen. «Na ja, da du dich offenbar dazu entschlossen hast, nicht mehr an dein Telefon zu gehen, blieb mir ja nichts anderes übrig, als persönlich vorbeizukommen.»
«Was habe ich?» Ich ziehe mein Smartphone aus der Tasche und werfe einen Blick auf das Display. Tatsächlich werden mir zwei verpasste Anrufe von N. Salomon angezeigt. Keine Ahnung, warum ich das Klingeln nicht gehört habe. Diese Sache beginnt Auswirkungen zu zeigen, die mir Sorgen machen.