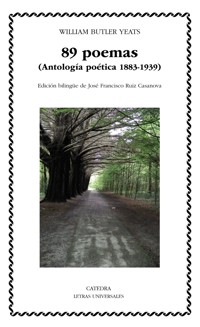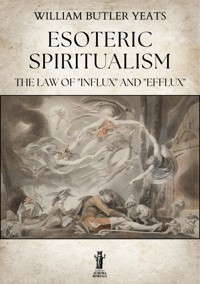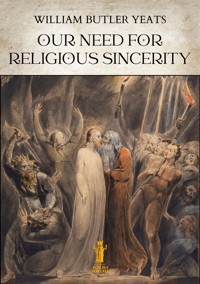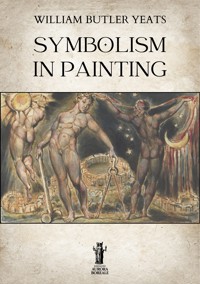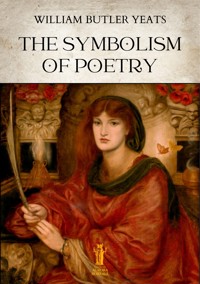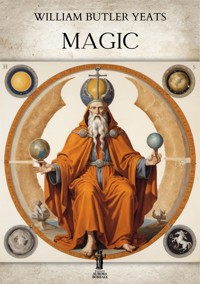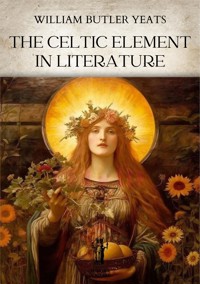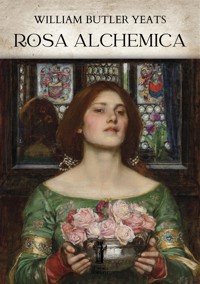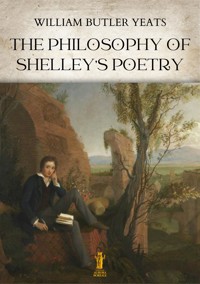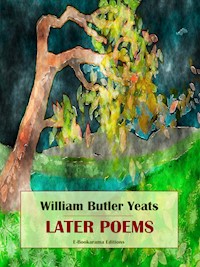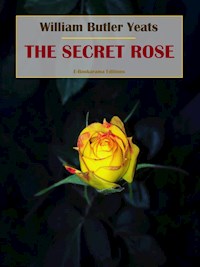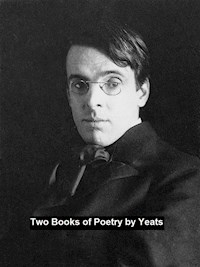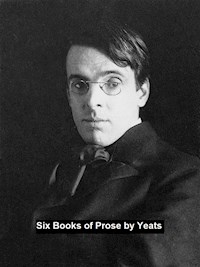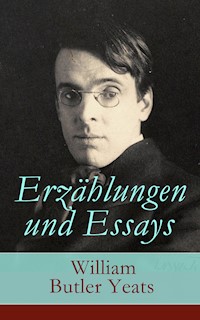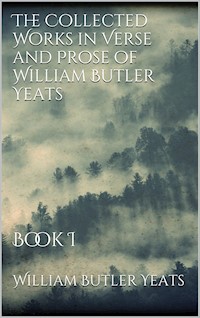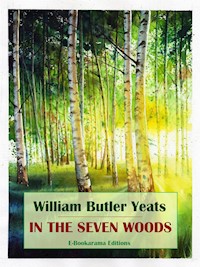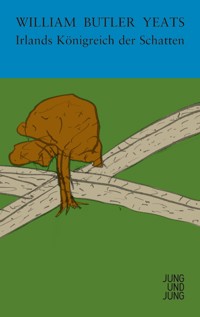
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irlands Mythen und Sagen, Elfen- und Gespenstergeschichten, erzählt von einem seiner großen Dichter.Irland – das ist nicht nur die grüne Insel, das ist auch eine Welt, die tatsächlich von Sagen umwoben ist, eine Welt, die eine einzige vielstimmige Erzählung zu sein scheint. Vor der Veröffentlichung seiner berühmten Gedichte und Theaterstücke beschäftigte sich William Butler Yeats, der spätere Nobelpreisträger, intensiv mit der Folklore und Mythologie Irlands. Er wanderte durch die ländlichen Regionen seiner Heimat, wo der Aberglaube noch fest im Alltag verwurzelt war, und ließ sich von Bauern, Dorfbewohnern und Landstreichern Geschichten erzählen. Diese eindrücklichen Begegnungen und sonderbaren Geschichten hat Yeats in diesem Band versammelt und ihnen dabei ihre ganze Frische gelassen. Obwohl die Geschichten von übernatürlichen Wesen, außergewöhnlichen Menschen, und seltsamen Erscheinungen berichten, handelt es sich nicht um Märchen oder phantastische Erfindungen des Autors. Das Übernatürliche bleibt in Irland stets ein natürlicher Bestandteil des täglichen Lebens, und all die Elfen, Hexenmeister und Gespenster sind weniger Heimsuchungen als vertraute Nachbarn, mit denen man gut auskommen kann, wenn man sich nur an bestimmte Umgangsformen hält, sein Haus nicht auf einem Elfenpfad errichtet und sich nicht durch Traumbilder in das Labyrinth des Schattenkönigreichs locken lässt.Diese erste vollständige Übersetzung wird ergänzt durch ein Nachwort sowie Anmerkungen und ein Glossar der irischen Begriffe, mythologischen Figuren und historischen Personen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irlands Königreich der Schatten
© 2008 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgDruck: Friedrich Pustet, RegensburgISBN 978-3-902497-46-8
WILLIAM BUTLER YEATS
Irlands Königreichder Schatten
Aus dem irischen Englisch übersetztund herausgegeben von Alexander Pechmann
Zeit verrinnt und vergehtWie erlöschende Kerzen.Und die Berge und WälderWerden schwinden, werden schwinden;Doch die freundliche RundeAm geselligen FeuerWird niemals enden.
Die Heerschar der Sidhe
Die Heerschar reitet von KnocknareaUnd über das Grab von Clooth-na-bare;Caoltes brennendes Haar weht im Wind,Und Niamh ruft: „Komm, komm geschwind;Befreie dein Herz von dem sterblichen Traum.Stürme erwachen, Blätter wirbeln im Raum,Blass sind unsre Wangen und lose das Haar,Stolz die Brust und der Augen leuchtendes Paar,Geöffnet die Lippen, der Arm wild geschwenkt,Und sobald ein Mensch unsre Heerschar erblickt,Wird ihm die Tatkraft der Hände genommen,Wird ihm die Hoffnung des Herzens genommen.“Zwischen Tag und Nacht reitet die Schar;Gab es je Kraft oder Hoffnung, die schöner war?Caoltes brennendes Haar weht im Wind,Und Niamh ruft: „Komm, komm geschwind!“
Dieses Buch
I
Wie jeder Künstler hegte ich den Wunsch, aus den schönen, erfreulichen und bedeutsamen Dingen dieser rohen und ungeformten Erde eine kleine Welt zu erschaffen und jenen unter meinen Landsleuten, die meiner Einladung folgen möchten, ein Stück vom Wesen Irlands aufzuzeigen. Darum habe ich vieles von dem, was ich gehört und gesehen habe, sorgfältig und freimütig niedergeschrieben und außer meinem Kommentar nichts beigefügt, das nur in meiner Phantasie existiert. Ich habe mir jedoch nicht die Mühe gemacht, meine Überzeugungen von denen der Landbewohner zu trennen, sondern den Männern und Frauen, Elfen und Dämonen lieber ihren Willen gelassen, ohne ihn durch eigene Argumente einzuschränken oder zu verteidigen. Die Dinge, die man hört und sieht, sind Lebensfäden, die zu einzigartigen Gewändern des Glaubens verwebt werden können, wenn man sie sorgsam aus dem wirren Garnknäuel der Erinnerung zieht. Wie jeder andere habe auch ich mein Gewand gewebt, doch hoffe ich, dass es mich wärmt, und wäre schon zufrieden, wenn es mich einigermaßen kleidet.
Hoffnung und Erinnerung haben eine Tochter namens Kunst, und sie hat ihre Heimstatt fern von dem Feld der Verzweiflung errichtet, wo Männer ihre Gewänder als Schlachtenbanner an gegabelte Zweige hängen. Oh geliebte Tochter der Hoffnung und der Erinnerung, bleib eine Weile bei mir.
1893
II
Ich habe einige neue Kapitel im Stil der alten hinzugefügt und hätte noch weitere angehängt, doch verlieren unsere Träume mit zunehmendem Alter etwas von ihrer Leichtigkeit: Man beginnt, das Leben mit beiden Händen zu packen und sich mehr um die Frucht als um die Blüte zu kümmern – und dies ist vielleicht kein großer Verlust. Ich habe in diesen neuen Kapiteln, genau wie in den älteren, nichts erfunden, außer meinen Anmerkungen und ein oder zwei irreführenden Sätzen, um den Umgang irgendeines armen Geschichtenerzählers mit dem Teufel und seinen Engeln oder dergleichen vor seinen Nachbarn geheimzuhalten. Etwas später möchte ich ein großes Buch über die Elfenvölker veröffentlichen, und ich werde mich bemühen, es so systematisch und akademisch wie möglich zu gestalten, damit es mir als Entschuldigung für diese Handvoll Träume diene.
1902
W. B. Yeats
Ein Geschichtenerzähler
Viele Geschichten in diesem Buch wurden mir von Paddy Flynn erzählt, einem kleinen Mann mit leuchtenden Augen, der in einer zugigen Ein-Zimmer-Hütte in Ballisodare wohnte; ein Dorf, das er gern als das „vornehmste im ganzen Landkreis von Sligo“ bezeichnete – er meinte damit das elfenreichste. Andere halten es im Vergleich mit Drumcliff und Dromahair für eher zweitrangig. Als ich ihn zum erstenmal traf, briet er sich gerade ein paar Pilze. Bei unserer nächsten Begegnung schlief er unter einer Hecke und lächelte im Schlaf. Er war eigentlich immer gut gelaunt, obwohl ich in seinen Augen (flink wie die Augen eines Kaninchens, das aus seinem zerfurchten Bau hervorspäht) eine Melancholie zu erkennen glaubte, die fast ein Bestandteil seiner Glücksgefühle war; die hellsichtige Melancholie rein instinktiver Gemüter und aller Tiere.
Und doch gab es einiges in seinem Leben, das ihn bedrückte, denn in der dreifachen Einsamkeit aus Alter, Verschrobenheit und Schwerhörigkeit wurde er häufig von Kindern belästigt. Vielleicht predigte er deshalb ständig über Freude und Hoffnung. Zum Beispiel liebte er es zu erzählen, wie Collumcille seine Mutter aufmunterte. „Wie geht’s dir heute, Mutter?“, fragte der Heilige. „Schlechter“, antwortete die Mutter. „Möge es dir morgen schlechter gehen“, sagte der Heilige. Collumcille kam am nächsten Tag wieder, und das Gespräch wiederholte sich wörtlich, doch am dritten Tag sagte die Mutter: „Besser, Gott sei Dank.“ Und der Heilige antwortete: „Möge es dir morgen besser gehen.“ Paddy Flynn erzählte auch gern, wie der Allmächtige am Jüngsten Tag gleichermaßen lächelt, wenn er die Guten belohnt und die Verlorenen zu ewigem Feuer verdammt. Er hatte oft merkwürdige Visionen, die ihn fröhlich oder traurig machen konnten. Ich fragte ihn, ob er je die Elfen gesehen habe, und erhielt die Antwort: „Machen sie mir nicht ständig Ärger?“ Ich fragte ihn auch, ob er je die Banshee, die Todesfee, gesehen habe. „Ich habe sie unten am Wasser gesehen“, sagte er, „als sie mit ihren Händen auf den Fluss einschlug.“
Dieses Portrait von Paddy Flynn habe ich mit einigen Änderungen im Wortlaut aus einem Notizbuch übernommen, das ich kurz nach unserer Begegnung fast vollständig mit seinen Geschichten und Sprüchen vollgeschrieben habe. Heute betrachte ich das Notizbuch mit Bedauern, da die letzten leeren Seiten immer leer bleiben werden. Paddy Flynn ist tot; einer meiner Freunde gab ihm eine große Whiskeyflasche, und obwohl er meist nüchtern war, erfüllte ihn der Anblick einer solchen Menge Schnaps mit großer Begeisterung. Er labte sich ein paar Tage daran und starb. Sein von hohem Alter und schweren Zeiten verbrauchter Körper konnte den Alkohol nicht mehr so gut vertragen wie in seiner Jugend. Er war ein großartiger Geschichtenerzähler, und anders als unsere gewöhnlichen Schriftsteller wusste er, wie man sich des Himmels, der Hölle, des Fegefeuers, des Elfenreichs und der Erde bedient, um seine Geschichten zu bevölkern. Er lebte in keiner eng begrenzten Welt, sogar Homer hatte keinen größeren Fundus an erzählenswerten Ereignissen. Durch Menschen wie Paddy Flynn wird das gälische Volk vielleicht die uralte Schlichtheit und Reichhaltigkeit der Vorstellungskraft zurückgewinnen. Was ist Literatur anderes, als Stimmungen mittels Symbolen und Handlungsabläufen Ausdruck zu verleihen? Und gibt es nicht Stimmungen, die Himmel, Hölle, Fegefeuer und Elfenreich genauso benötigen wie diese verkommene Erde, um ihnen Ausdruck zu verleihen? Ja, gibt es nicht Stimmungen, für die man keinen Ausdruck finden kann, es sei denn, jemand wagte, Himmel, Hölle, Fegefeuer und Elfenreich zu vermischen oder sogar Tierköpfe auf Menschenkörper zu setzen oder Menschenseelen in das Herz der Felsen zu zwängen? Lasst uns voranschreiten, Geschichtenerzähler, und jede Beute schnappen, die das Herz begehrt, und habt keine Furcht. Alles existiert, alles ist wahr, und die Erde ist nur ein Staubkorn unter unseren Füßen.
Glauben und Unglauben
Selbst in den westlichen Dörfern gibt es einige Zweifler. Letzte Weihnachten erzählte mir eine Frau, sie glaube weder an die Hölle noch an Geister. Die Hölle hielt sie lediglich für eine vom Pfarrer ersonnene Erfindung, um die Menschen zum Guten zu bekehren; und Geistern, meinte sie, sei es nicht gestattet, nach Lust und Laune „auf Erden zu wandeln. Doch gibt es Elfen“, fügte sie hinzu, „und kleine Leprechauns und Wasserpferde und gefallene Engel.“ Auch traf ich einen Mann, auf seinem Arm war ein Mohawk-Indianer tätowiert, der genau denselben Glauben und Unglauben teilte. Egal, an was man zweifelt, an den Elfen zweifelt man nicht, denn – wie der Mann mit dem Mohawk-Tattoo auf dem Arm mir erklärte – „sie widerstehen der Vernunft.“ Nicht einmal die Staatsbediensteten kommen an diesem Glauben vorbei.
Eines Nachts, vor ungefähr drei Jahren, verschwand plötzlich ein junges Dienstmädchen aus dem Dorf Grange, das dicht an den seewärtigen Hängen Ben Bulbens liegt. Sogleich gab es große Aufregung in der Nachbarschaft, da man munkelte, die Elfen hätten es entführt. Ein Dorfbewohner soll lange mit ihnen gerungen haben, um das Mädchen zu beschützen, doch die Elfen setzten sich letztlich durch, und er blieb mit nichts als einem Besenstiel in der Hand zurück. Der Dorfpolizist wurde verständigt, und er veranlasste sofort eine Durchsuchung sämtlicher Häuser und riet den Leuten, gleichzeitig die „bucalauns“ (das Traubenkraut) auf den Feldern, wo das Mädchen verschwunden war, abzubrennen, da „bucalauns“ den Elfen heilig seien. Sie verbrachten die ganze Nacht damit, das Traubenkraut zu verbrennen, während der Polizist Zaubersprüche aufsagte. Man erzählt sich, dass man das kleine Mädchen am nächsten Morgen entdeckte, als es über das Feld wanderte. Es berichtete, die Elfen hätten es auf einem großen Elfenpferd weit fortgebracht. Schließlich habe es einen großen Fluss erblickt und gesehen, wie der Mann, der die Entführung verhindern wollte, darin in einer Muschelschale hinabtrieb – so stellte die Magie der Elfen die Größenverhältnisse auf den Kopf. Auf ihrer Reise erwähnten ihre Begleiter die Namen einiger Dorfbewohner, die in Kürze sterben sollten.
Der Polizist hatte wohl recht. Es ist zweifellos besser, an viel Torheit und ein bisschen Wahrheit zu glauben, als aus reiner Dickköpfigkeit Torheit und Wahrheit gleichermaßen abzulehnen, denn wenn wir dies tun, haben wir nicht einmal eine flackernde Kerze, die unseren Pfad erhellt, nicht einmal ein armes Irrlicht, das vor uns im Sumpfland tanzt, und müssen unseren Weg durch die große Leere ertasten, wo die grauenvollen Dämonen hausen. Und was ist denn schon dabei, wenn wir in unserem Herd und unserer Seele ein kleines Feuer brennen lassen, und jedes vorzügliche Wesen, sei es Mensch oder Phantom, offenherzig einladen, sich daran aufzuwärmen, und nicht einmal zu den Dämonen allzu zornig „hebe dich hinfort“ zu sagen? Wenn alles gesagt und getan ist, wie können wir dann noch davon ausgehen, dass unsere eigene Torheit weniger wert sei als die Wahrheit eines anderen? Denn sie wurde auf unserem Herd und in unserer Seele gewärmt und ist bereit, den wilden Bienen der Wahrheit als Nest zu dienen, auf dass sie ihren süßen Honig erzeugen. Kommt zurück in die Welt, wilde Bienen, wilde Bienen!
Die Hilfe der Sterblichen
In den alten Balladen hört man von Männern, die entführt wurden, um den Göttern in der Schlacht beizustehen, und Cuchulain gewann eine Zeitlang die Göttin Fand, indem er ihrer verheirateten Schwester und deren Ehemann half, ein anderes Reich im Land der Verheißung zu unterwerfen. Man erzählte mir auch, dass die Elfen nicht einmal Hurling spielen können, wenn sie nicht in jeder Mannschaft einen Sterblichen haben, dessen seelenloser Körper zu Hause schläft oder, wie es der Geschichtenerzähler ausdrücken würde, dessen Leib durch ein Trugbild ersetzt wurde. Ohne die Hilfe der Sterblichen sind sie wie Schatten und können nicht einmal die Bälle werfen. Eines Tages spazierte ich mit einem Freund über ein Sumpfland in Galway, als wir einem alten Mann mit groben Gesichtszügen begegneten, der einen Graben aushob. Mein Freund hatte gehört, dass dieser Mann irgendetwas Wundersames gesehen habe, und schließlich entlockten wir ihm seine Geschichte. Als er ein Knabe war, arbeitete er eines Tages zusammen mit dreißig Männern, Frauen und Jungen. Sie waren hinter Tuam und nicht weit von Knock-na-gur. Plötzlich erblickten alle dreißig im Abstand von ungefähr einer halben Meile rund hundertfünfzig Angehörige des Elfenvolkes. Zwei von ihnen, sagte er, hätten dunkle Kleidung wie die Menschen unserer Zeit getragen und seien ungefähr hundert Yards voneinander entfernt gestanden, doch die anderen seien in allen Farben gekleidet gewesen, kariert und gemustert, und einige in roten Westen.
Er konnte nicht erkennen, was sie machten, doch schien es, als spielten sie Hurling, denn „sie sahen aus, als würden sie’s tun“. Manchmal verschwanden sie, und bei ihrer Rückkehr hätte er Stein und Bein schwören wollen, dass sie aus den Körpern der beiden dunkel gekleideten Männer herauskamen. Diese beiden Männer waren so groß wie normale Menschen, doch die anderen seien klein gewesen. Eine halbe Stunde lang konnte er sie beobachten, dann habe der alte Mann, für den er und die anderen arbeiteten, eine Peitsche genommen und gesagt: „Weitermachen, weitermachen, oder wir werden nie fertig!“ Ich fragte, ob auch er die Elfen gesehen habe. „Oh, ja, aber er wollte nicht, dass die Arbeit, für die er zahlte, vernachlässigt wurde.“ Er ließ sie allesamt so hart arbeiten, dass niemand sehen konnte, was mit den Elfen geschah.
Ein Seher
Eines Abends besuchte mich ein junger Mann in meiner Unterkunft und begann über die Erschaffung des Himmels und der Erde und viele andere Dinge zu reden. Ich befragte ihn über sein Leben und was er so mache. Er hatte seit unserer letzten Begegnung viele Gedichte geschrieben und viele mystische Skizzen gezeichnet, doch in letzter Zeit habe er weder geschrieben noch gezeichnet, denn sein ganzes Streben konzentrierte sich darauf, seinen Geist zu stärken, zu beleben und zu beruhigen, und er befürchtete, das Gefühlsleben des Künstlers sei schlecht für ihn. Er trug jedoch seine Gedichte bereitwillig vor. Er kannte sie alle auswendig. Einige sind tatsächlich nie aufgeschrieben worden. Sie, deren wilde Musik dem Wind glich, der durch das Schilfgras streicht, erschienen mir als vollkommener Ausdruck keltischer Traurigkeit und Sehnsucht nach unermesslichen Dingen jenseits der Welt.1 Plötzlich kam es mir so vor, als blicke er ein wenig gespannt umher. „Siehst du irgendetwas, X----?“, fragte ich. „Eine strahlende, geflügelte Frau, bedeckt von ihrem langen Haar, die in der Nähe des Eingangs steht.“ Mit diesen oder ähnlichen Worten antwortete er. „Ist sie die Verkörperung einer lebenden Person, die an uns denkt und deren Gedanken uns in dieser symbolischen Form erscheinen?“, fragte ich, denn ich kenne mich gut darin aus, wie Seher sich verhalten und wie sie sprechen. „Nein“, antwortete er, „denn wenn es die Gedanken einer lebenden Person wären, würde ich den lebendigen Einfluss in meinem Körper spüren, und mein Herz würde klopfen und mein Atem stocken. Es ist ein Geist. Es ist jemand, der tot ist oder nie gelebt hat.“
Ich fragte ihn nach seiner Arbeit und erfuhr, dass er Verkäufer in einem großen Warenhaus war. Sein Vergnügen bestand jedoch darin, über die Hügel zu streifen, mit halbverrückten und hellseherischen Bauern zu sprechen oder kauzige und von Gewissensbissen gepeinigte Menschen zu überreden, ihre Sorgen seiner Obhut zu überlassen. An einem anderen Abend, als ich bei ihm in seiner Unterkunft weilte, erschienen mehrere solcher Leute, um über ihren Glauben und Unglauben zu sprechen und ihre Überlegungen im feinsinnigen Licht seines Verstandes zu spiegeln. Manchmal suchten ihn Visionen heim, während er mit ihnen sprach, und man munkelte, er habe mehreren Leuten Wahrheiten über ihre Vergangenheit und in der Ferne weilenden Freunde erzählt und sie vor Ehrfurcht vor ihrem seltsamen Lehrer verstummen lassen, der kaum mehr als ein Knabe zu sein schien und doch viel weiser als der Älteste unter ihnen war.
Die Poesie, die er mir vortrug, war von seinem Wesen und seinen Visionen durchdrungen. Manchmal berichtete er von Leben, die er in anderen Jahrhunderten gelebt zu haben glaubte, manchmal von Menschen, mit denen er gesprochen und deren Verstand er geöffnet hatte. Ich sagte ihm, dass ich gern einen Artikel über ihn und seine Vorstellungen schreiben würde, und er wollte es mir erlauben, wenn ich seinen Namen nicht erwähnte, denn er wünschte für alle Zeit, „unbekannt, obskur und unpersönlich“ zu bleiben. Am Tag darauf erreichte mich ein Bündel seiner Gedichte und mit ihnen eine Nachricht in diesem Wortlaut: „Hier sind die Abschriften der Gedichte, die Dir gefielen. Ich glaube nicht, dass ich je wieder malen oder schreiben könnte. Ich bereite mich auf eine Reihe anderer Tätigkeiten in einem anderen Leben vor. Meine Wurzeln und Zweige sollen erstarren. Ich bin noch nicht reif, um Blätter und Blüten sprießen zu lassen.“
Die Gedichte waren allesamt Versuche, eine erhabene, kaum fassbare Stimmung in einem Netz verschwommener Bilder einzufangen. In allen gab es schöne Abschnitte, doch waren sie oft in Gedanken gebettet, die für ihn offensichtlich einen besonderen Wert hatten, während sie für andere Menschen Münzen unbekannter Prägung waren. Für diese bedeuteten sie lediglich eine bestimmte Menge Messing oder Kupfer oder bestenfalls mattes Silber. Dann wieder wurde die Schönheit des Gedankens durch achtlose Wortwahl verdunkelt, so als habe er sich plötzlich gefragt, ob Schreiben nicht doch eine alberne Tätigkeit sei. Häufig hatte er seine Verse mit Zeichnungen illustriert, in denen die fehlerhaften anatomischen Proportionen die außergewöhnlich empfindsame Schönheit nicht gänzlich verdeckten. Die Elfen, an die er glaubte, hatten ihn mit vielen Themen versorgt – ein bemerkenswertes Beispiel ist sein Portrait von Thomas of Ercildoune, der regungslos sitzend im Zwielicht verharrt, während sich ein junges und schönes Wesen sachte aus dem Schatten löst und ihm ins Ohr flüstert. Vor allem hatte er Freude an starken Farbeffekten: Geister, die statt Haaren Pfauenfedern auf den Köpfen tragen; ein Phantom, das aus einer züngelnden Flamme heraus nach einem Stern greift; ein Geist, der in seiner Hand eine schillernde Kristallkugel – ein Symbol der Seele – halb verbirgt. Doch unter den üppigen Farben liegt stets ein zärtliches Verständnis für die zerbrechlichen Hoffnungen der Menschen. Der spirituelle Eifer zieht all jene an, die wie er nach Erleuchtung suchen oder einer vergangenen Freude nachweinen. An einen dieser Menschen erinnere ich mich ganz besonders. Vor ein oder zwei Wintern verbrachte X---- einen Großteil der Nacht damit, den Berg hinauf- und hinunterzusteigen, um mit einem alten Bauern zu reden, der den meisten Menschen gegenüber stumm war, vor ihm jedoch sein ganzes Herz ausschüttete. Beide waren unglücklich: X----, weil er damals gerade erst entschieden hatte, dass Kunst und Poesie nichts für ihn waren, und der alte Bauer, weil sein Leben, ohne dass er irgendetwas vollbracht hätte und ohne Hoffnung auf die Zukunft, verebbte. Beide waren echte Kelten! Erfüllt vom Streben nach etwas, das weder durch Worte noch durch Taten jemals vollständig zum Ausdruck gebracht werden kann. Der Bauer versank in unablässigen, von Kummer getränkten Grübeleien. Einmal rief er plötzlich: „Gott besitzt den Himmel – Gott besitzt den Himmel – doch Er begehrt die Erde“; dann wieder jammerte er, dass seine alten Nachbarn verschwunden seien und alle ihn vergessen hätten. Früher rückten sie ihm in jeder Hütte einen Stuhl ans Feuer, und nun sagten sie: „Wer ist denn der alte Kerl da?“
„Ich bin verdammt“, wiederholte er und setzte dann sein Gerede über Gott und den Himmel fort. Auch sagte er öfters, während er den Arm in Richtung der Berge schwenkte: „Ich bin der einzige, der weiß, was vor dreißig Jahren unter dem Dornbusch geschah“; und bei diesen Worten glitzerten die Tränen auf seinen Wangen im Mondlicht.
Dieser alte Mann steht mir immer vor Augen, wenn ich an X---- denke. Beide versuchen – einer durch schweifende Sätze, der andere durch symbolische Bilder und feinsinnige allegorische Poesie – etwas zum Ausdruck zu bringen, das jenseits dessen liegt, was man zum Ausdruck bringen kann; und beide – möge X---- mir vergeben – haben in ihrem Inneren die ungeheure und unbestimmte Überspanntheit, die den Kern des keltischen Wesens ausmacht. Die hellsichtigen Bauern der Gegenwart, die duellierenden Landjunker der Vergangenheit und das ganze Wirrwarr der Legenden – Cuchulain, der zwei Tage lang gegen die See ankämpft, bis er stirbt, als die Wellen ihn fortreißen, Caolte, der den Palast der Götter stürmt, Oisin, der dreihundert Jahre lang vergeblich versucht, sein unersättliches Herz mit all den Freuden des Elfenreichs zu mästen, die beiden Mystiker, die die Berge hinauf- und hinabsteigen und die innersten Träume ihrer Seelen in nicht weniger traumwandlerischen Sätzen offenbaren und ich selbst, mitsamt meinem ausgeprägten Interesse an diesen Geschichten – alle sind sie ein Teil der großen keltischen Phantasmagorie, deren Bedeutung kein Mensch je entdeckte und kein Engel enthüllte.
1Ich schrieb den Satz vor langer Zeit. Diese Traurigkeit scheint mir nun Teil aller Menschen zu sein, die die Stimmungen der alten Völker der Erde bewahren. Ich bin nicht mehr so von dem Mysterium der Abstammung besessen wie früher, aber ich lasse diesen Satz und andere ähnliche Sätze unverändert. Früher glaubten wir daran, und vielleicht sind wir nicht klüger geworden.
Dorfgespenster
In den großen Städten sieht man so wenig von der Welt, weil die Minderheiten lieber unter sich bleiben. In den Kleinstädten und Dörfern gibt es keine Minderheiten, da es nicht genug Menschen gibt. Dort bekommt man gezwungenermaßen die ganze Welt zu sehen. Jeder Mensch ist eine Klasse für sich; jede Stunde ist eine neue Herausforderung. Wenn man am Gasthof am Ende des Dorfes vorbeigeht, lässt man seine eigenen Vorlieben hinter sich, da man niemanden trifft, der sie teilen kann. Wir lauschen wortgewandten Reden, lesen Bücher und schreiben sie, regeln alle Angelegenheiten des Universums. Die stummen Scharen der Dorfbewohner ändern sich nie. Der Spaten in der Hand des Bauern fühlt sich trotz all unserer Reden immer gleich an. Gute Jahreszeiten und schlechte folgen aufeinander wie in alten Zeiten. Die stummen Scharen kümmern sich nicht mehr um uns als das alte Pferd, das durch das rostige Gitter des Dorfpferches lugt. Die alten Kartenzeichner schrieben auf unerforschte Regionen: „Hier sind Löwen.“ Über die Dörfer der Fischer und Ackerbauern, die so wenig mit unserem Leben gemein haben, können wir nur einen unbezweifelbaren Satz schreiben: „Hier sind Gespenster.“
Meine Gespenster behausen das Dorf H---- in Leinster. Die Geschichte ist an diesem vorzeitlichen Dorf, seinen krummen Gassen, dem alten, mit hohem Gras überwucherten Klosterfriedhof, dem grünen Hintergrund aus kleinen Tannenbäumen und dem Kai, an dem einige teerige Fischkutter vertäut sind, spurlos vorübergegangen. In den Annalen der Insektenkunde ist es jedoch wohlbekannt. Denn ein Stück weit im Westen liegt eine kleine Bucht, wo derjenige, der nächtelang wacht, eine bestimmte seltene Mottenart erspähen kann, die beim Gezeitenwechsel, kurz vor dem Einbruch der Nacht oder dem Beginn der Morgendämmerung, umherflattert. Vor hundert Jahren wurde sie von Schmugglern in Kisten voll Spitze und Seide aus Italien eingeführt. Wenn der Mottenjäger sein Fangnetz beiseite legte, um den unzähligen lokalen Geschichten über Gespenster oder Elfen oder ähnliche Kinder Liliths nachzujagen, müsste er viel weniger Geduld aufbringen.
Um sich des Nachts dem Dorf zu nähern, braucht ein ängstlicher Mensch eine ausgezeichnete Taktik. Einst hörte man folgende Klage: „Beim Kreuz Christi! Welchen Weg soll ich wählen? Wenn ich am Dunboyhügel vorbeigehe, wird mir der alte Kapitän Burney auflauern. Wenn ich am Meer entlanggehe und die Stufen hinauf, wartet dort der Kopflose, und am Kai gibt’s noch einen und einen neuen an der alten Friedhofsmauer. Wenn ich den anderen Weg nehme, erscheint Mrs. Stewart bei Hillside Gate, und der Teufel persönlich haust in der Hospital Lane.“
Ich konnte nicht herausfinden, welchem Geist der Mann die Stirn bot, aber sicher war es nicht jener in der Hospital Lane. In den Zeiten der Cholera hatte man dort eine Hütte für die Patienten errichtet. Als man sie nicht mehr benötigte, wurde sie abgerissen, doch wird seitdem der Ort, wo sie stand, von zahllosen Geistern, Dämonen und Elfen heimgesucht. In H---- lebte ein Bauer namens Paddy B----; ein unheimlich starker Mann und Abstinenzler. Seine Frau und Schwiegertochter staunten über seine große Kraft und fragten sich oft, was er wohl anstellte, wenn er ein Trinker wäre. Als er eines Nachts durch die Hospital Lane ging, sah er etwas, das er zunächst für ein harmloses Kaninchen hielt; etwas später merkte er, dass es eine weiße Katze war. Als er sich dem Tier näherte, begann es langsam größer und größer zu werden, und während es wuchs, spürte er seine eigene Kraft schwinden, als ob sie ihm ausgesaugt würde. Er drehte sich um und rannte.
Bei der Hospital Lane verläuft der „Elfenpfad“. Jeden Abend wandern sie vom Hügel zum Meer und vom Meer zum Hügel. Dort, wo der Pfad am Meer endet, steht eine Hütte. Eines Nachts ließ Mrs. Arbunathy, die darin wohnte, die Tür offen, da sie ihren Sohn erwartete. Ihr Mann war am Kamin eingeschlafen; ein großer Mann trat ein und setzte sich zu ihm. Nachdem er eine Zeitlang dort gesessen hatte, fragte die Frau: „Wer sind Sie, in Gottes Namen?“ Er stand auf und sagte beim Hinausgehen: „Lasst zu dieser Stunde niemals die Tür offen, sonst wird das Böse zu euch kommen.“ Sie weckte ihren Mann und erzählte ihm, was geschehen war. „Jemand vom guten Volk hat uns besucht“, sagte er.
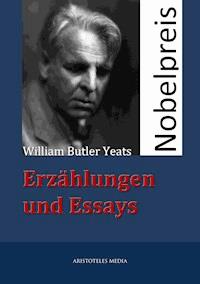
![La torre [Edición bilingüe] - William Butler Yeats - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d3fdad31e7c40cd4a924abd578225238/w200_u90.jpg)