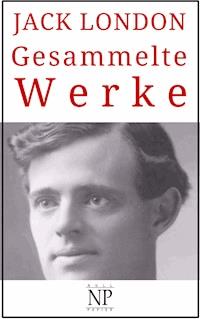
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Die wichtigsten Werke von Jack London: Der Seewolf Wolfsblut Nordlandgeschichten Martin Eden König Alkohol An der weißen Grenze Das Mondtal Der Ruhm des Kämpfers Der Mexikaner Felipe Rivera Der Schrei des Pferdes Wer schlug zuerst? Das Ende vom Lied Das Wort der Männer Die Liebe zum Leben Der Sohn des Wolfs Das weiße Schweigen Die Männer von Forty-Mile In fernem Lande Auf der Rast Das Vorrecht des Priesters Die Weisheit der Reise Das Weib eines Königs Eine Odyssee des Nordens Der Seebauer Die glücklichen Inseln Auf der Makaloa-Matte Die Gebeine Kahekilis Koolau, der Aussätzige Leb wohl Jack! Aloha ʻOe Der Sheriff von Kona Das Haus des Stolzes Die Tränen Ah Kims Chun Ah Chun Die Herrin des Großen Hauses Drei Sonnen am Himmel Die Heirat der Lit-Lit Jees Uck Braunwolf Bastard Negore, der Feigling Quartier für einen Tag Der König und sein Schamane Ein Sohn der Sonne Aloysius Pankburns wunder Punkt Die Teufel von Fuatino Die Witzbolde von Neu-Gibbon Eine kleine Abrechnung mit Swithin Hall Ein Abend in Goboto Federn der Sonne Parlays Perlen In den Wäldern des Nordens Das Gesetz des Lebens Nam-Bok, der Lügner Der Herr des Geheimnisses Die Männer des Sonnenlandes Die Krankheit des Einsamen Häuptlings Keesh, der Sohn des Keesh Ligouns Tod Li Wan, die Schöne Der Bund der Alten Jerry der Insulaner Kid & Co. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 7150
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jack London
Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Jack London
Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962813-47-5
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
An der weißen Grenze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Das Mondtal
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Der Ruhm des Kämpfers
Der Ruhm des Kämpfers
Der Mexikaner Felipe Rivera
Der Schrei des Pferdes
Wer schlug zuerst?
Das Ende vom Lied
Das Wort der Männer
Die Liebe zum Leben
Der Seewolf
Erster Teil
Zweiter Teil
Der Sohn des Wolfs
Das weiße Schweigen
Der Sohn des Wolfs
Die Männer von Forty-Mile
In fernem Lande
Auf der Rast
Das Vorrecht des Priesters
Die Weisheit der Reise
Das Weib eines Königs
Eine Odyssee des Nordens
Der Seebauer
Die glücklichen Inseln
Auf der Makaloa-Matte
Die Gebeine Kahekilis
Koolau, der Aussätzige
Leb wohl Jack!
Aloha ʻOe
Der Sheriff von Kona
Das Haus des Stolzes
Die Tränen Ah Kims
Chun Ah Chun
Die Herrin des Großen Hauses
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Drei Sonnen am Himmel
Drei Sonnen am Himmel
Die Heirat der Lit-Lit
Jees Uck
Braunwolf
Bastard
Negore, der Feigling
Quartier für einen Tag
Der König und sein Schamane
Ein Sohn der Sonne
Ein Sohn der Sonne
Aloysius Pankburns wunder Punkt
Die Teufel von Fuatino
Die Witzbolde von Neu-Gibbon
Eine kleine Abrechnung mit Swithin Hall
Ein Abend in Goboto
Federn der Sonne
Parlays Perlen
In den Wäldern des Nordens
In den Wäldern des Nordens
Das Gesetz des Lebens
Nam-Bok, der Lügner
Der Herr des Geheimnisses
Die Männer des Sonnenlandes
Die Krankheit des Einsamen Häuptlings
Keesh, der Sohn des Keesh
Ligouns Tod
Li Wan, die Schöne
Der Bund der Alten
Jerry der Insulaner
Vorwort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kid & Co.
Ein Missgriff der Schöpfung
Die Geschichte eines kleinen Mannes
Eier
Die neue Stadt
Das Wunder des Weibes
König Alkohol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lockruf des Goldes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Martin Eden
Erster Band
Zweiter Band
Meuterei auf der Elsinore
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Michael der Bruder Jerrys
1
2
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nachwort
Nordlandgeschichten
Negore, der Feigling
Der König und sein Schamane
Das Wort der Männer
Der Gott seiner Väter
Das Vorrecht des Priesters
Die Weisheit der Reise
Nam-Bok, der Lügner
Der Bund der Alten
Jan, der Unverbesserliche
Die große Frage
Liwan, die Schöne
Südsee-Geschichten
Die Perle
Der Walzahn
Mauki
Der blasse Schrecken
Otoo, der Heide
Die furchtbaren Salomoninseln
Der unvermeidliche weiße Mann
Feuer auf See
Wolfsblut
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Fünfter Teil
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
An der weißen Grenze
1
Alle Luken des Dampfers waren offen. Quietschende, kreischende und polternde Kräne tauchten mit spitzen Haken in seinen Bauch ein. Unablässig holten sie Kisten und Lasten der Goldgräber hervor und schwangen sie hinüber in offene Leichter, die zu beiden Seiten längs des Schiffes lagen. Tausend Menschen hasteten auf Deck umher und traten einander auf die Füße. Die Schauerleute waren im Streik, und die Passagiere mussten selbst ihre Ladung löschen. Es war keine Ordnung. Gruppenweise stritten sie sich um das Eigentumsrecht an bestimmten Lasten, die mit »Punkt 2« oder »Punkt 2 Strich« gezeichnet waren. Dann und wann kam es zu Schlägereien.
Der Erste Offizier ging durch das Tohuwabohu und machte ein heiteres Gesicht, als ginge ihn die ganze Sache nichts an.
»Goldgräber sind eine leicht verderbliche Fracht«, sagte er zu Frona Welse. »Sie zittern um jede Minute …«
»Und ich erst!« rief Frona. »Ich zittere auch um jede Minute. Da, schaun Sie da hinüber! Dort, wo der Fluss mündet, zwischen den Kiefern, sehen Sie das große Blockhaus? In dem bin ich geboren!«
»Dann allerdings, dann hätte ich auch Eile«, lachte er. »Also dann wollen wir Ihnen mal ein bisschen unter die Arme greifen.«
Sie war das einzige junge Mädchen an Bord, unter mehr als tausend Männern. Er lotste sie galant an die Reling, wo verzweifelte Passagiere standen und mit Schriftstücken winkten. Sie brüllten ihre Frachtzeichen und fluchten wie die Heiden.
»Der Proviantmeister sagt, entweder ist er schon verrückt geworden, oder er wird es augenblicklich«, erzählte der Erste Offizier, während er Fräulein Welse über die Laufplanke half.
»Dabei geht es bei uns noch ganz friedlich her. Sehen Sie da drüben den ›Stern von Bethlehem‹?«
Er zeigte auf einen Dampfer, der eine Meile entfernt vor Anker lag.
»Die Hälfte von den Passagieren da drüben hat Packpferde bestellt. Die wollen nach Skaguay und dem Weißen Pass. Dort soll es neue Goldfunde geben. In einem Jahr will jeder von ihnen Millionär sein. Ihre Pferde stehen am Strand und grasen friedlich, und die Leute kommen nicht vom Schiff weg. Da ist eine Art von Meuterei ausgebrochen.«
»He, Sie!« rief er einem Ruderboot zu, das sich vorsichtig am äußersten Rande des schwimmenden Wirrwarrs hielt.
Eine winzige Barkasse, die mit heroischem Mut an einer mächtigen Schute zerrte, versuchte, dem Ruderer den Weg abzuschneiden, aber der Mann legte sich einfach vor ihren Bug. Er bekam einen Stoß und fiel der Länge nach in sein Boot. Das Boot drehte sich und stoppte jetzt den ganzen Verkehr.
Eine paar lange Kanus, vollgeladen mit Waren, Goldgräbern und Indianern, drängten an ihm vorbei zum Strand und verhedderten sich ineinander. Als der Ruderer wieder auf die Füße kam, ließ er einen Hagel von Flüchen auf alle Kanuleute und Leichterschiffer niederfahren. Ein Mann auf dem Leichter beugte sich zu ihm hinüber und schwur, dass er nie einen armseligeren Sohn einer Hündin gesehen hätte, während die Weißen und Indianer in den Kanus in ein brüllendes Hohngelächter ausbrachen.
»Scher dich zum Satan!« rief einer aus dem Kanu, »hättest du lieber rudern gelernt!«
Die Faust des Ruderers krachte gegen das Kinn des anderen, der betäubt auf einen Warenstapel fiel. Er war damit aber noch nicht zufrieden. Weiß vor Wut, wollte er sich in das Kanu hinüberschwingen und weiter auf den Mann eindreschen, der behauptet hatte, er könnte nicht rudern. Ein Goldgräber im selben Kanu, der in all dem nur Zeitvergeudung sah, nestelte an seiner Revolvertasche, und man konnte große Dinge erwarten. Aber dann wurde dem Ruderer aus dem Kanu heraus ein Riemen über den Schädel geschlagen, sodass er für den Augenblick kampfunfähig war, das Kanu bekam seinen Weg wieder frei, und gerade als Mord und Totschlag unvermeidlich schienen, war die kleine Meinungsverschiedenheit plötzlich zu Ende.
Der Schiffsoffizier warf einen verstohlenen Blick auf das Mädchen … vielleicht wurde sie ohnmächtig, und er musste sie auffangen? Aber ihr Gesicht war voll vergnügter Spannung. Sie war noch hübscher geworden.
»Es ist mir ja lieb, dass der Revolver nicht geknallt hat«, sagte sie, »aber so was macht doch Spaß, finden Sie nicht?«
Inzwischen war der Ruderer wieder auf die Beine gekommen und legte sein Boot an die Schiffswand.
»Eine Dame an Land!« schrie der Offizier. »Wie viel?«
»Zwanzig Dollar.«
»Der Kerl ist ein Räuber«, sagte der Offizier zu Frona. »Zwanzig Dollar für die paar hundert Meter! Für einen Mann würde er wahrscheinlich fünfundzwanzig fordern. Richtige Seeräuberei! Eines schönen Tages wird er da drüben hängen an einer von den Kiefern.«
»Halten Sie’s …«, rief der von unten.
»Sie haben verdammt gute Ohren!«
»Mit den Flossen bin ich auch nicht langsam, wenn Sie’s darauf ankommen lassen.«
»Und ganz besonders schnell mit dem Maul!«
»Muss ich auch, bei meinem Geschäft, sonst käm’ ich nicht weit unter all den Haifischen. Ich soll ein Räuber sein? Was seid ihr denn dann? Tausend Passagiere aufeinander gepackt wie die Ölsardinen … und für nichts gesorgt! Bezahlen lasst ihr euch zweimal soviel wie in der ersten Klasse, und füttern tut ihr sie mit Zwischendeckfraß! Möchte wissen, wer von uns eigentlich Seeräuber ist!«
»Also, mein verehrtes Fräulein …«, sagte der Offizier zu Frona. »Alles Gute! Ich hätte Sie gern an Land begleitet. Aber Sie sehen ja selbst: ein bisschen muss ich doch hier noch zusehen. Die Leute haben das gern. Jedenfalls können Sie sich darauf verlassen, dass ich für Ihr Gepäck sorge.«
Sie drückte ihm die Hand und kletterte in das Boot. Es schwankte stark, im Augenblick waren die Bodenbretter überspült, und ihre Füße standen im Wasser. Sie blieb ganz ruhig, setzte sich auf die Steuerducht und zog die Beine hoch.
»Das geht ja nicht!« rief der Offizier von oben. »Kommen Sie zurück, Fräulein Welse! Sobald es möglich ist, lasse ich Sie mit einem von unseren Booten an Land bringen.«
Er kletterte die Strickleiter hinunter und wollte das viel zu leichte Boot mit Gewalt zurückhalten, aber der Ruderer hatte für soviel Ritterlichkeit kein Verständnis und schlug ihm über die Knöchel.
»Willst mir meinen Passagier ausspannen? Hast wohl Sehnsucht nach dem Himmel?«
»Ein feierlicher Abschied!« rief Frona Welse ihm mit strahlendem Gesicht zu. »Haben Sie tausend Dank, Sie sind ein Ritter!«
»Das ist ein Weib!« sagte der Ritter vor sich hin und rieb seine getroffenen Fingerknöchel. Er hatte plötzlich Sehnsucht, immer in diese grauen Mädchenaugen zu sehen, hatte Lust, seinen Beruf über Bord zu werfen und mit ihr nach Klondike zu ziehen.
*
Ein falscher Riemengriff … Platsch! hatte Frona eine dicke Hand voll Wasser mitten im Gesicht.
»Nur nichts übelnehmen«, entschuldigte sich der Bootsmann. »Man tut, was man kann, aber es kommt nicht immer viel dabei heraus.«
»Scheint mir doch so«, lachte sie gutmütig.
»Ich mach’ mir gar nichts aus der See«, sagte der Mann bitter, »aber man muss sehen, wie man’s wieder zu ein paar Dollars bringt. Wäre schon längst in Klondike, hab’ aber verfluchtes Pech gehabt. Auf dem ›Windigen Arm‹ hab’ ich meine ganze Ausrüstung verloren … beinahe hatte ich den Kram schon über den Pass hinübergeschafft.«
Abermals: Schwupp, Platsch! Sie schüttelte sich das Wasser aus den Augen und fröstelte, als eine nasse Ladung ihr den warmen Rücken hinunterrann.
»Sie werden’s schaffen!« sagte der Mann. »Sie sind aus dem richtigen Holz für dieses Land geschnitzt. Wollen Sie ganz hierbleiben?«
Sie nickte freundlich.
»Sie werden’s schaffen! Also, wie gesagt, meine Ausrüstung ist da oben zum Teufel gegangen, und jetzt muss ich all das Zeugs neu zusammenbringen. Kann man da billiger rudern als für zwanzig Dollar die Fahrt? Wissen Sie, Fräulein, schlimmer als die anderen bin ich auch nicht. Was meinen Sie, für diese alte Badewanne haben sie mir hundert Dollar aus den Zähnen gerissen. Drüben in den Staaten ist sie keine zehn wert. So ist es hier mit allem. Auf dem Weg nach Skaguay zahlt man Ihnen für einen alten Hufnagel einen Vierteldollar. Ein Mann geht in die Kneipe und trinkt einen Whisky, schmeißt zwei Hufnägel auf die Theke, und es ist o.k. Hufnägel sind da oben Scheidemünze.«
»Sie müssen ein tüchtiger Kerl sein, dass Sie gleich noch einmal angefangen haben! Wie heißen Sie eigentlich? Vielleicht begegnen wir uns wieder einmal.«
»Ich? Wie ich heiße? Also Del Bishop, Goldgräber. Wenn wir uns wieder begegnen, dann müssen Sie von vornherein wissen … mein letztes Hemd geb’ ich für Sie her, Fräulein! Entschuldigen Sie, ich meine natürlich, den letzten Bissen Brot geb’ ich für Sie.«
»Danke«, sagte sie. »Das kam von Herzen. Das hört man gleich.«
Er hielt einen Augenblick mit Rudern inne und fischte aus dem Wasser zu seinen Füßen eine alte Konservendose hervor.
»Schöpfen Sie lieber!« befahl er und warf ihr die Dose zu. »Leck war die Kiste schon vorher, aber vorhin hat sie noch eins abbekommen.«
Frona machte sich gehorsam an die Arbeit. So oft sie sich bückte, hoben und senkten sich die Berge mit ihren Gletschern am Horizont. Hin und wieder ruhte sie aus und sah nach dem von Menschen wimmelnden Strand, auf den sie zusteuerten, und dann wieder auf die Bucht, in der an zwei Dutzend große Dampfer ankerten. Von jedem dieser Schiffe ging ein Strom von Leichtern, Kähnen, Kanus hin und her zum Lande. Sie dachte an die Hörsäle, in denen sie vor ein paar Wochen noch zu Füßen ihrer Lehrer gesessen hatte. Diese Welt hier war ihr lieber … vor der hatte sie Respekt.
»Aber Sie haben mir Ihren Namen noch nicht gesagt«, mahnte Bishop höflich.
»Ich heiße Welse«, antwortete sie. »Frona Welse.«
Sein Mund stand offen, er starrte sie an: »Dann ist ja … Jacob Welse … Ihr alter Herr?«
»Jawohl, wenn Sie nichts dagegen haben.«
Er spitzte die Lippen, stieß einen Pfiff aus und ließ die Riemen gleiten. »Klettern Sie in den Stern und ziehen Sie die Beine hoch!« befahl er. »Geben Sie mir die Dose.«
»Arbeite ich denn nicht ordentlich?«
»Doch, sehr gut sogar. Aber Sie sind … Sie sind …«
»Genau dasselbe, was ich vorher war. Rudern Sie weiter … das ist Ihre Arbeit, und meine besorge ich.«
»Alle Achtung, Sie werden’s schaffen«, murmelte Bishop und beugte sich wieder über die Riemen. »Jacob Welse ist Ihr alter Herr! Donnerwetter, das hätte man wissen sollen!«
Auf der sandigen Landzunge, im Gewimmel geschäftiger Menschen, die wie Ameisen hin und her ihre Lasten trugen, schüttelte sie dem Fährmann die Hand.
Er war sehr stolz. »Nicht vergessen, Fräulein, mein letzter Bissen Brot gehört Ihnen.«
»Und Ihr letztes Hemd auch! Vergessen Sie das nicht.«
»Ganz bestimmt!«
Als sie davongegangen war, sah er ganz entrückt seine Hand an, die sie gedrückt hatte.
»Das ist ein Mädel … Donnerwetter!«
*
Das Trippeln auf städtischem Pflaster hatte ihre Füße nicht verdorben. Im Augenblick fand sie hier auf heimischem Strand die leichten, langen Wanderschritte wieder, die andere mit viel Mühe lernen müssen. Mehr als ein Goldgräber sah mit derselben Bewunderung wie Bishop auf ihre langen, elastischen Beine, aber die meisten blickten ihr ins Gesicht und freuten sich über den offenen, kameradschaftlichen Blick ihrer Augen. Wenn einer sie anlächelte, lächelte sie zurück, ermunternd, heiter, mitfühlend, je nachdem, aber immer kameradschaftlich.
Für sie schien die Zeit rückwärts gerollt, auf einmal war sie wieder in jenes Mittelalter zurückversetzt, in dem sie herangewachsen, in dem es keine Bahnen und Automobile, nur Karren und breite Bücken als Verkehrsmittel gab. Männer, denen man ansah, dass sie bisher nur mit der Aktenmappe unterm Arm spaziert waren, beugten sich unter schweren Lasten. Ihre Beine bewegten sich schwer und stolpernd, sie waren diese Anstrengung nicht gewöhnt, und ihre Gesichter perlten von Schweiß. Andere luden ihr Gepäck mit stillem Triumph auf vierrädrige Karren und schoben los, aber sie blieben stecken, wo der erste große Stein ihnen den Weg versperrte. Nach etlichem Kampf fügten sie sich dann den für Reisen in Alaska geltenden Grundsätzen, ließen den Karren stehen oder zogen ihn an den Strand zurück, um ihn zu einem fabelhaften Preis an die Chechaquos zu verkaufen, die noch später als sie gelandet waren. Neulinge wanderten mit zehnpfündigen Colt-Revolvern, Patronengürteln und Jagdmessern drauflos, aber bald merkten sie, wie unnütz diese Mordgepäckstücke waren. Revolver, Patronen und Messer garnierten ihre Spur.
Hier, an diesem Strand, den damals noch kein Strom goldgieriger Männer durchflutet hatte, war Frona Kind gewesen. Hier hatte sie im Grase gespielt und erschauernd gehört, wie das Echo ihre Stimme von Gletscher zu Gletscher trug und widerhallte. Über dieses Gras stapften jetzt zehntausend Männer rastlos hin und her. Zehntausend andere waren unterwegs über den Chilcoot. Abermals Zehntausend hatten die Pässe schon überwunden und marschierten zu dieser Stunde die Goldfelder an.
Die Dyea stürzte sich, wie in alten Tagen, rauschend und tosend ins Meer, aber an ihren Ufern quälten sich Männer in wogenden Reihen an Tauen und Riemen, schleppten schwer beladene Boote heran und löschten die Fracht.
Die Tür zu dem Laden, in dem einst Biberfänger oder Pelzhändler ihre bescheidenen Einkäufe gemacht hatten, war jetzt von einer lärmenden Schar von Kunden versperrt. Wo einst ein einsamer Brief Monate und Jahre darauf gewartet hatte, abgeholt zu werden, sah Frona jetzt die Post in Haufen liegen. Aufgeregte Leute schrien nach ihrer Korrespondenz. Auch die Waage vor der Theke war umlagert. Ein Indianer warf seinen Packen auf das Wiegebrett, ein weißer Beamter kritzelte das Gewicht in sein Notizbuch, ein neuer Packen flog heran, verschnürt und bereit, auf dem Rücken eines Mannes über den Chilcoot zu reisen.
Zu Fronas Zeiten war hin und wieder einmal das Gepäck eines Goldgräbers oder Händlers für sechs Cent das Kilo über den Chilcoot transportiert worden. Der Chechaquo, dessen Gepäck gerade abgewogen wurde, sah traurig in seine Brieftasche.
»Acht Cent«, bot er dem Indianer.
Großes Hohnlachen.
»Vierzig Cent«, verlangte die Rothaut.
Der Mann sah sich ängstlich um, mit tieftraurigem Gesicht. Er las das Mitgefühl in Fronas Augen und starrte sie an.
»Stellen Sie sich vor, Fräulein, drei Tonnen Gepäck hab’ ich und soll vierzig Dollar für hundert Pfund bezahlen! Das sind 2400 Dollar für dreißig Meilen!« schrie er ganz verzweifelt. »Was soll ich tun?«
Frona riet ihm: »Bezahlen Sie die vierzig Cent, sonst schmeißen sie Ihnen den ganzen Kram vor die Füße.«
Der Mann sagte: »Danke, Fräulein«, befolgte aber ihren Rat nicht, sondern fing wieder an zu handeln. Der erste Indianer trat vor und streifte sich, ohne ein Wort zu sagen, die Tragriemen ab. Als der Goldsucher sich eben entschlossen hatte nachzugeben, erhöhten die Lastträger ihren Preis auf 45 Cent. Er lächelte trüb und nahm auch diese Forderung an, aber in diesem Augenblick trat ein anderer Indianer zu der Gruppe, flüsterte ein paar Worte, und gleich darauf ertönte ein Hurra.
Im Handumdrehen hatten alle Indianer ihre Lasten abgeworfen und liefen davon, um die Nachricht zu verbreiten, von dieser Stunde an koste die Fracht nach dem Lindermannsee fünfzig Cent!
Über den Platz vor dem Hause gingen drei Männer, nach denen alle Gesichter sich drehten und alle Hälse sich reckten. Sie waren schlecht gekleidet, eigentlich zerlumpt. In einem zivilisierten Gemeinwesen hätte der Dorfpolizist ihre Papiere sehr genau angeschaut, denn er hätte sie für Vagabunden gehalten.
»Der Franzosen-Louis!« flüsterte ein Chechaquo seinem Kumpan zu. »Besitzt drei Eldorado-Claims in einem Block! Seine zehn Millionen ist der schwer!«
Der Franzosen-Louis hatte irgendwo unterwegs seinen Hut verloren und durch ein ausgefranstes seidenes Tuch ersetzt. Trotz seinen zehn Millionen trug er das Gepäck selbst auf seinem breiten Rücken.
»Der mit dem Bart ist der Stromschnellen-Bill, auch einer von den Eldorado-Königen.«
»Woher wissen Sie das?« fragte Frona misstrauisch.
»Woher ich das weiß? Ich weiß es eben, verstehen Sie, Fräulein! Wenn einer sein Bild alle fünf Minuten in sämtlichen Zeitungen hat, dann weiß man eben, wie er aussieht.«
»Wer ist der Dritte?« fragte sie. Ihr Berichterstatter stellte sich auf die Zehenspitzen.
»Den kenn’ ich nicht«, gestand er betrübt. Dann fragte er seinen Nebenmann.
»Du, der Magere, mit dem ausrasierten Vollbart, der mit dem Lappen ums Knie, wer ist das?«
In diesem Augenblick aber stieß Frona einen Freudenschrei aus und stürzte auf den Mann mit dem Vollbart zu.
»Matt! Mein lieber, alter Matt!«
Der Mann schüttelte ihr die Hand, aber sein Gesicht schien misstrauisch. Er hatte keine Ahnung, mit wem er sprach.
»Du kennst mich nicht mehr, Matt? Untersteh dich, mir zu sagen, dass du mich nicht mehr kennst! Wenn nicht so viel fremde Leute hier wären, bekämst du jetzt auf der Stelle einen Kuss, dass du’s nur weißt, alter Bär!«
»Natürlich, ich kenne Sie natürlich … aber wenn Sie mich totschlagen, im Augenblick komme ich nicht darauf …«
Sie zeigte auf das Haus, in dem sie geboren war.
»Jetzt hab’ ich’s!« rief er. Als er sie dann aber von oben bis unten gemustert hatte, war er wieder enttäuscht. »Kann nicht sein. Muss mich irren. In dem Stall da haben Sie nie gewohnt.«
Frona nickte heftig mit dem Kopf.
»Dann bist du’s also doch? Die kleine, blonde Hexe, immer barfuß und mit bloßen Beinen? Die ich immer hab’ kämmen müssen?«
»Ja, ja!«
»Der kleine Satan, der mit dem Hundegespann durchgebrannt ist und mitten im Winter über den Pass wollte, weil ihr der alte Matt erzählt hatte, dort drüben höre die Welt auf?«
»Matt, lieber alter Matt! Und weißt du noch, wie ich mit den Mädchen aus dem Indianerlager schwimmen gegangen bin?«
»Und ich dich grade noch an den Wuscheln gekriegt hab’, wie du schon am Ersaufen warst!«
»Und wie du dabei einen von deinen neuen Gummischuhen verloren hast?«
»Na, ob ich das noch weiß! Grade erst bei deinem Vater gekauft, da im Laden, für zehn Dollar, Gott erbarme sich meiner.«
»Und dann bist du fortgezogen … über den Pass ins Land hinein … und hast nichts mehr von dir hören lassen. Alle Welt hat geglaubt, du wärst tot.«
»Was du alles noch weißt! Und warst doch so ein winziges Frauenzimmer.«
»Acht Jahre alt war ich.«
»Lass mich mal nachrechnen, Mädel. Zwölf Jahre war ich drinnen im Land, heut’ zum ersten Mal wieder an der Küste. Dann hast du jetzt also deine zwanzig auf dem Buckel?«
»Und bin fast ebenso groß wie du, alter Matt!«
»Ein ausgewachsenes, großes Mädel und gar nicht so übel. So’n bisschen mehr Fleisch könntest du gern auf den Knochen haben.«
»Mit zwanzig braucht man kein Fett. Fühle lieber hier!«
Sie streckte ihm den gebeugten Arm hin und zeigte ihre Muskeln.
»Donnerwetter!« Er griff tüchtig zu. »Als ob du fürs tägliche Brot geschafft hättest.«
»Das nicht, aber Keulenschwingen, Boxen, Fechten! Außerdem Schwimmen, zwanzig Klimmzüge hintereinander! Und dann kann ich noch auf den Händen laufen!«
»Dann hast du deine Zeit nicht schlecht angewendet. Hier haben diese Kaffern erzählt, du wärst fortgereist, um da drüben Bücher zu büffeln.«
»Das ist heute nicht mehr ganz so, Matt. Sie pfropfen einem den Kopf nicht mehr so voll, dass die Beine zu dünn werden, um ihn zu tragen. Aber du, was machst du, Matt? Was hast du in diesen zwölf Jahren alles getrieben?«
»Also schau mich an, Mädel. Wie ich vor dir stehe, bin ich Herr Matthew McCarthy, König Matt der Erste aus der Eldorado-Dynastie. Mein Besitz ist unbegrenzt, und ich hab’ mehr Goldstaub gemacht, als ich je geträumt hätte. Jetzt hab’ ich genug, jetzt möcht’ ich wieder mal einen anständigen Whisky graben. Einen von der richtigen Sorte, ehe ich sterbe. Dazu fahre ich rüber in die Staaten, denn hier heraus kommt immer nur das gepanschte Zeug. Außerdem will ich mich nach meinen Vorfahren umsehen. Ich glaube bestimmt, dass ich welche habe. Wenn du im übrigen ein paar Pfund Goldstaub nötig hast, kannst du’s mir ja sagen.«
»Den hol’ ich mir selbst, wenn ich welchen brauche.«
Der Irländer Matt bahnte sich jetzt seinen Weg durch die Menge der Chechaquos, die ehrfürchtig vor ihm zur Seite wichen, und in seinem Fahrwasser segelte die leichte, kleine Frona. In den Augen all dieser Leute waren sie beide eine Art Götter des Nordens.
»Der Eldorado-König Matt McCarthy und eine richtige Welse, wirklich und wahrhaftig, eine Tochter von Jacob Welse!«
*
Sie trat aus dem glitzernden Birkenwald heraus und flog leicht über die betaute Wiese dahin, während die ersten Sonnenstrahlen auf ihrem flatternden Haar flammten. Die Erde strotzte von Feuchtigkeit und quoll unter ihren Füßen, und die nassen Pflanzen schlugen ihr gegen die Knie, dass flüssige Diamanten leuchtend sprühten. Die Morgenröte färbte ihre Wangen und funkelte in ihren Augen, und sie glühte von Jugend und Liebe. Denn da sie keine Mutter gehabt, war sie am Busen der Natur aufgewachsen, und sie liebte die alten Bäume und die Schlingpflanzen leidenschaftlich. Das undeutliche Gemurmel erfreute ihr Ohr, und der feuchte Brodem der Erde stieg ihr süß in die Nase.
Dort, wo der obere Teil der Wiese in einem dunklen, engen Waldweg verschwand, fand sie zwischen langstengeligem Löwenzahn und leuchtenden Butterblumen ein Büschel Alaska-Veilchen. Sie warf sich der Länge nach zu Boden, begrub ihr Antlitz in der duftenden Kühle und presste die purpurne Pracht an sich. Sie schämte sich nicht. Sie war zu den komplizierten Lebensbedingungen der großen Welt, zu ihrem Schmutz und zu ihrer verderblichen Hitze gewandert und war einfach, rein und gesund wiedergekehrt. Und sie freute sich dessen, wie sie jetzt dalag und zurückglitt zu den alten Tagen, als die Welt mit dem Horizont begonnen und geendet hatte und sie über den Pass gereist war, um den Abgrund zu schauen.
Fronas Kindheit war unter sehr harten Bedingungen verlaufen. Es hatte nur wenige, aber strenge Bindungen für sie gegeben, die sie später den »Brot- und Bettglauben« nannte. Das war, soviel ihr bekannt war, auch der Glaube ihres Vaters gewesen, von dem sie im übrigen wusste, dass sein Name unter den Männern einen guten Klang hatte. Es war der Glaube, mit dem starke, reine Männer jeder Gefahr trotzten oder in den Tod gingen, der Glaube Jacob Welses und Matt McCarthys, der Indianerjungen, mit denen sie gespielt hatte, der Indianermädchen, deren Feldherrin sie im Amazonenkrieg gewesen, der Wolfshunde sogar, die sich in den Strängen mühten und Schlitten über den Schnee zogen. Das war ein gesunder Glaube, greifbar und gut.
Ein Rotkehlchen zirpte aus dem Birkenwald, ein Rebhuhn schwirrte im Walde auf, ein Eichhörnchen schoss über ihrem Kopf mit sicherem Sprung von einem Baum zum anderen. Der Tag begann. Vom Fluss her, den sie nicht sah, tönten die Rufe der Glücksjäger, die sehr früh das Lager verlassen hatten und anfingen, sich ihren schweren Weg nach Norden zu erkämpfen.
Als Frona Gras und Blumen lange genug umarmt hatte, stand sie auf und schlug den alten Weg nach dem Lager des Dyea-Stammes ein. Sie begegnete einem Knaben, der bis auf die geflickten Hosen ein nackter Bronzegott war. Er suchte Holz und sah sie bös an. Sie sagte ihm in der Dyea-Sprache guten Morgen, aber er lachte frech, und als sie weiterging, streckte er ihr die Zunge heraus. So war es früher nicht gewesen. Als sie dann einem großen, finster blickenden Sitka-Indianer begegnete, grüßte sie nicht.
Am Rande des Waldes sah sie das Lager vor sich liegen, aber nicht das alte Lager mit seinen zwanzig oder dreißig Hütten, die unordentlich über das Gelände verstreut waren. An seiner Stelle befand sich da ein mächtiges Dorf. Es reichte bis zum Flussufer hinab, wo die langen Kanus, je zehn oder zwölf in einer Gruppe, lagen. Von weither waren die Stämme hier zusammen gekommen. Sie sah lauter fremde Indianer mit ihren Weibern und Hunden, ihrem Hab und Gut. Frona erkannte Männer aus Juneau und Wrangel, Styx mit brennenden Augen von jenseits des Passes, kriegerische Chilcoots und Eingeborene der Königin-Charlotte-Insel. Die meisten musterten sie finster, fast zornig; ein paar freche Halunken riefen ihr unanständige Worte zu.
Sie kränkte sich nicht, aber sie stellte mit Trauer fest, dass die Zeiten unter dem patriarchalischen Zepter ihres Vaters vorbei waren. Wie ein scheußlicher Brand war die Zivilisation über dieses Volk hinweggegangen. Durch eine offene Zelttür sah sie ausgezehrte Gestalten im Kreise auf dem Fußboden hocken. Vor dem Zelt lag ein Haufen zerbrochener Flaschen … Zu ihres Vaters Zeit hatten die Indianer kein Feuerwasser und keine Flaschen gekannt. Auf einer Decke, die als Spieltisch diente, verteilte ein weißer Mann mit gemeinen Zügen Spielkarten, Gold- und Silbermünzen kullerten auf der Decke umher. Ein paar Schritte davon schnurrte ein Glücksrad. Indianer, Männer und Frauen, setzten ihre mühsam verdienten Groschen, um prunkvolle Gewinne zu ergattern, die ihnen nichts nützen konnten. Aus Wigwams und Hütten kamen die brüchigen Töne billiger Spieldosen.
Vor der offenen Tür ihres Wigwams hockte eine alte Squaw1 im Sonnenschein und schälte Weidenzweige. Als Frona vorbeiging, hob sie den Kopf und stieß einen schrillen Schrei aus. Dann murmelte sie mit zahnlosem Mund:
»Hi – hi! Tenas Hi-hi!«
Es durchrieselte Frona bei diesem Wort. »Tenas Hi-hi!« Das war ihr Name gewesen … es bedeutete »das kleine Lachen« … damals, als sie hier unter den Indianern gelebt hatte. Sie drehte sich um und kauerte neben der Alten nieder.
»Sag rasch, Mutter, sag mir rasch deinen Namen!«
»So schnell hast du uns vergessen, Tenas Hi-hi? Und doch sind deine Augen jung und scharf. Nipuhsa hat müde alte Augen, aber ihr Herz vergisst nicht so rasch.«
»Du bist meine alte Nipuhsa!« rief Frona und streichelte die schmutzigen Runzelhände.
»Freilich bin ich Nipuhsa, die dich in den Armen gewiegt hat! Deinen Namen habe ich dir auch gegeben, kleines Lachen, und wenn die alte Nipuhsa nicht Kräuter für dich gesammelt hätte, für Medizintee, dann wärst du gar nicht hier, denn einmal hat der Tod dich haben wollen. Dein Schatten ist auf mich gefallen, kleines Lachen, da hab’ ich gleich gewusst, dass du es bist. Du hast noch dasselbe Haar, wie brauner Tang, und denselben Mund und dieselben Augen. Nipuhsa war oft streng mit dir, wenn dein Mund Worte sprechen wollte, die Lüge waren. Aber du hast immer gewusst, dass Nipuhsa dich lieb hat. Ai, ai! Ganz anders sind die weißen Frauen, die jetzt ins Land kommen!«
»Hat eine weiße Frau keine Ehre mehr unter euch?« fragte Frona. »Eure Männer werfen böse Dinge in mein Ohr, und sogar die Knaben lachen ein hässliches Lachen, wenn sie mich sehen. So war es nicht, als ich hier ein Kind war.«
»Ai, ai! Es ist, wie du sagst, kleines Lachen. Aber du musst kein zorniges Wort auf ihre Häupter werfen. Die weißen Frauen sind schuld daran, die jetzt zu uns kommen. Sie sehen alle Männer mit frechen Augen an; ihre Herzen sind unrein, und sie haben keinen Mann, auf den sie weisen können und sagen: ›Dies ist mein Herr.‹ Deshalb sind deine Frauen unter uns ohne Ehre.«
Jetzt wurde ein Zeltzipfel gehoben, ein alter Mann trat hervor, grunzte etwas und kauerte sich zu den beiden.
»So ist Tenas Hi-hi wiedergekommen in diesen schlimmen Tagen«, sagte er mit dünner, zitternder Stimme.
»Warum sind die Tage schlimm, Muskim?« fragte Frona. »Sind eure Bäuche nicht voll vom Mehl und Fleisch und von dem Proviant des weißen Mannes? Verdienen eure jungen Männer nicht Reichtümer mit Lastentragen und Paddeln? Und bringen sie dir nicht, wie in alter Zeit, ihr Opfer der, Fleisch, Fische und Decken? Haben eure Weiber nicht Tücher in hellen, gleißenden Farben? Warum sind die Tage schlimm?«
Der alte Medizinmann war erregt. In seine Augen trat ein Schimmer, der an die Glut seiner Mannesjahre gemahnte.
»Unsere Frauen tragen Tücher in hellen, gleißenden Farben! Aber sie schauen nur nach den Augen der weißen Männer, und die jungen Männer ihres eigenen Blutes sehen sie nicht. Deshalb vermehren unsere Stämme sich nicht; die kleinen Kinder hindern unsere Schritte nicht mehr. Die Bäuche sind voll vom Mehl und Fleisch und vom Proviant des weißen Mannes, aber sie sind noch voller vom Fusel des weißen Mannes. Wohl verdienen unsere jungen Männer Reichtümer mit Lastentragen und Paddeln. Aber sie sitzen nachts beim Kartenspiel und lassen die Dollars wieder dahin rollen, in die Tasche des weißen Mannes, aus der sie gekommen sind. Sie sprechen böse Worte zueinander, heben oft die Fäuste im Zorn, und ihr Blut ist böse geworden. Nur wenige bringen dem alten Medizinmann Opfergaben, Fleisch, Fische und Decken. Die jungen Frauen gehen nicht mehr die alten Wege, die jungen Männer ehren nicht mehr die alten Totems und die alten Götter. Deshalb sind es schlimme Tage, Tenas Hi-hi, und mit Kummer muss der alte Muskim ins Grab gehen.«
»Ai! Ai! So ist es!« klagte Nipuhsa.
»Dein Volk ist toll und hat mein Volk toll gemacht«, fuhr Muskim fort. »Es kam wie böser Wind über das salzige Wasser, dein Volk, und es geht – ach – wer weiß, wohin!«
»Ai, wer weiß, wohin?« jammerte Nipuhsa und schaukelte leise hin und her.
»Immer gehen sie Frost und Kälte entgegen. Und immer zahlreicher kommen sie, Woge um Woge!«
»Ai! Ai! Frost und Kälte entgegen! Es ist ein weiter Weg, dunkel und kalt!« Nipuhsa schauerte und legte ihre Hand auf Fronas Arm. »Und du gehst auch dorthin, Frost und Kälte entgegen?«
Frona nickte nur.
»Das kleine Lachen geht auch! Ai! Ai! Ai!«
Plötzlich stand der alte Matt vor Frona.
»Seit einer halben Stunde wartet das Frühstück auf dich, und Andy, die alte Hexe, jammert und tobt … Guten Morgen, Nipuhsa, guten Morgen, Muskim«, sagte er zu den Indianern. »Eure Augen haben mein altes Gesicht wohl vergessen?«
Die beiden grunzten einen Gruß, dann saßen sie schweigend und unbeweglich da.
»Jetzt aber schnell, Frona! Mein Dampfer geht um Mittag, und ich möchte noch ein bisschen von dir haben!«
indianische Frau(en) <<<
2
Fronas Ausrüstung war auf den Rücken von einem Dutzend Indianern unter der Aufsicht Bishops schon vor mehreren Stunden abgegangen. Sie selbst trug einen kleinen Reiseranzen und ihren Fotoapparat, als Bergstock einen Weidenstab, den Nipuhsa ihr zurechtgeschnitzt hatte. Mit Del Bishop war sie sehr rasch handelseinig geworden. Als sie von dem Frühstück mit Matt McCarthy zurückgekehrt war, hatte der Ruderer sie im Laden erwartet.
»Sie wollen ins Land hinein. Das will ich auch. Sie brauchen einen Mann zur Begleitung. Wenn Sie noch keinen besseren gefunden haben, bin ich gerade der richtige. Ich war schon mal drin im Land, ich weiß Bescheid. Fürchten tu ich mich vor dem Teufel nicht, und wenn Ihnen einer was tun will, dann muss er erst mit Del Bishop fertig werden. Das ist nicht leicht. Wenn wir glücklich bei Jacob Welse angekommen sind, legen Sie ein gutes Wort für mich ein, und er gibt mir die Ausrüstung für ein Jahr. Einverstanden? Damit Schluss. Über den Proviant hinaus lass ich mir nichts bezahlen.«
Ehe Frona noch ihre Zustimmung gegeben hatte, war er schon bei der Arbeit und suchte die besten Packträger aus. Sie merkte sofort, dass er wirklich etwas von der Sache verstand. Frona marschierte mit ihrem Ranzel besser als die meisten Goldgräber, die sich schwer beladen hatten und alle hundert Schritte haltmachen mussten. Trotzdem fiel es ihr schwer, mit sechs jungen Schweden Schritt zu halten, in deren Spur sie ging. Das waren gewaltige Gesellen, blonde Riesen, und jeder trug seine hundert Pfund auf den Schultern. Außerdem schoben und zogen sie einen schweren Karren, der mit weiteren sechshundert Pfund beladen war. Ihre Gesichter waren lachende Sonnen, sie strahlten von Lebenslust. Das Marschieren, Schleppen und Schieben war ihnen Kinderspiel. Sie sangen laut und warfen den Vorbeikommenden in ihrer Sprache lustige Grüße zu. Wenn sie lachten, dröhnte jede Brust wie ein Cello.
Sie überholten alles; die Menschen traten beiseite, um sie vorüberzulassen, und sahen ihnen neidisch nach. Wenn es bergauf ging, setzten sie sich aus lustigem Trotz in Trab; bergab ließen sie die eisenbeschlagenen Räder ihres Wagens über das Gestein rasseln, dass Funken sprühten. Singend und lachend bahnten sie sich den Weg durch eine dunkle Waldstrecke, bis sie zu der Furt im Flusse kamen.
Am Ufer lag ein Ertrunkener und starrte unbeweglich in die Sonne. Ein Mann stand neben ihm und fragte aufgeregt:
»Wo ist sein Kamerad? Hat er keinen Kameraden gehabt?«
Zwei andere hatten ihre Lasten abgeworfen und nahmen Inventar vom Besitz des Toten auf. Der eine rief laut die verschiedenen Gegenstände aus, der andere notierte sie auf ein Stück schmutziges Packpapier. Über den Sand waren Briefe und aufgeweichte Schriftstücke zerstreut. Auf einem ausgebreiteten Taschentuch lag der Barbestand des Toten: ein paar Goldmünzen und viel Kupfer. Viele Männer, die in Kanus und Booten über den Fluss fuhren, nahmen gar keine Notiz von der Sache. Die Schweden aber wurden für einen Augenblick ernst.
»Wo ist sein Kamerad? Hat er keinen Kameraden gehabt?« fragte auch sie der aufgeregte Mann. Sie schüttelten die Köpfe. Sie verstanden kein Englisch. Dann wateten sie in das Wasser hinein.
Vom anderen Ufer herüber rief jemand eine Warnung. Sie blieben stehen und berieten sich. Dann gingen sie weiter. Die beiden Männer, die das Verzeichnis vom Eigentum des Toten aufnahmen, unterbrachen ihre Arbeit und sahen den Schweden nach. Sie standen jetzt bis zum Gürtel in der reißenden Strömung, mit Riesenkräften an den Karren geklammert, der den Wellen eine gewaltige Fläche bot. Sie kämpften furchtbar, dann schien das schlimmste Stück überstanden. Als das Wasser den beiden vordersten Riesen nur noch bis zu den Knien reichte, riss dem dritten plötzlich ein Tragriemen durch. Seine Last warf sich mit einem Ruck auf die linke Schulter; er wollte sich dagegen stemmen und verlor das Gleichgewicht. Im selben Augenblick stolperte der zweite, griff hilfesuchend um sich, und einer zog den anderen in die Flut. Die beiden folgenden Männer verloren den Halt, denn jetzt war die Karre umgestürzt und wurde über die Furt hinaus ins tiefe Wasser gerissen.
Ein paarmal tauchten die Männer wieder auf und warfen sich rückwärts in die Tragriemen. Aber sie wurden ihre Lasten nicht los, sie kämpften wie Helden, aber es stieg über menschliche Kräfte. Zoll um Zoll sanken sie wieder unter. Ihre Rucksäcke, die sich voll Wasser gesogen hatten, hingen wie steinerner Ballast an ihnen. Nur der eine Mann, dessen Tragriemen gerissen war, wurde seiner Last ledig, aber er versuchte nicht, das Ufer zu gewinnen, sondern blieb bei seinen Kameraden. Fünfzig Meter stromabwärts zerstäubte die Flut an einem zackigen Felsriff; hier kamen sie noch einmal zum Vorschein. Zuerst der halb zerschmetterte Karren, dann die Männer in einem grässlichen Gewirr von Köpfen, Armen und Beinen. Das Wasser schmetterte sie gegen die Klippen und spülte sie über das Riff.
Ein Dutzend Kanus war den unglücklichen Schweden nachgefahren; auch Frona war unter denen, die retten wollten. Sie sah einen der jungen Riesen mit blutüberströmten Händen nach dem Felsen greifen, sah sein weißes Gesicht und seinen verzweifelten Kampf. Der einzige seiner Kameraden, der noch schwimmen konnte, stürzte sich mit mächtigen Bewegungen auf ihn zu. Seine Hand hatte ihn fast schon erreicht – da schleuderte auch diesen Mann eine Sturzwelle ins Gebrodel.
Den einen schwimmenden Mann nahm ein Kanu auf; alle anderen erdrosselte die Flut. Eine Viertelstunde lang fuhren die Boote fruchtlos auf und ab, dann fanden sie die Toten im Schlamm stecken. Man nahm ein paar Pferde von einem Transportzug am Ufer, umschlang die Leichen mit einer Leine, und so wurde die schreckliche Last an Land gezogen. Frona sah die fünf jungen Riesen mit gebrochenen Gliedern schlaff und regungslos im Schlamm liegen. Sie waren immer noch vor die Karre gespannt; die armseligen triefenden Lasten hingen noch an ihren Rücken. Der sechste saß mit trockenen Augen betäubt in der Mitte.
Ein paar Schritte entfernt von ihnen floss der Strom des Lebens wie immer. Frona schloss sich ihm an und zog weiter.
*
Die dunklen, mit Rottannen bestandenen Berge stießen am Dyea-Pass zusammen. Die Füße der Menschen zerstampften die feuchte Erde, auf die nie ein Sonnenstrahl fiel, zu Schlamm und Morast. Viele Fußwege zogen durch die feuchte Wüste. Auf einem dieser Wege traf Frona einen Mann, der sich nachlässig in den Schmutz geworfen hatte. Er lag auf der Seite mit gespreizten Beinen, von einer schweren Last zu Boden gedrückt. Seine Wange ruhte in dem weichen Schlamm wie auf einem Kissen. Er sah müde und zufrieden aus. Als er Frona sah, wurde sein Gesicht noch heller; er grüßte sie mit den Augen.
»Höchste Zeit, dass Sie kamen«, begrüßte er sie. »Ich warte schon eine Stunde auf Sie.«
Frona beugte sich über ihn.
»Machen Sie mir nur den Riemen los, liebes Fräulein«, bat er, »ein verdammtes Ding! Die ganze Zeit habe ich ihn nicht zu fassen gekriegt.«
»Sind Sie verletzt?« fragte sie.
Er schlüpfte aus dem Riemen heraus und befühlte seinen verdrehten Arm.
»Nein, gesund wie ein Fisch! Auch der Arm, Gott sei Dank.«
Er streckte die schmutzige Hand nach einer niedrigen Tanne aus und wischte sie an den Zweigen ab.
»Also stellen Sie sich vor, ich stolpere über diese kleine Dreckwurzel da, und – bums! – liege ich wie eine Schildkröte mitten im Dreck und kann den Riemen nicht zu fassen kriegen. Eine ganze Stunde liege ich schon so da; die anderen ziehen da unten vorbei, und keiner sieht mich. Immerhin, ich hab’ mich ausgeruht.«
»Warum haben Sie niemand gerufen?«
»Dass einer zu mir heraufklettern soll? Die armen Teufel haben mit sich selbst genug zu tun! Wenn ich mir vorstelle, mich lässt einer da heraufkrabbeln, nur weil er ausgerutscht ist … Aus dem Dreck herausziehen würd’ ich ihn schon, aber dann ihm das Fell vertobaken und ihn zuletzt wieder hineinschmeißen. Außerdem konnte ich mir ja denken, dass schließlich auch mal hier jemand vorbeikommt.«
»Sie passen hierher! Sie sind der richtige Mann für dies Land.«
»Bin ich auch!« sagte er, wuchtete seinen Packen auf die Schulter und trabte los. »Auf jeden Fall hab’ ich mich ordentlich ausgeruht.«
Der Weg ging jetzt steil abwärts durch einen Morast zum Flussufer. Eine schlanke Kiefer lag als Brücke über dem tosenden Schaum. In der Mitte bog sich der Stamm so tief, dass er das Wasser berührte. Wellen schlugen dagegen und setzten ihn in zitternde Bewegung. Die Stiefel der Packträger hatten seine vom Wasser überspülte Oberfläche glattgeschliffen. Über zwanzig Meter maß diese schwankende, gefährliche Brücke. Frona betrat sie, fühlte, wie das Vibrieren unter ihrem Gewicht heftiger wurde, hörte das Rauschen des Wassers, sah das wilde Tosen – und schauderte zurück.
Sie hockte sich am Weg nieder und tat, als wäre sie mit ihrem Schuhwerk beschäftigt, denn Indianer traten aus dem Wald hervor. Vier kräftige Männer schritten voran, ihnen folgte eine Schar von schwer belasteten Frauen mit Kindern, und den Schluss machte ein Dutzend Hunde, denen die Zunge zum Halse heraushing. Auch die Hunde und sogar die kleinsten Kinder waren bepackt.
Im Vorbeigehen machte einer der Männer eine Bemerkung über Frona. Sie verstand die Worte nicht, aber das helle Kichern, das durch den ganzen Zug lief, trieb ihr die Schamröte in die Wangen.
Der Führer trat beiseite; dann beschritt einer nach dem anderen den gefährlichen Pfad. Keiner durfte antreten, ehe der letzte jenseits das Ufer erreicht hatte. In der Mitte, wo der Stamm sich bog, wurde er vom Gewicht des Menschen tief unter die Wasserfläche gedrückt. Es war schwer, den Halt zu wahren, wenn der kalte, reißende Strom die Knöchel überspülte. Aber selbst die Kleinen gingen ohne Zögern hinüber, nur die Hunde winselten und mussten getrieben werden. Als der Führer schon den Stamm betreten hatte, drehte er sich zu Frona um:
»Dort oben ist der Weg für Pferde«, sagte er und wies auf die Bergwand. »Du gehst besser den Weg für Pferde! Das hier ist nichts für dich.«
Frona schüttelte den Kopf und wartete, bis er am anderen Ufer stand. Dann setzte sie den Fuß auf den Baumstamm und schritt in den wirbelnden Schaum hinein, während die Augen des fremden Volkes auf ihr ruhten. Ihr Herz krümmte sich vor Angst, aber so viel war sie ihrem Stolz und ihrer Rasse schuldig.
*
Sie traf einen Mann, der weinend am Wegrand saß. Er hatte einen Schuh ausgezogen; sein Fuß war geschwollen und wundgelaufen. Rings um ihn lag sein schlecht verschnürtes Gepäck zerstreut.
»Kann ich Ihnen helfen?« fragte sie.
»Mir kann keiner mehr helfen. Der Rücken ist beinahe gebrochen, die Füße sind kaputt.« Er heulte laut: »Meine Kameraden haben mich im Stich gelassen und sind weitergezogen. Aber ich komm’ keinen Schritt mehr von der Stelle. Ach, meine Frau, meine Kinder! Ich hab’ sie in den Staaten gelassen … nie werde ich sie wiedersehen. Ich muss sterben, was soll ich sonst nur tun? Was soll ich nur tun?«
»Warum haben Ihre Kameraden Sie verlassen?«
»Weil ich nicht so stark bin wie sie. Weil ich nicht so schleppen kann wie sie. Ausgelacht haben sie mich und sind weitergegangen.«
»Aber Sie sind stark und jung, Sie wiegen mindestens Ihre hundertfünfzig Pfund und haben kein Fett am Leib.«
»Hundertfünfundfünfzig.«
»Hat Ihnen je was gefehlt?«
»Nein.«
»Und Ihre Kameraden? – Sind das alte Goldgräber?«
»So wenig wie ich. Wir haben im selben Geschäft gearbeitet. Wir kennen uns seit Jahren! Und da gehen sie hin und lassen mich einfach im Dreck liegen, damit ich krepiere.«
»Mein lieber Mann«, sagte Frona streng, »Sie könnten genau dasselbe leisten, aber Sie sind weichlich, Sie haben Mitleid mit sich selbst. Sie können nicht mit, weil Sie nicht wollen. Das ist kein Land für Sie. Hier braucht man andere Männer! Die Knochen haben nichts zu sagen, auf das Herz kommt’s an, und das haben Sie nicht. Verkaufen Sie Ihren Kram, und fahren Sie nach Hause zu Ihren Kindern. Hier können wir Sie nicht brauchen, hier gehen Sie ein, und was hat Ihre Familie dann? Machen Sie, dass Sie in drei Wochen wieder zu Hause sind, und schlagen Sie sich die Goldgräberei aus dem Kopf! Leben Sie wohl.«
Die Mittagssonne brannte auf das Felsgewirr nieder, das die »Steinerne Waage« heißt. Zu beiden Seiten erhoben sich vom Eis gefurchte Erdriffe nackt und in ihrer Nacktheit stark. An der Wand des sturmumbrausten Chilcoot-Felsens kroch eine Reihe von Männern empor, eine dünne, endlose Kette. Vom Rande des verkrüppelten Waldes unten zog sie sich wie ein schwarzer Strich über die blendende Eisfläche, bewegte sich im Schneckentempo die steile Böschung hinan, wurde immer schwächer und dünner, bis sie wie eine Kolonne von Ameisen jenseits des Passes verschwand.
Während Frona am Wege kauerte und ihr Frühstück verzehrte, hüllte sich der Chilcoot in wallende Nebel und wirbelnde Wolken. Dann brach ein Unwetter, von Hagel krachend, auf die mühselig vordrängenden Zwerge ein. Das Tageslicht erlosch, aber Frona wusste: immer weiter, immer weiter zog sich dort oben die lange Reihe von Ameisen hin, an den Berg geklammert, unermüdlich, immer tiefer in die Wolken hinein. Der ewige Wille zum Sieg dieser Menschen durchbebte sie. Jetzt trat auch sie in die Reihe ein, die aus dem Sturm hinter ihr auftauchte und im Sturm vor ihr verschwand.
Auf der Höhe des Passes wurde sie gepackt: ein Wirbelwind aus dampfendem Nebel drückte sie zu Boden. Auf Fäusten und Knien kroch sie die mächtige Vulkanrinne des Chilcoot-Tals vorwärts, stundenlang. Dann endlich erreichte sie die öden Ufer eines Kratersees. Die Flut war aufgewühlt und mit weißem Schaum bedeckt. Hundert kleine Haufen von Gepäck warteten am Ufer darauf, übergesetzt zu werden, aber es ging kein Boot über den See.
Ein elendes Skelett aus Holzrippen mit einem Segeltuchüberzug lag auf dem Felsen. Daneben hockte ein junger Bursche mit schwarzen Augen und hellem Gesicht. Ja, er sei der Fährmann, sagte er, aber für heute hätte er die Arbeit niedergelegt. Fünfundzwanzig Dollar nahm er sonst für die Überfahrt, aber heute fuhr er nicht mehr.
»Bei diesem Sauwetter, was denken Sie denn?«
»Aber mich setzen Sie doch noch über?«
»Dort drüben ist es noch schlimmer, als man von hier aus glaubt. Nicht einmal die großen Holzboote kommen durch; das letzte hat der Sturm an die Westküste geworfen. Eine ganze Ladung von Trägern ist an Bord, von hier aus hat man alles sehen können. Von da, wo sie jetzt liegen, kommen sie nicht weiter. Da müssen sie lagern, bis der Sturm vorbei ist. Das machen wir nicht, Fräulein.«
»Aber mein Lagergerät ist schon in Happy Camp, hier kann ich doch nicht bleiben«, sagte Frona mit verführerischem Lächeln. »Seien Sie ein Mann und bringen Sie mich hinüber.«
»Nein.«
»Ich gebe Ihnen fünfzig.«
»Nein, sage ich.«
»Ich bin ein Mädel, aber ich habe keine Angst!«
Der Bursche fuhr auf und kehrte sich gegen sie mit zornfunkelnden Augen. Die Worte, die ihm auf der Zunge lagen, behielt er für sich, aber Frona konnte sie von seinem Munde lesen. Gegen den Sturm gebeugt, standen sie nebeneinander wie Seeleute auf schwankendem Deck und sahen einander trotzig in die Augen. Ihm klebte das Haar in nassen Locken um die Stirn; das ihre peitschte in triefenden Strähnen um ihr Gesicht.
»Also los!«
Der Bursche schob mit einem wütenden Ruck sein Boot ins Wasser und warf die Riemen hinein.
»Steigen Sie ein! Aber nicht für fünfzig Dollar. Sie bezahlen denselben Preis wie alle anderen.«
Ein Windstoß packte die Nussschale. Die Breitseite voraus, flog sie sechs Meter weit über das Wasser. Frona nahm die Schöpfkelle zur Hand, schwere Spritzer klatschten den beiden in die Gesichter, stachen und brannten in ihre Haut.
»Hoffentlich treiben wir nicht an Land«, keuchte er und beugte sich über die ächzenden Riemen. »Wäre kein Vergnügen für Sie.«
Dabei sah er sie wütend an.
»Wir werden schon nicht«, sagte Frona und lächelte.
Sie traten auf schlüpfrige Felsen, als das Boot sein Ziel erreicht hatte. Zu beiden Seiten erhoben sich triefende Steinwände, der Regen brauste immer noch nieder wie aus unerschöpflichen Mulden.
Frona wollte helfen, das Boot zu bergen.
»Machen Sie lieber, dass Sie vorwärts kommen«, brummte der Fährmann. »Von hier bis Happy Camp sind es noch zwei Meilen, aber ein Weg für Ziegen oder Affen. Kein Wald mehr. Sie werden noch Ihr Wunder erleben. Also vorwärts! Auf Wiedersehen!«
Frona drückte ihm die Hand und sagte: »Sie sind ein tapferer Kerl!« Dann marschierte sie drauflos. Und der tapfere Kerl sah ihr bewundernd nach.
*
Happy Camp bestand aus einem Dutzend Zelten, die sich am äußersten Rande der Baumgrenze mit spitzen Pfählen wie verzweifelt in den Boden krallten. Frona ging, ausgepumpt von den wilden Strapazen dieses Tages, von Zelt zu Zelt. Der Wind stieß sie vor sich her; ihr nasser Rock hing wie Blei an den Hüften. Einmal hörte sie durch die Leinenwände einen Mann ungeheuerlich fluchen und dachte beseligt: das ist Bishop! Aber als sie hineinsah, hatte sie sich geirrt. Erst das letzte Zelt des Lagers schien ihr einladend. Sie lüftete die Zelttür: drinnen lag ein Mann auf den Knien und blies mit aller Kraft in die Glut eines rauchenden Öfchens.
Frona trat ein. Nasser Rauch schlug ihr in den Mund, sie musste husten. Da erst bemerkte der Mann, dass er einen Gast bekommen hatte.
»Binden Sie die Klappe wieder zu, und machen Sie sich’s bequem«, sagte er, ohne seine Beschäftigung zu unterbrechen.
Ein Haufen Zwergkiefernzweige lag, in passende Stücke zerhackt, aber nass, neben dem Ofen. Frona sah, dass er nicht genügend gefüllt war, hockte sich nieder und legte sachverständig die feuchten Scheiter auf. Der Mann erhob sich, hustete den Rauch aus und sah Frona mit geröteten Augen an.
»Trocknen Sie Ihr Zeug«, sagte er. »Ich sorge für Abendbrot.«
Er goss Wasser aus einem Eimer in die Kaffeekanne und stellte sie auf den Ofen. Dann ging er mit dem Eimer hinaus, um ihn neu zu füllen. Als er verschwunden war, griff Frona nach ihrem Ranzen, und als er wiederkam, stand sie in einer trockenen Bluse da und wrang die nasse aus. Während er in der Proviantkiste nach Tellern und Bestecks kramte, spannte sie eine Leine zwischen den Zeltstangen aus und hängte ihre Wäsche zum Trocknen auf.
Die Teller waren schmutzig. Während der Mann gebückt dastand und sie wusch, wechselte sie auch noch die Strümpfe und zog ein Paar feiner, weicher Mokassins an. Das Feuer brannte jetzt. Bisher hatten die beiden kaum ein Wort gesprochen. Der Mann benahm sich, als sei es das Natürlichste von der Welt, dass ein junges Mädchen in Nacht und Unwetter zu ihm hereingeschneit kam. Frona nahm ein- oder zweimal einen Anlauf, um etwas zu sagen, aber er schien ihre Anwesenheit vergessen zu haben, und so schwieg sie.
Nachdem er mit der Axt eine Dose Pökelfleisch geöffnet hatte, warf er ein Dutzend Speckscheiben in die Pfanne. Dann kochte er Kaffee und holte aus der Proviantkiste einen kalten schweren Pfannkuchen hervor. Diese Delikatesse prüfte er zweifelnd und sah dabei Frona an. Dann schmiss er das klitschige Ding zum Zelt hinaus und warf eine Handvoll Schiffszwieback auf ein Wachstuch, das auf dem Boden lag und als Esstisch dienen sollte. Die Zwiebäcke waren zerkrümelt, vom Regen aufgeweicht; sie bildeten einen schmutzig weißen Brei.
»Mehr habe ich nicht, das da muss als Brot gelten.«
»Einen Augenblick!« Ehe er protestieren konnte, hatte Frona die Schiffszwiebacke auf das siedende Fett und den Speck in der Pfanne geworfen. Sie goss ein paar Tassen Wasser dazu und verrührte alles über dem Feuer. Als es einige Minuten lang aus der Pfanne geschluchzt und geseufzt hatte, schnitt sie das Pökelfleisch in Scheiben und tat es zu dem übrigen, salzte und pfefferte. Ein angenehmer Duft stieg aus der Pfanne auf. Als er nun seinen Teller auf dem Knie balanzierte und das Gericht kostete, sagte er:
»Das schmeckt, Donnerwetter, wie das schmeckt! Wie nennen Sie das?«
»Goldgräbersalat«, sagte sie kurz, und dann aßen sie beide wie hungrige Wölfe.
Nach und nach hatten Fronas Augen sich an den Rauch und das Halbdunkel gewöhnt, schweigend studierte sie das Gesicht ihres Wirtes. Es lag Kraft und Ausdruck darin, aber seltsam, das war ein Gelehrtenkopf … Solche Augen kannte sie bei Männern, die viele Nächte lang über Büchern gesessen hatten. Die Augen waren braun, es waren schöne, sympathische Augen. Bei Tag würden sie wahrscheinlich grau, beinahe graublau aussehen. Frona wusste Bescheid, ihre beste und einzige Freundin auf der Universität hatte genau solche Augen gehabt.
Sein Haar war tiefblond und schimmerte im Kerzenlicht, sein lohfarbener Schnurrbart war ein wenig gelockt. Unter seinen Backenknochen lagen schwache Höhlen, die Frona verdächtig schienen. Aber seine muskulöse, schlanke Figur mit den breiten Schultern beruhigte sie wieder. Er schien den Fünfundzwanzig näher zu sein als den Dreißig.
»Decken hab’ ich nicht viel«, sagte er nach langem Schweigen. »Meine Indianer kommen erst morgen früh vom Lindermannsee zurück. Sie haben alles mitgenommen, was ich entbehren kann. Aber es wird gehen; ich habe noch ein paar dicke Mäntel, die tun es auch.«
Er kehrte ihr den Rücken und öffnete einen Wachstuchballen. Dann nahm er aus der Kleiderkiste zwei Mäntel und warf sie auf die ausgebreiteten Decken.
»Sie sind vom Tingeltangel?« fragte er, scheinbar ganz gleichgültig, als wüsste er die Antwort im voraus. Frona erinnerte sich an Nipuhsas Fluch über die weißen Weiber, die ins Land gekommen waren, und plötzlich erkannte sie, in welchem Lichte sie stand.
Er fuhr fort: »Gestern Abend waren zwei Tingeltangeldamen bei mir, vorgestern drei. Da hatte ich aber noch mehr Bettzeug. Merkwürdig, all diese Damen haben Pech, immer ist ihre Ausrüstung verloren. Dass die Sachen sich wiedergefunden hätten, habe ich nie gehört. Alle sind sie Stars, darunter tun sie’s nie. Sie sind doch gewiss auch ein Star?«
Zu ihrem Ärger wurde Frona rot: »Ich bin nicht vom Tingeltangel.«
Er breitete ein paar Mehlsäcke neben den Ofen aus und machte ein zweites Bett zurecht.
»Aber Artistin sind Sie doch?« beharrte er.
»Leider bin ich keine Artistin, absolut nicht.«
Zum ersten Mal schien er sie anzusehen, aber diesmal aufmerksam, vom Kopf bis zu den Füßen. Er ließ sich Zeit zu seiner Musterung.
»Ich bitte Sie um Entschuldigung«, sagte er. »Dann muss ich Ihnen aber sagen, dass Sie eine große Närrin sind. In dies Land kommen nur zwei Sorten Frauen: die mit ihren Männern oder Vätern, das sind die anständigen, und dann die anderen, die man aus Höflichkeit Tingeltangel-Sterne oder Artistinnen nennt. Eine dritte Sorte hat hier keinen Platz. Wer nicht zur einen oder anderen gehört, kommt unter die Räder. Deshalb sage ich Ihnen: Sie sind ein sehr dummes Mädel und können nichts Besseres tun als umkehren, solange es möglich ist. Ich will Ihnen einen Indianer bis Dyea mitgeben und Geld für die Rückreise nach den Staaten. Sie werden von einem Fremden kein Geld nehmen wollen, aber es ist ja nur geliehen. Sie schicken mir den Kies zurück, wenn es Ihnen passt.«
Frona hatte versucht, ihn zu unterbrechen, aber er schnitt ihre Worte mit einer Handbewegung ab.
»Ich danke Ihnen«, setzte sie an, aber er unterbrach:
»Sie sollen gehorchen und nicht danken.«
»Ich danke Ihnen trotzdem, aber das heißt: danke nein«, beharrte sie. »Zufällig irren Sie sich so ziemlich in allem. Ich wollte meine Träger hier in Happy Camp treffen, sie sind mit Zelt und Bett und allem, was der Mensch braucht, ein paar Stunden vor mir abmarschiert. Ein Boot ist heute Nachmittag vom Sturm an die Westküste des Kratersees verschlagen worden, darin müssen meine Leute gewesen sein. So kommt es, dass ich wie ein nackter Spatz bei Ihnen hereingeweht bin. Ihr Rat, ich soll umkehren, ist gewiss gut gemeint, aber mein Vater erwartet mich in Dawson. Wir haben uns drei Jahre lang nicht gesehen. So weit sind Sie hoffentlich beruhigt, mein Herr Gastwirt? Dann erlauben Sie freundlichst, dass ich ein bisschen zu Bett gehe.«
»Das ist doch unmöglich!« rief er, dem plötzlich bewusst wurde, dass er es mit einer jungen Dame zu tun hatte.
»Ja, was denn? Sind etwa in den anderen Zelten noch andere Frauen?«
»Nur in einem Zelt, da sind zwei oder drei … Aber grade das ist gar nichts für Sie.«
Er überlegte mit Anstrengung; das Segelleinen des Zeltes bauschte sich im Sturm, der draußen brüllte.
»Ein Mann, der heute im Freien übernachten muss, ist verloren«, sagte er. »Die anderen Zelte sind überfüllt. Was tut man da? …«
»Vielleicht kann ich heute Abend noch nach dem Tiefensee kommen?« fragte Frona, halb mitleidig, halb ironisch.
»Sie können doch unmöglich im Dunkeln über den Fluss setzen!«
»Sie haben offenbar Angst vor mir?«
»Nicht für mich.«
»Also schön, dann geh’ ich ins Bett.«
»Ich bleibe auf und sehe nach dem Feuer«, sagte er gedehnt.
Frona sprang auf und schrie. »Jetzt hab’ ich den Unsinn aber satt! Sind wir in einem Bürgerdorf mit drei Gasthöfen, oder sind wir auf dem Weg zum Nordpol? Ich geh’ zu Bett, und Sie gehn auch zu Bett, und damit basta.«
»Gute Nacht«, sagte sie nach zwei Minuten, als sie ihre Glieder mit Wohlbehagen in der Wärme gestreckt hatte. Eine Viertelstunde später fragte sie:
»Sind Sie noch wach?«
»Ja, was gibt es?«
»Haben Sie Späne?«
»Was für Späne?«
»Zum Feueranmachen morgen früh, natürlich. Sonst stehen Sie auf und machen welche.«
Er gehorchte, ohne zu widersprechen, aber sie hörte nichts mehr …
Als sie die Augen aufschlug, war die Luft voll vom frischen Duft gebratenen Specks. Die Sonne fiel durch den aufgeschlagenen Zeltvorhang herein. Draußen zogen truppweise Lastträger vorbei mit Pfeifen und Singen. Es tat gut, aus dem warmen Bett heraus dies eifrige Leben zu sehen, dann rekelte Frona sich auf die andere Seite und machte noch einmal die Augen zu. Als ihr Wirt Speck und Bratkartoffeln fertig hatte, sagte er freundlich:
»Guten Morgen, Fräulein. Ob Sie gut geschlafen haben, brauche ich nicht zu fragen. Das hab’ ich gehört.«
Nach dem Frühstück ließen sie sich vor dem Zelt die warme Sonne auf den Pelz scheinen. Bald darauf bog eine Schar wohlbekannter Männer um den Gletscher beim Kratersee und marschierte auf Happy Camp zu. Sie klatschte in die Hände.
»Dort kommt mein Gepäck! Mein Transportführer wird schön die Ohren hängen lassen, aber ich kann ihn trösten. Das ganze Abenteuer war wunderschön.«
Sie hängte sich das Ränzel und die Kamera über die Schultern und nahm Abschied.
»Auf Wiedersehen, lieber Gastwirt, und haben Sie tausend Dank für alles.«
»Da ist doch nichts zu danken. Ich täte dasselbe gern für jeden …«
»… Tingeltangelstern!«
Er sah sie vorwurfsvoll an und sagte: »Ich weiß Ihren Namen nicht und will ihn auch gar nicht wissen.«
»So ungerecht wollen wir nicht sein, denn Ihren Namen kenne ich, Herr Vance Corliss. Ich hab’ ihn nämlich auf den Gepäckzetteln gelesen. Ich heiße Frona Welse. Auf Wiedersehen!«
Sie machte sich im Laufschritt auf die Beine.
»Ihr Vater ist doch nicht etwa …?« schrie er ihr nach.
Sie wandte den Kopf: »Natürlich. Und wenn Sie nach Dawson kommen, besuchen Sie uns!«
Eine Viertelstunde später stieß sie auf ihre Karawane. Del Bishop ließ durchaus nicht die Ohren hängen.
»Guten Morgen«, grüßte er. »Ich sehe Ihnen an, dass Sie eine famose Nacht gehabt haben, wenn es auch nicht mein Verdienst ist.«
»Sie haben sich doch nicht um mich gesorgt, Bishop?«
»Gesorgt? Um eine Welse? Nee, da hatte ich anderes zu tun, vor allem, dem Kratersee meine Meinung ins Gesicht zu spucken. Ich kann das Wasser nicht leiden. Immer spielt es mir solche Streiche. Aber Sie müssen nicht denken, dass ich Angst davor habe! Ich kann’s nur nicht leiden.«
*
Jacob Welse war Großkaufmann in einem Lande, das sonst noch keinen Handel kannte, ein ausgereiftes Produkt des neunzehnten Jahrhunderts in einer Gesellschaft, die primitiv war wie die der alten Vandalen. Als Monopolist großen Stils herrschte er über die unabhängigsten Menschen, die je in einem Winkel der Welt zusammengekommen waren. Als ein Missionar der Wirtschaft predigte er das Evangelium der Zweckmäßigkeit und der Macht. In seinem Glauben an die natürlichen Rechte der Menschen beugte er, selbst Demokrat, alle unter seinen starken Willen. Die Herrschaft Jacob Welses – das war sein ungeschriebenes Evangelium. Mit seinen Händen, ganz allein, hatte er ein Reich aufgebaut; unter seinem Kommando verbreitete sich die Bevölkerung über ein Gebiet von hunderttausend Meilen Umfang und zog sich wieder zurück. Städte wuchsen und verschwanden auf sein Gebot. Dennoch war er ein Mann aus dem Volke geblieben. Hier in der Prärie hatte er seinen ersten Atemzug getan. Der blaue Himmel war das Dach über seiner Wiege gewesen, und diese Wiege hatte aus einem Bündel grünen Heus bestanden.





























