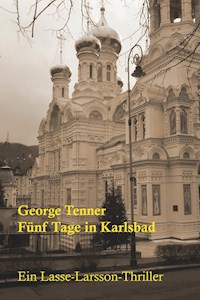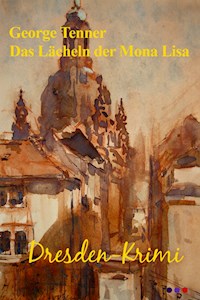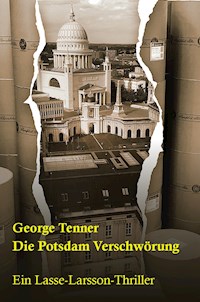Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Wir waren sechs junge Männer [ ] sechs Männer, die sogar voller Hoffnung in den Krieg zogen. Was ist nur aus uns geworden? Der Afghanistan-Krieg bildet in George Tenners Roman den Schauplatz für junge, deutsche Soldaten, die im Auftrag ihres Heimatlandes ausziehen, um Hilfe beim Aufbau eines verwüsteten Staates zu leisten und die unweigerlich durch die vorherrschende Brutalität im Kampf gegen die aufständischen Taliban ihren Idealismus verlieren. In episodenhaften Auszügen, versetzt mit den realen und als offiziell geltenden Ereignissen aus diesem Krieg, beschreibt der Autor das Bemühen seiner Protagonisten, sich fern der Heimat am Hindukusch in einer feindlichen Umgebung zurechtzufinden. Sie bestreiten dabei nicht nur einen Kampf um das eigene nackte Überleben, sondern befinden sich dabei auch auf der Suche nach einer moralischen Rechtfertigung des Einsatzes. Neben den Gefallenen kehren die Verbliebenen, seelisch und körperlich schwer verletzt, zurück in ein Heimatland, das sich zu Großteilen gegen seine Teilnahme am Einsatz der ISAF ausspricht, und finden dort keine Möglichkeit mehr, sich in ein normales Leben wiedereinzugliedern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Tenner
Jenseits von Deutschland
Roman
Inhalt
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Epilog
Literatur
Danksagung
Anhang
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in Der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Copyright © 2020 George Tenner Bernau
Tel.: 03338-9090917
Handy: 0157 844 951 28
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.george-tenner.de
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/George_Tenner
WWW. Facebook. COM/planetusedom
Titelbildnachweis Foto: pahe / photocase.com
Covergestaltung: VecroDesign, Unna
http://www.vercopremadebookcover.de
Herstellung: Epubli
George Tenner
Jenseits von Deutschland
Dieser Anti-Kriegsroman gewährt im Stil von Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues« einen Einblick in das Seelenleben von Soldaten, die an einem bewaffneten Auslandseinsatz teilnehmen. George Tenner gelingt es, für sich und den Leser die Frage eindeutig zu beantworten, ob es sich bei Deutschlands Bemühen im Zuge des ISAF-Einsatzes, der eine Sicherheits- und Aufbaumission sein sollte, um einen Krieg handelt oder nicht. Herausgekommen ist ein ergreifendes Plädoyer für den Pazifismus und eine mitunter erschütternde Anklage an die Politik.
Prolog
2006
Der Anruf erreichte Christoph Senz kurz vor 21:00 Uhr. Er hatte sich gerade hingelegt, würde noch ein wenig in eine Verfilmung eines Simmel-Romans sehen, bevor er das Licht löschte. Mitten in der Nacht, gegen 2:00 Uhr würde ihn der Wecker wieder hochscheuchen. Nicht, dass er seine Arbeit in der Bäckerei sonderlich liebte. Es war ein Knochenjob, der einem alles abverlangte. Ein schrilles Klingeln schreckte ihn hoch. Er brauchte einige Sekunden, bis er feststellte, dass es nicht der Wecker, sondern das Telefon war.
»Adam hier, Christoph …«
Adam Silarski. Christoph Senz hatte seit seiner plötzlichen Abreise aus der Beelitzer Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne nichts mehr von Silarski und den anderen Kumpels gehört. Seine Gedanken drehten sich in Sekunden. Er hatte versucht, die Jungs einschließlich aller unangenehmen Begebenheiten, die ihm in der verhassten Kaserne widerfahren waren, zu verdrängen. Zuerst hatte er im Schlaf von ihnen geträumt, war mehrfach schweißgebadet hochgefahren. Aber das flachte mit der Zeit ab, Gott sei Dank. Silarski war der knochige Typ, der über die Tatsache, dass Christoph unter Depressionen litt, lästerte, der ihm riet, bei der Vorstellung beim Militär-Psychiater zu behaupten, homophil zu sein, um ausgemustert zu werden.
»Adam … Adam Silarski?«, fragte Senz stockend.
»Da staunst du, was?«
»Wo bist du? In Dresden?«
Silarski lachte auf. »Mazar-e Sharif trifft es eher! Hörst du?«
Christoph Senz hörte im Hintergrund eine jaulende Stimme. »Was ist das für ein Geräusch?«
»Der Ruf des Muezzins vom Minarett der Blauen Moschee.«
»Und da rufst du mich an? Was ist passiert? Hast du beim Wecken den Mülleimer wieder laut polternd durch den Korridor geworfen?« Es sollte sarkastisch klingen. Senz verpasste aber den notwendigen ironischen Unterton. Stattdessen klang es eher kläglich in den Ohren des rund 4.500 Kilometer entfernten Adam Silarski.
»Ich wollte dir nur sagen, einer unserer gemeinsamen Kameraden aus Beelitz ist tot. Er wird, zusammen mit einem gefallenen Kameraden der Fallschirmspringer, in den nächsten Tagen nach Deutschland überführt werden. Vielleicht möchtest du sie bei der Ankunft begrüßen.«
Es war, als hätte Senz der Schlag getroffen. War es ihm gelungen, dieses Damoklesschwert stets drohender Gefahr auf seinen Leib, seine Psyche und sein Leben aus seinem Bewusstsein zu verdrängen, jetzt hatte es ihn wie mit einem Paukenschlag eingeholt.
»Du solltest damit keinen Scherz treiben, Adam. Woher hast du überhaupt meine Telefonnummer?«
»Jerôme hat sie mir gegeben. Er hat gesagt, ich solle dich verständigen, falls ihm etwas passiere.«
Jerôme Mohrs Gesicht tauchte in seinen Gedanken vor ihm auf, ein feiner Kerl, den sie anfänglich etwas abschätzend »den Jidd«nannten, obwohl ihm seine jüdische Herkunft nicht anzusehen war. Nicht mal beschnitten war er, wie bei gläubigen Juden üblich. Nur das Formular mit dem Namen seines Vaters hatte ihn verraten. Samuel Mohr. Wer in Gottes Namen hieß heute in Deutschland noch Samuel? Und dann hatte dieser Jidd erzählt, was seiner Familie im Namen des deutschen Volkes angetan wurde. Erst als er Kostproben der herrlichen Leckereien verteilte, die er aus der Schokoladenmanufaktur herumreichte, die sein Großvater Israel Mohr 1886 in Leipzig gegründet hatte, war es den Jungen egal, ob Jerôme jüdische Wurzeln hatte.
»Jerôme? Was ist ihm passiert?«
»Der Hubschrauber, der eine Gruppe von Kunduz nach Baghlan fliegen sollte, ist abgeschmiert. Alle sieben Insassen sind tot. Auch Jerôme.«
»Mein Gott!«, entfuhr es Senz. »Mein Gott!«
»Welcher? Der der Christen?«, fragte Adam Silarski spöttisch. »Jahwe, der Gott der Juden, oder vielleicht Allah? Welcher ist für diese Scheiße verantwortlich? Sag es mir!«
»Ich weiß es nicht, Adam. Es wird jener Gott sein, der sich immer hinter einer Wolke versteckt, wenn irgendjemand Hilfe benötigt.«
»Ist es doch angeblich ein Gott, der für alle gleichermaßen da sein sollte … Die Bundeswehr geht derweil weiter von einem technischen Problem im Getriebe des Hauptrotors des CH 53GS als Absturzursache aus. Zwischen Baghlan und Kunduz wurden die Wrackteile des Helikopters eingesammelt und für den Rücktransport vorbereitet.«
»Wo kommt denn das Flugzeug an, das Jerôme zurückbringt?«
»Das ist noch nicht sicher. Eine meiner Quellen sagt, es würde auf dem Flughafen Köln/Bonn landen. Dort gibt es ein Bundeswehrgelände mit Hallen, die man auch für die Trauerfeier von toten Soldaten nutzt. Ein anderer vermutete etwas ganz anderes. Derzeit landen offenbar immer mittwochs in Leipzig/Halle Flugzeuge der Bundeswehr, die aus Afghanistan kommen. Soldaten kehren zurück, Ausrüstung wird ab- und aufgeladen. Dafür nutzt die Bundeswehr auch eine eigens dafür angemietete Halle. Ich werde mich bemühen und dir schnellstens Bescheid sagen, wo die traurige Fracht hingeht.«
»Ja, tu das, Adam. Und … danke, dass du mich angerufen hast.«
»Es war Jerômes Wunsch.«
»Nochmals danke.«
Ich hätte Adam nach der Möglichkeit fragen sollen, ihn zu erreichen, dachte Christoph Senz, nachdem er aufgelegt hatte.
Jerôme tot? Der Psychiater in Leipzig war ein weiser Mann gewesen. Nur ein weiser Mann war in der Lage zu erkennen, in welchem Zustand ich mich befand. Wäre ich nicht ausgemustert worden, hätte die Möglichkeit bestanden, in diesem lausigen Hubschrauber mit den anderen Kameraden unterzugehen.
Er dachte an seine Großeltern. Sein Großvater, der als Chefarzt in einer Klinik gearbeitet hatte, die zu Zeiten der glorreichen DDR einem Bergbau in der Lausitz angeschlossen war, hatte ihn wie einen leiblichen Sohn aufgezogen, nachdem sich seine Mutter von seinem Erzeuger nach nur zweijähriger Gemeinsamkeit trennte.
Es heißt oft, wer eine solche Familie hat, braucht keine Feinde. Bei ihm war das anders. Die Familie war es, die ihn immer wieder auffing, wenn etwas schief lief. Und schief lief bei ihm dauernd etwas. Irgendwann hatte selbst sein ihm wirklich bisher alles verzeihender Großvater erkannt, dass da etwas zwischen Faulheit und mangelndem Selbstbewusstsein angesiedelt war, das seinen Enkel in immer ausweglosere Situationen brachte. Als Kardiologe konnte er sich anfangs keinen Reim darauf machen. Später vermutete er aber, dass Christoph unter psychischen Störungen litt. Und die Einschätzung von Christophs Onkel, der eine große Landpraxis für Allgemeinmedizin in Mecklenburg-Vorpommern betrieb, würde ihn später dazu bringen, sich in eine psychiatrische Behandlung zu begeben, die ihn weitgehend wieder auf die Reihe bringen würde. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg.
Dann kam ihm seine Mutter in den Sinn. Als Kind hatte er sie geradezu abgöttisch geliebt. Sie war ihm Mutter und Vater zugleich. Alles, was er besaß, hatte sie ihm geschenkt, vor allem aber Liebe. Wie, so fragte er sich, hätte sie reagiert, wenn Adam Silarski ihr seinen Tod hätte vermelden müssen?
*
Am Tag darauf meldete sich Silarski noch einmal. »Die gefallenen Kameraden, die nach Deutschland überführt werden sollen, stammen aus Thüringen, Brandenburg und, wie Jerôme, aus Sachsen. Neben der US-Armee nutzt auch die Bundeswehr den Flughafen Leipzig/Halle als Drehkreuz für regelmäßige Militärtransporte. Es gibt in Leipzig eine Aktionsgemeinschaft Flughafen – NATO-frei. Ruf dort an und frage, ob man weiß, dass diese Maschine in Leipzig abgefertigt wird.«
Silarski nannte ihm noch eine Telefonnummer, die Christoph Senz schnell notierte. Dann brach die Verbindung ab. Nur das Rauschen aus dem unendlichen Weltraum war noch vernehmbar.
Senz wählte die Leipziger Nummer.
»Aktionsgemeinschaft Flughafen – NATO-frei, guten Tag. Was können wir für Sie tun?«
Christoph Senz schilderte den Fall der Rückführung seiner toten Kameraden aus Afghanistan und den Verdacht, dass die Särge möglicherweise in Leipzig ausgeladen werden könnten.
»Wir beobachten diese Flüge bereits seit Jahren. Jeden Mittwoch gegen 19:00 Uhr landet ein Airbus der Luftwaffe mit Soldaten an Bord, die in Afghanistan im Einsatz waren. Meist folgt auch eine Transall-Maschine, die offenbar zum Transport von Ausrüstung genutzt wird. Da wir keine Auskunftszeiten von offizieller Seite bekommen, haben wir die Presse eingeschaltet. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte diese Flüge. Es hieß, sie dienten überwiegend dem Transport von Material und Soldaten sowie der Ausbildung von Flugzeug-Crews. Mehr war nicht zu erfahren. Aber uns reicht das schon, um dagegen zu protestieren.«
»Proteste?« Christoph Senz lachte heiser auf. »Bringt denn das überhaupt etwas?«
»Na ja, wir haben prominente Unterstützer. Der Luftfahrtrechtler Giemulla wertete in einem Bericht die auf Dauer ausgerichtete militärische Nutzung als eklatanten Verstoß gegen bestehendes Recht, wonach nur einzelne militärische Flüge möglich seien.«
»Aber die Flüge gehen weiter, oder?«
»Der FDP-Wirtschaftsminister sagte gegenüber dem Magazin, er habe keine Bedenken gegen die Praxis der Bundeswehr.«
»Wissen Sie etwas darüber, ob die Maschine mit den Kameraden in Leipzig ankommt?«, unterbrach Senz den Redefluss des Mannes.
»Nein. Das wissen wir nicht. Jedenfalls noch nicht. Ich könnte Sie aber verständigen, wenn wir eine solche Information bekommen.«
1. Kapitel
Jerôme
Die Gebäude der Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne lagen im kleinen Brandenburger Ort Beelitz und waren, wie alle Kasernen dieser Welt, mittels eines ausgeklügelten Zaunsystems von der Außenwelt abgeschottet. Zumal in dieser waldreichen Gegend, in der ein Mensch in den angrenzenden Gehölzen mühelos verschwinden konnte, wenn er es darauf anlegte, sich unbemerkt von der Truppe zu entfernen.
War bei den Rekruten der Name Beelitz unverbrüchlich mit dem Platz ihrer militärischen Ausbildung oder der Tätigkeit als fertiger Rekrut beim Logistikbataillon 172 verbunden, so gab es eine weitere Institution, die über die Grenzen hinaus bei vielen Menschen in unterschiedlichster Erinnerung verblieben ist: die legendären Heilstätten Beelitz; in segensreicher bei denen, die innerhalb der Lungen-Heilstätten eine Genesung so weit erfahren hatten, dass sie am Leben blieben – in schlimmer bei jenen, die in der ebenfalls dort beheimateten neurologischen Abteilung der Heilstätten zu DDR-Zeiten von willigen Werkzeugen des Regimes gegen ihren Willen dauerhaft sediert wurden, dass man sie mühelos über Monate ruhiggestellt und für psychisch krank erklären konnte.
Das dritte und jährlich immer wiederkehrende Andenken an den Ort war das an den bekannten Beelitzer Spargel, der freilich mit einer der besten Qualitäten auf dem deutschen Markt aufwarten konnte. Diese Erinnerung war allerdings die unbestritten angenehmste.
Jerôme Mohr war einen Tag früher angereist, hatte sich den kleinen Ort angesehen, die Heilstätten und schließlich den Eingang der Kaserne in der Husarenallee. Bei der Abfahrt von der Autobahn waren sie an einer Werbetafel für das Landhotel Gustav vorbeigekommen, das nur wenige Meter von der Hauptstraße entfernt im Paracelsusring lag.
»Hier wirst du die Nacht verbringen, Jerôme«, hatte der Vater versöhnlich gesagt. »Da kannst du dich ausschlafen und morgen in aller Ruhe in die Kaserne einrücken.«
Es hatte Ärger gegeben, zu Hause in Leipzig. Samuel Mohr baute jahrelang seinen Sohn als seinen Nachfolger für die eigene Schokoladenmanufaktur auf. Was der Großvater Jerômes, Israel Mohr, 1892 begründet hatte, sollte weiterleben. Von Generation zu Generation. Freilich mit einer Unterbrechung von fast zwanzig Jahren, die unfreiwillig durch die Naziherrschaft herbeigeführt worden war und den Großvater 1944 in Auschwitz das Leben gekostet hatte. Dass Jerôme zum Wehrdienst eingezogen wurde, war eine unumgängliche Situation. Aber sich freiwillig für vier Jahre zu verpflichten und sich darüber hinaus zum Einsatz in Afghanistan zu melden, war für den Vater eine nicht zu verzeihende Ungeheuerlichkeit, die zu schmählichen Komplikationen innerhalb der Familie geführt hatte. Böse Worte waren auf beiden Seiten gefallen. Worte, die sie sicher beide schon bereuten. Doch weder Vater noch der Sohn waren in diesen Minuten bereit, den Streit zu begraben.
Zu gern wäre Jerôme mit seinem eigenen Wagen, einem schwarzen Golf der neuesten Generation mit 140 PS, nach Beelitz gefahren. Aber er hatte nur einige Tage Urlaub bekommen, als man ihn vom Logistikbataillon 461 in Walldürn nach Beelitz in Marsch setzte. Ganze zwei Tage hatte man ihm gewährt und auch nur deshalb, weil das Logistikbataillon 172, dem man ihn auf eigenes Betreiben zugeteilt hatte, nach Mazar-e Sharif in Afghanistan verlegt werden würde. Deshalb hatte Jerôme Mohr auch entschieden, das Fahrzeug zu Hause in Leipzig in der Garage zu belassen. Zu leicht wäre der Wagen ein Opfer möglicher Randalierer geworden, wenn er mehrere Monate unbeaufsichtigt auf dem Parkplatz der Kaserne gestanden hätte.
Als der Vater wieder in Richtung Leipzig abgefahren war, lieh sich Jerôme im Hotel ein Fahrrad aus, um damit die Stadt zu erkunden. Vorbei ging es an den Heilstätten und der Husarenallee. Die in grau-grüner Tarnfarbe gespritzten Lastkraftwagen, die aus der Kaserne fuhren, zogen für einen Augenblick seine Aufmerksamkeit an. Sie sahen nicht anders aus als die Wagen der Nibelungen-Kaserne in Walldürn. Die jungen Gesichter in den Führerhäusern nahmen sich auch nicht abweichend aus. Rekruten hatten Einheitsgesichter, die zwischen aufgeblähtem Selbstbewusstsein und Angst angesiedelt waren. Nur wer von den Jungen wie Jerôme in Zivil unterwegs war, konnte den Kasernenmief ablegen und verströmte möglicherweise wissbegierige, gespannte Neugier.
Er verspürte Hunger. Zeit für eine Mahlzeit, dachte er, als er aus der Berliner Straße in die Mauerstraße einbog. Es ist eine Ringstraße, die um den Innenstadtkern führt, einbahnig mit einem Kirchlein aus Backstein und weißem Turm. An der Kreuzung Mauerstraße zur Treuenbrietzener lag die Gaststätte Zur Alten Brauerei in einem historischen Gebäude. Jerôme stellte das Fahrrad ab, schloss es an und betrat die Gaststube.
Schwere Eichenhölzer unbestimmbaren Alters stützten die Decken.
Obwohl es erst früher Nachmittag war, hatte die Wirtschaft einigen Zuspruch. Am Stammtisch saßen eine Handvoll ältere Herren, die sich ungeniert über die Veränderungen der tausendjährigen Stadt unterhielten, die der Ort erfuhr. Es waren Einheimische meist und Patienten der Heilstätten, die ihren Ausgang wahrnahmen, indem sie für eine Zeit in das Leben außerhalb des Krankenhauses eintauchten.
Deutlich war herauszuhören, dass nicht einhellig die Meinung vertreten wurde, dass die Einheit Deutschlands, die 1989 überraschend über sie hereingebrochen war, einen Segen für die hier verwurzelten Menschen darstellte. Während die Erneuerung und Restaurierung historischer, mittelalterlicher Gebäude gelobt wurde, schalt man die Heuschrecken, die auch hier bemüht waren, Fuß zu fassen und den Einheimischen das Wasser abzugraben.
An einem der hinteren Tische saßen sechs junge Männer, vier davon in Uniform, zwei in Zivil.
Jerôme nahm an einem der unbesetzten runden Tische Platz. Er bestellte ein Schweinefilet mit Spargel und ein in eigener Produktion des Hauses gebrautes Bier. Während des Essens war er bemüht, Wortfetzen von dem Tisch aufzufangen, an dem die Rekruten saßen. Offensichtlich schmeckte den jungen Männern das heimische Bier, und so war nach kurzer Zeit der Anstieg des Lärmpegels nicht zu überhören. Und auch hier gab es eine heftige Diskussion. Diesmal war es ein Pro und Contra über den Afghanistaneinsatz.
»Wir werden es diesen mittelalterlichen Banausen schon zeigen«, ließ sich einer der Männer großmäulig vernehmen. Ein anderer gab kleinlaut zu bedenken, dass schon mehr als dreißig deutsche Soldaten am Hindukusch gefallen waren.
»Wir stehen im Norden, nicht im Nordosten, und da ist es relativ friedlich.«
»An diesem Land haben sich schon Großmächte die Zähne ausgebissen, die Engländer, zuletzt die Russen und jetzt die Amerikaner. Und wisst ihr was? Die Europäer sind dumm genug, da mitzumarschieren! Wir marschieren in den Untergang!«
»Halt’s Maul, Eddie!«
»Recht hat er«, sagte einer der beiden Männer in Zivil.
»Ein Lied! Auf der schwäb’schen Eisenbahn, erste Strophe!«
Die Kellnerin kam an Jerômes Tisch. »Schmeckt es Ihnen?«
Sie ist eine hübsche Person, dachte Jerôme, jung, schlank und wirklich gut aussehend. Er dachte an seine eigene Freundin Rachel, die mit ihm Schluss gemacht hatte, weil sie nicht bereit war, sein freiwilliges Engagement innerhalb der Armee mitzutragen. Sie war eine Verwandte des Leipziger Kantors der liberalen Gemeinde, hielt sich schon aus diesem Grund für etwas Besseres. Es hatte ihn schon eine ganze Weile gestört, dass sie war, wie sie war, von sich und ihrer Ausstrahlung mehr als eingenommen. Die Tatsache, dass die Männer hinter ihr her waren wie die Motten um das Licht, überzeugte ihn, dass sie sich bald einer anderen, vielleicht lohnenderen Partie zuwenden würde. Und was Jerôme weiterhin bedrückte, war, dass sie nahezu gleichaltrig waren. Auf Dauer, dachte er, würde die Gesamtkonstellation zwischen Rachel und ihm ohnehin nicht gut gehen können.
»Jeder hat nur ein Leben«, hatte Rachel gesagt. »Noch bin ich jung genug, habe genügend Chancen und werde nicht versauern, während du den Kriegshelden spielst.«
Umsonst hatte er ihr nahegelegt, dass das heutige Deutschland auch auf seine Bürger jüdischen Glaubens zählen müsse. Gerade bei der Landesverteidigung. An diesem Tag ging ihre Beziehung zu Ende, und Jerôme entwickelte einen regelrechten Widerwillen gegen sie.
»Aus einer noch so schönen Schüssel kann man nichts essen, wenn nichts drinnen ist«, hatte seine Mutter mit Hinweis auf Rachel warnend gesagt.
Rachel war gegangen, und sein eigener Vater hätte fast mit ihm gebrochen. Nun, so weit war es zum Glück nicht gekommen. Viel hatte allerdings nicht gefehlt. Vielleicht war es die Hoffnung, dass Jerôme nach seiner Rückkehr aus dem Kriegsgebiet doch noch für die Übernahme des Traditionsunternehmens zur Verfügung stehen würde, spätestens aber nach den vier Jahren, die sich der Sohn zum Dienst an der Waffe verpflichtet hatte.
»Schmeckt es Ihnen?«, wiederholte die junge Frau ihre Frage.
Jerôme schluckte den letzten Bissen herunter. »Danke, ausgezeichnet. Sie können mir bitte einen Espresso bringen und dann die Rechnung. Sie haben doch Espresso?«
»Ja, natürlich. Einen Espresso und die Rechnung. Gerne doch.«
Er sah der Frau nach, als diese zum Tresen ging und telefonierte.
Am Tisch der Rekruten war für kurze Zeit Ruhe eingekehrt. Man diskutierte jetzt leise. Dann kam laut die Aufforderung: »Jetzt Strophe zwo – mit der schwäb’schen Eisenbahn … zwei, drei …«
»Mit der schwäb’schen Eisenbahn fahr’n wir nach Afghanistan, ich leg schon den Turban an, auf geht’s zu den Taliban!«, grölten die Männer. Nur jener Eddie und einer der Zivilisten schienen den Text vergessen zu haben, stellte Jerôme fest, der die Szene interessiert beobachtete.
Die Kellnerin brachte den Espresso. Sie bemerkte, wie gespannt Jerôme zu der Truppe am hinteren Tisch schaute.
»Es ist immer das Gleiche«, sagte sie. »Sie kommen friedlich herein, fangen an zu diskutieren und trinken mehr, als ihnen bekömmlich ist. Schließlich wird es so laut, dass sich die anderen Gäste beschweren und wir in der Kaserne anrufen müssen, bevor hier eine Schlägerei vom Zaun gebrochen wird. Wenn wir nicht aufpassen, geht die Einrichtung zu Bruch, und das können wir uns nicht leisten. Sind Sie auch einer von denen?«
Jerôme schaute auf die Rechnung. 17,50 Euro für das Schweinefilet mit Spargel schienen ihm nicht gerade billig. Es war eine gute Portion gewesen, der Spargel sauber geschält, sodass er butterweich im Mund zerging. So gesehen war das Essen diesen Preis wert. Nur den Espresso, von dem er nun einen kleinen Schluck nahm, hätte er sich heißer gewünscht. Alles Gute war nicht immer beisammen. »Ich rücke morgen ein.«
Der Leutnant kam in Begleitung eines Hauptfeldwebels und steuerte zielsicher auf den Tisch des Ungemachs zu. »Der Ausgang ist heute für euch beendet«, sagte er in einem ruhigen Ton. »Ihr zahlt jetzt und fahrt mit mir zur Kaserne zurück.«
Er ging zur Kellnerin. »Sie können jetzt abkassieren«, sagte er. »Ich nehme die Jungs mit.«
Die Frau nickte und ging zu dem Tisch. Der Leutnant blieb an der Tür stehen und schaute, dass alles ohne Komplikationen seinen Gang gehen würde. Auch der Hauptfeldwebel, der neben dem Tisch stehen geblieben war, gab seine drohende Haltung auf und lächelte den Kameraden zu. Der Grat zwischen einem friedlichen Abzug und einer explosionsartigen Schlägerei war nur sehr klein. Jeder von ihnen wusste das. Der Abmarsch der Rekruten vollzog sich relativ leise.
Niemand im Gastraum nahm Anstoß daran. Aber alle schauten dem Treiben gespannt zu. Insgeheim hoffte der eine oder andere der alten Herren vom Stammtisch darauf, dass noch etwas passieren möge. Als Voyeure waren sie darauf aus, auf Kosten anderer beste Spannungsunterhaltung geboten zu bekommen. Aber dieses Mal wurden sie enttäuscht, und so gingen die Unterhaltungen über den Sinn oder Unsinn der deutschen Wiedervereinigung weiter.
Jerôme war gerade dabei, das Kabel zu lösen, welches das Fahrrad vor einem Diebstahl sicherte, als die beiden Zivilisten, die an dem Tisch der Rekruten gesessen hatten, herauskamen. Lauthals diskutierten sie, dass der Leutnant sicher ein ganz patenter Kerl sei, denn er hatte die Rekruten in einem leisen, zivilen Ton zum Gehen aufgefordert.
»So schlecht scheint es beim Bund gar nicht zu sein, Wolfgang«, sagte Silarski. »Sieht eher nach einem ganz vernünftigen Haufen aus.«
»Franzke ist einer der ruhigen Typen. Ein Ausbilder, der die Rekruten anders bei den Eiern kriegt als nur mit Druck. Aber der Hauptfeldwebel, der dabei war, ist unberechenbar.«
»Darf ich euch mal etwas fragen?«, ließ sich Jerôme vernehmen.
»Ich wette zehn zu eins, dass du uns über die Kaserne ausfragen willst«, sagte der, den Adam Silarski mit Wolfgang angesprochen hatte.
»Na ja, ich muss morgen dort antreten.«
»Hast du gehört, Adam? Der muss morgen auch einrücken.«
»Zur Ausbildung?«, fragte Silarski.
»Das hab ich hinter mir.«
»Woher kommst du?«
»Aus Walldürn.«
»Nibelungen-Kaserne, kenne ich«, sagte Wolfgang. »Logistikbataillon 462.«
»461«, verbesserte Jerôme. »Und du?«
»Muss auch morgen einrücken. Nur Wolfgang hat es hinter sich. Der fährt nach Hause.«
»Bin heute entlassen worden«, sagte Wolfgang, »und weiß im Augenblick nicht, wohin ich soll.«
»Wieso?«
»Meine Mutter ist während meines Einsatzes gestorben. Krebs, da bin ich durchgedreht. Der Psychiater hat gesagt, ich sei für den Dienst an der Waffe nicht mehr zu gebrauchen.«
»Würde so mancher etwas dafür geben«, sagte Silarski.
»Halt’s Maul, Adam! Du weißt nicht, wie es ist, wenn man nachts hochschreckt und Kinder sieht, denen man den halben Kopf weggeschossen hat.«
»Hast du kein Zuhause? Was ist mit deinem Vater? Deiner Freundin? Du hast doch eine?«, fragte Jerôme.
»Meine Freundin ist mit meinem besten Freund abgehauen. Sie hat es mir telefonisch mitgeteilt, an dem Tag, als ich die Nachricht vom Tod meiner Mutter bekam. Das gab mir den letzten Rest.«
»Und dein Vater?«
»Den habe ich nie kennengelernt. War wohl ein One-Night-Stand gewesen. Aber sie war eine ordentliche Mutter, keine Schlampe!«
»Woher kommst du?«
»Aus Meiningen. Es existiert dort auch noch die Wohnung. Ich denke, ich werde sie auflösen und in eine andere Stadt ziehen. Vielleicht sogar nach dem Westen. Ich habe im Ruhrgebiet eine Tante.«
»Wird vermutlich das Vernünftigste sein, Wolfgang. Manch-mal ist man gezwungen, einen neuen Lebensabschnitt einzuläuten. Es ist mit Verlusten verbunden, öffnet aber meistens auch neue, interessante Perspektiven«, sagte Jerôme. »Ich weiß, wovon ich spreche.«
»Und schöne Frauen gibt es auch außerhalb Thüringens überaus reichlich«, ergänzte Silarski.
Sie gingen in Richtung Hotel Stadt Beelitz. Jerôme schob das Fahrrad neben sich her.
»Wir könnten noch einen Kaffee zusammen trinken«, sagte Silarski.
»Gute Idee«, sagte Jerôme. »Ich lade euch ein.« Er schloss das Rad wieder an, und die neue Allianz ging ins Restaurant des Hotels Stadt Beelitz. Es war kaum besucht. An einem Tisch am Fenster diskutierten zwei Männer über irgendein Geschäft mit Kunstdünger, den man für die ertragreiche Gewinnung von Futtergerste einsetzen wolle.
Silarski bestellte im Vorbeigehen bei dem Kellner drei Latte Macchiato.
»Was hat das mit den Kindern auf sich, die dir im Traum erscheinen?«
Jerôme merkte, dass er auf einen Nerv getroffen hatte.
»Keiner kann sich vorstellen, der noch niemals in solchen Gegenden gewesen ist, was es bedeutet, Tag für Tag an so einem verfluchten Platz, dem Arsch der Welt, zu vegetieren«, sagte Wolfgang leise. »Schuld daran sind alle Politiker, die unsere Jungs nicht in ein Land, sondern in eine Hölle geschickt haben.«
»Krieg ist immer grausam«, warf Silarski ein. »Ganz gleich, wo er stattfindet.«
»Aber du musst wissen, wofür du kämpfst. Ist es in Afghanistan ein gerechter oder ein ungerechter Krieg?«
»Was ist denn ein gerechter Krieg?«, fragte Jerôme.
»Ganz sicher nicht der in Afghanistan. Denn dort verteidigen wir unser Land nicht, verstehst du? Dort können wir nur die Schnauze voll bekommen. Und wofür? Dafür, dass die Islamisten uns irgendwann Bomben in unsere Städte tragen, so wie in Madrid oder in London. Vorerst begnügen sie sich aber damit, unsere Jungs vor Ort totzuschießen.« Wolfgang war so aufgeregt, dass sein Gesicht konvulsiv zuckte und rote Flecken bekam.
Der Kellner kam und brachte die Latte Macchiato.
»Und die Kinder?«, bohrte Jerôme, als der Kellner wieder hinter seinem Tresen verschwunden war.
»Der Norden Afghanistans ist der offizielle Einsatzort der Bundeswehr. Nach dem, was in Deutschland verbreitet wird, sind wir in einer Friedensmission in diesem Land. Aber das ist eine gezielte Desinformation des Volkes, eine Volksverdummung. Unser Land befindet sich längst im Krieg. Täglich schlagen die Taliban irgendwo zu. Meist dort, wo du sie gar nicht vermutest. Aber meist in unzugänglichen Bergregionen. Bei einem dieser Überfälle wurde einer unserer Kameraden gefangen genommen und verschleppt. Wir dachten, den sehen wir nie wieder. Sie werden ihn umbringen.«
Jerôme hörte aufmerksam zu. »Und?«, fragte er, als Wolfgang für einen Augenblick still blieb.
»Sie brachten ihn in eins ihrer Basislager und begannen, ihn systematisch über uns auszufragen. Truppenstärke, Namen der Befehlshaber, Bewaffnung und so weiter. Der Hauptfeldwebel war Zeitsoldat und als harter Hund bekannt. Das merkten auch die Taliban. Sie bedienten sich eines Verhörspezialisten, der offensichtlich aus einem arabischen Land stammte, der die deutsche Sprache aber genauso beherrschte wie sein Handwerk.«
»Woher wisst ihr das alles?«
*
Aus der Ferne war Gefechtslärm vernehmbar. Vereinzelt wurden große Haubitzen abgefeuert, deren Explosionsknall sich mehrfach in den nahen Bergen brach.
Die drei gepanzerten Fahrzeuge der Bundeswehr, zwei Dingos und ein Luchs, bahnten sich mühsam ihren Weg durch die unwirkliche Landschaft. Der Hügel, der vor ihnen lag, bestand aus von der Natur aufgetürmtem Steingeröll. Nur vereinzelt hatten einige dünne Bäumchen hier überlebt. Ihnen fehlte die eigentliche Lebensgrundlage – ein angemessener Boden, in dem sie wurzeln konnten. Plötzlich fing einer der Lastwagen an zu schlingern.
»Feindliches Feuer«, schrie Hauptfeldwebel Thomas Müntzer.
»Wir haben etwas abgekriegt! Raus hier und verteilen!«
Die Männer verteilten sich, nahmen Deckung hinter einzelnen Felsbrocken und begannen, das Feuer der Taliban zu erwidern. Gefühlt feuerten die Angreifer von allen Seiten. Aber so schnell sie gekommen waren, zogen sich die Islamisten wieder zurück. Die beiden intakten gepanzerten Fahrzeuge hatten in den Kampf eingegriffen. Sie waren es, die die Stellungen der Taliban mit Maschinengewehrfeuer bestrichen und den Anführer des Haufens zu einem schnellen Rückzug veranlasst hatten.
Nur der Hauptfeldwebel und ein weiterer Kamerad blieben zurück, als Müntzer die Soldaten seines Zuges wieder zu dem gepanzerten Dingo zurückschickte. Sie erklommen den Hügel, um zu sehen, wohin die Angreifer geflohen waren.
Wie aus dem Nichts waren die vier Taliban aufgetaucht. Sie hatten die beiden Männer geschickt eingekreist und hielten ihnen die Kalaschnikows an die Stirn. Zähneknirschend hatten sie sich ergeben müssen. Müntzer verfluchte sich, unter Vernachlässigung der Sicherheitsvorschriften seinem Aufklärungstrieb nachgegeben zu haben. Ausgerechnet er, der als umsichtiger Stratege innerhalb seines Zuges bekannt war.
Als der Schütze auf dem Spähpanzer Luchs etwas ahnte, war es bereits zu spät. Die Kameraden waren noch einmal ausgeschwärmt. Von den verschwundenen beiden Soldaten fehlte aber jede Spur.
*
Zwei Tage und zwei Nächte waren sie über die angrenzenden Berglandschaften unterwegs gewesen. Oft waren sie nachts marschiert, weil sie sich am Tage mehrfach verbergen mussten, um nicht von Flugzeugen des Feindes ausfindig gemacht zu werden. Endlich kamen sie zu einer Basis der Taliban, die irgendwo zwischen Kholm und Samangãn gelegen war.
Die Hütte war nicht eben groß, wie die meisten Häuser des Ortes unverputzt, aus den zusammengetragenen Steinen der Umgebung gebaut, die unbehauen waren und von Lehm zusammengehalten wurden. Dutzende Kämpfer lungerten in der Umgebung herum. Alte mit wallenden Bärten und dem Pakul, jener typisch afghanischen Mütze, die wie ein Pfannkuchen mit wulstigem Rand ebenso unwirklich für Europäer war wie die weiten Hosen. Auch die Jungen sahen so aus. Sie waren wahrscheinlich schon alt, bevor sie tatsächlich die Jugend abgelegt hatten.
Die Gefangenen wurden getrennt.
Müntzer kam in einen Raum, der nahezu dunkel war. Nur durch ein kleines Fenster, das relativ hoch angebracht war, fiel etwas Licht auf einen kleinen Tisch, der inmitten des kärglichen Zimmers stand. Zwei der Bärtigen hatten ihn hereingebracht. Einer bedeutete ihm, sich auf den Stuhl zu setzen. Der zweite Mann fesselte mit einem breiten, braunen Klebeband zuerst seine Hände an einem großen, rechteckigen Steinbrocken, der auf dem Tisch lag, dann seine Beine an den stählernen Beinen des Stuhles.
Die Tür ging auf, und ein Mann kam herein, den Müntzer auf Ende vierzig schätzte. Es war ein südländischer Typ, braun gebrannt mit einem schwarzen Mehrtagebart, der gepflegt war. Er trug eine Kakihose und ein leichtes, grünes Sakko über einem hellen Hemd. Mit dieser Aufmachung stach er gravierend von den Talibankämpfern ab. Müntzer wusste, dass das nichts Gutes bedeutete.
»Wie heißt du?«, fragte der Mann ganz ruhig in flüssigem Deutsch. »Ich bin Ahmad Romhi. Ich bin ein Verwandter von Sheik Yassin, der die Hamas gegründet hat. Sagt dir das etwas?«
»Yassin … Ist das nicht der Mann, der durch eine Bombe getötet wurde?«
»Der von den israelischen Imperialisten ermordet wurde, obwohl die Hamas legal an die Macht gekommen war.«
Müntzer sagte nichts. Für ihn war dieser Yassin ein Kriegstreiber, ein Falke, der die Feindschaft der semitischen Völker weiter anheizte.
»Ich komme aus Khān Yūnus. Weißt du, wo das ist?«
Müntzer schüttelte den Kopf.
»Im Gazastreifen. Sagt dir das etwas?«
»Es ist ein von Palästinensern bewohnter Streifen Israels.«
Romhi lachte abschätzig auf. »Du bist scheinbar auch so ein zionistischer Hund, der es begrüßt, dass man uns Arabern das Land unserer Väter gestohlen hat. Wie heißt du?«
»Müntzer. Thomas Müntzer.«
Wieder lachte Romhi auf. »Ich habe gelernt, dass Thomas Müntzer ein Theologe irgendwann im ausgehenden Mittelalter war, der wegen Aufsässigkeit hingerichtet wurde. Das ist kein besonders gutes Omen für dich! Was meinst du?«
»Sie sprechen meine Muttersprache aber verdammt gut«, warf Müntzer leise ein.
»Ich habe einen Teil meines Lebens in Deutschland verbracht, um zu studieren.«
»Sie haben in Deutschland studiert?«
»Auf Einladung des Auswärtigen Amtes studierten einige Ausländer an der Bundeswehrhochschule in München. Zwei Einladungen waren auch an die palästinensischen Sicherheitsbehörden ergangen. Ich war einer von ihnen.«
»Sie haben eine militärische Ausbildung auf Kosten unseres Landes genossen, um uns zu bekämpfen?«
»Erwartest du Skrupel?«
»Immerhin unterstützt die Europäische Gemeinschaft, also auch Deutschland, das palästinensische Volk mit vielen Millionen Euro in jedem Jahr. Auch die Leute im Gazastreifen, da kann man ein wenig Dankbarkeit erwarten«, sagte Müntzer.
»Dankbarkeit? Ein Land, das gegen unsere islamischen Brüder in Afghanistan vorgeht, erwartet Dankbarkeit für eine Selbstverständlichkeit im humanen Sinne? Wie soll die aussehen? Dass wir Araber aus den palästinensischen Gebieten mit euch ungläubigen Hunden gegen unsere Brüder vorgehen? Dass wir euch helfen, den amerikanischen Imperialismus weiter zu verbreiten? Dass wir den Sittenverfall, der aus den Staaten herübergekommen ist und dem auch ihr verfallen seid, unterstützen? Dass wir zusehen, wie unsere Frauen zu Huren gemacht werden? Für all das gibt es nicht genug Schuld, um das widerspruchslos mitzumachen. Nein, in diesem Sinn empfinde ich keine Dankbarkeit gegenüber Deutschland. Du kommst aus dem deutschen Lager in Kunduz?«
»Warum fragen Sie?«
»Ich will es von dir wissen.«
»Der Einsatz der Taliban war doch gut geplant. Also wussten Ihre Leute genau, wann wir wo waren und woher wir kamen.«
»Antworte nur auf meine Fragen.«
»Ja, ich komme aus Kunduz.«
»Wie hoch ist die derzeitige Einsatzstärke?«
»Das weiß ich nicht, da sich die Zahlen jede Woche ändern. Ein Trupp reist ab, ein anderer kommt dazu …«
»Wie heißt der Kommandant des Lagers?«
»Auch das weiß ich nicht«, log Müntzer.
»Sein Stellvertreter?«
Müntzer hob die Schultern.
»Ich könnte dich auspeitschen lassen. Ich könnte dir die Arme nach hinten drehen und dein Gesicht in Fäkalien tauchen. Aber ich weiß etwas Besseres.«
Romhi ging zu einem kleinen Tisch, der an der Stirnseite des Raumes stand. Mehrere Zangen langen dort bereit.
»Glaube mir, du wirst reden.« Er nahm eine ganz gewöhnliche Zange in die Hand, mit denen man schief eingeschlagene Nägel zu entfernen pflegte. »So ist das, Thommy, damit werde ich deine Zunge lösen. Klingt das gut genug, um dich zu überzeugen? Und wenn dich das nicht zum Reden bringt, gibt es einen Bohrer, mit dem wir dann deine Zähne bearbeiten werden.«
»Glauben Sie, dass wir so dem von allen gewünschten Frieden näher kommen?«, warf Müntzer ein.
»Nicht wirklich. Aber …«
»Aber?«
»Wir rücken auch nicht weiter von ihm ab«, sagte der Palästinenser ruhig. »Das jedenfalls haben bisher unsere Bemühungen, die zionistischen Hunde ins Meer zu jagen, gezeigt. Und weißt du was? Wir werden die Israelis so lang mit unseren handgefertigten Kassam-Raketen belegen, und sie werden ebenso lange versuchen, uns von ihren Jets aus in die Erde zu bomben, bis das Pulverfass platzt. Die armen kleinen Palästinenser mit den unbedeutenden Kassams gegen die hochgerüsteten Militärjets mit dem Magen David auf den Tragflächen. Das erzeugt Stimmung.«
»Sie haben recht, Romhi. Es ist eine Tragödie, die sich dort abspielt. Es ist ein Unglück für die Palästinenser und für die Israeli gleichermaßen. Israel weiß gar nicht, was man sich dort antut.«
Müntzer starrte auf eine Spinne, die sich unterhalb des kleinen Fensters angesiedelt hatte und sich nun an einer ins Netz gegangenen Fliege zu schaffen machte.
»Wieso?«
»Weil es ihrer gar nicht würdig ist. Sie verlieren einen Großteil ihres weltweiten Prestiges«, sagte Müntzer.
Ahmad Romhi lächelte maliziös. »Das ist absolut beabsichtigt. Meine Leute sind auf einem winzigen Stück Land eingesperrt wie in einer Sardinenbüchse. Anderthalb Millionen Menschen vegetieren auf diesem kleinen Gebiet von 37,5 mal 9,5 Kilometern. Die Leute werden in dieser Enge verrückt. Sie haben keine Perspektiven zur Armut. Sie sind dort geboren und mit vierzig Jahren oft noch nicht einmal aus dem Gazastreifen herausgekommen.«
»Das gibt es bei uns auch, dass in bäuerlichen Gegenden ältere Menschen ihren Lebensraum nicht verlassen haben«, warf Müntzer ein.
»Die Besiedlung des Westjordanlandes durch die Juden geht weiter. Wo, so frage ich dich, gibt es Platz für einen Palästinenserstaat? Wo? Der Platz für diesen Staat besteht dort, wo die Juden uns das Land genommen haben.«
»Ein Falke redet.«
»Die es auf beiden Seiten gibt!«
»Leider.«
»Mein Volk hat keine andere Wahl, als sich zu wehren. Und jede Kassam, die dazu beiträgt, dass Israel einen Vergeltungsangriff fliegt, wird lobend besungen. Warum? Weil es für jeden Kämpfer, für jedes Kind, das durch eine israelische Bombe getötet wird, wenigstens vier Angehörige gibt, die aufstehen und Israel schwören, dass sie für immer Feinde bleiben werden und nicht eher ruhen, als bis die Juden ins Meer getrieben worden sind.«
»Diese Einstellung ist perfide.«
»Nein, sie ist real. Sie ist so real wie der Widerstand gegen das Dritte Reich bei euch Deutschen und ebenso legal, denn die Hamas ist eine legal gewählte Partei.«
»Und dann werden eines Tages Leute wie der kleine Ahmadinedschad auf den atomaren Knopf drücken und die ganze Welt in die Luft jagen. Halten Sie das für erstrebenswert?«, fragte Müntzer.
»Wie hoch ist die derzeitige Mannschaftsstärke in Kunduz?«
Draußen wurden Stimmen laut. Männer schienen sich zu streiten.
Romhi beugte sich zu dem Mann herunter. Mit der Linken hielt er dessen Hand fest, mit der Zange in der rechten Hand fasste er nach dem Nagel des kleinen Fingers. Er hob die Zange an das Gesicht Müntzers und sagte: »Du nennst mir jetzt die Sollstärke auf eurer Basis in Kunduz.«
Als Müntzer nichts sagte, riss Romhi ihm mit einem gewaltigen Ruck den Nagel aus dem Finger. Müntzer bäumte sich auf. Sein Schrei hallte durch den Raum. Die im anschließenden Zimmer untergebrachten Wächter rissen ihre Witze darüber.
»Ihr bezahlt einen Zuträger, der euch mit Nachrichten über die Truppenbewegungen der Taliban versorgt. Wer ist es? Nenn mir seinen Namen.«
»Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen.«
Romhi hielt die Zange mit dem Fingernagel hoch. »Was für ein ekeliger Anblick doch so ein blutiger Nagel ist. Und das war erst der Anfang.«
»Das ist mittelalterliche Folter.«
»Was glaubst du, was eure Geheimdienste mit unseren Männern machen, die sie nach Abu Ghuraib oder in eines der anderen Verhörlager bringen? Glaube mir, der Dienst der Hamas ist durchaus in der Lage, Gleiches zu leisten.«
Müntzer dachte an die Bilder aus dem berüchtigten Gefängnis, die um die Welt gegangen waren. Eine Frau, die einen Mann an einer Leine wie einen Hund hinter sich her zog. Lynndie England mit angeleintem Gefangenen, was für ein entwürdigendes Bild. Und das Bild des mit Elektroschocks gefolterten Satar Jabar wurde zum Symbol des Skandals. An beiden Händen und am Penis waren stromführende Drähte befestigt. Ihm wurde angedroht, dass er durch Elektroschocks hingerichtet würde, falls er von der Kiste falle. Als das Foto an die Öffentlichkeit gelangte, leugneten die zuständigen US-Stellen, dass die Kabel Strom führend gewesen seien. Es gab Bilder, die unter anderem nackte Gefangene zeigen, die zuOralsex gezwungen worden sein sollen.
»Wenige kommen nach Abu Ghuraib. Um alle von deines-gleichen aufzunehmen, ist selbst dieses Lager zu klein«, sagte Müntzer trotz seiner Schmerzen provozierend. »Und die Verhöre gefangener Taliban-Offiziere und mutmaßlicher Al-Kaida-Kämpfer überließen die Amis dabei lange allzu gerne der Nordallianz. Die wussten eher, wie sie diese Terroristen zum Reden bringen.«
»Du spielst auf den Mörder Massoud an?«
»Auf den Löwen von Pandschir, Massoud.«
»Der mehr als 3.000 Taliban-Kämpfer bei Mazar-e Sharif ermordet hat.«