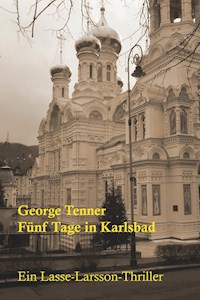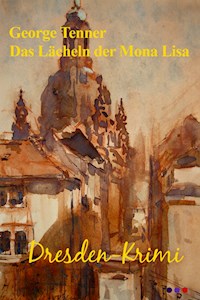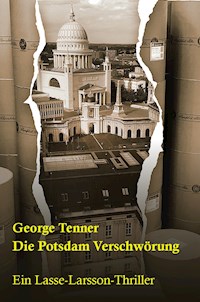Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Lasse Larsson fühlt sich bei weiten nicht mehr so glücklich an seinem Arbeitsplatz in Heringsdorf wie noch vor einigen Jahren. Zu viel ist in dieser Zeit passiert. Stets war es ihm und seinem zuverlässigen Team gelungen, die ihm gestellten Aufgaben mit Erfolg zu lösen. Übergangsmäßig war er dem BKA in Berlin unterstellt wurde, das an seiner kompletten Übernahme interessiert ist. Doch das zeigt Larsson, der inzwischen Familie hat, seine Grenzen auf. Der Spagat zwischen Beruf und Privatleben wird immer schwieriger zu meistern – und nun bekommt Larsson das auch körperlich zu spüren. In dieser Zeit ereignet sich ein ungewöhnlicher Fall. Eine junge Frau wird vermisst, deren wahre Identität sich nicht klären lässt. Gleichzeitig erschüttert ein grausamer Leichenfund die Ermittler. Haben beide Ereignisse etwas miteinander zu tun? Bei seinen Ermittlungen stößt Larsson auf ein Beziehungsdrama und lang gehütete Familiengeheimnisse, aber auch auf einen verdächtigen Eskort-Service und Spuren,
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Insel der Vergänglichkeit
PrologImpressum1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. KapitelEpilogDanksagungProlog
8. Mai 2008
Es war ein relativ schöner Tag gewesen, denn der Mai hatte seinem Namen als Wonnemonat in diesem Jahr alle Ehre gemacht. Zahlreiche Sonnenstunden prägten die Witterung vor allem im Norden Deutschlands. Stralsund schien besonders bevorzugt zu sein.
»Warum kommt sie nicht?«, hatte Suzanne gefragt. »Weißt du nicht, was für ein Tag heute ist?«
»Der Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus«, sagte Remy und rülpste.
»Scheiße, Remigius«, lallte Suzanne provozierend. Immer wenn sie ihn ärgern wollte, nannte sie ihn Remigius. »Ich denke an meine Schwester, deren Tod sich in drei Tagen jährt, und du kommst mit einer solchen Scheiße.«
»Scheiße? Ich werde dir gleich zeigen, was Scheiße ist! Ich sollte dir gleich aufs Maul hauen«, sagte Remy mit schwerer Zunge. »Du weißt genau, dass ich nicht mag, wenn du Remigius zu mir sagst.« Er nahm die Flasche mit dem Wodka und goss die Wassergläser zur Hälfte nach.
»Trink!«, befahl er.
»Es ist aber doch ein ehrenwerter Name.« Allein die Stimmlage Suzannes ließ nichts Gutes erwarten. »Remigius von Reims war ein aus gallorömischem Adel stammender Bischof vor fünfzehnhundert Jahren im Osten des heutigen Frankreichs. Der Name ist Historie pur, denn er wurde bekannt durch die Taufe des Merowingerkönigs Chlodwig I. und wird als einer der großen Heiligen des fränkischen Volkes verehrt. Damit solltest du handeln gehen.« Triumphierend grinste Suzanne den Mann an.
Die Faust Remys schlug hart auf den Tisch.
Sie fuhr zusammen.
»Halt endlich das Maul!«, schrie er.
»Übrig geblieben ist Remy der Starke«, provozierte Suzanne weiter. »Oder Schlappstarke.«
»Du glaubst doch wirklich, weil dein Vater so ein lausig kleiner Heimatschriftsteller ist, könntest du mich niedermachen …«
Plötzlich hatte Remy den fünfhundert Seiten starken Roman in der Hand, den Suzanne sich von ihrem Vater als Mitbringsel zu ihrem Treffen ausgebeten hatte. Mit der rechten Hand zog er eines der Küchenmesser aus dem Holzblock. Damit drohte er, das Buch zu filetieren.
»Leg das Buch wieder …« Sie merkte, wie ihre Galle rebellierte, und sie schluckte schnell, damit das Brennen in ihrer Speiseröhre und der Drang, erbrechen zu müssen, aufhörten. »Leg es hin, Remy, bitte lege es hin. Oder …«
»Oder?«
»Ich verlasse dich.«
Suzanne wusste seit einiger Zeit, dass ihre Liebe am Ende war. Vor langer Zeit hatte sie einmal flüchtig begonnen, als sie sich bei einer Tanzveranstaltung in Trassenheide kennengelernt hatten. Doch als die Ferien zu Ende waren, und er wieder in seine Heimat Stralsund zurückgegangen war, hatte sich die große Liebe schnell verflüchtigt. Sie hat ein wenig nachgetrauert, wie es jungen Mädchen zu eigen war. Aber dann hat auch sie sich mit einem neuen Freund über diese Zeit hinweg getröstet … Wie sie den anderen vergaß, und so geschah`s. Doch vor drei Jahren fanden sie sich durch Zufall auf Facebook wieder. Glühende Liebesbeteuerungen gingen zwischen beiden hin und her. Schließlich trennte sich Remy von seiner derzeitigen Freundin und versuchte Suzanne zu ermuntern, zu ihm nach Stralsund zu ziehen.
Suzanne wiederum kam diese Aufforderung sehr gelegen. Ihr damaliger Lebenspartner hatte sich als eine Fehlinvestition ihrer Liebe erwiesen. Alles, was den Mann bewegte, war, wie er andere Menschen aufs Kreuz legen konnte, um so nicht nur ein überdurchschnittliches Einkommen zu erzielen, sondern überhaupt eines. Peter Sockott hatte sogar sie dazu bewegt, ihren Vater unter Druck zu setzen, um an einen Teil seines Geldes in Form einer Autoabzahlung zu kommen.
»Niemand verlässt mich, niemand.«
»Meine Vorgängerin hat dich verlassen.«
»Niemand verlässt mich«, wiederholte er. »Eher steche ich dich ab.«
»Leg das Buch bitte hin«, bettelte Suzanne. »Und das Messer auch.«
»Hatte er die Widmung schon vorher ein… ein… eingeschrieben, oder?«, lallte er.
»Ist das so wichtig für dich?«
»Alles ist wichtig, was mich … be… betrifft.«
»Ich habe es dir schon einmal gesagt, Remy, Daddy hatte dich gar nicht auf dem Schirm. Er hat es für mich eingeschrieben. Und ich habe ihn schließlich darum gebeten, dich hinzuzufügen. Das müsste dir eigentlich genügen.«
»Weil du mich liebst!«, brüllte er.
»Ja, weil ich dich liebe. Trotz allem.« Obwohl sie stark angetrunken war, wusste sie, dass ihre Liebe längst am Ende, und er in diesem Stadium sehr gefährlich war. Das Verlangen, Hass und Testosteron sind eine tödliche Mischung.
Remy warf das Buch in die Ecke. Plötzlich stand er hinter ihr und zog sie an den Haaren hoch. Sie stützte sich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab, dabei fiel ihr Glas um, und der Wodka breitete sich aus, lief über ihre Hand. Remy versuchte, in sie einzudringen, was ihm aber nicht gelang.
»Warte einen Augenblick«, sagte Suzanne. Sie war sich darüber klar, dass er sie grün und blau schlagen würde, käme er nicht zum Schuss. Wie stets in diesen immer häufiger werdenden Situationen, hatte sie große Angst. Mit einer Hand versuchte sie, ihre Hose herunterzuziehen. Es gelang ihr nicht. Das Messer. Er hatte das Messer aus der Hand gelegt, um seine Hose abzustreifen. Es wäre eine Gelegenheit, dachte sie, mich ein für alle Mal von diesem Joch zu befreien.
In diesem Augenblick hatte der Alkohol Remy außer Gefecht gesetzt. Er torkelte ins Schlafzimmer. Krachend fiel die Tür hinter ihm ins Schloss.Eine Weile wartete Suzanne, dann schlich sie zur Schlafzimmertür, öffnete sie vorsichtig. Es roch nach Alkohol und Erbrochenem. Der beißende Geruch ließ sie vor Ekel ebenfalls mit dem Wunsch, den Fusel wieder loszuwerden, erbeben. Remy brachte immer die Flasche mit dem Etikett einer bekannten Wodka-Sorte. Doch sie wusste, dass es irgendein Fusel war, den Exilrussen heimlich und unkontrolliert in einer Garage brannten. Irgendwo in der Vorstadt. Remy hatte sie einmal mitgenommen, als er das verdammte Zeug abholte. Sechs Flaschen hatten sie geholt und innerhalb einer Woche ausgesoffen.
Remy lag bäuchlings auf dem Bett. Er hatte die Schuhe nicht ausgezogen. Sie würden das Bett beschmutzen. Aber was machte das schon? Sie hasste den Mann, den sie vor kurzer Zeit noch angebetet hatte. Suzanne schloss die Tür wieder und ging zurück zum Tisch. Sie trank den Rest aus Remys Glas aus. Dann drückte sie eine Kurzwahltaste ihres Smartphones.
»Hallo Dad«, sagte sie mit schwammiger Stimme. »Ich habe dir gestern geschrieben, dass alles scheiße ist.«
Sie lauschte eine kurze Zeit. Dann sagte sie: »Hier passiert gleich was. Entweder er ersticht mich, oder ich ersteche mich selbst.« Sie unterbrach abrupt die Leitung, als er ihr beruhigend zusprechen wollte, und machte schließlich das Smartphone ganz aus. Irgendwas muss passieren, dachte sie.
Larsson schaute zur Uhr – 18.22.
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in Der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright 2020 © by George Tenner
Besuchen Sie George Tenner im Internet:
www.george-tenner.de
oder auf Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/George_Tenner
Telefon: +49 (0) 15784495128
E-Mail: [email protected]
Coverfoto: © Henry Böhm
DAS FOTO henry boehm
Email: henry. [email protected]
Tel.:01795275483
WWW. Facebook. COM/planetusedom
Covergestaltung: VercoDesign, Unna
Herstellung: epubli
Neuauflage 2020
1. Kapitel
Ein Mittwoch im Juni 2008
Ben Thun war gerade dabei, die Mutterstute mit dem Fohlen auf die Weide zu stellen, als ihn das Geräusch eines anfahrenden Autos erreichte. Er drehte den Kopf, sah, dass ein Streifenwagen der Polizei auf das Grundstück fuhr und vor dem Haus anhielt. Mit einem Klick löste er den Führstrick vom Halfter der Stute. Sie drehte sich um, und Mutterstute samt Fohlen begannen einen Aufgalopp über die Weide.
Ben schloss das Gatter und ging auf die beiden Polizisten zu. »Was verschafft mir diese Ehre?«, fragte er.
»Herr Thun? … Gerd Thun?«
»Ich bin der Sohn. Mein Vater ist auf Reisen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen?«
»Es gibt eine Anfrage der Schweriner Polizei. Ihr Vater wird für eine Befragung gebraucht«, sagte einer der beiden Polizisten.
»Aus Schwerin? Worum gehtʼs da?«
Der Polizist zuckte mit den Achseln. »Das weiß ich auch nicht. Es geht um eine Zeugenaussage.«
»Ich gebe Ihnen die Handynummer meines Vaters. Da können sich Ihre Kollegen mit ihm in Verbindung setzen.« Er nannte die Nummer, die einer der Polizisten notierte. Die Polizisten verabschiedeten sich und fuhren davon.
Ben ging ins Haus zurück. Er nahm sein Handy und wählte die Nummer seines Vaters.
Als sich der Rufton des Smartphones in Gerd Thuns Wagen bemerkbar machte, schaute er kurz auf das Display und aktivierte die Freisprechanlage.
»Ben … Grüß dich. Gibtʼs Probleme mit den Pferden?«
Ben Thun lachte. »Mit den Pferden ist alles in Ordnung. Aber die Polizei war gerade hier.«
»Die Polizei?«
»Sie brauchen dich für eine Zeugenaussage.«
»In welcher Angelegenheit?«
»Das konnten sie mir nicht sagen. Die Anfrage kommt aus Schwerin. Ich habe ihnen deine Handynummer gegeben, sie werden sich bei dir melden. Aber was in Gottes Namen gibt es in Schwerin, was du in irgendeiner Art und Weise bezeugen könntest?«
»In Schwerin, nichts.«
»Dann verstehe ich die ganze Aufregung nicht.«
»Aber Ben, denk doch einmal nach. Wer wohnt denn in der Zuständigkeit des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern?«
Als sein Sohn nichts sagte, fasste der alte Thun nach. »Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern … Denk an deine Halbschwester.«
»Suzanne …«
Gerd Thun hatte mit einem Mal ein ungutes Gefühl. Suzanne war seine außereheliche Tochter. Offiziell hatte er von ihrer Existenz erst vor einigen Jahren erfahren, als er aus seiner Vita »Das Haus nahe des Strandes« in Bergen auf Rügen gelesen hatte. Damals hoffte er, dass die Makowskis, die inzwischen in den Norden der Insel gezogen waren, von dieser Lesung erfahren hatten und gekommen waren, um zu hören, ob er etwas von seinen Erfahrungen aus der Jugendzeit preisgab. Aber das war nicht der Fall gewesen. Eine weit entfernte Freundin Rosa Makowskis hatte Thun erkannt. Sie winkte ihm kurz zu. Daraufhin sprach er sie an. Er gab dieser Frau seine Karte, bat darum, Rosa in seinem Auftrage zu bitten, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Er wollte ein Zeichen der Versöhnung setzen. Alles hat seine Zeit. Zeit, so sagt man, heilt alle Wunden.
Rosa hatte sich tatsächlich mittels einiger E-Mails mit ihm in Verbindung gesetzt und ihrer Tochter Suzanne Kontakt ermöglicht.
Das erste Treffen zwischen Suzanne und ihm fand in einem italienischen Restaurant in Berlin Weißensee statt. Das war vor sieben Jahren gewesen. Doch bei genauer Überlegung waren die Kontakte über die ganzen Jahre immer sehr fragil geblieben.
Auf einer Lesereise, die ihn nach Tornesch im Norden von Hamburg, Leer in Ostfriesland, Oldenburg und wieder Hamburg führte, hatte er sich bei der Rückfahrt nach Prätenow am 27. April mit Suzanne in Stralsund getroffen. Wieder hatten sie bei einem Italiener, in der Osteria Dell‘Oca am Neuen Markt, gespeist. Suzanne hatte das Lokal ausgesucht. Während er Grigliata Di Pesce Misto, verschiedene gegrillte Fischfilets, bestellte, bestand Suzanne darauf, ihre Scampi nur mit Spaghetti zu ordern. Alle Versuche, sie zu einem höherwertigen Angebot zu bewegen, liefen ins Leere.
Doch kam eine sehr angeregte Unterhaltung zustande, bei der sie auch über die Beziehung sprachen, die Suzanne seit ihrem plötzlichen Wegzug aus Berlin zu einem Mann in Stralsund unterhielt.
Erst am Vorabend hatte Thun die Adresse ihrer Wohnung und den Namen des Mannes erfahren, mit dem sie jetzt lebte.
Das Haus lag ganz in der Nähe der Osteria Dell‘Oca in der Umgebung des Katharinenbergs, neben einem historischen Bürgerhaus, in dem in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ein beachtliches Fuhrgeschäft mit dem Namen Schulz residierte. Gerd Thun erinnerte sich nicht mehr an die Hausnummer. Suzanne hatte sie doch genannt. Er dachte daran, dass das Alter immer mehr und mehr seine Erinnerungen trübte. Speziell die Kurzzeiterinnerungen. Aber eben nicht nur die. Wie alle Menschen seines Alters fürchtete er den Namen Alzheimer, ganz besonders in Verbindung mit dem Wort Krankheit.
»Du meinst, es hat etwas mit Suzanne zu tun?«, unterbrach Ben seinen Gedankenfluss.
»Das ist die einzige Möglichkeit.« Gerd Thun dachte an eine der letzten WhatsApp-Nachrichten, die er von Suzanne bekommen hatte.
»Bitte, kannst Du mir helfen? Ich hasse mein Leben.«
»Und?«, drängte Ben.
»Ich habe ein ungutes Gefühl. Es hat einige Hinweise gegeben, die ich als Warnsignale registriert hatte.« Er sagte ihm, was sie ihm geschrieben hatte, und fuhr fort: »Das betraf auch dich. Sie hat immer wieder versucht, Kontakt zu dir zu bekommen.«
»Du weißt, warum ich da abgeblockt habe. Ich hatte weiß Gott genug eigene gesundheitliche Probleme. Da konnte ich es einfach nicht ertragen, länger vollgenölt zu werden als unbedingt nötig. Und sie konnte sich einfach nicht kurzfassen.«
»Warte kurz. Ich fahre gleich auf einen Parkplatz.« Gerd Thun fuhr auf den nächsten Autobahnparkplatz, stellte den Motor ab und rief Suzannes WhatsApp-Konto auf. Ein Blick auf das Icon gab ihm einen Stich ins Herz.
Ein »Danke« oder ein »Es ist schön, dass es Dich gibt« ist so viel mehr wert als etwas Materielles.Er öffnete die Nachrichten.
»Bitte, kannst Du mir helfen? Es geht nicht um Geld. Ich hasse mein Leben.«
Es geht nicht um Geld. Den Teil hatte er vergessen. Aber genau dieser Teil der Nachricht war es gewesen, der alle seine Warnlampen blinken ließen.
»Warum hasst Du Dein Leben??«, hatte er mit zwei roten Fragezeichen zurückgeschrieben. Ein Emoji zwinkerte zwischen den zwei S. Damit wollte Thun ein wenig Spannung aus der Nachricht nehmen. Der Versuch ging nach hinten los.
»Weil es so ist.«
»Und nun? Da gibt‘s nur eins, zu versuchen, dass man das Beste daraus macht.«Er setzte eine Hand mit erhobenem Daumen und ein Icon mit einem Herzen dahinter. Dann schickte er die Nachricht ab. Das war am 1. Mai um 15:34 Uhr.
Sechs Tage lang kam keine WhatsApp-Nachricht mehr von Suzanne bei ihm an. Doch am 7. Mai schrieb Thun: »So, ich bekomme meine Gesundheit langsam wieder in den Griff. Wie steht es bei dir?«
Dreizehn Minuten später kam die Antwort. »Was soll ich sagen? Alles gut.« An das Ende hatte sie ein Icon gesetzt, das schockiert schaut, bei dem kalter Schweiß von der Stirn tropft und der Mund entsetzt offensteht.
»Na, von gut sind wir sicher beide noch weit entfernt. Aber wir müssen es nehmen, wie es kommt. Ben liegt wieder auf der Nase.«
Drei Minuten später schrieb sie: »Rufe mich bitte an. Es kotzt mich immer an, zu schreiben.«
Diese Nachricht erreichte Thun erst am Morgen des 9. Mai, zusammen mit einer weiteren Nachricht, die sie am 8. Mai am späten Nachmittag abgeschickt hatte: »Tut mir leid. Ich konnte mich nicht richtig at kulturellen. Habe meinen zu dicht.«
Er konnte mit dieser verstümmelten Nachricht nichts anfangen. Vielleicht hatte sie ja wieder getrunken, wie manchmal, wenn sie nachts bei ihm das Telefon klingeln ließ. Doch das war, wie sich erst später feststellen ließ, die letzte Nachricht, die er von ihr erhalten hatte.
Also schrieb er um 6:32 Uhr »Guten Morgen, mein Kind. Hast du versucht, hier anzurufen? Ich stehe gerade erst auf. Endlich habe ich mal eine Nacht richtig geschlafen. Ich habe versucht, zurückzurufen. Es funktioniert nicht. Du musst dich hier mit mir auf WhatsApp verabreden, und dann versuchen wir es noch einmal. Euch beiden einen schönen Tag nach Stralsund.«
»Ben, bist du noch dran?«
»Natürlich.«
»Ich glaube, ich habe mich völlig falsch verhalten.«
»Verstehe wirklich nicht, Vater, was du damit sagen willst.«
Gerd Thun berichtete seinem Sohn, dass alle weiteren Versuche, Suzanne nach dem 8. Mai zu erreichen, ins Leere gelaufen waren.
»Du glaubst, dass sie nicht mehr lebt?«
»Vielleicht hat sie sich ja ...«
Einen Augenblick schwiegen beide Männer.
»Ich kann unmöglich bei den Eltern anrufen«, sagte Thun. »Manuel würde durch den Draht hindurchkommen und auf mich losgehen.«
»Auf dich vielleicht, Vater. Ich kann ja anrufen.«
»Das würdest du machen?«
»Es ist ja schließlich meine Halbschwester.«
Thun gab Ben die Nummer durch. Dann fuhr er weiter auf der Autobahn in Richtung Dresden.
Zwanzig Minuten später, er hatte gerade die Ausfahrt nach Groß Köris passiert, rief Ben ihn wieder an.
»Ich habe mit dem Mann telefoniert«, sagte er. »Nachdem ich ihm sagte, wer ich bin, hat er kurz mit mir geredet.«
»Er ist nicht auf dich losgegangen?«
»Er war sehr, sehr ruhig.«
Thun merkte, dass sich seine Herzfrequenz erhöhte. »Was hat er gesagt?«, drängte er.
»Ich habe ihm gesagt, dass die Polizei hier war, um mit dir zu sprechen. Als ich ihn fragte, ob etwas mit Suzanne sei, sagte er nur, dass sie tot sei.«
Ben hatte eine Pause gemacht, um zu hören, wie sein Vater reagierte. Aber als Thun nichts sagte, fuhr er fort: »Als ich ihn fragte, wie sie ums Leben gekommen sei, fragte er, ob er das beantworten müsse. Ich habe das verneint, habe mich bedankt für die Auskunft, und damit war das Gespräch für uns beide beendet ... Vater, bist du noch dran?«
»Ich frage mich immer wieder, warum ich ihren offensichtlichen Hilferuf so beiseitegeschoben habe.«
»Du solltest dir keine Vorwürfe machen, schließlich war sie immer sehr widersprüchlich in ihren Aussagen.«
Gerd Thun wusste, dass Ben recht hatte. Dennoch hatte er genau bei diesem letzten Hilferuf das Gefühl gehabt, dass etwas dran sein musste. Doch er hatte das Gefühl negiert.
An der Ausfahrt Großräschen verließ er die Autobahn und bog rechts ab. Nach wenigen Kilometern kam der Ort Saalhausen, wo er vor dem örtlichen Friedhof hielt. Er stieg aus, um das Grab eines Ehepaars zu besuchen, mit dem er mehr als sechs Jahre befreundet gewesen war. Die beiden hatten ein glückliches Leben hinter sich gebracht, zwei Kinder großgezogen, beide Kinder hatten studiert, aus beiden war etwas geworden. Das war ohne Zweifel eine Erfolgsstory.
Vor zwei Jahren war der Mann gestorben. Nur einige Monate später folgte ihm seine Frau. Nun waren ihre Urnen vereint unter dieser Steinplatte mit der einfachen, schnörkellosen Aufschrift.
Gerd Thun wurde an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Obwohl er sonst sorgsam vermied, ausschließlich Privatreisen zu unternehmen, hatte er diese Dresden-Fahrt als eine solche geplant, um auf den Spuren seiner Wurzeln zu wandeln. Ein kleiner Teil dieser Wurzeln lag auch hier auf diesem Friedhof. Wenn man alt wird, dachte er, kommen die Einschläge immer näher. Es ist wie bei einer Blume, die erst aufgeht, schön anzusehen ist und dann doch welk wird und schließlich umfällt. Auf diesem letzten Trail des Lebens schien er jetzt unterwegs zu sein.
Er war erst wenige Meter von dem Friedhof entfernt, als sein Smartphone klingelte.
»Hier ist Lilli …«
Lillian, schoss es ihm durch den Kopf, die Tochter von Suzanne. Er vermied das Wort Enkelin. Es würde ihn nur an sein Alter erinnern. »Meine Enkel umfahre ich weiträumig«, pflegte er zu sagen. Daran hielt er sich. Er fuhr rechts in den Parkhafen eines Einfamilienhauses und stellte den Motor ab.
»Hallo Lilli.«
»Du weißt, was passiert ist?«, fragte sie.
»Ben hat mit deinem Großvater telefoniert, nachdem die Polizei bei uns war, um mit mir zu sprechen. Deine Mutter ist verstorben.«
»Verstorben?« Es war ein Aufschrei.
»Sie hatte mir so eine kurze Mitteilung geschickt, dass sie ihr Leben nicht mehr mag«, sagte Thun. »Ich kann das gar nicht verstehen, denn ich habe mich erst am 27. April mit ihr in Stralsund getroffen. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Sie schien mit ihrem Leben zufrieden zu sein.«
»Das hat sie zu dir gesagt?«
»Ja. Und sie hat es durchaus glaubhaft rübergebracht. Zwischen uns gab es kein böses Wort. Es gab einen Schriftverkehr auf WhatsApp, der am 27. Dezember letzten Jahres begann. Ich habe alle Einträge geprüft. Es gab wirklich kein böses Wort zwischen uns.«
»Ich weiß.«
»Hat sie dir das gesagt?«
»Ja.«
»Ich kann dir einige Posts vorlesen, damit du mir glaubst.« Er begann, den Schriftverkehr in rückwärtiger Reihenfolge vorzulesen. Als sie versuchte, ihn zu unterbrechen, sagte er: »Ich kann nicht verstehen, weshalb sie sich umgebracht hat, ich mache mir Vorwürfe, nicht auf sie eingegangen zu sein. »
»Sie hat sich nicht umgebracht«, sagte Lillian, »Du bist nicht schuld an ihrem Tod.«
Gerd Thun hatte eine Veränderung in ihrer Stimme bemerkt. Sie war noch aufgeregter als zuvor.
»Wann ist dein Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen?«
»Am 8. Mai«, sagte er. »Ich habe nur sehr kurz mit ihr telefoniert.«
»Wie bei mir. Ich bekam einfach keinen Kontakt mehr zu ihr, auch nicht, wenn ich versuchte, mit ihr zu telefonieren«, sagte Lillian. »Ich war beunruhigt und wollte deshalb schon mit meinem Freund nach Stralsund fahren. Du weißt doch, ich bin schwanger. Und mein Freund meinte, ich solle das Kind nicht gefährden. Also gab ich eine Vermisstenanzeige auf. Man hat mich verständigt, dass die Polizei die angegebene Adresse überprüft hat.«
»Und?«, fragte Thun leise.
»Als die Beamten den Lebensgefährten meiner Mutter nach ihr fragten, zeigte er auf einen großen Koffer, der im Flur stand.«
Thun wagte nicht, etwas zu sagen.
»Bist du noch dran?«, fragte Lillian.
»Ja.«
»Die Beamten haben dann Mama in dem Koffer gefunden.«
Gerd Thun fragte sich, wie ein Mensch von geschätzten 1,65 Metern Körpergröße in einen Koffer passen würde.
»In einem … Koffer?«
»Es war ein Schrankkoffer, wie ihn Artisten verwenden.«
»Ich bin gerade auf der Fahrt nach Dresden, Lilli«, sagte er. »Kann ich dich anrufen, wenn ich wieder zu Hause bin?«
»Ja, natürlich.«
»Ich bin so angeschlagen von der Nachricht, dass ich das erst einmal verdauen muss«, sagte er, und: »Pass auf dich auf, Kleines. Deine Mutter hat mir vor vier Wochen schon erzählt, dass du schwanger bist. Nicht, dass dem Kind noch etwas passiert.«
Als die Verbindung getrennt war, rief Thun seinen Cousin an. Er sagte ihm, dass er leider die vereinbarte Zeit nicht einhalten könne und deshalb den Termin um zwei Stunden verschieben müsse. Dann begab er sich wieder auf die Autobahn, um die restlichen Kilometer nach Dresden zu bewältigen.
Da an der Dresdner Autobahn gebaut wurde, zog es sich endlos hin, bis er endlich die Ausfahrt nach Dresden Neustadt nehmen konnte. Nach einigen Kilometern musste er feststellen, dass die früher genutzte Einfahrt in die Stadt über den Neustädter Bahnhof so nicht mehr nutzbar für den Durchgangsverkehr war. Sicher ein Gewinn für die Stadt. Vorbei ging es am Elbschloss Albrechtsberg, hinauf in Richtung zum Weißen Hirsch. Nur einige Kilometer weiter würde er die Grundstraße nach Loschwitz hinunterfahren können. Als er rechtsseitig über die kleine Brücke fuhr, die mitten in der S-Kurve gelegen war, erinnerte er sich daran, dass er, führe er geradeaus weiter, direkt an dem auf dem Berg gelegenen Wohnhaus des Bassbaritons Theo Adam vorbeifahren würde. Er erinnerte sich an die Zeit, in der er oft in Dresden war, um seine Großmutter zu besuchen. Vor dem Haus auf dem Berg, direkt an der Straße, lag die Garage der Adams. An diese hatte Thun eine besondere Erinnerung an ein amouröses Abenteuer. Er beschloss, diese Straße hinunter nach Loschwitz zu fahren. Er fuhr die enge, kurvige abwärts, bis vor ihm die imposante Brücke Das blaue Wunder auftauchte, die er überquerte. Auf dem Schillerplatz reihte er sich nach links ein. Eigentlich wollte er in der Tolkewitzer Straße parken, fand aber keinen Platz für sein Auto. Doch hatte er ein Restaurant mit dem Namen Mikado entdeckt, von dem aus eine kleine Straße bis zur Elbe hinunterging. Er war schon an dem Restaurant vorbei, musste zurückfahren. Er hatte Glück, denn genau dort fand er, ziemlich am Fluss, den letzten freien Parkplatz, der seinen Wagen aufnahm.
Er ging zurück zum Mikado, las am Eingang die Speisekarte durch. Offensichtlich wurde hier japanisch gekocht. Aber er fand für sich einen Lachs, der seinem Wunsch der Zubereitung entsprach. Also ging er hinein, setzte sich ans Fenster und bestellte sich, was er vor dem Eingang schon ausgesucht hatte. Plötzlich machte sich sein Handy bemerkbar. Er meldete sich.
»Hier ist die Polizei in Stralsund. Herr Thun?«
»Ja. Was kann ich für Sie tun?«
»Wir haben eine Nachricht für Sie, dass Sie sich für eine Befragung zur Verfügung stellen müssen.«
Thun tat so, als wisse er nicht, worum es ging. »Was habe ich denn verbrochen?«
»Verbrochen? Ich denke mal, gar nichts. Man will ihnen etwas mitteilen«, sagte der Mann am anderen Ende.
»Na schön, dann kann man mit mir reden, wenn ich wieder zu Hause bin.«
»Ich gebe Ihnen jetzt eine Telefonnummer. Sie werden gebeten, dort anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren.«
Thun schrieb sich die Nummer auf. »Sie wollen mir nicht sagen, worum es sich handelt?«
»Soviel ich weiß, geht es um einen Todesfall.«
»Man hat meine Tochter ermordet«, kam es aus Thun heraus.
»Oh, dann wissen Sie mehr als wir hier. Seien Sie so freundlich und rufen bei der Kripo an, um einen Termin zu vereinbaren, oder sagen Sie mir, wie Sie zu erreichen sein werden.«
Thun versicherte, sich am kommenden Tag mit der Kriminalpolizei in Stralsund in Verbindung zu setzen, und beendete das Gespräch.
Kurz darauf kam der Lachs, den er sich bestellt hatte. Obwohl er nach dem ersten Bissen feststellen musste, dass der Fisch exzellent schmeckte, stocherte er unlustig in dem Essen herum. Zu viele Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Es war ein Glück, dass Lillian ihn angerufen und aufgeklärt hatte, was in Stralsund passiert war. Er fragte sich, ob der Polizist, der ihn so unbedarft angerufen hatte, tatsächlich so unwissend über den Todesfall war, wie er getan hatte.
Kurze Zeit später zahlte er, rief seinen Cousin Egon an, dem er sagte, dass er in etwa zehn Minuten bei ihm in der Heinrich-Schütz-Straße ankommen würde.
2. Kapitel
Montag, 12. Mai 2008
Oberkommissar Feltin schaute auf das Fernschreiben, das gerade eingegangen war. Es handelte sich um eine Vermisstenanzeige aus Berlin mit der Bitte um Amtshilfe. Er ging einige Türen weiter.
Beim KDD war schon zu früher Stunde reichlich Betrieb. Das Stimmengewirr war beträchtlich. Es galt, die Fälle vom Vortag aufzuarbeiten. Zwei Einbrüche, in denen die Ermittlungsarbeiten am Vortag angelaufen waren. Die sexuelle Belästigung einer älteren Frau von mehreren Männern. Mehrere Einsätze wegen Schlägereien, die aus Trunkenheit und Angebereien entstanden waren. Beziehungsstreits, die über das normale Maß verbaler Beschimpfungen hinausgingen. Ein Verkehrsunfall mit Todesfolge allerdings forderte den Einsatz des Teams, weil bei der Festnahme und anschließender Durchsuchung des Fahrzeuges Drogen gefunden wurden. Der Fahrer saß nun in Gewahrsam, und Einsatzleiter Harald Verstappen war bei der Formulierung der Unterlage für den Richter, der eine U-Haft anordnen müsste.
»Eine Vermisstenanzeige, Harald«, sagte Feltin.
Verstappen schaute kurz auf die Nachricht aus Berlin.
»Sie vermissen eine Frau, die in der Heilgeiststraße 5 wohnen soll. Das ist das Haus, in dem ehemals die Stralsunder Spar- und Darlehnskasse ihren Geschäften nachging, Ecke Mühlenstraße.«
»Schick einen Streifenwagen zum Abklären hin«, beschied Verstappen kurz.
Feltin ging zurück zu seinem Büro, in dem die Vermisstenfälle bearbeitet wurden. Meist hatten sie abgängige Jugendliche, die sie dann irgendwo wieder auffanden, oftmals zugekifft, oder die weggelaufen waren, weil sie mit den Zuständen, die sie umgeben hatten, nicht zurechtkamen.
»Verstappen meint, der Streifendienst soll einen Wagen hinschicken.«
»Ein typischer Montag«, stellte Mira Ludwig lakonisch und ohne sichtliche Regung fest.
Feltin nickte. Sein Gesicht drückte Widerwillen gegen die Entscheidung Verstappens aus. Zu gerne wäre er die Aufgabe losgeworden. Er ließ sich mit der Einsatzleitung der Landespolizei im Hause verbinden und trug seine Bitte vor. Man sagte ihm, dass man einen Funkwagen zur Heilgeiststraße schicken würde.
»Bin gespannt, wann die melden, was dort los ist. Wahrscheinlich gar nichts, wie so oft. Die Frau öffnet die Tür und fragt völlig erstaunt, ob die Polizei sich verklingelt habe.« Er schaute erwartungsvoll zu seiner Kollegin Mira Ludwig. Was denkt die sich nur, mir nicht sofort zu antworten, dachte er. Na ja, die Weiber ...
»Ich hole mir einen Kaffee«, sagte sie. »Solle ich einen für dich mitbringen?«
Feltin nickte. »Gerne, Mira.«
Mira verließ das Zimmer in Richtung Teeküche.
*
Polizeihauptmeister Leo Funke leerte den letzten Tropfen Kaffee aus seinen Becher, als ihr Wagen von der Leitstelle gerufen wurde.
»Strela vier … Strela vier, bitte kommen.«
Funke nickte seinem jungen Kollegen Jörn Schulz zu.
»Strela vier hört«, sagte Schulz.
»Wo seid ihr gerade, Leo?«
Leo Funke ließ sich von seinem Kollegen das Mikrofon geben und sagte: »In der Jacobiturmstraße, kurz vor der Neuapostolischen Kirche, Iris.«
»Ich hab einen Auftrag für euch. Ihr fahrt in die Heilgeiststraße 5 und überprüft bei dem Bewohner namens Remy Günner, ob bei ihm eine Frau namens Suzanne Makowski anwesend ist. Es liegt eine Vermisstenanzeige vor.«
»Wohnung Remy Günner«, wederholte Funke. »Heilgeiststraße 5. Wir sind unterwegs. Na da wollen wir mal«, sagte er und startete den Wagen.
Wegen der vielen Einbahnstraßen, die teilweise durch Fußgängerstraßen verbunden waren, mussten sie den kleinen Außenring über die Seestraße und die Mühlenstraße nehmen. Nach einigen Minuten kamen sie vor der Heilgeiststraße 5 an.
»Günner«, sagte Schulz und zeigt auf das Namensschild. Er drückte die Klingel. Als sich nichts rührte, wiederholte er den Druck etwas länger. Der Türsummer schnarrte, und die beiden Männer gingen hinein. Sie gingen die halbe Treppe hinauf bis zum Hochparterre. Rechts hatte sich die Tür einen kleinen Spalt geöffnet. In dem Spalt erschien das Gesicht eines Mannes mit schwarzgrau meliertem Haar.
»Sind Sie Günner, Remy Günner?«
Der Mann nickte.
»Ich kann nichts hören«, sagte Jürgen Schulz bestimmend.
»Ja.«
»Wohnt Frau Suzanne Makowski bei Ihnen?«, fragte Funke.
»Ja.«
»Wir möchten mit ihr sprechen.«
Als der Mann sich nicht bewegte, setzte Funke nach: »Wir möchten mit ihr sprechen, jetzt.«
Sie hörten, wie der Mann die Kette, die die Eingangstür sicherte, löste. Dann öffnete sich die Tür einen Spalt. Im Flur war es dunkel, Günner hatte kein Licht gemacht. Sie versuchten, in den Flur hineinzuschauen. Doch es blieb dunkel. Vor ihnen stand ein Mann im Unterhemd und einergrauen Jogginghose. Sein Haar hing ihm wirr im Gesicht.
»Rufen Sie Frau Makowski«, sagte Polizeimeister Jörn Schulz. »Und machen Sie endlich Licht.«
Günner regte sich nicht.
»Holen Sie Frau Makowski«, drängte Schulz wieder.
Funke hatte gleich das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Der Mann benahm sich einfach sonderbar.
Günner hatte Licht gemacht. Die beiden Polizisten betraten die Wohnung und schlossen die Eingangstür hinter sich.
»Ich kann Suzanne nicht holen.«
»Wieso denn nicht?«, fragte Funke ungeduldig. »Wo ist sie denn?«
Günner deutete auf einen großen Koffer, der vor dem Spiegel im Flur stand. »Im Koffer.«
»Hören Sie mit solchem Mist auf«, sagte Schulz unwirsch, »uns ist nicht zum Spaßen zumute.«
»Ich habe sie getötet, und jetzt ist sie im Koffer.«
Günner ging die wenigen Schritte zu dem Koffer und öffnete ihn.
Die Männer starrten auf die Leiche, die sicher nicht ganz einfach in diesen Koffer hineingepasst hatte. Aber irgendwie war sie hineingekommen, und sie fragten sich, wie. Gleichzeitig machte sich ein aufdringlicher Verwesungsgeruch breit.
Polizeimeister Schulz hatte seine Dienstwaffe in der Hand.
»Sie werden die Waffe nicht brauchen, ich habe Sie schon lange erwartet. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr mit ihr allein sein muss.«
Funke nahm sein Handy und rief die Zentrale an.
Es meldete sich jemand, es war nicht die Stimme von Iris.
»Strela vier, Polizeihauptmeister Funke. Geben Sie mir bitte Iris Sellin.«
Kurz darauf meldete sie sich. »Leo, habt ihr die Frau?«
»Ja, in einem Koffer. Verständige den KDD.«
»Was?«
»Frau Makowski ist seit mehreren Tagen tot. Der KDD soll übernehmen.«
Nachdem er das Gespräch beendet hatte, sagte Funke: »Sie setzen sich jetzt auf den Stuhl an den Tisch. Ich möchte, dass Sie die Hände auf den Tisch legen und sie dort liegen lassen.«
Jörn Schulz hatte seine SIG Sauer P225 wieder ins Halfter gesteckt. Er ließ Günner jedoch keine Sekunde aus den Augen.
Der Mann hatte seinen Kopf zwischen die Unterarme auf den Tisch gelegt, so wie er es nach dem Säubern des Tisches gemacht hatte. Manchmal aber hatte er den Kopf gehoben, mit offenen Augen stundenlang in dieser Position verharrt. Sein Blick war dabei auf eine gerahmte Fotografie an der Wand fokussiert gewesen, die ihn und Suzanne in glücklichen Tagen am Strand auf der Insel Rügen zeigte. Längst hatte er keine Tränen mehr gehabt, sondern nur noch Angst. Angst, dass man ihm nicht glauben würde und er für eine Sache büßen müsste, die er nicht begangen hatte. Vor allem aber vor der Schande, wenn man ihn abführte. Und ein ohnmächtiges Gefühl des Verlustes traf ihn an der empfindlichsten Stelle seiner Seele. Er hatte Suzanne geliebt, wenngleich auf seine Weise.
»Sie haben gesagt, Sie hätten schon lange auf uns gewartet. Warum in Gottes Namen haben Sie uns nicht gleich angerufen?«
»Ich habe es mehrfach versucht«, sagte Günner leise.
»Und? Es ist bei dem Versuch geblieben?«, fragte Jörn Schulz.
»Nein, ich hatte einmal sogar den Notruf dran. Habe dann aber aufgelegt, weil ich Angst hatte, man würde mich einsperren.«
Polizeihauptmeister Funke mischte sich ein. »Was haben Sie eigentlich erwartet?«
Günner hob den Kopf. »Ich habe sie nicht umgebracht. Wir hatten wohl einen Streit, dennoch habe ich sie nicht umgebracht. Ich habe sie sehr geliebt.«
»Eben haben Sie etwas anderes gesagt«, sagte Jörn Schulz.
»Ich bin durcheinander, habe einen starken Schock.«
»Einen Streit? Worum ging es in dem Streit?«, fragte Funke.
»Suzannes Schwester ist einige Jahre zuvor um diese Zeit verstorben. Immer dann wird sie schwermütig.«
»Schwermütig?«
»Ja, schwermütig aber auch streitsüchtig.«
Funke schaute aus dem Fenster. Offensichtlich hatten sich schon einige Zuschauer eingefunden, die von dem ungewöhnlich geparkten Polizeifahrzeug angezogen wurden. Als wüssten sie, dass es in den nächsten Minuten hier etwas zu sehen gäbe, warteten sie wie die Aasgeier, die über einem sterbenden Rind kreisten.
»Woran ist die Schwester von Frau Makowski verstorben?«, fragte Funke übergangslos.
Schulz sah ihn verständnislos an, sagte aber nichts.
»Sie hatte wohl Hepatitis.«
»Aha«, sagte Schulz nur.
Es klingelte an der Tür. Funke sah aus dem Fenster und den Einsatzwagen der Kriminaltechnik. Es klapperte an der Tür, jemand schien durch den Briefschlitz zu schauen. Funke ging in den Flur und öffnete.
»Hallo Kollegen. Willkommen in der Hölle.« Er zeigte auf den offenen Koffer mit der Leiche.
»Die Frau muss aber schon einige Tage tot sein«, stellte Hauptkommissar Marcel Schroder, der leitende Beamte der KT, fest.
Durch das Fenster zuckte für einen Augenblick das blaue Licht des Einsatzwagens der Kripo auf.
Kurze Zeit später tauchte hinter Schroder, der noch einmal hinausgegangen war, um seine Kollegen zu instruieren, Kriminalhauptkommissar Jürgen Reiniger, der Stellvertreter Harald Verstappens, auf. Funke machte Meldung.
»Hat er schon was gesagt, außer dass er es nicht gewesen ist?«, fragte Reiniger.
Funke musste lächeln. Es war der Standardsatz, den Reiniger in jeder ähnlichen Situation anbrachte. Funke schüttelte den Kopf.
»Dann bringt ihn ins Kommissariat in die Barther Straße.«
Die Gruppe der Voyeure vor der Tür war angewachsen. Da war eine ältere Frau, die genau aus diesem Haus kam, um ihren Müll wegzuschaffen. Sie hielt die zwei Tüten noch in der Hand. Doch die Männer der KT waren gerade dabei, alles abzusperren, auch den Platz für den Müll. Sie untersuchten bereits den Inhalt eines Containers und fanden blutbefleckte Kleidungsstücke.
Weitere Menschen waren stehen geblieben, hatten dem Treiben mit Interesse und Erschrecken zugesehen.
Zwei Halbstarke schauten fasziniert zu, redeten ungeniert miteinander. »Der sieht aus wie ein Dealer.«
»Meinst du wirklich? Eher wie ein Penner, der irgendetwas geklaut hat. Sonst würde man ihn nicht in Jogginghose und offenem Hemd rausschleppen.«
»So etwas sieht man sonst nur im Fernsehen«, sagte die Nachbarin mit dem Müll zu einer anderen Seniorin. »Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier bei uns passiert.«
»Man kann nie in die Menschen hineinsehen«, antwortete die Angesprochene.
»Die Frau kam aus Berlin«, sagte die Frau mit der noch vollen Mülltüte.
»Da hätte sie bleiben sollen, dann würde sie noch leben.«
»Immer wieder gab es lauten Streit in der Wohnung«, sinnierte die Müllfrau.
»Aber die waren doch ein Paar?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
»Gewiss. Doch die Frau hatte nichts zu lachen.«
»Die haben immer gesoffen. Manchmal stank das Gelumpe bis ins Treppenhaus«, stellte ein älterer Mann fest, der den beiden Frauen zugehört hatte.
»Glaubst du noch an die Macht des Guten, Liesbeth?«
»Wenn ich das sehe ... Eher wohl nicht. Ich werde mir eine zweite Kette an meiner Eingangstür anbringen lassen.«
»Es ist einfach nur grausam.«
Inzwischen hatten die beiden Polizisten Remy Günner in den Funkwagen verfrachtet, der sich nun langsam in Bewegung setzte.
»Das warʼs für uns«, sagte einer der beiden Halbstarken und stupste den anderen in die Seite. »Lass uns abhauen.«
Langsam zerstreuten sich die Menschen, die plötzlich über ungeahnte Zeitreserven verfügt hatten.
Während Polizeihauptmeister Funke mit seinem Kollegen Jörn Schulz Remy Günner zum Wagen brachten, begannen die weiß gekleideten Männer ihre Arbeit in der Wohnung. Stück für Stück suchten sie die Räume nach Blutspuren ab, die sie allerdings ausschließlich im Küchenbereich auf und unter dem Tisch feststellten. Dafür fanden sie andere Dinge, Medikamente gegen Epilepsie … Antikonvulsiva, diverse Antiepileptika, dazu Zolpidem, Zopiclon und andere Schlafmittel.
Jürgen Reiniger wiederum benachrichtigte kurz Verstappen über die aufgefundene Situation, und der wiederum verständigte den zuständigen Leiter der Kriminalpolizei in Neubrandenburg. Kurze Zeit später waren die Beamten der Sonderkommission für Straftaten gegen das Leben und die Gesundheit auf dem Wege nach Stralsund.
*
3. Kapitel
Donnerstag, 10. Juli 2008
Gerd Thun kannte die Polizeidirektion in Anklam. Das Gebäude in der Friedländerstraße 13 war nach der Wende neu entstanden. Um die Region hier nicht ganz von der Entwicklung abzuhängen, hatte man die Polizeidirektion nicht nach Greifswald oder Stralsund gegeben, sondern hier, nahe des Zugangs zur Insel Usedom, angesiedelt.
Es hatte der Stadt zwar nur wenig Auftrieb gebracht, kamen doch die meisten Beamten aus anderen Städten angefahren, aus Lubmin, aus Stralsund, aus Greifswald und Umgebung, doch erfüllte diese Institution auch eine Aufgabe, Sicherheit zu verbreiten, denn Anklam war eine Neonazi-Hochburg.
Thun ging zum Schalter der Anmeldung. Hinter dem Glas befanden sich zwei Beamte.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte einer der beiden.
»Ich bin mit einem Ihrer Kollegen hier verabredet, der von der Abteilung Straftaten gegen das Leben und die Gesundheit aus Neubrandenburg kommt.«
Der Beamte sah eine Liste durch, fand aber offensichtlich keine Notiz zu diesem Vorgang. Deshalb befragte er seinen Kollegen. Kurze Zeit darauf meldete er sich wieder.
»Der Kommissar aus Neubrandenburg ist noch nicht da, Sie müssen sich einen kleinen Augenblick gedulden.«
Thun schäumte innerlich. Verabredung war Verabredung. Er würde niemals jemanden warten lassen, denn er würde andere Menschen nicht um ihre kostbare Lebenszeit betrügen.
Wenige Minuten später ging die Tür auf. Eine sehr forsch eintretende, gut aussehende junge Frau in Begleitung eines Mannes kam auf ihn zu.
»Herr Thun?«
»Ja.«
»Mein Name ist Daniela Herzog.« Sie deutete auf den Mann, der sie begleitete. »Kriminaloberkommissar Weber. Wir sind in der Angelegenheit Makowski verabredet.« Sie wandte sich dem Anmeldeschalter zu, hielt ihren Dienstausweis vor die Scheibe. »Wir haben von Neubrandenburg aus ein Besprechungszimmer bei Ihnen geordert.«
»Der Raum ist im ersten Stock, mein Kollege wird Sie gleich hochführen.«
»Ich möchte Ihnen gleich sagen, Herr Thun, dass die Nachricht in der Bild-Zeitung falsch war. Die Frau in dem Koffer war nicht zerstückelt.« Daniela Herzog hatte ihre Stimme gesenkt.
»Sie können sich jede Sentimentalität sparen. Ich kann mit dem Tod durchaus umgehen, denn ich beschäftige mich seit langer Zeit damit. Manchmal schreibe ich auch darüber.«
Der Beamte, der sie hochführen würde, öffnete die Glastür, um sie hereinzubitten. Während die Kommissarin vorging, achtete ihr Begleiter darauf, dass sie Thun in die Mitte nahmen. Sie gingen hoch in den ersten Stock und fanden ein leeres Zimmer, das für sie reserviert war. Thun blieb allein mit den beiden Kommissaren aus Neubrandenburg. Nachdem sie sich gesetzt hatten, legte Daniela Herzog ein Diktiergerät vor sich hin.
»Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich das Gespräch gern aufzeichnen.«
Thun nickte zustimmend.
»Ich zeichne meine Frage auf, Sie antworten. Nur dass Sie sich nicht wundern, ich wiederhole dann Ihre Antwort so, dass unsere Schreibkräfte das auch verstehen können. Ist das für Sie in Ordnung?«
»Aber sicher doch.«
»Sie sind der leibliche Vater von Suzanne Makowski?«
»Ja.«
»Woher wissen Sie das so genau? Haben Sie einen Vaterschaftstest gemacht?«
»Nein, das brauchte ich gar nicht. Zum Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, sah sie aus, wie meine Tante mütterlicherseits in ihrer Jugend ausgesehen hat. Außerdem habe ich an jeder ihrer Bewegungen gesehen, dass es meine Tochter war.«
»Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrer Tochter beschreiben?«
»Als äußerst fragil.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Mal meldete sie sich, mal hörte ich dann wieder ein, zwei Jahre gar nichts von ihr.«
Satz für Satz wiederholte die Hauptkommissarin Thuns Antworten. Er konnte daran nichts aussetzen.
»Wann hatten Sie den ersten Kontakt zu Ihrer Tochter?«
»Kontakt? Ich sah sie einmal als Kind, aber ich hatte keinen Kontakt.«
»Wie das?«, fragte die Kommissarin.