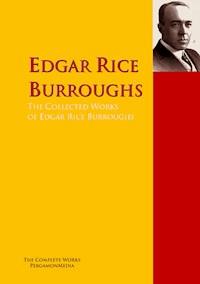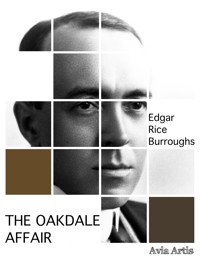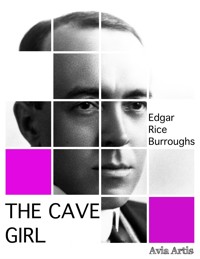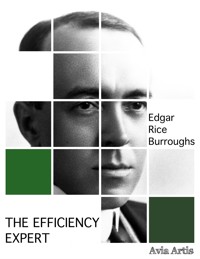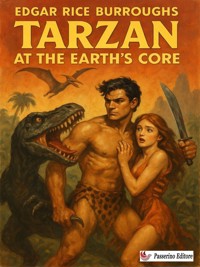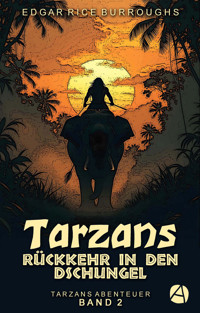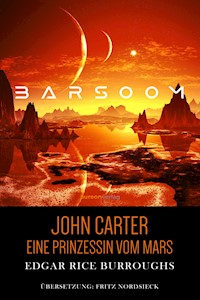
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit der Erzählung Eine Prinzessin des Mars erschuf Edgar Rice Burroughs, der Autor der Tarzan-Reihe, einen Meilenstein des Fantasy und Science-Fiction Genres. Die Geschichte erschien erstmals im Jahr 1912 und begründete den Anfang einer Serie von Romanen, der Barsoom-Reihe, die alle auf dem Planeten Mars spielen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Protagonist John Carter, ein konföderierter Kapitän des amerikanischen Bürgerkriegs, der auf mysteriöse Weise auf den Planeten Mars transportiert wird. Bei seiner Ankunft entdeckt John Carter, dass ihm die geringere Schwerkraft des Planeten eine übermenschliche Kraft und Beweglichkeit verliehen hat. Diese Fähigkeiten helfen ihm, die Treue der Tharks zu gewinnen, einem nomadischen, kriegerischen Stamm grüner sechsgliedriger Aliens. Der Mars von Edgar Rice Burroughs ist eine Wüstenwelt, ein sterbender Planet, auf dem sich verschiedene Stämme feindlich gegenüber stehen. Unter anderem gibt es die wilden "Grünen Marsmenschen", Tharks genannt und die fortschrittlicheren "Roten Marsmenschen", eine Gruppe von Humanoiden, die ein loses Netzwerk von Stadtstaaten bewohnen und die Kanäle und die Landwirtschaft des Planeten kontrollieren. John Carter wird bald in den politischen Konflikt zwischen den beiden "Roten Mars"-Stadtstaaten Zodanga und Helium verwickelt, als er die schöne Dejah Thoris, Prinzessin von Helium, rettet und sich in sie verliebt. Eine Prinzessin vom Mars ist sowohl ein romantisches Abenteuer als auch eine Science-Fiction-Fantasiegeschichte, die seit ihrer Erstveröffentlichung unzählige Science-Fiction-Autoren inspiriert hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit dem Rücken zum goldenen Thron kämpfte ich wieder einmal für Dejah Thoris.
EINE PRINZESSIN VOM MARS
von Edgar Rice Burroughs (1912)
Für meinen Sohn Jack
Übersetzung: Fritz Nordsieck (2021)
Aureon Verlag GmbH
VORWORT
An den Leser dieses Werks:
Da wir Ihnen Captain Carters merkwürdiges Manuskript in Buchform präsentieren, glaube ich, dass einige wenige Worte über diese bemerkenswerte Persönlichkeit von Interesse sind.
Meine erste Erinnerung an Captain Carter stammt von den wenigen Monaten, die er im Haus meines Vaters in Virginia verbrachte – kurz vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges. Ich war damals noch ein Kind, kaum fünf Jahre alt; trotzdem erinnere ich mich gut an den hochgewachsenen, dunkelhaarigen und athletischen Mann mit weichen Gesichtszügen, den ich Onkel Jack nannte.
Er schien immer zu lachen und beteiligte sich an den Spielen der Kinder mit derselben herzlichen Kameradschaft, die er auch bei dem Zeitvertreib mit den Männern und Frauen seines Alters zeigte. Aber er setzte sich auch schon mal eine Stunde lang zu meiner alten Großmutter und unterhielt sie mit Geschichten von überall auf der Welt aus seinem seltsamen wilden Leben. Wir liebten ihn alle und unsere Sklaven verehrten den Boden, auf dem er ging.
Er war ein gut aussehender Mann, fast einen Meter neunzig groß, mit breiten Schultern und schmaler Hüfte mit der Haltung eines trainierten Kämpfers. Seine Gesichtszüge waren regelmäßig und klar definiert, seine schwarzen Haare kurz geschnitten und er hatte stahlgraue Augen, die seinen starken und loyalen Charakter voller Feuer und Initiative widerspiegelten. Seine Manieren waren perfekt und sein höfliches Benehmen war das eines typischen Kavaliers des Südens der ersten Kategorie.
Seine Reitkunst, besonders bei der Jagd mit Hunden, war großartig - selbst in diesem Land der ausgezeichneten Reiter. Ich habe oft gehört, wie mein Vater ihn vor seiner wilden Unbändigkeit warnte, aber er lachte dann nur und sagte, dass das Pferd, von dem er abgeworfen werden würde, noch nicht geboren sei.
Als der Bürgerkrieg ausbrach, verließ er uns und ich sah ihn etwa fünfzehn oder sechzehn Jahre lang nicht wieder. Als er aber ohne jede Ankündigung zurückkehrte, war ich überrascht, denn ich bemerkte, dass er anscheinend nicht einen Moment gealtert war und sich auch anderweitig nicht verändert hatte. Wenn andere Leute anwesend waren, war er derselbe geniale und glückliche Kamerad, den wir seit langem kannten, aber wenn er dachte, er sei allein, habe ich ihn dabei beobachtet, wie er mit einem Gesicht wehmütigen Verlangens und hoffnungslosen Elends in den Himmel starrte. Nachts saß er da und sah zum Himmel hinauf – ich wusste nicht, was er anstarrte, bis ich Jahre später sein Manuskript gelesen hatte.
Er erzählte uns, er habe nach Bodenschätzen gesucht und für einige Zeit nach dem Bürgerkrieg eine Mine betrieben. Er hatte damit offenbar großen Erfolg gehabt; das bewies eine anscheinend unbegrenzte Menge Geld, die ihm zur Verfügung stand. Über nähere Einzelheiten seines Lebens während dieser Jahre schwieg er sich aus; er sprach tatsächlich überhaupt nicht davon.
Er blieb etwa ein Jahr bei uns und ging dann nach New York, wo er ein kleines Anwesen am Hudson erwarb. Dort besuchte ich ihn einmal im Jahr bei meinen Reisen zum New Yorker Markt, denn mein Vater und ich betrieben zu dieser Zeit eine Reihe von Gemischtwarenläden überall in Virginia. Captain Carter hatte ein kleines, aber sehr schönes Landhaus auf einem Steilhang mit Blick auf den Fluss und während eines meiner letzten Besuche im Winter 1885 beobachtete ich, dass er sehr intensiv mit dem Schreiben beschäftigt war – wie ich nun vermute, mit diesem Manuskript.
Er sagte mir bei dieser Gelegenheit, wenn ihm irgendetwas zustoßen sollte, wünsche er sich, dass ich mich um seinen Besitz kümmerte. Er gab mir einen Schlüssel zu einem Fach in dem Tresor, der in seinem Studierzimmer stand und sagte mir, ich würde darin seinen letzten Willen und einige persönliche Anweisungen finden. Ich musste ihm feierlich versprechen, diese Anweisungen absolut getreu zu befolgen.
Nachdem er sich zur Nachtruhe zurückgezogen hatte, sah ich ihn von meinem Fenster aus, wie er im Mondlicht am Rand des Steilhanges stand – mit gen Himmel ausgestreckten Armen, als würde er etwas erbitten. Zu dieser Zeit dachte ich, er würde beten, obwohl ich nie für einen besonders religiösen Menschen im strikten Sinne des Wortes gehalten habe.
Einige Monate nachdem ich von diesem letzten Besuch wieder nach Hause zurückgekehrt war – ich glaube, es war am ersten März 1886 – erhielt ich ein Telegramm von ihm, in dem er mich bat, ihn doch sofort auszusuchen. Ich war unter der jüngeren Generation immer Carters Liebling gewesen und so beeilte ich mich, seinem Wunsch zu entsprechen.
Ich kam am 4. März 1886 an dem kleinen Bahnhof an, der etwa eine Meile von seinem Grundstück entfernt war und als ich den Kutscher bat, mich zu Captain Carters Anwesen zu fahren, sagte dieser, wenn ich ein Freund von Captain Carter sei, habe er schlechte Nachrichten für mich. Der Captain sei im Morgengrauen von einem Wachmann, der auf dem benachbarten Grundstück arbeitete, tot aufgefunden worden.
Aus irgendeinem Grund war diese Nachricht keine wirkliche Überraschung, aber ich fuhr, so schnell ich konnte zu seinem Haus, um mich um seinen Körper und seine Angelegenheiten zu kümmern.
Ich traf den Wachmann zusammen mit dem örtlichen Polizeichef und einigen Leuten aus dem Ort an; alle versammelt in seinem kleinen Studierzimmer. Der Wachmann, der ihn gefunden hatte, informierte mich in allen Einzelheiten darüber, wie er den Körper angetroffen hatte, der noch warm gewesen war, als er ihn fand. Wie er sagte, hatte der Körper ausgestreckt in voller Länge im Schnee gelegen, mit über dem Kopf ausgestreckten Armen in Richtung auf den Rand des Steilhangs und er zeigte mir auch den genauen Ort. Mir wurde plötzlich bewusst, dass das derselbe Ort war, wo ich ihn in den anderen Nächten gesehen hatte – mit flehentlich zum Himmel erhobenen Armen.
Es gab keine Anzeichen für Gewalt an seinem Körper und mit der Unterstützung des Hausarztes kam der Leichenbeschauer schnell zu dem Schluss, der Tod sei auf Grund eines Herzversagens eingetreten. Als ich allein in dem Studierzimmer war, öffnete ich den Tresor und nahm den Inhalt aus der Schublade, von dem er mir gesagt hatte, ich würde darin seine Anweisungen finden. Die waren in der Tat teilweise recht merkwürdig, aber ich habe sie, so gut ich konnte, aufs Genaueste befolgt.
Er hatte verfügt, ich solle seinen Körper, ohne ihn einzubalsamieren, nach Virginia bringen und ihn in einen offenen Sarg in ein Grab legen, dass er bereits angelegt hatte und das, wie ich später erfuhr, gut belüftet war. Die Anweisungen verpflichteten mich darauf, mich persönlich darum zu kümmern, dass alles genau nach seinem Willen ausgeführt wurde – falls notwendig, sogar unter Geheimhaltung.
Er hatte seinen Besitz so hinterlassen, dass ich fünfundzwanzig Jahre lang die gesamte Rendite kassierte und das Kapital danach endgültig in meinen Besitz übergehen würde. Weitere Anweisungen hatten mit seinem Manuskript zu tun, das ich versiegelt und ungelesen elf Jahre lang aufbewahren musste, so wie ich es vorgefunden hatte. Ich dürfte seinen Inhalt keinesfalls veröffentlichen – erst einundzwanzig Jahre nach seinem Tod.
Eine merkwürdige Besonderheit hatte sein Grab, wo sein Körper immer noch begraben liegt – nämlich eine schwere Tür, die mit nur einem vergoldeten Schnappverschluss ausgestattet ist, der nur von innen geöffnet werden kann.
Hochachtungsvoll
Edgar Rice Burroughs.
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
KAPITEL VI
KAPITEL VII
KAPITEL VIII
KAPITEL IX
KAPITEL X
KAPITEL XI
KAPITEL XII
KAPITEL XIII
KAPITEL XIV
KAPITEL XV
KAPITEL XVI
KAPITEL XVII
KAPITEL XVIII
KAPITEL XIX
KAPITEL XX
KAPITEL XXI
KAPITEL XXII
KAPITEL XXIII
KAPITEL XXIV
KAPITEL XXV
KAPITEL XXVI
KAPITEL XXVII
KAPITEL XXVIII
KAPITEL I
AUF DEN HÜGELN VON ARIZONA
Ich bin ein sehr alter Mann; ich weiß nicht einmal genau, wie alt ich bin. Möglicherweise bin ich hundert Jahre alt, vielleicht sogar noch älter. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich nie so gealtert bin wie die anderen Menschen und ich erinnere mich auch nicht an irgendeine Kindheit. Soweit ich mich erinnern kann, war ich immer ein Mann im Alter von etwa dreißig Jahren. Ich sehe heute noch so aus wie vor vierzig oder sogar noch mehr Jahren und dennoch habe ich das Gefühl, dass ich nicht immer weiter leben kann; dass ich eines Tages sterben werde - eines richtigen Todes, von dem man nicht mehr wieder aufersteht. Ich weiß nicht, warum ich den Tod fürchten sollte, da ich doch schon zweimal gestorben und trotzdem noch immer am Leben bin. Und doch bereitet mir der Tod dieselbe Angst wie Ihnen, der Sie ja noch nie gestorben sind. Und ich glaube, es ist wegen dieser Angst vor dem Tod, weshalb ich so von meiner Sterblichkeit überzeugt bin.
Und wegen dieser Überzeugung habe ich mich entschieden, die Geschichte der interessantesten Phasen meines Lebens niederzuschreiben. Ich kann das Phänomen nicht erklären; ich kann hier nur indeneinfachen Worten eines gewöhnlichen Glücksritters eine Chronik der merkwürdigen Ereignisse niederschreiben, die mir in den zehn Jahren zustießen, in denen mein toter Körper unentdeckt in einer Höhle in Arizona lag.
Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt und kein Sterblicher soll dieses Manuskript lesen, bevor ich nicht für alle Ewigkeit gestorben bin. Ich weiß, dass der durchschnittliche Menschenverstand nicht glauben wird, was er nicht begreifen kann. Ich habe nicht die Absicht, von der Öffentlichkeit, von der Kanzel und von der Presse angeprangert und für einen ungeheuren Lügner gehalten zu werden, wenn ich doch einfach nur die Wahrheit sage, wie die Wissenschaft eines Tages beweisen wird. Möglicherweise werden die Erkenntnisse über den Mars, zu denen ich gelangte und das Wissen, das ich in dieser Chronik niederschrieb, zu einem besseren Verständnis der Geheimnisse unseres Schwesterplaneten beitragen – Geheimnisse für Sie, aber nicht mehr für mich.
Mein Name ist John Carter, aber ich bin besser bekannt als Captain Jack Carter aus Virginia. Am Ende des Bürgerkriegs befand ich mich im Besitz von mehreren hunderttausend Dollar (Geld der Konföderierten), und im Rang eines Captains der Kavallerie einer Armee, die es nicht mehr gab; der Diener eines Staates, der zusammen mit den Hoffnungen des Südens verschwunden war. Ohne Anführer, ohne einen Pfennig und da der Krieg, mein einziges Mittel zum Lebensunterhalt verloren war, entschied ich mich, in Richtung Südwesten aufzubrechen und mein verlorenes Glück durch die Suche nach Gold zurückzugewinnen.
Ich verbrachte fast ein Jahr mit der Suche nach Bodenschätzen - zusammen mit einem anderen konföderierten Offizier, Captain James K. Powell aus Richmond. Wir hatten unglaubliches Glück, denn im Winter 1865 haben wir nach vielen Strapazen und Entbehrungen eine überaus bemerkenswerte goldhaltige Quarzader entdeckt, wie wir sie uns in unseren wildesten Träumen niemals hätten vorstellen können. Powell, der eine Ausbildung als Bergbauingenieur genossen hatte, stellte fest, dass wir in der relativ kurzen Zeit von drei Monaten Gold für über eine Million Dollar freigelegt hatten.
Da unsere Ausrüstung überaus primitiv war, entschieden wir, dass einer von uns in die Zivilisation zurückkehren, die nötigen Maschinen und Werkzeuge kaufen und mit ausreichend vielen Männer zurückkehren musste, um die Mine richtig ausbeuten zu können.
Da Powell mit der Gegend sowie mit der notwendigen mechanischen Ausrüstung für den Bergbau vertraut war, entschieden wir, dass es das Beste wäre, wenn er sich auf den Weg machte. Wir kamen überein, dass ich unsere Mine bewachen würde – für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendein herumziehender Goldsucher uns die Mine streitig machen sollte.
Am 3. März 1866 packten Powell und ich seinen Proviant auf zwei unserer Esel und nachdem er sich verabschiedet hatte, stieg er auf sein Pferd und begann, den Berg hinabzureiten, auf das Tal zu, dessen Durchquerung den ersten Abschnitt seiner Reise markierte.
An dem Morgen, an dem Powell loszog, hatten wir, wie an fast jedem Morgen in Arizona, schönes und klares Wetter. Ich konnte ihn und seine Tragtiere auch noch in großer Entfernung sehen, während sie auf dem Weg hinunter ins Tal waren und ich würde sie noch den ganzen Morgen lang hin und wieder ausmachen, wenn sie über eine Anhöhe kamen oder höher als das Niveau der Ebene stiegen. Das letzte Mal, dass ich Powell sah, war etwa um drei Uhr nachmittags, als er in den Schatten der Anhöhe auf der gegenüberliegenden Seite des Tales trat.
Etwa eine halbe Stunde später blickte ich zufällig über das Tal und bemerkte zu meiner größten Überraschung drei kleine Punkte etwa an derselben Stelle, an der ich meinen Freund und seine Tragtiere zuletzt gesehen hatte. Ich bin eigentlich nie grundlos besorgt, aber je mehr ich mich davon zu überzeugen versuchte, dass mit Powell alles in Ordnung war und dass die Punkte, die ich auf seinem Weg gesehen hatte, tatsächlich nur Antilopen oder Wildpferde waren, umso unsicherer wurde ich.
Seit wir in diesem Territorium angekommen waren, hatten wir keinen einzigen feindseligen Indianer gesehen und wir waren deshalb extrem unvorsichtig geworden. Wir waren es gewohnt, uns über Geschichten von der großen Zahl dieser niederträchtigen Plünderer lustig zu machen, die die Spuren der Weißen verfolgten und diese in großer Zahl folterten und töteten, wenn sie in ihre erbarmungslosen Klauen gerieten.
Ich wusste, dass Powell gut bewaffnet war und außerdem viel Erfahrung im Kampf gegen die Indianer hatte. Auch ich hatte jahrelang unter den Sioux im Norden gelebt und gekämpft und ich wusste daher, dass seine Chancen gegen eine Gruppe von Apachen auf dem Kriegspfad doch recht gering waren. Schließlich hielt ich die Spannung nicht länger aus und bewaffnete mich mit zwei Colts und einem Karabiner, streifte mir zwei Patronengürtel über, stieg auf mein Reitpferd und begann denselben Weg entlangzureiten, den Powell am Morgen genommen hatte.
Als ich vergleichsweise ebenen Grund erreichte, spornte ich mein Pferd zu leichtem Galopp an und ritt so, wo auch immer das möglich war, den ganzen Tag weiter, bis ich schließlich kurz vor Sonnenuntergang die Stelle erreichte, wo andere Spuren die von Powell kreuzten. Es waren Spuren von Ponys ohne Hufe, drei Ponys, die galoppiert waren.
Ich ritt schnell weiter, bis es vollständig dunkel war und ich auf den aufgehenden Mond warten musste. Das gab mir die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob es wohl eine weise Entscheidung gewesen war, Powell nachzureiten. Möglicherweise hatte ich unmögliche Gefahren heraufbeschworen wie eine nervöse alte Hausfrau und wenn ich Powell einholen würde, hätte er mich wegen der Mühe, die ich mir gemacht hatte, auch noch ausgelacht. Ich bin jedoch nicht überempfindlich und das Pflichtgefühl, ganz gleich wohin es führte, war mein Leben lang mein Leitmotiv. Das war wohl auch der Grund für die Ehrungen, die mir von drei Republiken verliehen worden waren und für die Freundschaft eines alten und mächtigen Kaisers und einiger weniger mächtiger Könige, in deren Diensten sich mein Schwert viele Male rot gefärbt hatte.
Gegen neun Uhr schien der Mond hell genug, um meinen Weg fortzusetzen und ich konnte der Spur problemlos und zügig folgen, an manchen Stellen sogar im flotten Trab. Um Mitternacht erreichte die Wasserstelle, wo Powell eigentlich lagern wollte. Ich erreichte die Stelle unerwartet und fand sie vollkommen verlassen vor – ohne das geringste Anzeichen dafür, dass irgendjemand hier in letzter Zeit sein Lager aufgeschlagen hätte.
Ich bemerkte sehr bald, dass es viele Spuren von Reitern gab, die, davon war ich nun überzeugt, Powell verfolgten und nur kurz an der Wasserstellen angehalten hatten. Sie ritten mit derselben Geschwindigkeit wie er. Ich war mir inzwischen sicher, dass die Verfolger Apachen waren und dass sie Powell lebend gefangen nehmen wollten – wegen der teuflischen Freude an der Folter – also gab ich meinem Pferd die Sporen und ließ es gefährlich schnell galoppieren – in der verzweifelten Hoffnung, ich könnte ja die roten Halunken vielleicht noch einholen, bevor sie ihn angriffen.
Jede weitere Spekulation wurde abrupt unterbrochen - von zwei Schüssen, die weit vor mir zu hören waren. Ich wusste, dass Powell, wenn überhaupt, dann jetzt meine Hilfe brauchte und ich trieb das Pferd auf dem schwierigen, steil ansteigenden Pfad zu schnellstem Galopp an.
Ich war etwa eine Meile weiter geritten, ohne noch irgendetwas zu hören, als der Pfad plötzlich auf einem kleinen, offenen Hochplateau in der Nähe des höchsten Punktes des Passes endete. Ich war durch eine enge, überhängende Schlucht geritten, kurz bevor ich plötzlich auf dem Hochplateau ankam und der Blick, der sich mir bot, erfüllte mich mit Bestürzung und Entsetzen.
Das kleine Stück ebenen Landes des Hochplateaus war weiß vor lauter Indianerzelten, denn es hatten sich etwa ein halbes tausend rote Krieger um ein Objekt in der Mitte des Lagers versammelt. Ihre Aufmerksamkeit war vollständig auf diesen Punkt konzentriert, so dass sie mich gar nicht bemerkten und ich hätte mich einfach in die dunkle Schlucht zurückziehen und ihnen so vollkommen sicher entkommen können. Tatsächlich kam mir dieser Gedanke jedoch erst am darauffolgenden Tag. Man kann daher kaum von Heldentum sprechen, worauf ich andernfalls möglicherweise Anspruch gehabt hätte.
Ich glaube nicht, dass ich aus dem Stoff gemacht bin, aus dem die Helden bestehen, denn bei all den hunderten Fällen, bei denen ich freiwillig dem Tod ins Auge sah, kann ich mich an kein einziges Mal erinnern, wo mir irgendein anderer Schritt als der eingefallen wäre, den ich ohne zu überlegen tat. Das fiel mir, wenn überhaupt, immer erst Stunden später ein. Ich bin offenbar so geschaffen, dass ich unterbewusst immer nur meine Pflicht tue, ohne mir viel dabei zu denken. Wie auch immer habe ich es niemals bereut, dass Feigheit keine Option für mich ist.
In diesem Augenblick war ich natürlich sicher, dass Powell das Zentrum der Aufmerksamkeit war, aber ich weiß nicht, ob ich zuerst dachte oder gleich handelte. Jedenfalls hatte ich einen Augenblick nachdem ich den Schauplatz erblickt hatte bereits meine Revolver gezogen, feuerte auf eine ganze Armee von Kriegern und schrie aus vollem Hals. Ganz allein konnte ich keine bessere Taktik verfolgen, denn die Rothäute waren in ihrer Überraschung davon überzeugt, dass ein ganzes Regiment regulärer Truppen über sie herfiel. Sie drehten sich um und flohen in alle Himmelsrichtungen, um ihre Bögen, Pfeile und Gewehre zu holen.
Ich sah, wie sie in aller Eile flohen, was mich mit Unbehagen und mit Wut erfüllte. Unter dem klaren Licht des Mondes Arizonas lag Powell, den Körper voller feindlicher Indianer-Pfeile. Ich konnte nicht umhin anzunehmen, dass er bereits tot war, trotzdem wollte ich seinen Körper vor der Verstümmelung durch die Apachen retten, genau wie ich den Mann selbst vor dem Tod gerettet hätte.
Ich ritt in seine Nähe und beugte mich auf dem Sattel nach unten, um ihn an seinem Patronengurt hochzuziehen und vor meinen Sattel auf das Pferd zu legen. Ein kurzer Blick zurück verriet mir, dass es gefährlicher wäre, auf dem gleichen Weg zurückzukehren, auf dem ich gekommen war, als quer über die Hochebene zu reiten. So gab ich meinem armen Pferd die Sporen und galoppierte mit rasender Geschwindigkeit auf eine Öffnung in dem Pass zu, die ich auf der anderen Seite des Plateaus ausgemacht hatte.
Die Indianer hatten inzwischen bemerkt, dass ich allein war und ich wurde von Flüchen, Pfeilen und Gewehrkugeln verfolgt. Die Tatsache, dass es bei Mondlicht schwierig ist, mit irgendetwas anderem als mit Flüchen genau zu treffen, dass sie wütend und erregt über mein unerwartetes Auftauchen waren und dass ich ein sich ziemlich schnell bewegendes Ziel war, rettete mich vor mehreren tödlichen Kugeln des Feindes und erlaubte mir, den Schatten der umgebenden Berge zu erreichen, bevor eine richtige Verfolgung organisiert werden konnte.
Mein Pferd lief praktisch ohne meine Führung, weil ich wusste, dass ich den genauen Weg zum Pass weit weniger kannte als das Pferd und so geschah es, dass es in einen Hohlweg einritt, der zum Berggipfel führte und nicht zu dem Pass, von dem ich mir erhofft hatte, dass er uns ins Tal und in Sicherheit bringen würde. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass ich dieser Tatsache mein Leben verdanke und die einzigartigen Erfahrungen und Abenteuer, die mir in den folgenden zehn Jahren passierten.
Ich erkannte erst, dass ich auf dem falschen Weg war, als die Schreie der mich verfolgenden Wilden plötzlich immer schwächer und weiter weg zu meiner Linken zu hören waren. Ich wusste, dass sie links an der gezackten Felsformation vorbeigelaufen waren, mein Pferd hatte mich und Powells Körper jedoch auf den Weg rechts davon gebracht.
Ich hielt das Pferd auf einem kleinen Felsvorsprung an, von wo aus man den Weg unter mir und zur linken überblicken konnte und sah wie die Gruppe der uns verfolgenden Indianer hinter einem naheliegenden Berg verschwand. Ich wusste, dass die Indianer sehr bald merken würden, dass sie auf dem falschen Pfad waren und dass sie mich dann auf dem richtigen Weg verfolgen würden, wenn sie erst mal meine Spur aufgenommen hatten.
Ich war nur ein kurzes Stück weiter geritten, als der scheinbar hervorragende Weg um eine hohe Klippe herum führte. Der Pfad war eben und ziemlich breit und führte nach oben im Großen und Ganzen in die Richtung, in die ich reiten wollte. Die Klippe erhob sich zu meiner Rechten mehrere hundert Meter in die Höhe und zu meiner Linken fiel ein Steilhang fast senkrecht mehrere hundert Meter tief bis auf den Grund einer Felsschlucht hinab.
Ich war diesem Weg etwa hundert Meter weit gefolgt, als mich eine scharfe Biegung nach rechts zur Öffnung einer großen Höhle führte. Die Öffnung war etwas über einen Meter hoch und einen knappen Meter breit und der Pfad endete dort.
Es war bereits heller Morgen, denn es gab praktisch keine Dämmerung – eine überraschende Eigenart von Arizona. Es war praktisch ohne Vorwarnung plötzlich taghell. Ich stieg ab und legte Powell auf den Boden, aber auch bei genauester Untersuchung zeigte er keinen Funken Leben mehr. Ich flößte ihm Wasser aus meiner Feldflasche zwischen seine toten Lippen ein, wusch sein Gesicht ab und massierte seine Hände und bearbeitete ihn so fast eine Stunde lang, obwohl ich wusste, dass er tot war.
Ich hatte Powell sehr gemocht, er war in jeder Hinsicht ein großartiger Mann, ein glänzender Kavalier des Südens; ein wahrer und treuer Freund; und in tiefer Trauer musste ich schließlich meine unbeholfenen Wiederbelebungsversuche aufgeben.
Ich ließ Powells Körper auf dem Felsvorsprung liegen und kroch in die Höhle, um sie zu untersuchen. Ich fand eine große Kammer, möglicherweise mit einem Durchmesser von etwa dreißig Metern und etwa zehn bis zwölf Metern Höhe, ein glatter und ausgetretener Boden und viele weitere Anzeichen dafür, dass die Höhle vor langer Zeit einmal bewohnt gewesen war. Der hintere Teil der Höhle lag in tiefer Dunkelheit und ich konnte nicht erkennen, ob es dort noch weitere Öffnungen gab, die in andere Teile der Höhle führten oder nicht.
Während ich meine Untersuchung fortsetzte, befiel mich eine angenehme Schläfrigkeit, die auf den langen und anstrengenden Ritt zurückzuführen war – eine natürliche Reaktion auf die Aufregung während des Kampfes und der Verfolgung. Ich fühlte mich an diesem Ort vergleichsweise sicher, denn ich wusste, dass ein einzelner Mann den Weg zu der Höhle gegen eine ganze Armee verteidigen konnte.
Ich wurde schon bald so schläfrig, dass ich dem starken Verlangen, mich für ein paar Augenblicke auf den Boden der Höhle zu legen, kaum noch widerstehen konnte, aber ich wusste, dass ich das nicht tun dürfte, denn das würde den sicheren Tod durch meine roten Freunde bedeuten, die mich jeder Zeit finden konnten. Ich raffte mich auf und begann mich auf den Eingang der Höhle zuzubewegen, nur um wie betrunken gegen die Höhlenwand zu torkeln und von da aus auf dem Bauch liegend auf dem Höhlenboden zu landen.
KAPITEL II
DAS ENTKOMMEN DES TOTEN
Eine Art köstlicher Verträumtheit überkam mich; meine Muskeln waren entspannt und ich war dabei, meinem Verlangen nach Schlaf nachzugeben, als ich das Geräusch sich nähernder Pferde vernahm. Ich wollte aufspringen, musste aber zu meinem Erschrecken feststellen, dass mir meine Glieder nicht mehr gehorchten. Ich war jetzt hellwach, aber unfähig, auch nur einen einzigen Muskel zu bewegen, als sei ich in einen Stein verwandelt worden. Dann bemerkte ich zum ersten Mal einen leichten Dunst, der die Höhle durchströmte. Er war extrem schwach und auch nur gegen den vom Tageslicht erleuchteten Höhleneingang zu sehen. Ich nahm auch einen schwachen, aber beißenden Geruch in der Nase war und konnte nur vermuten, dass ich von einem giftigen Gas überwältigt worden war; warum ich meine geistigen Fähigkeiten behielt, aber bewegungsunfähig war, konnte ich nicht ergründen.
Ich lag mit dem Gesicht zum Eingang der Höhle und ich konnte ein kurzes Stück der Strecke überblicken, die von der Höhle bis zu der Biegung des Weges an der Klippe reichte. Das Geräusch der sich nähernden Pferde hatte aufgehört und ich stellte mir vor, dass die Indianer sich jetzt über den kleinen Felsvorsprung, der zu meinem lebendigen Grab führte, an mich anschlichen. Ich kann mich erinnern, dass ich hoffte, sie würden kurzen Prozess mit mir machen, weil ich es nicht besonders schätzte, mir die zahlreichen Dinge vorzustellen, die sie mir antun könnten, wenn sie die Lust danach verspürten.
Ich brauchte nicht lange zu warten, bis ein schwacher Laut mir verriet, dass sie ganz in der Nähe waren. Ein Gesicht mit voller Kriegsbemalung lugte vorsichtig hinter der Klippe hervor und wilde Augen sahen mir in die Augen. Ich war mir sicher, dass er mich in dem schwachen Licht in der Höhle sehen konnte, denn das Licht der tiefstehenden Morgensonne fiel auf mich durch die Höhlenöffnung.
Anstatt sich zu nähern, stand der Mann da und starrte mich mit aufgerissenen Augen und offenem Mund an. Dann tauchte noch ein Gesicht eines weiteren Wilden auf und das eines dritten, eines vierten und eines fünften, die über die Schulter der davorstehenden schauten, denn auf dem schmalen Felsvorsprung war nicht genug Platz. Alle Gesichter waren von Angst und Schrecken gezeichnet – ich wusste nicht warum und erfuhr es auch erst zehn Jahre später. Offenbar waren hinter denen, die mich ansahen noch mehr Wilde, denn die Vorderen flüsterten den dahinterstehenden etwas zu.
Plötzlich kam ein schwaches, aber deutlich zu hörendes Stöhnen aus dem Inneren der Höhle hinter mir und als die Indianer das hörten, flohen sie Hals über Kopf – von einem panischem Schrecken gepackt. Sie waren so außer sich vor Angst, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste losstürmten, wobei einer der Wilden den Abhang vor der Klippe hinabstürzte. Für kurze Zeit hörte man noch das Echo der Schreie der Indianer und dann war alles wieder ruhig.
Das Geräusch, dass den Indianern so viel Angst gemacht hatte, wiederholte sich nicht, aber es hatte ausgereicht, um mich dazu zu bringen mich zu fragen, was dieses mögliche Schreckgespenst wohl sein konnte, das da hinter meinem Rücken im Schatten lauerte. Angst ist relativ, also kann ich meine Gefühle zu dieser Zeit nur daran messen, was ich bei früheren gefährlichen Situation und seither empfand, aber ich kann sagen, ohne mich zu schämen, wenn das Gefühl, das ich in den nächsten Minuten hatte, Angst war, dann möge Gott dem Feigling beistehen, denn Feigheit ist sicherlich ihre eigene Bestrafung.
Handlungsunfähig am Boden liegend, mit dem Rücken zu einer schrecklichen und unbekannten Gefahr, vor deren Geräusch die wilden Apachen Hals über Kopf geflohen waren, wie eine Herde Schafe, wie verrückt vor einem Rudel Wölfe fliehen würde, schien mir die schlimmste Zwangslage für einen Mann, der daran gewöhnt war, mit all der Energie seines kräftigen Körpers um sein Leben zu kämpfen.
Mehrmals meinte ich hinter mir schwache Geräusche zu hören, als ob sich jemand vorsichtig bewegte, aber auch das hörte schließlich auf und ich konnte ununterbrochen über meine unangenehme Situation nachdenken. Über den Grund meiner Lähmung konnte ich nur vage Vermutungen anstellen und meine einzige Hoffnung war, dass die Lähmung so schnell vorübergehen würde, wie sie mich befallen hatte.
Am späten Nachmittag begann mein Pferd, das mit angezogenen Zügeln vor der Höhle gestanden hatte, langsam den Pfad herunterzugehen – offenbar auf der Suche nach Futter und Wasser und ich war allein mit meinem geheimnisvollen, unbekannten Gefährten, und dem toten Körper meines Freundes, der in meinem Blickfeld auf dem Felsvorsprung lag, wo ich ihn am frühen Morgen abgelegt hatte.
Von da an bis möglicherweise Mitternacht herrschte absolute Stille – Totenstille – dann drang plötzlich, wie am Morgen zuvor, ein furchtbares Stöhnen an meine erschrockenen Ohren und man hörte wieder von dem schwarzen Schatten, wie sich etwas bewegte und ein entferntes Rascheln wie von trockenem Laub. Der Schock auf mein überspanntes Nervensystem war enorm und mit einer übermenschlichen Anstrengung versuchte ich, meine fürchterlichen Fesseln zu brechen. Es war eine Anstrengung des Geistes, des Willens und der Nerven, nicht der Muskeln, denn ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, nicht einmal den kleinen Finger, aber nichtsdestotrotz war mir alles voll bewusst. Und dann geschah etwas – ein momentanes Gefühl der Übelkeit, ein scharfer Klick, als sei ein Stahldraht eingeschnappt und ich stand aufrecht mit dem Rücken gegen die Höhlenwand mit dem Gesicht meinem unbekannten Feind zugewandt.
Dann durchflutete das Mondlicht die Höhle und vor mir lag mein eigener Körper so, wie er schon stundenlang dalag; die Augen waren auf den Felsvorsprung außerhalb der Höhle gerichtet und die Hände lagen schlaff auf dem Boden. Ich blickte zuerst auf meinen leblosen Körper auf dem Boden der Höhle und sah dann mit großer Verwirrung an mir selbst herab; denn ich lag bekleidet auf dem Boden, aber hier stand ich völlig nackt wie im Moment meiner Geburt.
Der Übergang war so plötzlich und unerwartet passiert, dass ich für einen Moment alles um mich herum außer meiner eigenartigen Metamorphose vergaß. Mein erster Gedanke war: Dann ist das der Tod! Also bin ich tatsächlich für immer in dieses andere Leben übergegangen! Aber ich konnte das nicht wirklich glauben, denn ich fühlte mein Herz gegen die Rippen schlagen – von der Anstrengung, mich von der Lähmung zu befreien, die mich im Bann hatte. Ich atmete schnell und schwer, kalter Schweiß kam aus jeder Pore meines Körpers und das klassische Experiment, mich zu kneifen offenbarte die Tatsache, dass ich alles andere als ein Geist war.
Wiederum wurde ich urplötzlich durch eine Wiederholung des unheimlichen Stöhnens aus der Tiefe der Höhle in meine unmittelbare Umgebung zurückgeholt. Ich hatte keine Lust, mich nackt und unbewaffnet diesem unsichtbaren Ding entgegenzustellen, das mich bedrohte. Meine Revolver waren an meinem leblosen Körper festgeschnallt, den ich aus unerfindlichen Gründen nicht erreichen oder berühren konnte. Mein Karabiner steckte in seinem Halfter angeschnallt an meinem Sattel und da mein Pferd weggelaufen war, verfügte ich über keine Waffe, um mich zu verteidigen. Die einzige Alternative war die Flucht und meine Entscheidung wurde durch eine Wiederholung des raschelnden Geräusches dieses Dings bestätigt, das nun in der Dunkelheit der Höhle und in meiner verdrehten Vorstellung heimlich auf mich los kroch.
Ich konnte der Versuchung, diesem schrecklichen Ort zu entkommen, nicht länger widerstehen und sprang schnell durch die Öffnung in die klare Nacht unter dem Sternenhimmel Arizonas. Die frische kühle Bergluft wirkte, wie ein Aufputschmittel und ich fühlte neues Leben und neuen Mut in mir aufkeimen. Ich setzte mich auf den Rand des Felsvorsprungs und machte mir Vorwürfe wegen der wie mir schien, völlig unberechtigten Befürchtungen. Ich schlussfolgerte, dass ich viele Stunden lang hilflos in der Höhle gelegen hatte; aber ich war nicht angegriffen worden und mein klarer Verstand überzeugte mich davon, dass die Geräusche, die ich gehört hatte, eine natürliche und harmlose Ursache haben müssten; wahrscheinlich waren sie, durch den Luftzug wegen der besonderen Form der Höhle entstanden.
Ich entschloss mich, das zu untersuchen, aber zuerst erhob ich den Kopf und füllte meine Lungen mit der reinen und belebenden Bergluft. Währenddessen sah ich unter mir die herrliche Aussicht auf die Felsenschlucht und die Hochebene voller Kakteen, die das Mondlicht in ein Wunder mit sanftem Glanz und wundersamem Zauber verwandelte.
Wenige Wunder des Westens sind so inspirierend wie eine Landschaft in Arizona im Mondlicht; die silbernen Berge am Horizont, das seltsame Zusammenwirken von Licht und Schatten über den Erhebungen und Tälern und die grotesken Feinheiten der steifen und doch bildschönen Kakteen, die ein zauberhaftes und beeindruckendes Bild abgeben. Es scheint als würde man zum ersten Mal einen Blick auf eine tote und vergessene Welt werfen – ganz anders als an jeden anderen Ort auf der Welt sieht es hier aus.
Als ich da stand und sinnierte, richtete sich mein Blick von der Landschaft zum Himmel, wo eine Unzahl von Sternen einen wunderschönen und passenden Baldachin für die irdischen Wunder bildete. Meine Aufmerksamkeit galt sehr bald einem hellen roten Stern nahe dem weit entfernten Horizont. Während ich auf ihn blickte, fühlte ich den Zauber überwältigender Faszination – es war Mars, der Gott des Krieges und für mich, den Krieger hatte er immer die Macht des unwiderstehlichen Zaubers gehabt. Während ich ihn in dieser fortgeschrittenen Nacht anstarrte, schien er mich über diese unvorstellbare Entfernung hinweg zu rufen, mich zu locken und mich anzuziehen, so wie ein Magnet Eisenspäne anzieht.
Mein Verlangen war stärker als jeder Widerstand, ich schloss meine Augen, streckte meine Arme zu dem Gott meiner Berufung aus und fühlte mich angezogen - mit der Schnelligkeit eines Gedankens durch die weglose Unendlichkeit des Alls. Ich fühlte einen Moment extreme Kälte und dann brach die völlige Dunkelheit herein.
KAPITEL III
MEINE ANKUNFT AUF DEM MARS
Ich öffnete meine Augen und erblickte eine seltsame und unheimliche Landschaft. Ich wusste, dass ich auf dem Mars war und ich zweifelte auch nicht an meinem Verstand oder an meinem Wachzustand. Ich schlief nicht und kneifen war hier auch nicht nötig; mein innerliches Bewusstsein sagte mir ganz klar, dass ich auf dem Mars war, genau wie Sie sich bewusst sind, dass Sie auf der Erde sind. Sie zweifeln nicht daran – genauso wenig wie ich.
Ich lag bäuchlings auf einer Ebene mit einem gelblichen, moosartigen Bewuchs, der sich um mich herum viele Meilen weit erstreckte. Ich befand mich anscheinend in einem tiefen, kreisrunden Becken, an dessen äußerem Rand ich unregelmäßige niedrige Hügel erkennen konnte. Es war Mittag und die Sonne schien kräftig auf mich hernieder; die Hitze war auf meinem nackten Körper recht intensiv, allerdings auch nicht mehr als sie es unter ähnlichen Bedingungen in der Wüste Arizonas gewesen wäre. Hier und da trat etwas quarzhaltiger Felsen zu Tage, der in der Sonne glitzerte und zu meiner Linken, etwa hundert Meter entfernt, sah ich eine niedrige ummauerte Anlage, die etwas über einen Meter hoch war. Es gab kein Wasser und es waren auch keine anderen Pflanzen außer dem Moos zu sehen und da ich etwas Durst hatte, entschied ich mich, die Gegend auszukundschaften.
Als ich auf die Füße sprang, erlebte ich meine erste marsianische Überraschung, denn der Kraftaufwand, mit dem ich auf der Erde einfach nur aufgestanden wäre, beförderte mich auf dem Mars etwa drei Meter hoch in die Luft. Ich landete trotzdem wieder sanft auf dem Boden – ohne einen spürbaren Aufschlag oder eine Erschütterung. Jetzt begann eine Reihe von Lernprozessen, die noch dazu extrem lächerlich erschienen. Ich stellte fest, dass ich das Laufen ganz neu lernen musste, denn die Muskelkraft, mit der ich mich auf der Erde leicht und sicher bewegte, spielte mir auf dem Mars dumme Streiche, als ich zum ersten Mal versuchte, mit der geringeren Schwerkraft und dem niedrigeren Luftdruck zurechtzukommen.
Ich war jedoch entschlossen, die ummauerte Anlage zu untersuchen, die als der einzige Beweis für Bewohner in Sicht war und so fasste ich den Plan, das erste Gesetz der Fortbewegung umzukehren und zu kriechen. Das machte ich ganz gut und erreichte die niedrige Ummauerung in wenigen Augenblicken. Anscheinend gab es weder Türen noch Fenster auf der Seite, die mir zugewandt war, da aber die Mauer nur etwas über einen Meter hoch war, stand ich vorsichtig auf und sah über die Mauer. Da bot sich mir der seltsamste Anblick, der mir je zuteilwurde.
Die Abdeckung der Anlage war aus solidem Glas, etwa zehn bis zwölf Zentimeter dick und darunter lagen mehrere hundert enorm große Eier, vollkommen rund und schneeweiß. Die Eier waren alle nahezu gleich groß – etwa siebzig Zentimeter im Durchmesser. Fünf oder sechs waren bereits geschlüpft und die grotesken Karikaturen, die da blinzelnd in der Sonne saßen, waren merkwürdig genug, um mich an meinem Verstand zweifeln zu lassen. Sie schienen hauptsächlich aus Köpfen zu bestehen, mit kleinen hageren Körpern, langen Hälsen und sechs Beinen, oder, wie ich später erfuhr, mit zwei Beinen und zwei Armen und dazwischen ein Paar Gliedmaßen, die sowohl als Arme als auch als Beine dienen konnten. Ihre Augen befanden sich an den jeweils gegenüberliegenden Seiten ihrer Köpfe etwas höher als in der Mitte – Stielaugen, die sowohl nach vorne als auch nach hinten gerichtet werden konnten, ja sogar unabhängig voneinander, sodass dieses merkwürdige Tier in alle Richtungen blicken konnte und sogar gleichzeitig in zwei unterschiedliche Richtungen, ohne den Kopf drehen zu müssen.
Die Ohren, etwas über den Augen und näher zusammen, waren kleine, tassenförmige Antennen, die bei diesen jungen Exemplaren nur etwa drei Zentimeter hervorragten. Ihre Nasen waren nichts weiter als längliche Schlitze in der Mitte ihrer Gesichter, mitten zwischen ihren Mündern und Ohren.
Ihre Körper waren von leicht gelblich-grüner Farbe und sie hatten keine Haare. Bei den Erwachsenen ist diese Farbe, wie ich bald erfahren sollte, ein dunkleres Olivgrün und bei den männlichen Kreaturen dunkler als bei den weiblichen. Außerdem sind die Köpfe im Verhältnis zu den Körpern nicht so unverhältnismäßig groß wie bei den Jungen.
Die Iris der Augen ist blutrot, wie bei den Albinos, während die Pupille dunkel ist. Der Augapfel selbst ist schneeweiß wie auch die Zähne. Dies fügt zu dem sonst schon furchterregenden und schrecklichen Aussehen noch einen überaus grimmigen Eindruck hinzu, besonders weil die unteren Stoßzähne, die leicht gebogen sind, in scharfen Spitzen etwa da enden, wo Menschen ihre Augen haben. Die Zähne sind nicht elfenbeinfarben, sondern schneeweiß. Vor dem dunklen Hintergrund der olivfarbenen Haut stechen die Stoßzähne besonders hervor – gefährliche Waffen, die besonders eindrucksvoll erscheinen.
Die meisten Details bemerkte ich erst später, denn ich hatte nur wenig Zeit, über die Wunder meiner neuen Entdeckung nachzudenken. Ich hatte gesehen, dass die Kreaturen in den Eiern dabei waren zu schlüpfen und während ich da stand und beobachtete, wie die abscheulichen kleinen Monster ihre Schalen durchbrachen, bemerkte ich nicht, dass eine Gruppe ausgewachsener Marsianer von hinten auf mich zukam.
Sie hätten mich leicht gefangen nehmen können, denn sie kamen lautlos über das weiche Moos, das praktisch die ganze Oberfläche des Planeten bedeckte – mit Ausnahme der gefrorenen Polkappen und der überall verstreuten Anbaugebiete- , aber ihre Absichten waren noch viel unheilvoller. Das Klappern der Ausrüstung des vordersten Kriegers warnte mich.
Mein Leben hing an so kleinen Dingen, dass ich mich oft wunderte, wie ich doch immer so leicht entkommen konnte. Hätte das Gewehr des Anführers der Gruppe nicht an seiner Befestigung an seinem Sattel hin und her geschwungen und gegen die Metallverkleidung seines großen Speers geschlagen, ich wäre ausgelöscht worden, ohne überhaupt zu bemerken, dass ich dem Tod so nahe war. Aber als ich dieses schwache Geräusch hörte, drehte ich mich um und keine drei Meter von meiner Brust entfernt sah ich die schimmernde metallische Spitze eines riesigen Speers, der etwa zehn Meter lang war und von einer berittenen, großen Kopie der kleinen Teufelchen, die ich beobachtet hatte, nach unten geneigt gehalten wurde und auf mich gerichtet war.
Aber wie kümmerlich und harmlos die Kleinen doch aussahen – im Vergleich zu dieser riesigen und furchterregenden Reinkarnation des Hasses, der Rache und des Todes. Der Mann selbst, wenn ich ihn mal so nennen darf, war über vier Meter groß und hätte auf der Erde mehr als zweihundert Kilo gewogen. Er saß auf seinem Reittier wie wir auf einem Pferd sitzen und hielt sich mit seinen unteren Gliedmaßen an dem Tier fest, während seine beiden rechten Arme seinen riesigen Speer an der Seite seines Reittiers hielten. Seine beiden linken Arme waren nach der Seite ausgestreckt, um das Gleichgewicht zu halten. Das Tier, auf dem er ritt, hatte weder Zügel noch Zaumzeug irgendeiner Art, um es zu führen.
Und was für ein Reittier! Wie kann man es nur mit irdischen Worten beschreiben! An den Schultern war es über drei Meter hoch, hatte auf jeder Seite vier Beine, einen breiten flachen Schwanz, der am Ende dicker war als am Anfang und den es gerade nach hinten hielt, während es lief. Es hatte ein riesiges Maul, das seinen Kopf in zwei Teile teilte – oben seine Schnauze und unten sein langer gewaltiger Hals. Genau wie sein Herr hatte es keine Haare und hatte die Farbe dunklen Schiefers, überaus glatt und glänzend. Sein Bauch war weiß und die Farbe seiner Beine ging von dunklem Schiefer an den Schultern und Hüften zu grell gelb an den Füßen über. Die Füße selbst waren stark gepolstert und ohne Krallen, was auch dazu beitrug, dass es sich so geräuschlos nähern konnte, was zusammen mit den vielen Beinen charakteristische Eigenheiten der Tiere auf dem Mars sind. Nur die höchstentwickelte Menschenart und noch eine andere Tierart sind die einzigen Säugetierarten auf dem Mars und nur sie haben gut ausgebildete Nägel; Huftiere gibt dort überhaupt nicht.