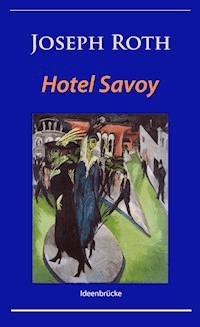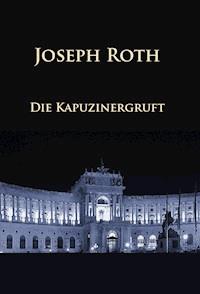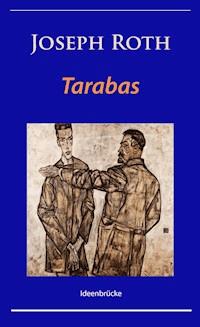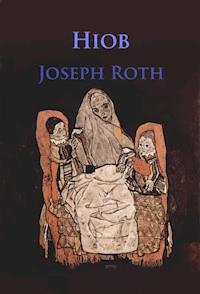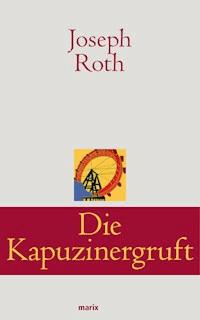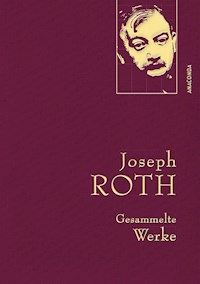Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den journalistischen Schriften von Joseph Roth wird die Vielseitigkeit und das Talent des Autors deutlich. Roth, bekannt für seine intensive Prosa, zeigt in diesem Band seine Fähigkeit, komplexe Themen mit Leichtigkeit zu behandeln. Die Sammlung umfasst eine Vielzahl von Themen, von Politik und Sozialkritik bis hin zu Alltagsgeschichten, die Roth auf eindringliche Weise präsentiert. Sein literarischer Stil kombiniert eine klare Sprache mit tiefgründigen Gedanken, die den Leser zum Nachdenken anregen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Journalistische Schriften von Joseph Roth
Books
Inhaltsverzeichnis
Reise in Rußland (1926)
Erster Band
I. Die zaristischen Emigranten
Frankfurter Zeitung, 14. 9. 1926
Lange bevor man noch daran denken konnte, das neue Rußland aufzusuchen, kam das alte zu uns. Die Emigranten trugen den wilden Duft ihrer Heimat, der Verlassenheit, des Bluts, der Armut, des außergewöhnlichen, romanhaften Schicksals. Es paßte zu den europäischen Klischee-Vorstellungen von den Russen, daß sie solches erlebt hatten, Ausgestoßene waren, von warmen Herden Vertriebene, Wanderer durch die Welt ohne Ziel, Entgleisende mit der alten literarischen Verteidigungs-Formel für jeden Sprung über gesetzliche Grenzen: »die russische Seele«. Europa kannte die Kosaken aus dem Varieté, die russischen Bauernhochzeiten aus opernhaften Bühnenszenen, die russischen Sänger und die Balalaikas. Es erfuhr (auch nachdem Rußland zu uns gekommen war) niemals, wie sehr französische Romanciers die konservativsten der Welt – und sentimentale Dostojewski-Leser den russischen Menschen umgelogen hatten zu einer kitschigen Gestalt aus Göttlichkeit und Bestialität, Alkohol und Philosophie. Samowarstimmung und Asiatismus. Was hatten sie aus der russischen Frau gemacht! – Eine Art Menschtier, mit Treue begabt und Leidenschaft zum Betrug, eine Verschwenderin und eine Rebellierende, eine Literatenfrau und eine Bombenfabrikantin. Je länger die Emigration dauerte, desto näher kamen die Russen der Vorstellung, die man sich von ihnen gemacht hatte. Sie taten uns den Gefallen und assimilierten sich an unser Klischee. Das Gefühl, Träger einer »Rolle« zu sein, linderte vielleicht ihr Elend. Sie trugen es leichter, wenn sie literarisch gewertet wurden. Der russische Fürst als Chauffeur eines Pariser Taxis steuert unmittelbar in die Literatur. Sein Schicksal mag grausam sein. Aber es ist belletristisch verwendbar.
Das anonyme Leben der Emigranten wurde eine öffentliche Produktion. Wie erst, wenn sie sich selbst zur Schau stellten. Hunderte gründeten Theater, Sängerchöre, Tanzgruppen und Balalaika-Orchester. Zwei Jahre lang waren alle neu, echt, verblüffend. Später wurden alle selbstverständlich und langweilig. Sie verloren die Beziehung zur heimatlichen Erde. Sie entfernten sich immer mehr von Rußland – und Rußland noch mehr von ihnen. Europa kannte schon Meyerhold – sie hielten immer noch bei Stanislawsky. Die »blauen Vögel« fingen an, deutsch, französisch, englisch zu singen. Schließlich flogen sie nach Amerika und verloren das Gefieder.
Die Emigranten betrachteten sich als die einzigen Vertreter des Echt-Russischen. Was nach der Revolution in Rußland wuchs und von Bedeutung wurde, verleumdeten sie als »unrussisch«, »jüdisch«, »international«. Europa hatte sich längst daran gewöhnt, in Lenin einen russischen Repräsentanten zu sehen. Die Emigranten hielten noch bei Nikolaus dem Zweiten. Sie hielten mit rührender Treue an der Vergangenheit fest, aber sie vergingen sich gegen die Geschichte. Und sie selbst reduzierten ihre Tragik.
Ach! sie mußten leben. Deshalb ritten sie in Pariser Hippodromen heimatliche Kosaken-Galoppe auf fremdblütigen Pferden, bekleideten sie sich mit krummen Türkensäbeln, die auf dem Flohmarkt von Glignaucourt erworben waren, führten sie leere Patronentaschen und stumpfe Dolche auf dem Montmartre spazieren, setzten sie auf ihre Häupter große Bärenmützen aus echten Katzenfellen und standen furchtbar anzusehn als Häuptlinge aus Dongebieten vor den Drehtüren der Etablissements, auch wenn sie in Wolhynien zur Welt gekommen waren. Manche avancierten auf unkontrollierbaren Nansen-Pässen zu Großfürsten. Es war ja auch gleichgültig. Alle konnten sie mit der gleichen Fertigkeit aus den Balalaikas Heimweh und Schwermut zupfen, rote Saffianstiefel mit silbernen Sporen tragen und hockend in tiefer Kniebeuge auf einem Absatz herumwirbeln. Eine Fürstin sah ich in einem Pariser Varieté eine russische Hochzeit darstellen. Sie war eine strahlende Braut, Nachtwächter aus der Rue Pigalle, als Bojaren verkleidet, wuchsen Spalier, wie aus Blumentöpfen, eine Kathedrale aus Pappe leuchtete im Hintergrund, aus ihr trat der Pope mit einem Bart aus Watte, gläserne Edelsteine funkelten im russischen Sonnenglanz, der aus dem Scheinwerfer floß und die Kapelle träufelte aus gedämpften Geigen das Lied von der Wolga in die Herzen des Publikums. Andere Fürstinnen waren Kellnerinnen in russischen Lokalen, Notizblöcke hingen an tulasilbernen Ketten an ihren Schürzen, ihre Köpfe standen stolz im Nacken, Musterbeispiele standhafter Emigrantentragik.
Andere, Gebrochene, saßen still auf den Bänken der Tuilerien, des Luxemburggartens, des Wiener Praters, des Berliner Tiergartens, an den Ufern der Donau in Budapest und in den Caféhäusern von Konstantinopel. Mit den Reaktionären eines jeden Landes hatten sie Verbindung. Sie saßen da und trauerten ihren gefallenen Söhnen und Töchtern nach, ihren vermißten Frauen – aber auch der goldenen Taschenuhr, dem Geschenk Alexanders des Dritten. Viele hatten Rußland verlassen, weil sie »das Elend des Landes nicht ansehen konnten«. Ich kenne russische Juden, die, noch vor wenigen Jahren von Denikin und Petljura »enteignet«, heute dennoch nichts mehr auf der Welt hassen als Trotzki, der ihnen nichts getan hat. Sie wollen ihren falschen Taufschein wieder haben, mit dem sie sich demütig, unwürdig einen verbotenen Aufenthalt in den großen russischen Städten erschlichen hatten.
In dem kleinen Hotel im Pariser Quartier Latin, in dem ich wohnte, lebte einer der bekannten russischen Fürsten, mit Vater, Frau, Kindern und einer »bonne«. Der alte Fürst war noch echt. Er kochte seine Suppe auf einem Spirituskocher, und, obwohl er mir bekannt war als eine antisemitische Kapazität und eine Leuchte im Bauern-Schinden, erschien er mir dennoch rührend an feuchten herbstlichen Abenden, durch die er frierend kroch, ein Symbol, kein Mensch mehr, ein Blatt, abgeweht vom Baum des Lebens. Aber sein Sohn, in der Fremde erzogen, elegant von Pariser Schneidern eingekleidet, von reicheren Großfürsten erhalten – wie anders war er! Im Telephonzimmer konferierte er mit gewesenen Leibgardisten, an falsche und an echte Romanows schickte er Ergebenheits-Adressen zu Geburtstagen und den Damen im Hotel legte er kitschige rosa Liebesbriefchen in die Schlüsselfächer. Zu zaristischen Kongressen eilte er in Automobilen und er lebte wie ein kleiner emigrierter Gott in Frankreich. Wahrsager, Popen, Kartenleser, Theosophen kamen zu ihm, alle, die die russische Zukunft kannten, die Wiederkehr der großen Katharina und der Trojkas, der Bärenjagden und der Kalorga, Rasputins und der Leibeigenschaft…
Alle verloren sich. Sie verloren das Russentum und den Adel. Und, weil sie nichts mehr gewesen waren als Adelige und Russen, hatten sie alles verloren. Sie sanken aus ihrer eigenen Tragik. Dem großen Trauerspiel entfielen die Helden. Die Geschichte ging unerbittlich ihren eisernen und blutigen Weg. Unsere Augen wurden müde, ein Elend zu betrachten, das sich selbst so billig gemacht hatte. Wir standen vor den Überresten, die ihre eigene Katastrophe nicht begriffen, wir wußten mehr von ihnen, als sie uns erzählen konnten, und, Arm in Arm mit der Zeit, gingen wir über die Verlorenen hinweg, grausam und dennoch traurig. –
II. Die Grenze Niegoreloje
Frankfurter Zeitung, 21 9. 1926
Die Grenze Niegoreloje ist ein großer brauner hölzerner Saal, in den wir alle eintreten müssen. Gütige Träger haben unsere Koffer aus dem Zug geholt. Die Nacht ist sehr schwarz, es ist kalt und es regnet. Deshalb sahen die Träger so gütig aus. Mit ihren weißen Schürzen und ihren starken Armen kamen sie uns helfen, als wir fremd an die Grenze stießen. Ein Mann, der dazu befugt war, hat mir noch im Zug den Paß abgenommen, mich meiner Identität beraubt. So, ganz und gar nicht ich, ging ich über die Grenze. Man hätte mich mit jedem beliebigen Reisenden verwechseln können. Später allerdings stellte es sich heraus, daß die russischen Zollrevisoren mich nicht verwechselten. Intelligenter als ihre Kollegen aus andern Ländern wußten sie, zu welchen Zwecken ich reise. Im braunen hölzernen Saal hatte man uns schon erwartet. Gelbe, warme elektrische Lampen waren an der Decke entzündet. Auf dem Tisch, an dem der Oberste der Zollrevisoren saß, brannte, freundliche Grüßerin aus vergangenen Zeiten, eine Petroleumlampe mit Rundbrenner und lächelte. Die Uhr an der Wand zeigte die osteuropäische Zeit. Die Reisenden, beflissen, ihr nachzukommen, rückten ihre Uhren um eine Stunde vor. Es war also nicht mehr zehn, sondern schon elf. Um zwölf mußten wir weiterfahren.
Wir waren wenige Menschen, aber viele Koffer. Die meisten gehörten einem Diplomaten. Sie blieben laut Gesetz unberührt. Keusch, wie sie vor der Abfahrt gepackt waren, müssen sie am Ziel ankommen. Sie enthalten nämlich sogenannte Staatsgeheimnisse. Dagegen werden sie sorgfältig in Listen eingetragen. Es dauerte lange. Der Diplomat beschäftigte unsere tüchtigsten Revisoren. Und indessen verstrich die osteuropäische Zeit.
Draußen, in der feuchten Schwärze der Nacht, rangierte man den russischen Zug. Die russische Lokomotive pfeift nicht, sondern heult wie eine Schiffssirene, breit, heiter und ozeanisch. Wenn man durch die Fenster die nasse Nacht sieht und die Lokomotive hört, ist es wie am Ufer des Meeres. In der Halle wird es beinahe behaglich. Die Koffer fangen an sich auszubreiten, aufzugehen, als wäre ihnen heiß. Aus dem dicken Gepäck eines Kaufmanns aus Teheran klettern hölzerne Spielzeuge, Schlangen, Hühner und Schaukelpferde. Kleine Stehaufmännchen schaukeln leise auf dem bleibeschwerten Bauch. Ihre bunten, lächerlichen Gesichter, von der Petroleumlampe grell beleuchtet, von vorüberhuschenden Schatten der Hände abwechselnd verdunkelt, werden lebendig, verändern ihren Ausdruck, grinsen, lachen und weinen. Die Spielzeuge klettern auf eine Küchenwaage, lassen sich wiegen, kollern wieder auf den Tisch und hüllen sich in raschelndes Seidenpapier. Aus dem Koffer einer jungen, hübschen und etwas verzweifelten Frau quillt schimmernde, schmale, bunte Seide, Streifen eines zerschnittenen Regenbogens. Dann folgt Wolle, die sich bauscht, bewußt atmet sie wieder frei nach langen Tagen luftloser, zusammengepreßter Existenz. Schmale graue Halbschuhe mit Silberspangen legen ihr Zeitungspapier ab, das sie verbergen sollte, die vierte Seite des »Matin«. Handschuhe mit bestickten Manschetten entsteigen einem kleinen Sarg aus Pappendeckel. Wäsche, Taschentücher, Abendkleider, groß genug um eine Hand des Revisors zu bekleiden, schweben empor. Alle spielerischen Utensilien einer reichen Welt, alle eleganten, polierten Sächelchen liegen fremd und dreifach nutzlos in dieser harten, braunen, nächtlichen Halle, unter den schweren Balken aus Eichenholz, unter den strengen Plakaten mit den eckigen Buchstaben wie geschliffene Beile, in diesem Duft von Harz, Leder und Petroleum. Da stehen die flachen und die bauchigen kristallenen Flakons mit den saphirgrünen und bernsteingelben Flüssigkeiten, lederne Maniküretuis öffnen ihre Flügel wie heilige Schreine, kleine Damenschuhe trippeln über den Tisch.
Niemals noch sah ich eine so genaue Visitation, auch nicht in den ersten Jahren nach dem Krieg, in der vollen Blütezeit der Revisoren. Es scheint doch, daß hier nicht eine gewöhnliche Grenze ist zwischen Land und Land, sie will eine Grenze sein zwischen Welt und Welt. Der proletarische Zollbeamte – der kundigste der Welt – wie oft hat er selbst verbergen und entkommen müssen! – revidiert zwar Bürger aus neutralen und selbst freundlichen Staaten, aber Menschen einer feindlichen Klasse. Das sind Abgesandte des Kapitals, Händler und Spezialisten. Sie kommen nach Rußland, vom Staat gerufen, vom Proletariat befehdet. Der Zollbeamte weiß, daß diese Kaufleute in den Läden Fakturen säen und daß dann in den Schaufenstern wunderbare, teure, dem Proletarier unerreichbare Waren aufgehen werden. Er revidiert zuerst die Gesichter und dann die Koffer. Er erkennt die Heimkehrenden, die jetzt mit neuen polnischen, serbischen, persischen Pässen versehen sind.
Spät, in der Nacht noch, stehen die Reisenden im Gang und können den Zoll nicht verschmerzen. Alles erzählen sie einander, was sie mitgebracht, was sie bezahlt und was sie geschmuggelt haben. Stoff genug für lange russische Winterabende. Die Enkel werden es noch hören müssen.
Die Enkel werden es hören und das merkwürdige, verworrene Antlitz dieser Zeit wird vor ihnen auftauchen, der Zeit an ihrer eigenen Grenze, der Zeit mit ihren ratlosen Kindern, den roten Revisoren, den weißen Reisenden, den falschen Persern, den Rotarmisten in den langen sandgelben Mänteln, deren Saum den Boden berührt, der feuchten Nacht von Niegoreloje, dem lauten Keuchen schwer bepackter Träger.
Kein Zweifel, diese Grenze hat historische Bedeutung. Ich fühle sie in dem Augenblick, in dem die Sirene breit und heiser aufheult und wir hinausschwimmen in dunkles, weites, ruhiges Land. –
III. Gespenster in Moskau
Frankfurter Zeitung, 28. 9. 1926
Wer leuchtet mir von den Plakatwänden entgegen? – Der »Maharadschah«. Mitten in Moskau! Gunnar Tolnaes, der stumme Tenor aus dem hohen Norden, schreitet siegreich durch Kanonendonner, Blut, Revolution, unverletzbar, wie jedes echte Gespenst. In seinem Gefolge befinden sich die ältesten Kinodramen Europas und Amerikas. Die Häuser, in denen sie gespielt werden, sind überfüllt. Hoffte ich nicht, den Maharadschahs und ihresgleichen zu entkommen, als ich hierherfuhr? Um ihn zu erblicken, bin ich nicht gekommen. Schicken sie uns den »Potemkin« und lassen sich dafür den Gunnar kommen, die Russen? Welch ein Tausch! Sind wir die Revolutionäre und sie die Spießer? Welch eine verrückte Welt! – – Mitten in Moskau spielt man den »Maharadschah« …
In den Auslagen der wenigen Frauen-Mode-Läden hängen alte Kostüme, lange, breite Glockenformen. Bei den Modistinnen kann man die ältesten Hutformen sehen. Auf den Köpfen der Bürgerinnen auch. Sie tragen breitrandige Hüte mit Reihern; Napoleonische Dreispitze; Kolpaks mit Schleiern; lange Haare und lange Kleider bis zu den Knöcheln. Und diese Tracht ist nicht nur die Folge einer Not, sondern zum Teil auch eine Manifestation konservativer Gesinnung. Justament bleiben sie beim Sonnenschirm.
Ich ging in den »Maharadschah«, um zu sehen, wer ihn besuchte: es waren die alten Kolpaks, die Schleier, die Mieder und die Sonnenschirme.
Es kam die alte, geschlagene Bourgeoisie. Man sieht es ihr an, daß sie die Revolution nicht überlebt, sondern nur überstanden hat. Ihr Geschmack hat sich in den letzten Jahren nicht gewandelt. Sie ist den Weg der europäischen und amerikanischen oberen und mittleren Gesellschaftsschichten nicht gegangen, den Weg vom Sommernachtstraum zur Negerrevue, von Kriegs-Auszeichnungen zu Gedenktagen, von der Helden-Verehrung zur Boxer-Verehrung, vom Ballett-Corps zum Girl-Bataillon und von der Kriegsanleihe zum Grab des Unbekannten Soldaten. Das alte russische Bürgertum ist im Jahre 1917 stehen geblieben. Es möchte im Kino die Sitten, Gebräuche, Schicksale, Möbelstücke seiner Zeitgenossen sehen: Offiziere, die nicht etwa bei der Roten Armee sind, sondern noch im feudalen Kasino verkehren; Liebes-Leidenschaften, die zum Polterabend führen und nicht zur zeremoniellen Sowjet-Ehe vor einem Matrikel-Schreiber; Duellmöglichkeiten zwischen Ehrenmännern; Schreibtische mit Dachgiebeln; Speiseschränke mit Nippes-Sachen; und romantische Erotik. Man möchte die Welt wiedersehen, in der man zwar auch schon unsicher gelebt hat, von der man aber heute glaubt, sie wäre paradiesisch gewesen. Deshalb sind die alten Kinodramen ausverkauft. In Paris werden sie schon unter dem höhnischen Titel: »20 Minuten vor dem Krieg« gegeben. Der französische Bürger lacht über dasselbe Schicksal, das sein russischer Klassengenosse mit ernster Spannung verfolgt.
Ich spreche jetzt vom alten russischen Bürger. Denn schon wächst ein neuer heran, mitten in der Revolution entsteht er, von ihr am Leben gelassen. Von ihren Gnaden darf er Geschäfte machen und ihre Einschränkungen versteht er zu umgehen. Stark, lebendig, aus einem ganz andern Material als sein Vorgänger, ein Freibeuter halb und halb ein Händler, trägt er mit einem gewissen Trotz seinen Namen: »Nepmann«, der im ganzen Land und jenseits der Grenzen einen degradierenden Klang hat. Ohne Sentimentalität, wie er ist, läßt er sich nicht bannen, weder von einer Weltanschauung noch von Gegenständen noch von Moden noch von literarischen und künstlerischen Erzeugnissen noch von einer Moral. Er unterscheidet sich ganz deutlich vom alten Bürger, ganz deutlich vom Proletariat. Er wird erst in einigen Jahrzehnten seine ihm passenden Formen, Traditionen und konventionellen Lügen haben – – wenn er am Leben bleibt…
Ich spreche also nicht von ihm, sondern vom alten Bürger und vom alten »Intellektuellen«. Er hat keine Lebenskraft mehr. Sein ehrlicher kleiner revolutionärer Idealismus, seine gutherzige, aber enge Liberalität ist vom großen Brand der Revolution erstickt worden – wie eine Kerze erlischt in einem brennenden Hause. Er leistet dem Sowjetstaate Dienste. Er lebt von kargen Gehältern und er führt immer noch seine alte Lebensweise in einem sehr reduzierten Umfang weiter. Er hat noch ein paar häßliche Andenken aus Karlsbad, ein Familienalbum, ein Lexikon, einen Samowar und Bücher mit Lederrücken. An stillen Abenden spielt seine Frau auf dem Klavier. Aber der Sinn seines Daseins war: ein nützliches Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft zu sein und seinen Sohn, wenn möglich, zu einem bedeutenden zu machen. Die äußeren Weihen seiner stillen Existenz waren kleine Auszeichnungen und kleine Rangerhöhungen, Gehaltszulage, private Familienfeier und zuverlässiger Schwiegersohn.
Nichts von all dem ist geblieben. Seine Tochter fragt ihn nicht, bevor sie zu irgendeinem Mann ins Zimmer zieht. Seinem Sohn kann er keine »Grundsätze« mehr fürs Leben geben. Der Sohn kennt sich in der russischen Gegenwart genauer aus, und er führt seinen Vater in ihr herum wie einen Blinden. Der Vater wird ohne Rang und ohne Ehren zu Grabe getragen werden. (Auch der Tod hat seine Feierlichkeit verloren.) Zwar dient er heute dem neuen Auftraggeber mit der alten Ehrlichkeit und Treue, die des Bürgers schönste Tugend ist. Er mag sogar mit dieser Welt zufrieden sein und sie bejahen. Und dennoch, dennoch ist er fremd und tot in ihr. Schon, daß er sie nicht ersehnt und nicht erkämpft hat und daß sie dennoch geworden ist, stellt ihn außerhalb ihrer eigentlichen, ihrer inneren Grenzen. Die blutige Entschiedenheit, mit der sie geworden ist, wird ihm immer unbegreiflich sein. Sein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl kann sich mit der Unvollkommenheit neuer Einrichtungen nicht zufrieden geben. Die Fehler der neuen Welt erspäht er mit einem viel schnelleren und kritischeren Auge als dereinst die Fehler der alten. Auch gegen diese hatte er sich aufgelehnt. Aber er war schließlich ihr Kind, auch als stiller Empörer. (Ein lauter ist er niemals gewesen.) Und so kommt es, daß in Rußland dasselbe liberale Bürgertum, das im Jahre 1905 mit dem wirklichen meuternden Panzerkreuz »Potemkin« sympathisierte, das in Odessa die rote Flagge der Rebellen grüßte und das schließlich von den Kosaken niedergeschossen wurde – – daß dieses Bürgertum heute den gefilmten »Potemkin« nicht mehr sehen will.
Die Geschmacksverirrungen des Vorkriegsbürgers; eine gewisse frischfröhliche ahnungslose Ekstase der Vorkriegsjugend; ein ganz bestimmter enger Eifer, der wie ein stumpfer Pfeil ist und infolgedessen nur Oberfläche trifft; eine bewußte Abgrenzung gegen alles, was man irrtümlicherweise »Luxus« und »nutzlos« in den neunziger Jahren genannt hat; ein freiwilliger Verzicht auf geistige Verwöhntheit und auf jene Anmut des Menschen, die bereits ins Metaphysische hineinreicht; eine hartnäckige Verwechslung der großen und weiten, allerdings nicht tagespolitischen Tendenz mit Tendenzlos-nur-Schönem und »Bürgerlich Spielerischem« – – das alles ist wieder das Gespenst der Revolutionären. Das haben sie vom aufgeklärten Liberalismus der kleinen französischen Bourgeoisie übernommen. Das sind die gesunden, rotwangigen, robusten Tages-Gespenster. Sie haben zu viel Fleisch und Blut, um lebendig zu sein.
Man hat Homer als eine Art »Religionsunterricht« vollkommen aus den Schulen abgeschafft. Nie mehr soll in Rußland ein Hexameter skandiert werden. Es ist sozusagen eine vollkommene Trennung von Staat und Humanismus durchgeführt worden. Sophokles, Ovid, Tacitus müssen also als Repräsentanten »bourgeoiser« Geistigkeit verstanden worden sein. Was die bürgerlichen Oberlehrer der klassischen Philologie am Altertum gesündigt haben, muß es selbst offenbar büßen. Welch eine Gelegenheit wäre hier gewesen, die Verlogenheiten alter Kommentare in wirklich revolutionärer Weise aufzudecken! Zu zeigen, wie weit entfernt die historische Wirklichkeit und auch die innere Wahrheit von der überlieferten edlen und »klassischen« Gebärde war; wie groß der Unterschied zwischen den aristokratischen Helden war, welche die Dreiruderer befehligen und den tausend Sklaven, die eng an die Ruderbänke gefesselt, die Flotte gegen einen »Feind« führen, der ihr Bruder ist; wie grausam, sinnlos und barbarisch der Tod der Dreihundert in den Thermopylen war – für ein Vaterland, das seinen Opfern zwei ganze Verszeilen schenkt; zu fragen, was mit den Witwen und Waisen dieser Dreihundert geschehen ist; zu lehren, daß Patroklus immer begraben liegt und daß Thersites immer zurückkehrt; die fürchterliche Leichenschändung, die Achilles an Hektor begeht, so zu lesen, wie Homer sie beschreibt – nämlich so, daß jeden ein Grauen schüttelt vor dem Protektionskind blinder, ungerechter, grausamer Götter – einer sozusagen herrschenden Klasse des Altertums; Ovids untertänige Schmeichelwidmungen nicht nur als Beispiele lateinischen »früh-epischen« Stils vorzutragen, sondern als abschreckendes Exempel einer Zeit, in der ein schaffender Mensch, also immerhin auch ein Arbeiter, seine Arbeit verrät und seine Würde verleugnet. – –
Das alles will also die Revolution in Rußland versäumen! Sie protegiert in der Schule das »Praktische«, das ohne Zweifel für morgen taugt, aber nicht mehr für übermorgen. Sie verzichtet auf das fundamentale Material, auf dem sie ihre Häuser bauen könnte, wie die alte Welt ihre Tempel und Paläste gebaut hat…
Es geht der Atem durch einen großen Teil des geistigen Lebens in Rußland, der bei uns vor zwanzig Jahren ein frischer war. Es war die Zeit, in der der »Schillerkragen« Rationalismus mit Naturbegeisterung auf jeder männlichen Brust entblößte. Neben ihm grassiert die »sexuelle Aufklärung«, die, wie man weiß, Schleier lüften will, aber Türen aufreißt. Hygiene wird Epidemie. Eine Literatur, die mit kleinbürgerlichen artistischen Mitteln arbeitet, hält schützend vor sich die dick aufgetragene Tendenz, so, daß man sie nicht treffen kann, will man die Revolution nicht verletzen. Eine billige Symbolik, die sprachliche Metaphern ins ursprünglich Gemalte und Geformte zurück-übersetzt, also gesprochene Bilder in Farben ausdrückt, kennzeichnet viele Ausstellungen der bildenden Kunst. Es gibt Plakate mit Buchstaben, die vor lauter Deutlichkeit unleserlich werden, Bögen, die in Giebel verwandelt sind, Kreise in Rechtecke, schwingende Rundungen in stumpfe Trapeze.
Daß Gott aufgehört hat, zu existieren, weil die Popen nicht mehr vom Staat erhalten werden, scheint die Überzeugung der meisten zu sein. Die Naivität in metaphysischen Fragen findet man in dieser Art und Vollkommenheit nur noch in Amerika. Und in Moskau kam es wirklich zu einem öffentlichen Disput zwischen dem Führer einer der häufigen amerikanischen Delegationen und einem Moskauer Professor über die Existenz Gottes und über die Verträglichkeit des Glaubens mit der marxistischen Weltanschauung. Und es war ganz wie in einem New Yorker Klub …
Es wäre freilich anders kaum möglich. Vielleicht muß die große Masse zuerst durch die Oberfläche der Erkenntnis. Sie ist ja kaum einige Jahre befreit von der tiefsten Blindheit! Wahrscheinlich muß es dauern, bis allgemein wird, was wirklich neu im Schöpferischen ist. Denn eine neue Art, zu schaffen und aufzunehmen, zu schreiben und zu lesen, zu denken und zu hören, zu lehren und zu erfahren, zu malen und zu betrachten, ist hier entstanden. Daneben bleibt alles andere, was es ist: gespenstisch. –
IV. Auf der Wolga bis Astrachan
Frankfurter Zeitung, 5. 10. 1926
Der Wolga-Dampfer, der von Nishnij-Nowgorod nach Astrachan geht, liegt weiß und festlich im Hafen. Er erinnert an einen Sonntag. Ein Mann schüttelt eine kleine, unerwartet starke Glocke. Die Lastträger laufen, nur mit Trikothosen und einem Tragleder bekleidet, durch die hölzerne Halle. Sie sehen aus wie Ringer. Vor dem Kassenschalter stehen Hunderte. Es ist die zehnte Stunde eines hellen Vormittags. Ein fröhlicher Wind weht. Es ist hier wie bei der Ankunft eines neuen Zirkus außerhalb der Stadt.
Der Wolga-Dampfer trägt den Namen eines berühmten russischen Revolutionärs und hat vier Klassen für Passagiere. In der ersten fahren die neuen Bürger Rußlands, die Nep-Männer, dem Sommerurlaub entgegen, in den Kaukasus und in die Krim. Sie essen im Speisesaal, im spärlichen Schatten einer Palme, gegenüber dem Porträt des berühmten Revolutionärs. Es ist über der Tür mit Nägeln befestigt. Die jungen Bürgerstöchter spielen auf dem harten Klavier. Es klingt wie das Anschlagen metallener Löffel an Teegläser. Die Väter spielen Sechsundsechzig und klagen über die Regierung. Einige Mütter haben eine deutliche Vorliebe für orangefarbene Schals. Der Kellner ist keineswegs klassenbewußt. Als die Dampfer noch nach den Großfürsten hießen, war er schon Kellner. Ein Trinkgeld bringt in sein Angesicht jenen Ausdruck unterwürfigen Respekts, der die ganze Revolution vergessen läßt.
Die vierte Klasse befindet sich tief unten. Ihre Passagiere schleppen schwere Bündel, billige Körbe, Musikinstrumente und ländliche Geräte. Alle Nationen, die an der Wolga und weiter, in der Steppe und im Kaukasus, wohnen, sind hier vertreten: Tschuwaschen, Tschuwanen, Zigeuner, Juden, Deutsche, Polen, Russen, Kasacken, Kirgisen. Es gibt hier Katholiken, Orthodoxe, Mohammedaner, Lamaisten, Heiden, Protestanten. Hier sind Greise, Väter, Mütter, Mädchen, Kinder. Hier sind kleine Landarbeiter, arme Handwerker, wandernde Musikanten, blinde Korsaren, fliegende Händler, halbwüchsige Schuhputzer und die obdachlosen Kinder, die »Bezprizorni«, die von der Luft und vom Unglück leben. Die Menschen schlafen in hölzernen Schubläden, in zwei Etagen übereinander. Sie essen Kürbisse, suchen nach Ungeziefer auf den Köpfen der Kinder, stillen Säuglinge, waschen Windeln, kochen Tee und spielen Balalaika und Mundharmonika.
Am Tage ist dieser enge Raum beschämend, laut und unwürdig. In der Nacht aber weht eine Andacht durch ihn. So heilig sieht die schlafende Armut aus. Auf allen Gesichtern liegt das echte Pathos der Naivität. Alle Gesichter sind wie offene Tore, durch die man in weiße, klare Seelen sieht. Verwirrte Hände wollen die schmerzenden Lampen vertreiben wie zudringliche Fliegen. Männer bergen ihre Köpfe in den Haaren der Frauen, Bauern umklammern die heiligen Sensen, Kinder ihre schäbigen Puppen. Die Lampen schaukeln im Takt der stampfenden Maschinen. Rotbackige Mädchen entblößen lächelnd ihr offenes, weißes, starkes Gebiß. Ein großer Friede ist über der armen Welt, und als ein durchaus pazifistisches Wesen erweist sich der Mensch, solange er schläft.
Auf eine so billig symbolische Weise: oben und unten – sind reich und arm auf dem Wolga-Dampfer nicht getrennt. Unter den Passagieren der vierten Klasse sind reiche Bauern, unter den Passagieren der ersten nicht immer reiche Händler. Der russische Bauer fährt lieber in der vierten. Sie ist nicht nur billiger. Der Bauer ist in ihr auch heimischer. Die Revolution hat ihn von der Demut gegenüber dem »Herrn« befreit, aber noch lange nicht von der Demut gegenüber dem Objekt. In einem Restaurant, in dem ein schlechtes Klavier steht, kann der Bauer seinen Kürbis nicht mit Appetit essen. Ein paar Monate lang fuhren alle in allen Klassen. Dann schieden sie sich, beinahe freiwillig.
»Sehen Sie«, sagte mir ein Amerikaner auf dem Schiff, »was hat die Revolution erreicht? Die armen Leute drängen sich unten und die reichen spielen Sechsundsechzig!«
»Das ist aber auch die einzige Tätigkeit«, sagte ich, »der sie sich ohne Sorgen hingeben können! Der ärmste Schuhputzer in der vierten Klasse hat heute das Bewußtsein, daß er zu uns heraufkommen könnte, wenn er nur wollte. Die reichen Nepleute fürchten aber, daß er jeden Augenblick kommen würde. ›Oben‹ und ›unten‹ sind auf unserem Dampfer längst nicht mehr symbolische, sie sind rein sachliche Bestimmungen. Vielleicht werden sie einmal wieder symbolisch sein.«
»Sie werden es wieder sein«, sagte der Amerikaner.
Der Himmel über der Wolga ist nah und flach und mit unbeweglichen Wolken bemalt. Zu beiden Seiten, hinter den Ufern, sieht man in weiten Fernen jeden emporragenden Baum, jeden aufsteigenden Vogel, jedes weidende Tier. Ein Wald wirkt hier wie ein künstliches Gebilde. Alles hat die Tendenz sich auszubreiten und zu zerstreuen. Dörfer, Städte und Völker sind weit voneinander entfernt. Gehöfte, Hütten, Zelte wandernder Menschen stehen da, umgeben von Einsamkeit. Die vielen verschiedenen Stämme vermischen sich nicht. Auch wer sich festgesetzt hat, bleibt sein Leben lang auf der Wanderung. Diese Erde gibt das Gefühl der Freiheit, wie bei uns nur das Wasser und die Luft. Hier würden auch die Vögel nicht fliegen wollen, wenn sie wandern könnten. Der Mensch aber streicht über das Land wie über einen Himmel, beschwingt und ohne Ziel, ein Vogel der Erde.
Der Fluß ist wie das Land: breit, unendlich lang (von Nishnij-Nowgorod bis Astrachan sind es mehr als zweitausend Kilometer) und sehr langsam. An seinen Ufern erwachsen erst spät die »Wolga-Hügel«, niedrige Würfel. Ihr nacktes felsiges Innere haben sie dem Fluß zugekehrt. Sie sind nur der Abwechslung wegen da, eine spielerische Viertelstunde Gottes hat sie geschaffen. Hinter ihnen dehnt sich wieder die Fläche, vor der die Horizonte zurückweichen, immer weiter, bis hinter die Steppe.
Ihren großen Atem schickt sie über die Hügel, über den Fluß. Man schmeckt die Bitternis der Unendlichkeit. Im Anblick der großen Berge und der uferlosen Meere fühlt man sich verloren und bedroht. Gegenüber der weiten Ebene ist der Mensch verloren, aber getröstet. Er ist nichts mehr als ein Halm, aber er wird nicht untergehen: Man ist wie ein Kind, das in der ersten Stunde eines Sommermorgens erwacht, wenn alle noch schlafen. Man ist verloren und geborgen zugleich in der unbegrenzten Stille. Wenn eine Fliege summt, ein gedämpfter Pendelschlag tönt, liegt in diesen Geräuschen dieselbe tröstliche, weil überirdische und zeitlose Trauer einer weiten Ebene.
Wir halten vor Dörfern, deren Häuser aus Holz sind und aus Lehm, mit Schindeln und mit Stroh gedeckt. Manchmal ruht die breite mütterliche gute Kuppel einer Kirche in der Mitte der Hütten, ihrer Kinder. Manchmal steht die Kirche an der Tête einer langen Hütten-Zeile und hat auf der Kuppel einen feinen spitzen langen Turm aufgepflanzt, wie ein vierkantiges französisches Bajonett. Es ist eine bewaffnete Kirche. Sie führt ein wanderndes Dorf an.
Kasan bleibt vor uns stehen, die Hauptstadt der Tataren. Ihre bunten Verkaufszelte lärmen am Ufer. Mit offenen Fenstern grüßt sie wie mit gläsernen Fahnen. Man hört das Getrappel ihrer Droschken. Man sieht das grüne und goldene abendliche Glänzen ihrer Kuppeln.
Eine Landstraße führt vom Hafen nach Kasan. Die Straße ist ein Fluß, es hat gestern geregnet. In der Stadt plätschern stille Teiche. Überreste eines Pflasters ragen selten in die Höhe. Die Straßentafeln und die Ladenschilder sind vom Kot bespritzt und unleserlich. Sie sind übrigens doppelt unleserlich, weil zum Teil in alter türkisch-tatarischer Schrift abgefaßt. Deshalb sitzen die Tataren lieber selbst vor den Läden und zählen jedem ihre Waren auf. Sie sind kluge Händler, wie man berichtet. Sie tragen schwarze Pinsel am Kinn. Seit der Revolution hat bei ihnen die alte Volkssitte des Analphabetismus um 25 Prozent abgenommen, jetzt können viele lesen und schreiben. In den Buchhandlungen liegen tatarische Schriften, die Zeitungsjungen rufen tatarische Blätter aus. Tatarische Beamte sitzen hinter dem Postschalter. Ein Postbeamter erklärte mir, die Tataren wären das tapferste der Völker. »Sie sind aber mit Finnen gemischt« – sagte ich boshaft. Der Postbeamte war beleidigt.
Mit Ausnahme der Gastwirte und der Händler sind alle mit der Regierung zufrieden. Die tatarischen Bauern haben im Bürgerkrieg bald mit den Roten, bald mit den Weißen gekämpft. Sie wußten manchmal gar nicht, worum es ging. Heute sind alle Dörfer des Kasaner Gouvernements politisiert. Die Jugend ist in den Komsomol-Organisationen. Wie bei den meisten mohammedanischen Völkern Rußlands ist auch bei den Tataren die Religion mehr Übung als Glaube. Die Revolution hat eher eine Gewohnheit zerstört als ein Bedürfnis unterdrückt. Die armen Bauern sind hier zufrieden wie überall in den Wolga-Gouvernements. Die reichen Bauern, denen man viel genommen hat, sind unzufrieden wie überall, wie die Deutschen in Pokrowsk, wie die Bauern von Stalingrad und die von Saratow.
Die Dörfer an der Wolga – mit Ausnahme der deutschen – liefern übrigens der Partei die gläubigsten jugendlichen Anhänger. In den Wolgagebieten kommt der politische Enthusiasmus vom Lande häufiger als aus dem städtischen Proletariat. Viele Dörfer waren hier von der Kultur am weitesten entfernt. Die Tschuwaschen zum Beispiel sind heute noch heimliche »Heiden«. Sie beten Götzen an und opfern ihnen. Für den naiven Naturmenschen aus dem Wolga-Dorf ist Kommunismus – Zivilisation. Für den jungen Tschuwaschen ist die städtische Kaserne der Roten Armee ein Palast und der Palast – der ihm auch offen steht – ein siebenhundertster Himmel. Elektrizität, Zeitung, Radio, Buch, Tinte, Schreibmaschine, Kino, Theater – also alles, was uns so ermüdet, belebt und erneuert den primitiven Menschen. Alles hat »die Partei« gemacht. Sie hat nicht nur die großen Herren gestürzt, sie hat auch das Telephon erfunden und das Alphabet. Sie hat den Menschen gelehrt, auf sein Volk stolz zu sein, auf seine Kleinheit, seine Armut. Sie hat seine niedrige Vergangenheit in ein Verdienst gewandelt. Vor dem Ansturm so vieler Herrlichkeiten erliegt sein bäuerliches instinktives Mißtrauen. Sein bewußter kritischer Sinn ist noch lange nicht wach. So wird er ein Fanatiker des neuen Glaubens. Das »kollektivistische Gefühl«, das dem Bauern fehlt, ersetzt er doppelt und dreifach durch Ekstase.
Die Städte an der Wolga sind die traurigsten, die ich je gesehen habe. Sie erinnern an die zerstörten Städte des französischen Kriegsgebiets. Diese Häuser brannten im roten Bürgerkrieg; und dann sahen ihre Trümmer den weißen Hunger durch die Straßen galoppieren.
Hundertmal, tausendmal starben die Menschen. Sie aßen Katzen, Hunde, Raben, Ratten und die verhungerten Kinder. Sie bissen sich die Hände wund und tranken ihr eignes Blut. Sie kratzten in der Erde nach fetten Regenwürmern und nach weißem Kalk, den das Auge für Käse hielt. Zwei Stunden, nachdem sie gegessen hatten, starben sie unter Qualen. Daß diese Städte überhaupt noch leben! Daß die Menschen feilschen und Koffer tragen und Äpfel verkaufen, Kinder zeugen und gebären! Schon wächst eine Generation heran, die das Grauen nicht kennt, schon stehen Gerüste da, schon sind Zimmerleute und Maurer beschäftigt, das Neue aufzurichten.
Ich wundere mich nicht darüber, daß diese Städte so schön sind nur aus der Höhe und aus der Ferne; daß mir in Samara ein Ziegenbock den Eintritt in das Hotel verwehrte; daß in Stalingrad ein Platzregen in mein Zimmer niederging; daß die Servietten aus buntem Packpapier sind. Wenn man über die schönen Dächer spazieren könnte, statt über das bucklige Pflaster!
Man kann in allen Städten des Wolgagebiets mit den Menschen dieselben Erfahrungen machen: Überall sind die Händler unzufrieden, die Arbeiter optimistisch, aber müde, die Kellner respektvoll und unzuverlässig, die Portiers demütig, die Schuhputzer unterwürfig. Und überall ist die Jugend revolutionär, – auch die Hälfte der bürgerlichen Jugend ist in den Pionier-und Komsomol-Organisationen.
Übrigens richten sich die Menschen nach meiner Kleidung: Wenn ich die Stiefel anziehe und ohne Krawatte bin, wird das Leben plötzlich märchenhaft billig. Die Früchte kosten ein paar Kopeken, eine Droschkenfahrt einen halben Rubel, man hält mich für einen ausländischen politischen Flüchtling, der in Rußland lebt, sagt »Genosse« zu mir, die Kellner haben proletarisches Bewußtsein und erwarten kein Trinkgeld, die Schuhputzer sind mit 10 Kopeken zufrieden, die Händler sind mit der Lage zufrieden, im Postamt bitten mich die Bauern, ich möchte ihnen eine Adresse auf ihren Brief schreiben, »mit klarer Schrift«. Wie teuer aber ist die Welt, wenn ich eine Krawatte anziehe! Man sagt: »Grashdanin« (Bürger) zu mir und schüchtern auch: »Gospodin« (Herr). Die deutschen Bettler sagen: »Herr Landsmann«. Die Händler fangen an, über die Steuern zu klagen. Der Wagenbegleiter erwartet einen Rubel. Der Speisewagenkellner erzählt, daß er eine Handelsakademie absolviert habe und »eigentlich ein intelligenter Mensch« sei. Er beweist es, indem er zwanzig Kopeken aufschlägt. Ein Antisemit gesteht mir, daß bei der Revolution nur die Juden gewonnen hätten. »Sogar in Moskau« dürften sie schon leben. Ein Mann möchte mir imponieren. Er erzählt, daß er im Krieg Offizier und in Magdeburg gefangen war. Ein Nep-Mann droht mir: »Alles werden Sie bei uns nicht sehen können!«
Indessen scheint es mir, daß ich in Rußland genau so viel, genau so wenig sehen kann wie in anderen fremden Ländern. Ich bin in keinem Lande noch von fremden Menschen so selbstverständlich, so freimütig eingeladen worden. Ich kann in Ämter, Gerichte, Spitäler, Schulen, Kasernen, Arreste, Strafanstalten, zu Polizeidirektoren und Universitätsprofessoren gehen. Der Bürger kritisiert lauter und schärfer, als dem Fremden angenehm ist. Ich kann mit dem Soldaten und mit dem Regimentskommandanten der Roten Armee in jedem Gasthaus über Krieg, Pazifismus, Literatur und Bewaffnung sprechen. In anderen Ländern ist es gefährlicher. Die Geheimpolizei ist wahrscheinlich so geschickt, daß ich sie nicht bemerke.
Die berühmten Lastträger an der Wolga singen immer noch ihre berühmten Lieder. In den russischen Kabaretts des Westens werden die »Burlaki« bei violettem Scheinwerfer und gedämpftem Geigenklang dargestellt. Aber die wirklichen Burlaki sind trauriger, als ihre Darsteller ahnen können. Obwohl sie mit traditioneller Romantik so stark belastet sind, gleitet ihr Gesang tief und schmerzlich in die Zuhörer. Sie sind wahrscheinlich die stärksten Männer dieses Zeitalters. Jeder von ihnen kann zweihundertundvierzig Kilogramm auf dem Rücken tragen, hundert Kilogramm von der Erde heben, eine Nuß zwischen Zeige-und Mittelfinger zermalmen, ein Ruder auf zwei Fingern balancieren, drei Kürbisse in fünfundvierzig Minuten essen. Sie sehen aus wie bronzene Denkmäler, die man mit menschlicher Haut überspannt und mit einem Tragfell bekleidet hat. Sie verdienen verhältnismäßig viel, vier bis sechs Rubel durchschnittlich. Sie sind stark, gesund, sie leben am freien Fluß. Aber ich habe sie noch nicht lachen sehen. Sie werden nicht froh. Sie trinken Schnaps. Der Alkohol vernichtet diese Riesen. Seitdem die Wolga Frachten trägt, leben die stärksten Träger hier und alle trinken. Heute verkehren auf der Wolga mehr als 200 Dampfer mit etwa 85 000 Indikatorstärken, einer Gesamt-Tonnage von 50 000 Tonnen. – 1 190 Lastschiffe ohne Motorbetrieb mit einer Gesamt-Tonnage von beinahe zwei Millionen Tonnen. Aber die Lastarbeiter ersetzen immer noch die Kräne wie vor zweihundert Jahren.
Ihr Gesang kommt nicht aus den Kehlen, sondern aus den unbekannten tiefen Winkeln des Herzens, in denen wahrscheinlich Gesang und Schicksal zusammen gewoben werden. Sie singen wie zum Tode Verurteilte. Sie singen wie Galeerensträflinge. Niemals wird der Sänger von seinem Tragfell frei werden, und niemals vom Schnaps. Solch ein Segen ist die Arbeit! Solch ein Kran ist der Mensch!
Selten hört man ein ganzes Lied, immer nur einzelne Strophen, ein paar Takte. Die Musik ist ein mechanisches Hilfsmittel, sie wirkt wie ein Hebel. Es gibt Lieder zu singen beim gemeinsamen Ziehen der Taue, beim Heben, beim Abladen, beim langsamen Versenken. Die Texte sind alt und primitiv. Ich habe verschiedene Texte zu denselben Melodien gehört. Einige handeln vom schweren Leben, vom leichten Tod, von tausend Pud, von Mädchen und von Liebe. Sobald die Last auf dem Rücken verstaut ist, bricht das Lied ab. Dann ist der Mensch ein Kran.
Es ist unmöglich, wieder das gläserne Klavier zu hören und Sechsundsechzig spielen zu sehen. Ich verlasse den Dampfer. Ich sitze auf einem winzigen Schiff. Zwei Träger schlafen neben mir einen weichen Schlaf auf einem gerollten Bündel dicker Taue. In vier, fünf Tagen sind wir in Astrachan. Der Kapitän hat seine Frau schlafen geschickt. Er ist seine eigene Bemannung. Jetzt brät er einen Schaschlik. Wahrscheinlich wird er fett und hart sein, und ich werde ihn essen müssen. –
Bevor ich ausstieg, beschrieb der Amerikaner mit dem Zeigefinger einen großen Bogen, zeigte auf die kalk-und lehmhaltige Erde und auf den sandigen Strand und sprach:
»Wieviel kostbares Material liegt hier ungenützt! Welch ein Strand für Erholungsbedürftige und Kranke! Welch ein Sand! Wenn all dies mitsamt der Wolga in der zivilisierten Welt läge!«
»Wenn das in der zivilisierten Welt gelegen wäre, würden hier Fabriken dampfen, Motorboote rattern, schwarze Kräne schweben, die Menschen würden krank werden, um sich dann zwei Meilen weiter im Sand zu erholen, und es wäre sicherlich keine Wüste. In einer bestimmten hygienisch einwandfreien Entfernung von den Kränen lägen Restaurants und Cafés hingestreut, mit ozonhaltigen Terrassen. Die Musikkapellen müßten das »Lied von der Wolga« spielen und einen schmissigen Wolga-Wellen-Charleston, Text von Arthur Rebner und Fritz Grünbaum…«
»Ah, Charleston!« rief der Amerikaner und freute sich. –
V. Die Wunder von Astrachan
Frankfurter Zeitung, 12. 10. 1926
In Astrachan beschäftigen sich viele Menschen mit Fischfang und Kaviarhandel. Der Geruch dieser Tätigkeit ist in der ganzen Stadt verbreitet. Wer nicht nach Astrachan kommen muß, der vermeidet es. Wer einmal nach Astrachan gekommen ist, der bleibt nicht lange dort. Zu den Spezialitäten dieser Stadt gehören die berühmten Astrachaner Pelze, die Lammfellmützen, der silbergraue »Persianerpelz«. Die Kürschner haben viel zu tun. Sommer und Winter (der Winter ist hier auch warm) tragen Russen, Kalmücken und Kirgisen Pelze.
Man erzählt mir, daß reiche Leute vor der Revolution in Astrachan gelebt hätten. Ich kann es nicht glauben. Man zeigt mir ihre Häuser, von denen einige im Bürgerkrieg vernichtet wurden. An den Trümmern erkennt man noch ihre gewesene geschmacklose und prahlerische Größe. Von allen Eigenschaften eines Bauwerks erhält sich die Prahlsucht am längsten, und noch der letzte Ziegelstein protzt. Die Erbauer sind geflüchtet, sie leben im Ausland. Daß sie mit Kaviar gehandelt haben, ist begreiflich. Aber weshalb wohnten sie hier, wo der (schwarze, blaue und weiße) Kaviar wächst und wo die Fische so unbarmherzig stinken? In Astrachan steht ein kleiner Park mit einem Pavillon in der Mitte und einer Rotunde in der Ecke. Am Abend zahlt man Eintrittsgeld, geht in den Park und riecht die Fische. Weil es dunkel ist, meint man, sie hängen in den Bäumen. Die Kino-Vorstellungen finden unter freiem Himmel statt, die primitiven Kabaretts ebenfalls. In einigen Kabaretts spielen Musikkapellen heitere Lieder aus vergangenen Zeiten. Man trinkt Bier und ißt die billigen rosaroten Krebse. Es vergeht keine Stunde, in der man sich nicht nach Baku sehnen würde. Leider verkehrt der Dampfer nur dreimal in der Woche.
Um intensiver an den Dampfer denken zu können, gehe ich zum Hafen. Vom Hafen Nr. 18 wird man nach Baku fahren dürfen. Übermorgen. – Wie weit ist Übermorgen! – Kalmücken rudern in Booten, Kirgisen führen Kamele am bekannten Halfterband in die Stadt, Kaviarhändler lärmen im Kontor, ahnungslose Bauern lagern im Grün, zwei Tage, zwei Nächte, und warten auf das Schiff, Zigeuner spielen Karten. Weil man hier so deutlich sieht, daß noch kein Dampfer kommt, ist die Stimmung im Hafen trauriger als in der Stadt. Eine entfernte Ahnung von Abreise gewährt eine Droschkenfahrt. Die Droschkensitze sind schmal, ohne Rückenlehne, lebensgefährlich, ohne Dach, die Pferde tragen lange weiße Ku-Klux-Klan-Gewänder gegen den Staub als gingen sie zum Turniere. Die Kutscher verstehen sehr wenig Russisch und hassen das Pflaster. Sie fahren durch die sandigen Straßen, weil ja das Pferd bekleidet ist. Der Fahrgast, der in einem dunklen Anzug abfährt, kommt in einem silbernen an. Wer einen weißen angezogen hatte, trägt am Ziel einen taubengrauen. Die für Astrachan ausgerüstet sind, tragen wie die Pferde lange Staubmäntel mit Kapuzen. In der spärlich beleuchteten Nacht sieht man, wie Gespenster von gespenstischen Pferden gefahren werden.
Ungeachtet dessen gibt es eine technische Hochschule, Bibliotheken, Klubs und Theater in Astrachan, Gefrorenes unter einer schaukelnden Bogenlampe, Früchte und Marzipan hinter bräutlichen Gazeschleiern. Ich betete um eine Linderung der Staubplage. Am nächsten Tag schickte Gott einen Platzregen. Die Decke meines Hotelzimmers, von Staub, Wind und Dürre verwöhnt, fiel erschrocken auf den Fußboden. Um so viel Regen hatte ich nicht gebetet. Es donnerte und blitzte. Die Straße war nicht mehr zu erkennen. Die Droschken rollten stöhnend bis zur Mitte der Räder im Schlamm, von den Felgen troffen graue, schwere, weiche Klumpen. Die Gespenster schlugen die Kapuzen zurück und spannten wohlbekannte menschliche Geräte auf. Auf dem Pflaster der Hauptstraße konnten zwei nicht aneinander vorüber. Einer mußte umkehren und mindestens fünf Meter zurückgehen, damit der andere passiere. Die Straße überquerte man in periodischen Sprüngen. Es war ein Glück, daß es nur eine nennenswerte Straße gab, in der sich die notwendigsten Einrichtungen befanden: Hotel, Schreibpapier, die Post und die Konditorei.
In jenen Astrachaner Tagen schien mir die Konditorei die wichtigste Institution zu sein. Sie wurde von einer polnischen Familie betrieben, die ein unerbittliches Schicksal von Czenstochau hierher verschlagen hatte. Ich beschrieb den Frauen ausführlich die Kleider, die man in Warschau trägt. Auch über die polnische Politik wußte ich divinatorisch viel zu sagen. Bedenken, die man in Astrachan in bezug auf einen Krieg zwischen Polen, Rußland und Deutschland hegte, konnte ich mit beredter Geschicklichkeit zerstreuen. In Astrachan bin ich ein amüsanter Plauderer.
Ohne diese Konditorei hätte ich nicht arbeiten können, das wichtigste Schreibmaterial ist Kaffee. Fliegen aber sind überflüssig. Und dennoch waren sie dabei, morgens, mittags, abends. Die Fliegen, nicht die Fische, machen achtundneunzig Prozent der Astrachaner Fauna aus. Sie sind ganz nutzlos, kein Handelsobjekt, niemand lebt von ihnen, sie leben von allen. In dicken schwarzen Schwärmen lagern sie auf Speisen, Zucker, Fensterscheiben, Porzellantellern, Überresten, auf Sträuchern und Bäumen, auf Kotlachen und Misthaufen und selbst auf kahlen Tischtüchern, auf denen ein menschliches Auge nichts Nahrhaftes sehen kann. Verschüttete Suppen, längst trockene Bestandteile des Stoffes, können die Fliegen aus den Molekülen schlürfen wie aus Löffeln. Auf den weißen Hemdblusen, die hier die meisten Männer tragen, sitzen tausende Fliegen, sicher und versonnen, sie fliegen nicht auf, wenn sich ihr Wirt bewegt, sie sitzen zwei Stunden auf seinen Schultern, sie haben keine Nerven, die Fliegen von Astrachan, sie haben die Ruhe großer Säugetiere, etwa der Katzen, und ihrer Feinde aus der Insektenwelt, der Spinnen…
Es wundert mich und ich bedaure es, daß diese intelligenten und humanen Tiere nicht in großen Scharen nach Astrachan kommen, wo sie nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden könnten. Zwar leben acht Kreuzspinnen in meinem Zimmer, stille, kluge Tiere, freundliche Genossen durchwachter Nächte. Am Tag schlafen sie in ihren Wohnungen. In der Dämmerung beziehen sie ihre Posten – zwei, die wichtigsten und die gefährlichsten, in der Nähe der Lampe. Lange und geduldig sehen sie ahnungslosen Fliegen zu, mit feinen haardünnen Beinen klettern sie an Stricken aus Nichts und Speichel, flicken und geben acht, umkreisen ein Tier auf weiten, weiten Umwegen, klammern sich geschickt an vorspringenden Sandkörnchen der Wand, arbeiten schwer und geistreich – – aber wie gering ist der Lohn! Tausend Fliegen summen im Zimmer, ich wünsche mir zwanzigtausend giftige Spinnen her, eine Armee von Spinnen! Bliebe ich in Astrachan, ich würde sie züchten und ihnen mehr Sorgfalt zuwenden als dem Kaviar.
Aber die Menschen in Astrachan kümmern sich nur um diesen. Sie fühlen die Fliegen gar nicht. Sie sehen zu, wie diese mörderischen Insekten auf ihrem Fleisch, ihrem Brot, ihren Früchten herumnagen, und rühren keine Hand. Ja, während auf ihren Bärten, Nasen und Stirnen Fliegen spazieren, reden sie gemütlich und lachen. In der Konditorei hat man jeden Kampf gegen Fliegen aufgegeben, man schließt nicht einmal die Glaskästen, nährt sie reichlich mit Zucker und Schokolade, man verwöhnt sie geradezu. Das Fliegenpapier, das ein Amerikaner erfunden hat und das ich von allen Segnungen der Kultur am tiefsten haßte, erscheint mir in Astrachan als ein Werk edler Humanität. Aber es gibt in ganz Astrachan kein einziges Stück jener köstlichen gelben Materie. Ich frage in der Konditorei: Warum haben Sie kein Fliegenpapier? Die Menschen gebrauchen Ausflüchte und sagen: Ach, wenn Sie doch Astrachan vor dem Krieg gesehen hätten, noch zwei Monate vor der Revolution! – Der Gastwirt sagt es und der Händler. Aus passiver Resistenz unterstützen sie die reaktionären Fliegen. Eines Tages werden diese kleinen Tiere das große Astrachan aufessen, die Fische und den Kaviar.
Den Fliegen von Astrachan ziehe ich die Bettler vor, deren es hier mehr gibt als in jeder anderen Stadt. Sie wandeln, laut schluchzend, singend, ihre Leiden ausschreiend, langsam durch die Straßen, gleichsam hinter ihrer eigenen Leiche, ergießen sich in alle Bierhallen, bekommen nur von mir eine Kopeke – und von dieser einen Kopeke leben sie! Von allen Astrachan-Wundern sind sie das erstaunlichste …
VI. Der auferstandene Bourgeois
Frankfurter Zeitung, 19. 10. 1926
Aus den Trümmern des zerstörten Kapitalismus steigt der neue Bürger hervor (nowij burjuj), der Nep-Mann, der neue Händler und der neue Industrielle, primitiv, wie in den Urzeiten des Kapitalismus, ohne Börse und Kurszettel, nur mit Füllfeder und Wechsel. Aus dem absoluten Nichts entstehen Waren. Aus Hunger macht er Brot. Aus allen Fensterscheiben macht er Schaufenster. Eben ging er noch barfuß – schon fährt er in Automobilen. Er verdient und zahlt Steuern. Er mietet vier, sechs und acht Zimmer und zahlt Steuern. Er fährt im Schlafwagen, fliegt im teuren Aeroplan und zahlt Steuern. Der Revolution scheint er gewachsen zu sein – sie hat ihn ja selbst geboren. Das Proletariat steht vor seinen Schaufenstern und kann seine Waren nicht kaufen – als wär’s ein kapitalistischer Staat. An vielen Gefängnissen streift der neue Bürger vorbei – in mehreren hat er schon gesessen. Der Verlust der »bürgerlichen Ehrenrechte« kann ihm gleichgültig sein; denn er besitzt gar keine. Er will nicht befehlen, er will nicht regieren, er will nur erwerben. Und er erwirbt.
Diese neue russische Bourgeoisie bildet noch keine Klasse. Sie hat weder die Tradition noch die Stabilität, noch die Solidarität einer sozialen Klasse. Sie ist eine dünne, lockere Schicht aus sehr beweglichen und sehr verschiedenen Elementen. Unter dem Dutzend neuer Bürger, die ich kenne, war einer früher Offizier, ein anderer ist ein grusinischer Edelmann, eine Art »Häuptling«, der dritte war Bäckergeselle, der vierte Staatsbeamter, der fünfte Kandidat der Theologie, Alle tragen die Zufallskleidung, die sie äußerlich proletarisiert. Alle sehen aus, als hätten sie sich auf der Flucht vor einer Katastrophe angezogen. Alle tragen die russische Hemdbluse, die ebenso nationales Kostüm wie revolutionäre Manifestation sein kann. Diese Kleidung des neuen Bürgers ist nicht nur die unmittelbare Folge seines Willens, nicht aufzufallen, sondern auch seiner besonderen Wesensart bezeichnender Ausdruck. Denn er ist nicht ein Bürger, wie wir ihn kennen, wie er etwa in Frankreich vorbildlich und für literarische Verwertung reif von Gott und den Verhältnissen jeden Tag erschaffen wird. Der neue russische Bourgeois hat keinen Familieninstinkt, kein intimes Verhältnis zu seinem Haus, seiner Abstammung und seinen Nachfolgern, keine »Prinzipien«, die er ihnen vererben könnte, und keine materiellen Güter, die er ihnen vererben dürfte. In seiner gutausgestatteten Wohnung ist er selbst und seine Familie nicht zu Hause, sondern wie heimische Gäste. Ein Sohn ist kommunistisch gesinnt, ein Komsomol; mit feindseligem Blick betrachtet er sein Elternhaus, morgen wird er fortziehen, heute schon lebt er von eigener Hände Parteiarbeit. Die Tochter geht ohne eine Kopeke Mitgift, ohne väterliche Begleitung zum Standesamt und heiratet in drei Minuten einen Rotarmisten. Der bürgerlich gesinnte Sohn findet keinen Platz an der überfüllten Hochschule und rüstet zu ungesetzlicher, also gefährlicher Abreise ins Ausland. Das Geld, das man verdient, wird nicht »angelegt«, sondern ausgegeben, verlebt oder vergraben oder gegen hohe Zinsen an gute und verschwiegene Bekannte verliehen. Die Familie – Urzelle und Festung des bürgerlichen Lebens zugleich – ist nicht mehr vorhanden. Dafür kennt der neue Bürger aber auch nicht jene lauwarme bürgerliche Atmosphäre, die schützt, aber auch schwächt; keine Fürsorge, die Liebe weckt, aber auch Enge erzeugt; keinen Opferwillen, der heroisch sein kann, aber auch belanglos ist; keine Sentimentalität, die rührend ist, aber auch falsch. Der neue Bürger ist ein revolutionärer Bürger. Er ist in seiner Art mutig, weil von Rücksichten frei; er ist hemmungslos, weil ohne Prinzip; er ist auf alles gefaßt, weil er das meiste schon erlebt hat. Er war zum Teil aktiv an der Revolution beteiligt. Das ist der Bürger, von dem Lenin 1918 schrieb: »Wie kann man so blind sein und nicht sehen, daß unser Feind der kleine Kapitalist und der Spekulant ist? Dieser fürchtet mehr als jeder andere den Staatskapitalismus; denn sein erstes Ziel ist ja, alles Mögliche an sich zu raffen, alles, was nach dem Sturz der Großgrundbesitzer und großen Spekulanten übriggeblieben ist. In dieser Beziehung ist er sogar noch revolutionärer als der Arbeiter – denn er ist auch rachsüchtig. Er leistet willige Beihilfe im Kampf gegen die Großbourgeoisie – – um die Früchte des Sieges für seine eigenen Interessen zu ernten.« Acht Jahre sind seit damals vergangen. Der Spekulant erntet die Früchte des Siegs und er ist auf dem Weg, selbst ein Großkapitalist zu werden.
Es gibt in Rußland aber nicht nur diesen aktiven, sichtbaren neuen Händler und Industriellen. Es gibt viele stille, maskierte, sozusagen passive Bürger. Ihnen ist es gelungen, bares Gold mitten in der Revolution zu verbergen oder sich anzueignen. Heute gehen sie in Stellungen, leben in proletarischer Enge, geben vor, mit hundert Rubel im Monat auszukommen und verleihen ihr Geld gegen hohe Zinsen an furchtlosere Freunde – die in zwei, drei Jahren ebenfalls Kapital haben werden, um es zu verleihen. So spielt sich unter der Decke ein regelloses kapitalistisches Leben ab, ein Kaufen und Verkaufen, ein Borgen und Verzinsen, ein gefahrvolles Leben, das dem modernen tüchtigen Nep-Mann die wesentlichen Züge eines Räuberhauptmanns verleiht.
Das alles ist nicht imstande, das Proletariat zu beunruhigen. Die reichen Leute – so rechnet man – werden von den zunehmenden Staatsbetrieben erdrückt. In fünf Jahren sind sie nicht mehr vorhanden. »Es ist eine Übergangszeit« – sagen die Arbeiter. Sie meinen, es wäre ein Übergang zum sozialistischen Staat.
Aber auch die Bürger sagen: »Es ist eine Übergangszeit« und sie meinen, es wäre ein Übergang zur kapitalistischen Demokratie. Beide warten auf das Kommende und stören einander vorläufig nicht merkbar. Wenn es wahr ist, daß das Proletariat die herrschende Klasse ist, so ist sicherlich das neue Bürgertum die genießende Klasse. Das Proletariat hat alle Institutionen des Staates. Die neue Bourgeoisie hat alle Institutionen der Bequemlichkeit. Es gibt beinahe kein Übereinander. Es gibt ein Nebeneinander. Das Theater gehört dem Arbeiter. Aber in der Loge sitzt der Bürger. Der Arbeiter hat das Bewußtsein, Hausherr und Vermieter der Loge zu sein. Den Bürger stört die Umgebung, die revolutionäre Aufmachung, der Gedanke, ein Transport würde beschlagnahmt, eine Steuer erhöht werden. Der Proletarier geht in den Klub, sieht einen Film, spielt Domino, hört einen Vortrag, trinkt einen Tee am Büfett für zehn Kopeken und weiß, daß dieses Haus, in dem sich der Klub befindet, einmal einem Kapitalisten gehört hat, der jetzt enteignet ist. Das ist ein greifbarer Erfolg. Der enteignete Kapitalist – oder ein anderer an seiner Stelle – geht am Abend in die Halle des großen Hotels, wo zwar ein Bild von Lenin hängt, aber auch eins von Fragonard, der » Combat de la Flute« aus dem Speisezimmer meiner Tante, und wo die unvermeidliche Appetitspalme fünfzig teure Liköre beschattet. Hierher haben selbst die Bettler, die überall hinkommen, keinen Zutritt. Es ist eine ganz großbürgerliche Welt, wie im Westen Europas. Da das Trinkgeld nicht gesetzlich abgeschafft, sondern nur unwürdig geworden ist, nehmen es die Kellner mit untertänigem Dank. Hierher kommt kein Proletarier. Vor acht und neun Jahren hat er diese »Paläste« gestürmt. Heute erwartet er, daß sie eines Tages geräumt werden.
Der neue Bürger ist nicht gesonnen, sie zu räumen. Auch er wartet – daß die Arbeiterklubs eines Tages geräumt werden. Beide haben Geduld …
VII. Das Völker-Labyrinth im Kaukasus
Frankfurter Zeitung, 26. 10. 1926
Wir landen am Abend in Baku. Das ist die Hauptstadt Aserbeidschans und des Petroleums. Sie besteht aus einem neuen (europäischen) und einem alten (asiatischen) Teil. Die europäischen Straßen sind breit, hell und heiter. Das asiatische Baku ist kühl, dunkel und beklemmend. Vor die breiten, stolzen, schönen Bogenfenster sind dichte Drahtgitter gespannt. Jedes Haus ist ein Palast, und alle Paläste sind Gefängnisse. Junge Mohammedanerinnen tragen weiße und blaue Tücher vor dem Mund; sie sehen aus wie eingemauert: jede ihr eigenes Gefängnis. Den mohammedanischen Bettlern vor dem großen Tor der alten Stadt braucht man nichts zu schenken: sie sind Ornamente. Alte Sejiden, Nachfolger Mohammeds, im weißen, dickgeflochtenen Turban, kauen Sonnenblumenkerne. Die leichtsinnigen Schalen bleiben in den gelblichgrauen Barten hängen. Dumme, unbegabte Händler sitzen auf Steinen, zehn Blätter vergilbten Briefpapiers liegen vor ihnen, nichts tun sie für ihre Waren. Hinter finstern, langen und schmutzigen Hausfluren leuchten weiße Höfe aus Stein, mit Zierbrunnen, weit, märchenhaft, rechteckig, langweilig. Es scheint mir, daß die tausendundeins Nächte in Baku ein verlorener Posten sind: einige Kilometer weiter spritzt Petroleum aus der Erde …
Dennoch ist der Marktplatz exotisch: viele schmale und schmutzige Gassen; Passagen, die als Markthallen verwendet werden; unzählige kleine Kaufläden mit Schildern in türkischer, persischer, armenischer Sprache. Was ist das für ein bekannter, lateinisch gedruckter Name? Wer heißt hier »Levin«? Mit Vornamen »Arvad Darzah« allerdings? Es ist ein Bergjude. Er handelt mit Sohlenleder. Obwohl er der Rasse nach ein Tatte ist, also nicht einmal Semit, spricht er dennoch ein mangelhaftes Deutsch. Vorbeiwandernden Kamelen bläst er aus einer langen Pfeife Rauch in die traurigen Gesichter. Welch unwahrscheinlich pathetische Tiere! Ihre Dummheit ist von einer ganz besonderen Art: es ist eine feierliche Dummheit. Vielleicht wirken sie in der Wüste natürlicher. Dieser exotische Marktplatz – für Kamele ist er noch immer nicht exotisch genug. Vor dem Laden des Genossen Levin sehen sie aus wie mißlungene Pferde.
Es riecht nach brennendem Fell. An der Ecke ist die »Kuschetschnaja«, ein Schnell-Imbiß. Das Fett der Lämmer wird, glaube ich, über Gebühr gewürdigt. Es schmort prasselnd über offenem Feuer. Vorläufig bohrt der Verkäufer in der Nase. Ich passiere ein Durchgangshaus. Menschen wohnen in weitgeöffneten Läden. Halbnackte Frauen schaukeln hart und hastig über zischenden Wascheimern. Greise schlummern auf den Steinen. Ein ruhiges Alter ist ihnen beschieden. Kinder spielen Karten in einem Tümpel. Achtung! Nicht zertreten! Verkäufer rufen mir nach. Was soll ich kaufen? Orientalische, flache, ungesäuerte Brote, »Mazzes« der Juden; einen grusinischen Gürtel für sechs Rubel, ein dünnes Leder, silberne Platten hängen daran, eine »Akquisition« für Engländer; einen Dolch in tulasilberner Scheide; grüne Schnürsenkel. Haarnadeln soll ich mir anschaffen, Manschettenknöpfe mit türkischen Segenssprüchen, einen Tabakbeutel aus Ziegenleder, einen Kranz Knoblauch, ein Lendenstück von einem Hammel, frischgeschlachtet, blutrot, appetitlich, runden Schafskäse, Uhren ohne Zeiger, falsche Juwelen, giftgrüne Hosenträger, äußerst schlaffe Symbole der Zivilisation. Lastträger vom Hafen, groß, stark, schwarz, mit Bartstoppeln in traurigen und müden Gesichtern, stehen mir im Weg. Von Stand zu Stand gehen sie langsam. Es ist keineswegs ihre Absicht, zu kaufen: Erfahrungen wollen sie sammeln. Halbwüchsige Jungen tragen Erfrischungswasser in irdenen Krügen auf dem Kopfe. Ihre Füße laufen, ihre Köpfe stehen. Die Gefäße ruhen sicher wie auf eisernen Sockeln. Barfüßige Mädchen, ansichtskartenhaft, gehen um Wasser zu Brunnen, durstige Eimer hängen am Tragholz, das quer über der rechten Schulter liegt. Die Repräsentanten der kaukasischen Bergvölker tragen riesige, wilde, zottelige Pelzmützen. Was haben, frage ich vergeblich, diese Mützen für einen Zusammenhang mit den Bergen?
Es wimmelt hier von schweren Pelzmützen, die meisten kaukasischen Völker sind hier vertreten. Und wieviele gibt es auf dem riesigen Gebiet des Kaukasus, auf den 455 000 Quadratkilometern? Vierzig bis fünfundvierzig zählte ein veralteter Führer. Im nördlichen Kaukasus allein mußten nach der Revolution neun Republiken errichtet werden. Daß dort die Nogaier, die Kara-Nogaier (schwarze Nogaier), die Turkmenen (die heute noch Nasenringe tragen) und die schöngebildeten Karatschaier leben, wußte ich. Daß in Kurdistan die Kurden, in Karabach die Armenier wohnen, haben wir alle gelernt. Von wievielen Völkern aber weiß mir ein Gelehrter, der finnische Philologe Stimumagi, im Aserbeidschanischen Forschungsinstitut zu erzählen! Er kennt die Mugalen und Lesgier, kunstfertige Handwerker, dagestanischer Rasse; im Kubruischen Ujezd allein fünf kleine Stämme: die Chaputlinzen, die Chinalugen, die Buduchen, die Tschekzen, die Krislen; die 50 000 Küriner, südlich von den Lesgiern; die Tatten, die ein Rest alter Perser sind – im 6. und 7. Jahrhundert als lebendige Wälle gegen Chasaren und Hunnen angesiedelt; im Bezirk Nucha die Wartäschen und Nidseh; die Talyschen im Lengoran-Bezirk. In den muganischen Steppen leben die russischen Bauernsekten, der Zar hat sie zwangs-und strafweise hier angesiedelt: die Duchoborzen, Molokaner, Starowierzy und Sobotniki. In den reichen Weinbaudörfern Geudscha und Schamachow leben Landsleute, Schwaben. Sie sind zum großen Teil menonitischen Glaubens. In den Dörfern Priwolnaja und Pribosch leben die interessantesten Juden der Welt: nämlich die reinarischen. Es sind russische Bauern, die früher einmal Sobotniki waren, Sabbat-Heiliger. Als sie von der offiziellen Kirche und den Behörden verfolgt wurden, gingen sie aus Zorn und Trotz zum Judentum über. Sie nennen sich selbst »Gerim« (hebräisch: »Fremde«), sehen slawisch aus, leben von Ackerbau und Viehzucht und sind neben den weißrussischen, semitischen, »echten« Juden die frömmsten der Sowjet-Union.
Ein Rassenantisemit käme diesen Juden gegenüber in eine große Verlegenheit. Eine noch größere würden ihm die »Bergjuden« bereiten. Ich habe sie besucht. Sie sind, obwohl ihre Orthodoxen es selbst behaupten, keine Semiten, – meint die Wissenschaft. Sie gehören der tattischen Rasse an. Ich erfahre, daß die Zionisten vor dem Krieg Verbindungen mit den Bergjuden angeknüpft haben. Es erwies sich, daß der bergjüdische Klerus – im Gegensatz zu seinen semitischen ostjüdischen Kollegen orthodoxer Prägung – dem Zionismus freundlich gesinnt war. Der Krieg hat diese Beziehungen unterbrochen, die Revolution hat sie zerstört. Die kommunistische bergjüdische Jugend ist nicht nur antiklerikal, sondern zeigt auch Nationalbewußtsein – nämlich tattisches, nicht etwa jüdisches. Unsere Stammesgenossen, sagen die jungen Bergjuden, sind nicht etwa die Juden der Welt, sondern die mohammedanischen und armenisch-katholischen Tatten. Man hat also jetzt die ersten Schulen – vorläufig zwei – mit tattischer Unterrichtssprache eröffnet. Eine tattische Schrift hat es niemals gegeben. Man kam auf den unpraktischen Ausweg hebräische Schriftzeichen für die tattische Sprache zu verwenden. Indessen haben sogar die Türken das lateinische Alphabet angenommen.
Nach einer – immer noch bestrittenen – Theorie sind die Völker des Kaukasus japhetidischer oder alarodischer Rasse. Japhetiden sollen einmal alle Mittelmeergebiete bevölkert haben, die biblischen Chetiter waren Japhetiden, die Urartu aber Chalden, die Nairi und Mittani, die in den assyrischen Keilinschriften vorkommen, die Urbevölkerung von Cypern und Kreta, die Pelasger, die Etrusker und Ligurier, die Iberier – und ihr heutiger Überrest: die pyrenäischen Basken. Indoeuropäer haben die Japhetiden verdrängt, Iraner kamen in den Kaukasus, iranisierten die von den Sassaniden angesiedelten Stämme, die Araber brachten ihnen den Islam, die Türken die türkische Sprache. Eine allgemeine Assimilation ist niemals gelungen. In den unzugänglichen Schluchten und Tälern des Kaukasus leben die letzten Überreste einer sonst längst verschwundenen Exotik, längst verrauschter Kulturen. Die ganze Entwicklung des Menschengeschlechts ist an lebendigen Exempeln im Kaukasus zu sehen: der Weg vom primitiven Höhlenbewohner zum seßhaften Ackerbauer, vom kriegerischen Nomaden zum friedlichen Hirten, vom wilden Jäger zum pazifistischen Duchoborzen, der vegetarisch aus Religion ist…
Alle diese Völker haben heute vollkommen nationale Autonomie