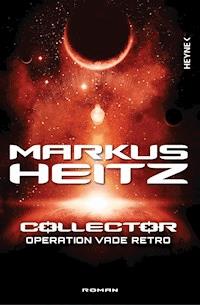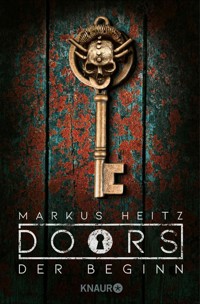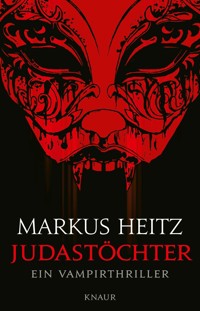
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Pakt der Dunkelheit
- Sprache: Deutsch
Die Vampirin Sia ist das letzte der todbringenden Judaskinder – und zu allem bereit, um zu verhindern, dass der Fluch an Emma und Elena, ihre einzigen Nachfahren, weitergegeben wird. Als die beiden entführt werden, beginnt für Sia daher ein mörderischer Wettlauf mit der Zeit: Denn gelingt es ihr nicht, die unschuldige Frau und ihr Kind zu retten, könnten sie zu Töchtern des Judas werden. Und dann muss Sia die beiden töten … Judastöchter von Markus Heitz: Urban Fantasy im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 796
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Markus Heitz
Judastöchter
Ein Vampirthriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Ich habe versagt. Aber das wird mir nie wieder passieren!« Ihr unsterbliches Leben hat die Vampirin Sia einem einzigen Zweck gewidmet: ihre letzten beiden Nachfahren zu beschützen. Sie kann trotzdem nicht verhindern, dass Emma und die junge Elena entführt werden. Es dauert nicht lange, und die Entführer schicken Sia einen Boten: Will sie Emma und Elena lebend wieder sehen, muss sie eine Gruppe von Gestaltwandlern töten. Sia geht zum Schein auf den Deal ein, während sie tatsächlich Jagd auf die Erpresser macht. Doch auch von den Gestaltwandlern geht eine tödliche Gefahr aus …
Inhaltsübersicht
Dramatis Personae
Dramatis Personae (passiv)
Besondere Vampirsorten
Begriffe
Prolog
26. Januar, Großbritannien,York, 16.21 Uhr
Kapitel I
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 13.04 Uhr
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 17.36 Uhr
2. Februar, Großbritannien,Nordirland, Omagh, 16.36 Uhr
Kapitel II
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 18.36 Uhr
2. Februar, Republik Irland,Cork, 20.36 Uhr
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 19.01 Uhr
2. Februar, Großbritannien,Nordirland, Omagh, 20.35 Uhr
Kapitel III
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 20.21 Uhr
2. Februar, Großbritannien,Nordirland, Omagh, 20.51 Uhr
3. Februar, Deutschland,Brandenburg, Schwielowsee, 02.49 Uhr
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 22.01 Uhr
Kapitel IV
2. Februar, Republik Irland,Cork, 21.17 Uhr
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 23.09 Uhr
3. Februar, Deutschland,Berlin, Gesundbrunnen, 10.14 Uhr
Kapitel V
2. Februar, Großbritannien,Nordirland, Omagh, 22.21 Uhr
3. Februar, Großbritannien,Nordirland, Cookstown, 09.17 Uhr
3. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 00.02 Uhr
Kapitel VI
3. Februar, Großbritannien,Nordirland, Maghera, 13.32 Uhr
3. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 02.21 Uhr
3. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 06.01 Uhr
Kapitel VII
3. Februar, Großbritannien,Nordirland, Omagh, 22.23 Uhr
3. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 05.41 Uhr
4. Februar, Großbritannien, Nordirland,in der Nähe der Dundrum Bay, 07.42 Uhr
Kapitel VIII
3. Februar, Republik Irland,Kerry, 10.11 Uhr
3. Februar, Frankreich,21.21 Uhr
4. Februar, Großbritannien, Nordirland,in der Nähe der Dundrum Bay, 07.59 Uhr
3. Februar, Deutschland,Berlin, Gesundbrunnen, 12.31 Uhr
4. Februar, Großbritannien, Nordirland,Richtung Dundrum Bay, 08.38 Uhr
Kapitel IX
4. Februar, Großbritannien,London, 04.38 Uhr
4. Februar, Großbritannien,Nordküste von Wales, 23.51 Uhr
5. Februar, Irische Seezwischen Irland und Wales,08.38 Uhr
5. Februar, Großbritannien,Republik Irland, Wicklow, 09.00 Uhr
Kapitel X
5. Februar, Republik Irland,Dublin, 06.43 Uhr
5. Februar, Großbritannien,Republik Irland, Wicklow, 09.10 Uhr
5. Februar, Großbritannien, Republik Irland,Wicklow, 14.21 Uhr
5. Februar, Republik Irland,Kerry, 13.41 Uhr
Kapitel XI
5. Februar, Großbritannien,Republik Irland, Wicklow, 16.07 Uhr
5. Februar, Großbritannien, Republik Irland,Wicklow, 22.23 Uhr
3. Februar, Deutschland,Berlin, Gesundbrunnen, 12.45 Uhr
6. Februar, Großbritannien, Republik Irland,Arklow, 00.23 Uhr
Kapitel XII
6. Februar, Großbritannien, Nordirland,30 Meilen südlich von Londonderry, 06.32 Uhr
6. Februar, Großbritannien, Nordirland,06.40 Uhr
6. Februar, Großbritannien, Nordirland,Londonderry, 19.45 Uhr
Kapitel XIII
3. Februar, Deutschland,Berlin, Gesundbrunnen, 13.14 Uhr
6. Februar, Großbritannien, Nordirland,Londonderry, 20.32 Uhr
6. Februar, Großbritannien, Nordirland,Newry, 10.01 Uhr
Kapitel XIV
7. Februar, Großbritannien, Nordirland,Craigavon, 09.43 Uhr
7. Februar, Irland,Sliabh-an-Iarainn im County Leitrimin der Provinz Connacht, 18.07 Uhr
7. Februar, Großbritannien, Nordirland,Coleraine, 22.19 Uhr
Kapitel XV
7. Februar, Großbritannien, Nordirland,Craigavon, 15.21 Uhr
7. Februar, Großbritannien, Nordirland,Coleraine, 21.11 Uhr
8. Februar, Großbritannien, Nordirland,Ballymena, 00.19 Uhr
8. Februar, Republik Irland,Sligo, 13.45 Uhr
Kapitel XVI
7. Februar, Großbritannien, Nordirland,Coleraine, 23.12 Uhr
8. Februar, Großbritannien, Nordirland,Ballymena, 08.24 Uhr
9. Februar, Irland,Shannon, 09.21 Uhr
Kapitel XVII
9. Februar, Irland,Shannon, 10.01 Uhr
9. Februar, Irland,Kilkenny, 11.15 Uhr
9. Februar, Irland,Belfast, 12.38 Uhr
Kapitel XVIII
9. Februar, Irland,Shannon, 11.11 Uhr
9. Februar, Irland,Belfast, 13.31 Uhr
10. Februar, Irland,Shannon, 00.32 Uhr
8. Februar, Republik Irland,Sligo, 14.45 Uhr
10. Februar, Irland,nordwestlich von Galway, 01.56 Uhr
Kapitel XIX
9. Februar, Irland,Dublin, 08.01 Uhr
10. Februar, Irland,nordwestlich von Galway, 02.22 Uhr
16. Februar, Irland,Shannon, 08.34 Uhr
16. Februar, Norwegen,Oslo, 07.39 Uhr
Kapitel XX
18. Februar, Nordirland,Maghera, 12 Uhr
Kapitel XXI
18. Februar, Nordirland,Belfast, 12.51 Uhr
18. Februar, Nordirland,Maghera, 12.51 Uhr
23. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 21.03 Uhr
24. Februar, Norwegen,Oslo, 19.01 Uhr
Epilog
10. Oktober, irgendwo in Deutschland,14.43 Uhr
Nachwort
Dramatis Personae
Theresia »Sia« Sarkowitz: Judastochter
Emma Karkow: ihre Nachfahrin
Elena Karkow: Emmas Tochter
Trisha: Elenas Schulfreundin
Schwester Hildegard: Krankenhauspflegekraft
Melanie: Lernschwester
Professor Axel »Sascha« Kleinert: Stationsarzt des Krankenhauses
Kantor: Polizist
Faltow: Kriminalkommissar
Eric von Kastell/de Lavall: Wandelwesenjäger
Justine Marie Jeanne Chassard: seine Halbschwester
Mütterchen Wissen: eine von Erics Informationsquellen
Jeoffray Charles Wilson: Butler und Harm Byrnes Testamentsvollstrecker
Reginald Mirror: Wettbürobetreiber/Krimineller
Milly: Betreiberin des Pubs Shamerock
Ireen: Friseurin
Mhatha: Sídhe/Banshee
Jonathan Smyle: irischer Vampir/Vieszcy
Alice und Grag: Nachtkelten (Menschen)
Mike O’Malley: IRA-Kämpfer
Sínead: seine Frau
Mitch Donaghue: IRA-Kämpfer
Finn McFinley: Rí der BlackDogs
Brian Baker: Rí der HellDogs
Uther: Wandler der HellDogs
Tim Emerald: Wandler der HellDogs
Ard Rí: Hochkönig der irischen Wandler
Rob: rechte Hand des Ard Rí
Boída de Cao: Scharfrichterin
Miss Black: Sídhe-Killerin
Stiff und Cougar: Hundewandler, Streuner und ohne Clan
Barnaby Fitzpatrick: Bärenwandler
Rainal und Lisica Righley: Fuchswandler
Alanis und Liam Killroy: Pantherwandler
Britney Majors: Katzenwandlerin
David O’Liar: Lobbyist
Liam Baxter: Senator im irischen Oberhaus
Freddy Cormick: unabhängiger Abgeordneter im irischen Unterhaus
Ian Rutherford: Premierminister Irlands
Frost und Wells: seine Leibwächter
Willy Moroda: Spion der Wandler
Aaron Goldsteen: einflussreicher Geschäftsmann
Gemma Corr: einflussreiche Geschäftsfrau
Taila Apple: einflussreiche Geschäftsfrau
Elizabeth Anne Sophie Montesque: Inhaberin des Poor Duck (Bed&Breakfast)
der Professor: führendes Mitglied der union des lames
Dramatis Personae (passiv)
Levantinus/Levantin: mystisches Wesen aus einer anderen Sphäre; die Sphäre trägt je nach Verständnis bzw. Erklärungsansatz verschiedene Namen, mal Hölle, mal Jenseits, mal Paralleluniversum …
Marek: Sias Halbbruder
Tanguy Guivarch/Harm Byrne/Tonja Umaschwili: Figuren, die in Sias Vergangenheit und über die Jahrhunderte hinweg eine wichtige Rolle gespielt haben
Comte de Morangiès: Widersacher von Sia und vor allem Eric
Besondere Vampirsorten
Abgesehen von den einfachen Vampiren, existieren besondere Spezies, die sich durch ungewöhnliche Eigenschaften, Stärken und Schwächen auszeichnen.
Die Kinder des Judas haben immer rote Haare und töten ihre Opfer mit einem einzigen Biss. Sie können kein sichtbares fließendes Wasser überqueren. Spitze, scharfe Gegenstände über den Eingängen oder den Fenstern eines Hauses hindern sie am Eintreten.
Dafür sind sie schneller, stärker und beweglicher als normale Menschen. Der Unterkiefer lässt sich aushängen wie bei einer Schlange, und die Reißzähne werden etwa so lang und dick wie der kleine Finger.
Im Allgemeinen kümmern sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten und lassen Menschen weitestgehend in Ruhe – es sei denn, sie brauchen Forschungsobjekte oder die Gier nach Blut wird zu stark. Üblicherweise töten sie alle anderen Vampire – den Abschaum – die ihnen unter die Augen kommen.
Die Vieszcy sind die Kinder einer Hexe mit einem Werwolf oder mit einem Teufel/Dämon.
Sie vermögen sich in eine Schlange oder einen Luchs zu verwandeln, zu fliegen, sich unsichtbar zu machen und persönliche Krankheiten zu erschaffen, die an einen einzelnen Menschen gebunden sind.
Allerdings reagieren sie auf christliche Symbole, sind aber damit nicht zu töten und können durch Zauberer und Dhampire (Kinder von Vampiren) gefangen werden.
Sie sind recht aggressiv und bevorzugen Männer als Opfer, mit denen sie sich auch gerne vergnügen.
Ein Umbra ist der Schatten eines toten Mannes, der zu Lebzeiten viel Böses getan hat und vom Teufel Fertigkeiten als Belohnung erhielt.
Sie besitzen enorme Stärke, vermögen Feuer zu speien und können sich in einen Werwolf verwandeln. Sieht man sie, erkennt man nicht mehr als einen schwarzen Umriss. Sie können sich nicht durch Biss vermehren, sondern werden vom Bösen ausgesucht. Außerdem leben sie nicht sehr lange. Sie sind extrem aggressiv, ziehen durch die Gegend und wüten blindlings.
Die Sídhe sind feenhafte Figuren der irischen Mythologie. Bei ihnen handelt es sich um Altvampire und die Beherrscher der Nachtkelten.
Begriffe
Sídhe: feenhafte Figuren der irischen Mythologie/Vampire
Nachtkelten: Bezeichnung für sowohl die Vampire aus der Art der Sídhe als auch deren menschliche Anhänger
altir. Rí: dt. König
altir. Ard Rí: dt. Hochkönig
altir. Tuath: dt. Stamm
altir. Tuatha: dt. Stämme
altir. Oenach: dt. waffentragende Elite eines Stamms
Wandler/Wandelwesen: Wesen, die in der Lage sind, eine Tierform oder eine Mischform aus Tier und Mensch anzunehmen; ihre primäre Gestalt ist in der Regel menschlich. Sie haben deutliche animalische Züge, meistens charakterlich, gelegentlich auch äußerlich, die das Tier in ihnen repräsentieren. In erster Linie sind es Raubtiere, es kommen aber auch friedlichere Tiere vor.
Schwesternschaft vom Blute Christi: Nonnenorden, gegründet im 18. Jahrhundert, um Wandelwesen zu fangen und von ihrem »Fluch« zu befreien. Dies sollte durch Heilung mittels Sanctum (s.u.) geschehen – andernfalls muss das Wandelwesen getötet werden.
Sanctum: heiligste Substanz, das Blut Christi
Prolog
26. Januar, Großbritannien,York, 16.21 Uhr
Jeoffray Charles Wilson nippte an seinem starken Assamtee, den er wie immer mit Milch und einem Löffel Zucker trank, während sein Blick über die aufklärenden Zeilen der letzten Seite huschte.
Nachdenklich wandte er den Kopf zum Fenster und schaute hinaus in den Garten, wo die Äste der alten Eichen im Wintersturm wogten. Halbzersetztes Laub wurde gelegentlich gegen die Scheibe geweht, blieb kleben und wurde vom prasselnden Regen wieder fortgespült.
Perfektes Teatime-Wetter.
Als waschechter Brite verweigerte er sich nicht einem gewissen Maß an Aberglauben und nahm den Spuk auf alten Schlössern und Landsitzen als gegeben hin. Aus guter Tradition heraus.
Jetzt aber hatte ihm Harm Byrne, Schwerstkrimineller und sein ehemaliger Arbeitgeber, ein elektronisches Dossier über eine andere, verborgene Welt hinterlassen, das ihn nachdenklich stimmte. Weil es keinen erkennbaren Wahnsinn in sich trug. Nicht in einem einzigen Wort.
Perfektes Monsterwetter.
Wilson hatte nie an Vampire geglaubt. Auch nicht an Werwölfe oder Dämonen. Und doch beschrieb sein alter Chef, der nie ein Spinner gewesen war, diese Spezies mit all ihren Unterarten, mit ihren Stärken und Schwächen, woran man sie erkannte, wie man sie eliminierte, was man bei Begegnungen vermeiden sollte und so weiter und so fort.
Zuerst hatte der einstige Butler auf die Zeilen gestarrt. Dann hatte er gelacht. Dann war er ins Wanken geraten, und jetzt befand er sich in einem merkwürdigen Zwischenzustand: Er wollte eines der Monster sehen!
Wilson hatte sehr viel Geld von Harm Byrne als Hinterlassenschaft erhalten und im Gegenzug einen Auftrag bekommen: Elena Karkow, ein Mädchen von knapp sieben Jahren, und ihre Mutter Emma, irgendwo um die dreißig. Sie sollte er aus der Ferne beschützen, behutsam Kontakt zu ihnen aufnehmen, sich ihnen als Freund nähern und zu einem Vertrauten werden.
Dann bekomme ich doch noch Frau und Tochter.
Wilson war der perfekte Mann für den Auftrag. Ende vierzig, alleinstehend, keine Kinder, gebildet und versiert, mehrsprachig und mit einem freundlichen Gesicht ausgestattet, zu dem Menschen schnell Vertrauen fassten. Völlige Ungebundenheit.
Er stellte die Tasse ab; mit einem leisen Klirren landete sie auf dem Knochenporzellan. Er zögerte nicht, diesen ungewöhnlichen Auftrag anzunehmen, für den er pro Jahr eine Million Euro aus einer Stiftung gezahlt bekam. Wilson hätte es für weniger getan. Loyal über den Tod hinaus, und das nicht einmal wegen des Geldes. Er hätte Harm Byrne niemals seine Zuneigung gestehen können. Es schickte sich nicht für einen Bediensteten und hätte auch nichts gebracht. Der Schwerkriminelle hatte Frauen bevorzugt.
Wilson erhob sich aus dem Ohrensessel. Seine Schritte führten ihn vorbei am Kamin, in dem kleine Flämmchen zuckten, bis ans Fenster, wo er den Blick schweifen ließ.
Vampire, Dämonen, Werwölfe. Und Elena und Emma stehen mit dieser Welt irgendwie in Verbindung. Er legte die Hände auf den Rücken und sah den Regentropfen zu, die am Glas hinabrollten. Wenn es derartige Alptraumgestalten gibt, was existiert dann noch Schlimmeres in unserer Welt?
Vor dem Studium des Dossiers hatte er sich sicher gefühlt. Die Ausbildung als Personenschützer verlieh ihm die Fertigkeit, mit jeder Art von Feuerwaffen umzugehen; auch um seine Selbstverteidigungskünste stand es äußerst gut. Aber nutzte ihm das was beim Nahkampf mit einem rasenden Werwolf? Bei einer Schießerei mit einem Vampir? Bei einem Schwertkampf mit einem Dämon?
Ich brauche ein Silbermesser. Und passende Kugeln für meine Pistolen. Wilson atmete tief durch. Allmächtiger, ich klinge schon, als würde ich tatsächlich glauben, was ich da gelesen habe!
Harm Byrne hatte ihn in seinem Testament gewarnt, sich Mutter und Tochter behutsam zu nähern, weil sie in der Vergangenheit oft getäuscht worden waren. Anfangs sollte er nur aus der Entfernung auf sie achten und erst nach einem Jahr Kontakt aufnehmen. Beim Einkauf oder sonst wo. Hauptsache, vorsichtig und so gut wie zufällig.
Das Bild einer Frau, die aussah wie Emmas ältere Schwester, war im Dossier ebenfalls enthalten. Angeblich handelte es sich dabei um eine Vampirin der Sorte Kinder des Judas, die Ahnin der beiden. Und: Sie war die andere Beschützerin sowie mehr als argwöhnisch. Sie tötete Verdächtige eher, bevor sie lange fragte. Skrupellos.
Wohl auch mich, wenn ich nicht achtgebe … also, wenn sie eine Vampirin ist. Muss sie aber eigentlich gar nicht. Es reicht vollkommen aus, wenn sie eine Killerin ist.
Sein Spiegelbild zeigte ihm ein Gesicht mit langen Stoppeln, die erstes Grau aufwiesen. Das Ergebnis seiner Vernachlässigung der Körperpflege, aber die Lektüre war zu spannend gewesen. Auch die persönlichen Einschübe seines Chefs, die Lamenti … sie hatten ihn in der Seele gerührt.
Er sah an sich herab, am zerknitterten grau-rot karierten Morgenmantel, den er über dem hellen Pyjama trug, und wackelte mit den nackten Zehen. Der Plan: duschen, rasieren und ab in den Butler’s Club. Wilson marschierte ins Bad.
Nach einer blitzschnellen Nachmittagstoilette, inklusive Entfernen der Bartstoppeln und Korrektur der Frisur, schlüpfte er in der Ankleide in seinen grauen Maßanzug und warf sich den schwarzen Mantel über. Er mochte den Stil eines Gentlemans. Die Jahre in den Diensten von Leuten, die Wert auf ihr Erscheinungsbild legten, hatten ihn sehr geprägt. Wilson bevorzugte es, auf sich zu achten und zu jeder Zeit gut gekleidet zu sein.
Ein leises Klirren ertönte aus dem Haus, dann krachte es.
Wind fuhr heulend durch seine Wohnung und warf die Tür zum Ankleideraum mit einem lauten Knall zu.
Bloody hell … Wilsons erster und sehr normaler Gedanke war, dass der Sturm einen Eichenast abgerissen und durchs Fenster geschleudert hatte. Gleich darauf kamen ihm die Worte und Beschreibungen des Dossiers von selbst in den Verstand und eröffneten ihm weitere Möglichkeiten. Ich werde paranoid.
Er starrte auf den Ausgang. Unbewaffnet wollte er plötzlich nicht hinaus, auch wenn er sich dabei lächerlich vorkam. Seine beiden Pistolen, für die er eine Besitzerlaubnis besaß, bewahrte er im Tresor neben dem Eingang auf. Um sie zu erreichen, müsste er allerdings durchs Kaminzimmer.
Wilson nahm den schweren Kerzenleuchter vom Beistelltisch. Silber. Und mit spitzen Füßen. Besser als nichts.
Dann ging er zur Tür, öffnete sie ruckartig.
Der Wind heulte noch immer. Leises Plätschern verriet, dass der Regen durch ein offenes Fenster auf die Fliesen fiel.
Wilson schluckte und spürte sein schnell pochendes Herz. Es ist nur ein Ast. Oder ein Einbrecher, sagte er zu sich selbst und versuchte, seinen Puls zu verlangsamen. So viel Adrenalin hatte er schon lange nicht mehr im Blut gehabt. Oder Vampire, Werwölfe, Dämonen … verfluchtes Dossier!
Er stahl sich durch die geöffnete Kaminzimmertür und verharrte, runzelte die Stirn.
Das Fenster hatte ein Loch und stand offen, kleine Rinnsale sickerten über den Boden. Im Sessel saß eine Gestalt in einem dunklen, nassen Anorak mit übergezogener Kapuze, die seinen Laptop auf dem Schoß hatte und das Dossier las. Mit der behandschuhten Rechten scrollte sie hoch und runter, in der Linken hielt sie eine große Pistole mit Schalldämpfer; der Unterarm lag entspannt auf der Sessellehne.
Kein gewöhnlicher Einbrecher. Das Beruhigende: Vampire, Werwölfe und Dämonen würden sich vermutlich nicht die Mühe machen und eine Waffe mit Suppressor besorgen, um bei einem Butler einzusteigen. Wilson wog den Kerzenleuchter in der Hand. Nichtsdestotrotz war er unterbewaffnet.
»Wenn Sie lange genug da gestanden und mich angestarrt haben«, flüsterte der Einbrecher, ohne dass klarwurde, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, »könnten Sie uns einen Tee machen, Mister Wilson.« Die Hand mit der Pistole wurde kurz angehoben. »Keine Sorge. Ich glaube, lebend sind Sie wertvoller, als ich zuerst angenommen hatte. Heute ist Ihr Glückstag.«
Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Glück fassen kann. Wilsons Herz hatte sich immer noch nicht beruhigt. Er war hin- und hergerissen: angreifen oder schauen, was der Besuch wollte. »Ich bin gespannt auf Ihre Erklärung, Mister …?«
»Geben Sie mir irgendeinen Namen, den Sie mögen, Mister Wilson, aber bitte nicht Smith. Das wäre zu viel Klischee.« Noch immer flüsterte die Person. »Lassen Sie den Assamtee bitte vier Minuten ziehen. Ich bevorzuge braunen Zucker, und die Milch müssen Sie nicht eigens für mich vorwärmen.«
Wer immer das ist, er hat einen Hauch von Stil. Wilson entschied herauszufinden, wer in sein Haus eingebrochen war. Die Ruhe und Selbstsicherheit des Gasts fand er beeindruckend, und er ging tatsächlich in die Küche, um eine Kanne Tee zuzubereiten. Je mehr Zeit man ihm gab, desto besser. Wo ist das Arsen, wenn man es mal braucht? Ich habe nicht mal Pflanzendünger, um ihn dem Besucher in den Tee zu kippen. Die Handgriffe vollführte er, ohne zu denken. Butlerautomatismus. Als er fertig war, nutzte Wilson die Gelegenheit, sich ein großes Küchenmesser unter den Gürtel zu stecken, wenn er schon nicht an seine Pistolen gelangte.
Nach knappen zehn Minuten kehrte er mit einem beladenen Tablett ins halbdunkle Kaminzimmer zurück, baute Kanne, Tassen, Milch, Zucker und die Löffel auf dem Tisch neben dem Kamin auf, goss zuerst sich, dann seinem Gast ein, der immer noch vor dem Laptop saß und las. »Wie viel Zucker, Sir oder Madam?«
»Zwei gestrichene Löffel, bitte.« Die behandschuhte Rechte klappte den Monitor herunter. »Ich komme, Mister Wilson. Das Licht können Sie auslassen. Ich brauche es nicht.« Als die Gestalt aufstand, sah er, dass es sich um eine Frau handelte, die er auf knapp eins siebzig schätzte. Im Vorbeigehen nahm sie einen Scheit aus dem Korb und warf ihn in die Glut; das trockene Holz begann sofort zu brennen. Der Anorak stand leicht offen, darunter trug sie einen schwarzen Rollkragenpullover und schwarze Cargohosen. »Haben Sie sich schon einen Namen ausgedacht?«, fragte sie und klang trotz des Flüsterns belustigt.
»Miss Black passt ganz gut«, gab er zurück und setzte sich.
Die Flammen beleuchteten sie und verliehen ihrem Gesicht einen äußerst gesunden Teint. Sie lächelte, und um die hellen Augen entstanden kleine Fältchen. »Ja, das ist in Ordnung.« Sie wählte den Stuhl ihm gegenüber, die Mündung der großkalibrigen Waffe blieb auf ihn gerichtet. »Hatten Sie wirklich vor, mich mit dem Kerzenleuchter anzugreifen?« Sie streifte die Kapuze zurück, nahm die Tasse und führte sie an die Lippen, blies über den Tee. Offensichtlich fürchtete sie sich nicht vor einem Giftanschlag.
»Er stand gerade da, und ich denke nicht, dass ein Kamm aus dem Badezimmer Sinn gemacht hätte, Miss Black. Die Durchschlagskraft wäre zu gering gewesen. Zum Durchschneiden Ihres Halses wäre er auch nicht geeignet. Und mir ist auch leider kein Fall bekannt, bei dem ein Angreifer zu Tode gekämmt wurde«. Wilson trank langsam und musterte sie. Ihre Züge waren weder hübsch noch hässlich, keine besonderen Merkmale, die sie aus einer Menschenmasse gehoben hätten; die halblangen dunkelblonden Haare hatte sie zu einem kleinen Zopf zusammengefasst. Da sie immer noch leise sprach, vermutete er, dass es dafür einen bestimmten Grund gab.
»Gut geantwortet.« Black grinste und nippte am Tee. »Oh, der ist sehr lecker. Welche Plantage?«
»Mokalbarie.«
»Wirklich ausgezeichneter Geschmack. Voll, malzig und nicht zu bitter, obwohl er es mit drei Minuten anstatt der vier auch tun würde.«
»Sie hatten um vier Minuten gebeten.«
»Ich weiß.« Sie nahm einen langen Schluck, bevor sie die Tasse absetzte. »Sie können sich denken, warum ich hier bin?«
»Ich kann mir denken, wie Ihre ursprüngliche Absicht gelautet hat, aber inzwischen stehe ich wohl nicht mehr unabdingbar auf der Todesliste.« Wilson sah über den Tassenrand zu ihr. »Ich gestehe, dass ich nicht weiß, wem ich ein Dorn im Auge sein könnte und warum Sie erst heute erscheinen. Ich kann also nur vermuten: einer von Mister Byrnes alten Feinden? Oder sind Sie eine Killerin eines Verbrechersyndikats? Hat womöglich die verschollene Verwandtschaft Sie losgeschickt, um an Mister Byrnes Hinterlassenschaft zu gelangen?«
Black wiegte den Kopf hin und her. »Nein, ich bin keine Killerin der Russen-Mafia oder der Yakuza. Es gibt meines Wissens auch keine wütende Cousine dritten Grades, die gerne die Millionen hätte.«
»Nun, dann bleibt der alte Feind?« Er sah sie gespannt an. »Beruhigend ist es dennoch nicht.«
»Feind, na ja, das kann man so sagen, auch wenn es noch nicht lange her ist.« Black nickte über die Schulter zum Laptop. »Es hat etwas mit der netten Datei voller Wahrheiten zu tun.«
Bin ich zu einem ungewollten Mitwisser für die Welt der Monster geworden? Wilson wurde kurz heiß, dann hob er die Brauen. »Die unheimlichen Mächte schicken eine Killerin mit einem Schalldämpfer – das ist enttäuschend und nicht das, was ich erwartet hätte.« Sie grinste wieder bei seinen Worten. »Aber genau weiß ich es immer noch nicht. Sie sehen belustigt aus, aber glauben Sie mir bitte: Ich bin es nicht.« Er richtete mit einem automatischen Handgriff die Krawatte.
Black dachte einige Sekunden nach. »Was haben Sie sich von der netten Abhandlung über die Nachtkelten merken können, Mister Wilson?«
»Wird das ein Test?«
»Möglich.«
»Und wenn ich durchfalle?«
Blacks Blicke huschten als Antwort auf die Pistole und wieder zurück. »Strengen Sie sich an, Mister Wilson. Ein so herausragender Butler wie Sie kann sich Dinge doch leicht einprägen. Stellen Sie sich vor, es ginge darum, Ihre Herrschaft zufriedenzustellen.«
Wilson schluckte und spürte, wie sein Mund trocken wurde. Eine Hand ließ er von der Krawatte nach unten gleiten, um näher an das versteckte Messer zu gelangen. Für den Fall, dass ihr seine Ausführungen nicht reichten und er um sein Leben kämpfen musste. Er hatte in seinem Leben einige Prüfungen durchlaufen, aber niemals war der Einsatz so hoch gewesen wie heute. »Ich denke, es handelt sich bei den Nachtkelten um eine Subkultur, die aus irischen Vampiren und ihren menschlichen Anhängern besteht«, tastete er sich vorwärts und dachte dabei fieberhaft nach. »Eine Art … Symbiose. Die Menschen geben freiwillig Blut, die Vampire ihnen dafür von ihrem Wissen. Aber die normalen Iren fanden das weniger gut, weswegen die Nachtkelten in den Untergrund flüchten mussten.« Er räusperte sich. »Verzeihen Sie.« Er nahm einen Schluck Tee und nutzte die Unterbrechung, um nachzudenken. Die Fülle an gelesenen Informationen machte es schwer, auf Einzelheiten zurückgreifen zu können. Konzentriere dich! Nebenbei dachte er fieberhaft darüber nach, wie er seiner Besucherin entkommen könnte.
Black schmunzelte. »Sind Sie ein Zeitspieler, Mister Wilson?«, raunte sie.
»Wie liege ich bisher in der Prüfung?«
»Scheint gut für Sie auszusehen: Sie leben noch. Machen Sie weiter. Vielleicht lernen Sie heute noch etwas, was nicht in Byrnes kleiner Akte steht. Was wissen Sie über die Feinde der Nachtkelten?«
»Gestaltwandler«, erwiderte er unverzüglich. Sie hatte bei ihm den richtigen Knopf gedrückt. »Die Nachtkelten mussten sich lange auch vor ihnen verbergen und haben danach einen Waffenstillstand mit den Wandlern geschlossen.«
»Sehr gut, Mister Wilson!« Black pochte ihren Beifall auf der Tischplatte. »Sie bewegen sich auf eine gute Note zu. Was noch?«
Gott, was noch? »Ich … fürchte, ich weiß nicht mehr«, sagte er gedehnt, während die Finger zur Seite glitten und den Messergriff ertasteten. Ihm war eine Idee gekommen, wie er ein Überraschungsmoment zu seinen Gunsten kreieren konnte. »Mister Byrne hat nicht mehr geschrieben. Glaube ich.« Noch war Wilson unschlüssig, ob er präventiv angreifen sollte. Knisternd zerfiel der Scheit in drei Stücke, die Flammen loderten höher und beleuchteten die Frau, die immer noch entspannt wirkte. Ich sollte darauf nichts geben. Jeder Killer wirkt entspannt, wenn er ein Profi ist. »Sie gehören also zu den Nachtkelten – Mensch oder Vampir?«
Black schoss nicht und legte nicht mal den Schlagbolzen nach hinten. »Ah, Sie wollen wissen, womit Sie es zu tun haben. Ich bin ein Mensch, eine sehr treue Soldatin meines Herrn, und man hatte mich ausgesandt, um Sie auszuschalten. Man fürchtet, dass Sie sich berufen fühlen könnten, einen Rachefeldzug mit den kriminellen Schergen Ihres toten Bosses gegen uns vom Zaun zu brechen. Geld genug hätten Sie dazu.« Ihre Unterlippe zuckte. »Aber wie ich eben gesehen habe, gab Ihnen Harm Byrne einen ganz anderen, überraschenderen Auftrag. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und die Personen sind auch sehr bemerkenswert: drei Judastöchter.«
Also wissen die Nachtkelten über diese Vampirspezies Bescheid. »Es ist nur eine Vampirin. Die zwei anderen …«
»Beide tragen den Keim in sich, Mister Wilson! Sie mögen noch Menschen sein, aber nach ihrem Tod könnten sie zu überaus mächtigen Blutsaugern werden. Sie haben die Anlagen dazu.« Ihr Handy klingelte mit einer unangenehmen, schrägen Melodie, die nur nach modernen Maßstäben Lied genannt werden konnte. Black fischte es aus der seitlichen Beintasche und führte eine leise Unterhaltung, die Wilson nicht verstand; es schien Gälisch zu sein.
Die Unterbrechung kam ihm recht, denn er musste seine Gedanken weiter ordnen. Was können die Nachtkelten von mir wollen? Alles schien sich auf Theresia Sarkowitz sowie Emma und Elena Karkow zu zentrieren – doch warum?
Harm Byrne hatte von ihm in seinem Testament verlangt, jegliche Hindernisse für Mutter und Tochter aus dem Weg zu räumen, koste es, was es wolle.
Noch waren die Nachtkelten kein Hindernis, doch je länger die Unterredung von Black mit dem Unbekannten dauerte, desto sicherer wurde Wilson, dass die Nachtkelten die Ersten auf seiner Abschussliste wurden. Das zu deutliche Interesse an der kleinen Patchwork-Familie Karkow-Sarkowitz prädestinierte sie geradezu dafür.
Dumm war nur, dass Wilson keine Ahnung hatte, wie viele Nachtkelten es überhaupt gab, sowohl Vampire als auch deren Verbündete. Die Vorzeichen standen in der aktuellen Situation nicht eben günstig für ihn. Worüber sie wohl gerade redet? Und mit wem? Seine Finger legten sich um den Messergriff, mit der anderen Hand nahm er die Tasse auf und trank.
Black hörte schon eine Weile zu, ohne zu sprechen, dann grüßte sie und legte auf. »Entschuldigen Sie, Mister Wilson«, bat sie in ihrem Flüsterton. »Ich weiß, es ist unhöflich, in Gegenwart anderer lange zu telefonieren, aber da es um Ihre Zukunft ging, werden Sie es verzeihen können.«
»Ich kann. Gerade so«, erwiderte er und stellte das Gefäß auf den Unterteller. »Und? Was hat man beschlossen?«
»Dass ich Ihnen ein Geschäft vorschlagen soll, anstatt Sie zu erledigen.« Jetzt legte Black den Schlagbolzen nach hinten um, es knackte beim Arretieren trocken. »Es geht um Theresia Sarkowitz und ihre beiden Nachfahren. Wir haben Interesse an ihnen. Ausgesprochen großes Interesse, und Sie sollen für uns in dem Zusammenhang ein paar Dinge erledigen.«
»Aha.« Damit steht ihr auf der Liste. Wilson schenkte sich Tee ein. Nun musste er seine Ablenkungsidee in die Tat umsetzen. »Dinge. Und womit wollen die Nachtkelten meine Kooperation herbeiführen?«
Black hatte das Lächeln verloren, und ihr Flüstern wurde kalt, als sie raunte: »Da wir es bei Ihren Vermögenswerten mit Geld nicht zu versuchen brauchen, Mister Wilson, was denken Sie, was sonst in Frage kommt?«
»Ich nehme mal an, dass …« Ich hoffe, es klappt. Wilson schleuderte die Kanne blitzschnell in den nahen Kamin.
Sofort quollen Dampf und Rauch in die Höhe und hüllten Black ein, die zweimal abdrückte.
Er ließ sich zur Seite fallen. Die erste Kugel traf ihn in die Schulter und jagte durch sein Fleisch, die zweite verfehlte ihn. Der Schmerz brachte ihn dazu, die Zähne zusammenzubeißen, während er das Messer zog und es im Liegen am Tisch vorbei nach Black schleuderte.
Die Frau duckte sich, die Klinge bohrte sich sirrend in die gepolsterte Lehne. »Mister Wilson, ich warne Sie!«
Zeit für meine Waffen. Wilson robbte unter dem Tisch durch, sprang und hechtete aus dem Kaminzimmer in den Flur. Er trat die Tür mit dem Fuß zu und stemmte die Sohle dagegen, damit Black sie nicht öffnen konnte; gleichzeitig streckte er sich und tippte die Nummer ins elektronische Schloss des Tresors, der neben dem Eingang stand.
Es krachte splitternd, als vier daumendicke Löcher in der Tür aufplatzten. Die Schüsse hätten ihn getroffen, wenn er vor dem Eingang gestanden hätte. Es rumpelte, Wilson bekam von der Tür einen Schlag gegen den Fuß. Black warf sich von der anderen Seite dagegen, aber er hielt stand.
Mit einem Piepsen wurde die Korrektheit des eingegebenen Codes gemeldet.
Gleich haben wir Chancengleichheit, Black. Hastig riss er die Tür auf und nahm die Pistolen, zwei Walther neun Millimeter, aus dem Fach, lud jede einmal durch und feuerte durch die geschlossene Tür. Die Erschütterungen der Rückschläge machten die Schmerzen in seiner Schulter schlimmer, und er stöhnte dumpf.
Von der anderen Seite erklang ein leiser, heiserer Schrei, gefolgt vom Rumpeln eines fallenden Körpers.
Das Glück und die Tüchtigen! Wilson blieb liegen und trat die perforierte Tür auf, zielte mit den Halbautomatikpistolen knapp über den Boden, um Black den Rest zu geben. Doch er sah sie nirgends – nur den umgestürzten Stuhl. Shit! Sie hat mich …
Ein Schatten löste sich vom Rahmen über ihm und flog auf ihn zu.
Wilson rollte sich zur Seite, die Stiefel verfehlten ihn knapp und krachten auf die Fliesen. Bevor er etwas unternehmen konnte, traf ihn ein Tritt, und er verlor eine der beiden Walther. Zwar schaffte er es, die Mündung seiner zweiten Waffe auf Black zu richten und zweimal abzudrücken, aber er schien sie verfehlt zu haben.
Black beförderte die Waffe mit einem gezielten Kick aus seinen Fingern, der heiße Schmerz im Handgelenk sagte ihm, dass es mindestens verstaucht war. Dann presste sie ihm das Ende des riesengroßen Schalldämpfers gegen die Stirn. »Mister Wilson, das war nicht schlecht, aber auch nicht clever«, raunte sie. Durch den Kampf war ihr Pullover zu Schaden gekommen, der Kragen hing herab. Wilson sah eine alte Narbe, die waagrecht an ihrem Hals entlanglief. »Jetzt müssen wir gehen, denn ich fürchte, dass einer Ihrer Nachbarn die Bobbys verständigen wird. Wir reden an einem anderen Ort weiter.«
Er war zuallererst froh, dass Black nicht abgedrückt hatte. Die Löcher in ihrer Kleidung bewiesen, dass er sie wohl getroffen hatte. Kevlarweste. Klar. Profi. Langsam nickte er.
»Sie stehen vorsichtig auf. Danach gehen wir zu meinem Auto und fahren ein bisschen durch die Gegend. Wenn wir uns handelseinig geworden sind und Sie in Ihre Wohnung zurückkommen, erklären Sie den Polizisten, dass Sie einen Einbrecher gestellt und verfolgt haben.« Sie bedeutete ihm mit einer Handbewegung aufzustehen.
»Und wenn wir uns nicht einigen können?« Wilson erhob sich und presste die Hand auf seine Schulterwunde, aus der warmes Blut sickerte. Er konnte es riechen. Wäre Black eine Vampirin, hätte er sicherlich große Schwierigkeiten.
»Tja, was denken Sie?« Black verstärkte für zwei Sekunden den Druck des Schalldämpfers gegen seine Stirn.
Kapitel I
Biep.
Biep, biep.
Biep. Klick-fchhhh-klack, klick-fchhhh-klack.
Biep.
Biep, biep …
Ich … ich sehe nichts! …Wieso sehe ich nichts? Meine Augen … sind doch … offen, oder etwa nicht? Ich … könnte … mir ist schlecht. Kann mir jemand sagen, was passiert ist?
Biep, biep, biep. Klick-fchhhh-klack, klick-fchhhh-klack. Biep. Biep …
Ein Krankenhaus!? Ich denke, es ist ein Krankenhaus. Was mache ich hier? Gott, nein, was … Ruhig, nur ruhig! Panik bringt nichts! Die Geräusche und die Gerüche stimmen. Das Piepsen ist wohl ein EKG, das Klicken könnte ein Beatmungsgerät sein … Intensivstation?
Biep, biep, biep. Klick-fchhhh-klack, klick-fchhhh-klack. Biep. Biep …
Was muss mir zugestoßen sein, dass ich auf der Intensivstation liege? … Ich bin gefallen. Genau, ich bin gefallen! Vom Balkon in meiner … Gott, nein! Sie war es! Diese Frau, die sich als Sias Cousine ausgegeben hat. Sie hat mich über das Geländer geworfen, nachdem sie … Harter Aufschlag, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Ich fühle, dass sie geschwollen ist. Oder … ist das der Beatmungsschlauch? Aber ich habe keine Schmerzen. Sie … haben mich ruhiggestellt. Weil ich so schwer verletzt bin? Das ist … ich kann nicht mal rufen!
Biep, biep, biep. Klick-fchhhh-klack, klick-fchhhh-klack. Biep. Biep …
Wo ist Elena? Scheiße, ich sehe nichts und kann mich … nicht … bewegen! Bin ich gelähmt? Mir ist nach Schreien, nach lautem …
Trapp, trapp, tock, tock, klick. Trapp, trapp … »Guten Morgen, Frau Karkow. Sie haben hoffentlich gut geschlafen?« Trapp, trapp. Pschhhhhhh …
Diese Stimme … nein, ich kenne sie nicht. Es ist eine Frau, eine Krankenschwester. Ist das ein Waschlappen? Sie wäscht mich mit einem kalten Waschlappen? Sag mir sofort, was passiert ist! Los, sag mir sofort …!
»Geschwitzt haben Sie nicht viel. Ich glaube, ich sage dem Arzt lieber, dass er die Infusionen erhöhen soll.« Trapp, trapp, trapp …
Die Schritte … sie geht ums Bett herum und … Hallo? Hörst du mich? He, Krankenpflegerin! Schwester! Meine Lippen sollen sich bewegen, bitte, ihr guten Mächte! Macht, dass sich meine Lippen bewegen, damit sie … Was ist los hier?
»Na, na, Frau Karkow. Sie haben ja immer noch erhöhte Temperatur. Das ist nicht gut. Ich schicke nochmals Blut ins Labor.«
Kein Nadelstich. Ich merke nichts davon … Bin ich durch den Sturz vollkommen gelähmt worden? Die Panik wird wieder schlimmer, mir schnürt es die Brust zu! Ich halte das nicht mehr länger …
Trapp, trapp, trapp. »Bis später, Frau Karkow. Ich komme in einer Stunde wieder Fieber messen. Ich schätze mal, dass Ihre Tochter nachher vorbeischauen wird. Sie haben ein tolles Mädchen. So jung und doch so schlau für ihr Alter. Fast schon erwachsen.« Trapp, trapp, wumms.
Ah, danke! Danke, dass es Elena gutgeht! Jetzt muss ich es nur noch schaffen, aus dieser Starre zu kommen. Es fühlt sich an, als wäre ich … eine Gefangene. Eine Gefangene, die man in einen dunklen Keller geschmissen hat und die sich nicht bewegen kann. Ich fühle nicht viel, rieche und höre nur. HE! HE, ICH WILL …
Biep, biep, biep. Klick-fchhhh-klack, klick-fchhhh-klack. Biep. Biep …
Oh, Gott! Das ist es: Sie denken, ich liege im Koma! Das ist es: Ich liege im Koma! Es gab mal dieses Video, von Metallica, glaube ich. Das Lied hieß … ich weiß es nicht mehr. Der Soldat in einem Militärkrankenhaus, ohne Arme und Beine, ohne Augen und ohne die Möglichkeit zu sprechen. Alle hielten ihn für … keine Ahnung. Er musste ihnen zuhören, bei allen Gesprächen über seinen Zustand musste er ihnen zuhören und konnte sich nicht äußern! Diese Verzweiflung war in dem Video gut eingefangen.
Biep, biep, biep. Klick-fchhhh-klack, klick-fchhhh-klack. Biep. Biep …
Ich habe schreckliche Angst, dass es mir genauso geht. Vielleicht haben sie mir auch Gliedmaßen abnehmen müssen? Bin ich entstellt? Nein, dann würden sie Elena nicht zu mir ins Zimmer lassen. Hoffe ich.
Biep, biep, biep. Klick-fchhhh-klack, klick-fchhhh-klack. Biep. Biep …
Ich habe Angst. Schreckliche Angst …
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 13.04 Uhr
»Ich habe gehört, dass Erfrieren total schön ist. Stimmt das?«
Krankenschwester Hildegard, die eben bei Emma Karkow die Temperatur maß, zuckte zusammen, als sie die freundliche Mädchenstimme in ihrem Rücken hörte. Sie sah über die Schulter zum Zimmereingang, wo die Tochter der Komapatientin auf der Türschwelle stand. Die Siebenjährige hatte die Hände in die Taschen ihrer dunkelgrauen Sweatjacke gesteckt und sah sie abwartend an.
»Na, schön ist wohl anders«, antwortete sie und sah nach vorne auf die Digitalanzeige. Sie hielt Elena für ein äußerst merkwürdiges Kind, das sehr gut zu ihrer Tante passte. Theresia Sarkowitz arbeitete als Sitzwache und konnte mit bemerkenswerter Genauigkeit vorhersagen, welcher Patient starb und welcher nicht. »Im Vergleich zu Verbrennen mit Sicherheit.«
Seit einer Woche stellte Elena diese Fragen, die sich immer um das eine drehten: sterben. Erhängen, ertrinken, Stromschlag, vergiften mit Chemikalien, durch Spritzen, durch Schlucken, durch Einatmen, Rattengift … Es gab wohl fast keine Variante mehr, die das Mädchen nicht abgefragt hatte.
Hildegard schob es auf das durch den Überfall erlittene Trauma, auf die schwere Verletzung ihrer Mutter und die geringe Aussicht, dass sie je wieder aus dem Koma erwachte. Sie hatte in ihren vierzig Berufsjahren schon viel erlebt, Schönes und Schlechtes an Krankenbetten erfahren, doch ein Kind wie Elena war ihr noch nie begegnet. Abgesehen davon hatte auch der häufige Umgang mit der Sarkowitz sicher etwas damit zu tun. Ein derart morbides Verhalten fiel aus der Norm.
»Und was passiert beim Erfrieren?«
Das Thermometer fiepte und zeigte den aktuellen Wert der Patientin: 37,9 Grad. Erhöhte Temperatur. Besser als Fieber, aber auch nicht wirklich zufriedenstellend, weil es der Anfang von etwas Schlimmerem sein konnte, dessen Ursache sich nicht zeigen wollte. »Elena, was sollen denn diese Fragen? Und sag jetzt nicht, dass es ein Referat für die Schule wäre. Du bist höchstens in der zweiten Klasse. Da werden solche Themen nicht besprochen.«
»Nee, nicht in der Schule. Aber es kam im Fernsehen, eine Wissenssendung. Willi will’s wissen, und da hat er erklärt, wie das so mit dem Tod ist. Mir geht es einfach nicht mehr aus dem Kopf, wie ein Mensch sterben kann. Und du als Krankenschwester, dachte ich mir, weißt das sicher.«
»Die Sendung hat gezeigt, wie Menschen sterben?« Hildegard konnte es nicht fassen.
»Nein, das nicht. Aber im Fernsehen, in den Nachrichten, da sind ständig Leichen zu sehen. Oder sie berichten über Unfälle und Unglücke, wo Menschen ums Leben kommen. Das finde ich total spannend.«
Hildegard seufzte. »Was ist nur aus den Sendungen geworden, in denen lustige Grimassenschneider Kinder zum Lachen brachten? Schaut denn heute keiner mehr Dick und Doof?«, murmelte sie und warf einen Blick auf die Überwachungsmonitore der verschiedenen Maschinen, an die Emma Karkow angeschlossen war.
Alle Anzeigen waren so, wie sie sein sollten, die Frau lebte, war physisch auf dem Weg zu bester Gesundheit. Die Knochenbrüche und Verletzungen vom Sturz heilten – aber ihr Verstand wollte den Weg ins Hier und Jetzt nicht finden. Der Aufprall aus großer Höhe hatte tiefere Spuren hinterlassen.
»Beim Erfrieren ist es so, dass man das Gefühl hat, immer müder zu werden«, sagte Hildegard widerstrebend. Sie wusste nur zu gut, dass sich Elena die Informationen woanders beschaffen würde, wenn sie von ihr keine Auskünfte bekam. »Mal abgesehen davon, dass einem sehr, sehr kalt ist. Irgendwann schafft es der Körper nicht mehr, genug Wärme zu produzieren, und dein Kreislauf … Egal, du wirst jedenfalls müde und schläfst dann ein. Wenn man dich nicht rechtzeitig findet, stirbst du an Unterkühlung.«
»Aha«, machte Elena und klang zufrieden. »Es tut also nicht weh?« Sie kam ins Zimmer und setzte sich auf den Stuhl neben dem Bett ihrer Mutter.
»Du hast keine echten Schmerzen, würde ich sagen, aber das starke Frieren stelle ich mir fürchterlich vor. Erlebt habe ich es noch nicht.«
»Danke, Schwester Hildegard.«
»Keine Ursache, Schätzchen. Versprich mir, dass du jetzt keine Fragen mehr über das Sterben stellst, ja?«
»Warum denn nicht?«
»Herrgott! Weil es … also, für dein Alter …« Die Krankenschwester fühlte sich hilflos. »Du bist eigentlich viel zu jung dafür. Du müsstest mich nach neuen Puppen oder nach einem Comic fragen, aber doch nicht …« Hildegard nahm einen Pudding aus der Kitteltasche, den sie für ihre Mittagspause aufbewahrt hatte, und reichte ihn Elena. Noch so ein Zeichen ihrer Überforderung: Bestechung anstelle von Argumenten. »Hier. Und jetzt vergiss das mit dem Tod.«
»Vielen Dank, aber den mag ich nicht. Der schmeckt immer so sandig. Gib ihn lieber Opa Paschulke aus Zimmer 412, der isst ihn gern.« Elena blies den hellen Pony in die Höhe, zog einen Müsliriegel aus der Tasche, packte ihn aus und aß, während sie mit der anderen Hand die Rechte ihrer Mutter nahm und sie hielt.
Hildegard ging zur Tür und verharrte kurz, sah zu den beiden und musste gerührt schlucken. Elena erzählte der Komatösen mit vollem Mund und voller Begeisterung, was sie heute in der Schule alles gemacht hatten, welche Hausaufgaben sie erledigen musste und mit wem sie sich später treffen wollte.
Sie ist schon sehr reif für ihr Alter, dachte sie und trat hinaus auf den Flur, um Opa Paschulke den Pudding zu bringen. Hoffentlich wird ihre Mutter wieder wach.
Im Schwesternzimmer trug sie alle Werte in eine Tabelle ein und sah, dass die Temperatur von Emma Karkow unregelmäßig anstieg und fiel. Das sprach dafür, dass sie eine Entzündung im Körper hatte, aber die Bluttests ergaben keine erhöhten Leukozyten oder andere Anhaltspunkte. Infusionen, Medikamente, nichts brachte die Körpertemperatur dauerhaft auf einen normalen Wert.
Hildegard nahm den pinkfarbenen Marker und hob Karkows hohe Temperaturen hervor. Sie würde einen entsprechenden Vermerk an den Oberarzt machen. Das war nicht normal.
Sie sah auf die Anzeigen, die aus dem Krankenzimmer direkt zu ihnen auf die Monitore übertragen wurden. Alles bestens. Die kleine Kamera über dem Bett zeigte eine ruhige Patientin und ihre Tochter, die immer noch gleichzeitig erzählte und aß.
Es hatte Hildegard überrascht zu hören, dass ihr Todesengel Sia eine Schwester und eine Nichte hatte.
Sarkowitz übernahm freiwillig die Nachtsitzwachen im Krankenhaus, auf den unterschiedlichsten Stationen. Je nachdem, wo es gerade an Leuten mangelte. Das Bizarre daran war, dass sobald Sia sagte, ein Mensch würde nicht mehr lange leben, dann war es auch so. Unabänderlich und ungeachtet aller Diagnosen.
Anfangs hatte Hildegard sie in Verdacht gehabt, eine von denjenigen Psychopathinnen zu sein, die Kranke umbrachten, aber ihre Zweifel legten sich bald. Jeder war an den Folgen seiner Krankheit gestorben. Nachweisbar. Könnte Sarkowitz die Lottozahlen mit der gleichen Präzision vorhersagen, wäre sie Multimillionärin, aber mit Todesvorhersagen verdiente man kein Geld.
Die Kleine war für Hildegards Geschmack zu viel bei ihrer Tante. Sie schüttelte sich. Es war kein schönes Los, den Tod anderer vorherzusehen. Außerdem hatte sie immer ein bisschen Angst, dass Sarkowitz eines Tages ihr das Ableben vorhersagte.
»Es gibt Dinge, die man sich nicht aussuchen kann«, sagte eine bekannte Stimme hinter ihr, und der Geruch von Leder umspielte ihre Nase.
Die Krankenschwester zuckte zum zweiten Mal an diesem Tag vor Schreck zusammen und legte eine Hand gegen die Brust. Ihr war nicht bewusst gewesen, dass sie ihre Gedanken laut ausgesprochen hatte. Sie wandte sich um und sah direkt in Sias schlankes Gesicht, das von langen dunkelroten Haaren umrahmt wurde.
»Hallo, Frau Sarkowitz«, sagte Hildegard und klang etwas außer Atem. »Sie schleichen aber auch jedes Mal durch die Gänge. Und so früh heute.«
Sia lächelte. »Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht erschrecken.« Die dunkelgrauen Augen richteten sich auf die Tabelle mit den Temperaturwerten. »Immer noch steigend?«
»Ja. Ich werde noch mal Druck beim Oberarzt machen. Irgendwas muss es ja sein, was das verursacht.« Hildegard betrachtete Sarkowitz’ schlichtes und doch beeindruckendes Outfit: schwarzer Pullover mit einem weiten, dicken Kragen, eine schwarze Lederhose und Boots, darüber ein langer schwarzer Ledermantel. Wenn sie ein bisschen größer gewesen wäre, hätte man sie für eine astreine Actionheldin halten können, aber ihre Statur war fast zierlich.
»Regen Sie an, meine Schwester nochmals in den Kernspin zu schicken. Vielleicht lässt sich auf die Weise mehr herausfinden.« Sarkowitz nickte ihr dankend zu. »Ist meine Nichte schon da?«
»Ja.« Hildegard zögerte zwei Lidschläge lang. »Frau Sarkowitz, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber haben Sie überlegt, mit Elena zu einem Psychologen zu gehen?«
»Weswegen?«
»Sie ist so … fixiert auf den Tod, seitdem das mit ihrer Mutter passiert ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie sich zu sehr darauf versteift. Wenn sich so etwas erst mal verfestigt hat, wird sie das nie wieder los. Verlustängste, Depressionen … das zieht sich dann durch ihr ganzes Leben. Sie ist ja schon sehr besonders und ein geistig weit entwickeltes Kind, aber …« Sie seufzte. »Verstehen Sie, was ich meine?«
»Sie denken, die Kleine hat ein Trauma davongetragen und ist vom Sterben besessen«, fasste Sarkowitz nüchtern zusammen. »Ich rechne es Ihnen hoch an, Schwester Hildegard, dass Sie sich solche Sorgen machen.« Sie sah ernst aus, aber nicht besorgt, als sie ging. »Ich rede mit ihr.«
Hildegard war erleichtert, aber dennoch wäre ihr lieber gewesen, wenn die Kleine wieder von ihrer Mutter und nicht vom Todesengel umsorgt würde.
Manchmal war ihr die Sarkowitz mehr als unheimlich.
Lass sie allein sein. Ich möchte IHN hier nicht spüren. Sia pochte knapp gegen die Tür und betrat das Krankenzimmer.
Elena saß mit dem Rücken zu ihr und machte ihre Hausaufgaben an einem Beistelltisch. Emma lag wie immer im Bett, die Augen geschlossen, und die Brust unter der Decke hob und senkte sich gleichmäßig. Der Beatmungsschlauch führte durch ihren Mund, die Haare hatte man ihr abrasiert, weil die Ärzte zuerst geglaubt hatten, sie müssten den Schädel öffnen. So weit war es nicht gekommen.
Sia kannte den Anblick. Sie hatte bei ihren Sitzwachen viele solcher Patienten gesehen, doch wenn es die eigene Familie traf, besaß es eine gänzlich andere Qualität. Jedes Mal bekam sie einen kleinen Schock, in dem immer ein Quantum Schuld mitschwang. Ein brutaler Anblick, die vielen Leitungen, Schläuche, die in Emma steckten. In den Fängen von medizinischer, unpersönlicher und roboterhafter Hochtechnologie, perforiert, penetriert – und doch waren die Maschinen überlebensnotwendig. »Hallo, Lieblingsnichte.«
»Hallo, Tante Sia!« Elena sah verwundert auf und wischte sich eine braune Strähne aus dem Gesicht. »Was machst du denn schon hier?« Sie sah zum Fenster. »Ah, es ist bewölkt.«
»Der Vorteil des Winters. Ich kann stundenlang durch die Gegend laufen. Vampire mögen den Winter sehr gern.«
»Sollten dann nicht alle am Nordpol leben? Ich meine, in der Phase, wo die Sonne für viele Monate gar nicht mehr aufgeht?« Sie grinste. »Das ist für Vampire doch das Paradies.«
»Das haben wir früher so gemacht, aber wir haben die Gegend durch unsere Gier entvölkert. Deswegen gibt es da so wenige Menschen. Heute machen wir gern Urlaub im Norden.« Sia zwinkerte, näherte sich ihrer Nichte und sah auf Heft und Bücher. »Was müsst ihr denn machen? Einfach nur abschreiben?«
»Ja. Das ist total langweilig. Kann ich auch alles schon, aber ich mache es trotzdem, damit der Lehrer zufrieden ist.« Elena wippte mit den Füßen, die weißen Turnschuhe waren dreckig vom Schneematsch, ebenso die Säume ihrer braunen Hose. »Ich könnte schon in der dritten Klasse sein. Denke ich. Frau Thomaczik sagt das auch.«
»Wer ist denn Frau Thomaczik?«
»Die Pfarrerin, die uns in Religion unterrichtet. Sie sagt, ich bin ziemlich schlau.«
»Stimmt. Das bist du. Wo du schon weißt, dass Vampire gerne am Nordpol sind.« Sia setzte sich ihr gegenüber, warf einen Blick auf Emma. »Hat sie reagiert, als du ihre Hand gehalten und mit ihr gesprochen hast?«
Elena presste die Lippen zusammen, atmete schneller und schüttelte schwach den Kopf. »Das eine Mal, als Mama meinen Namen gerufen hat … es war ein Traum oder so etwas. Seitdem liegt sie da wie jeden Tag.«
»Dann müssen wir weiter warten.« Sia atmete durch und sah ihrer Nichte an, dass sie um Fassung rang und die Fassade des tapferen Mädchens nicht mehr lange aufrechterhalten würde. Elendes Nichtstun! »Kommst du zurecht?«
Elena nickte langsam, schraubte den Füller zu und legte ihn in die Mitte des Schreibheftes, damit er nicht wegrollte. »Ich mache mir Vorwürfe, weil ich Mama nicht helfen konnte«, flüsterte sie traurig. »Und dass ich meinen Freunden und den Nachbarn nicht helfen konnte, die durch diese … Vampirin umgebracht wurden.« Sie schluchzte leise. »Tante Sia …«
Sie ist nicht so stark, wie sie gerne tut. Sia ging neben dem Stuhl auf die Knie, der Ledermantel knirschte dabei leise, und nahm das Mädchen in den Arm. »Du hättest nichts unternehmen können. Dieses Wesen war zu mächtig, viel zu mächtig für dich. Selbst ich habe es eigentlich nicht alleine geschafft.«
Sia erinnerte sich an die schreckliche Blutnacht, in der Tanguy Guivarch, einer ihrer vergessenen Nachfahren aus dem achtzehnten Jahrhundert, sie in Leipzig aufgespürt hatte. Der wahnsinnige Tanguy hatte sich an ihr für die unzähligen Dekaden der vermeintlichen Missachtung rächen und alles vernichten wollen, was für sie von Bedeutung war. In der Gestalt von Tonja Umaschwili, einer angeblichen Cousine, hatte er vor Emmas Tür gestanden, damit niemand Verdacht schöpfte.
Was danach gefolgt war, nannten die Zeitungen ein Massaker, und selbst diese Bezeichnung wurde dem nicht gerecht, was Tanguy angerichtet hatte: Die Menschen im Mietshaus hatte er zerrissen und zerfetzt, die Leichen in Emmas Wohnung aufgestapelt, Elena und Emma gefangen und auf Sia gewartet. Es war zu einem langen Kampf gekommen, bei dem Emma von Tanguy über den Balkon geworfen wurde. Das war der Grund für ihr Hirntrauma.
Sia drückte die weinende Elena an sich. Es ist sehr schwer für sie. Ich sollte vielleicht wirklich mit einem Psychologen darüber sprechen, welche Behandlung Sinn macht. Sie konnte nur erahnen, wie viel von Tanguys Grausamkeiten ihre Nichte mitbekommen hatte. Sia streichelte über die halblangen, braunen Haare und wiegte das Mädchen hin und her, um sie zu beruhigen.
Ohne meinen Schutzengel wäre ich heute auch nicht hier. Keine von uns. Oft hatte Sia an den Unbekannten gedacht, den Maskierten in Weiß, der sie nach dem Kampf gegen Tanguy vor der Auslöschung bewahrt hatte. Ein Gestaltenwandler, ein Werwolf hatte sie attackieren wollen, als sie entkräftet am Boden lag – doch der Maskierte war aufgetaucht und hatte den Wandler hingerichtet. Seitdem fehlte jede Spur von dem Werwolfjäger, dem sie schon einmal zuvor begegnet war. Der alte Spruch Man sieht sich immer zweimal im Leben stimmte. Ohne sein Eingreifen wäre Elena ganz allein. Abgesehen davon fand sie ihn als Mann attraktiv und faszinierend. Sia vermutete, dass er ein Tarnleben führte, meistens einsam war, und sie spürte eine unbestimmbare Verbundenheit.
Das Mädchen schniefte wieder und setzte sich gerade an den Tisch. »Geht schon«, nuschelte sie und nahm ein Taschentuch aus dem Sweater, schneuzte sich und seufzte danach anhaltend. »Ich habe eine Bitte: Kannst du mir das Schießen beibringen? Und das Kämpfen, Tante Sia? Ich möchte nicht, dass noch einmal jemand Mama und mir weh tut. Ich will mich … uns verteidigen können.«
Sie ist wirklich tapfer. Sia sah ihr an, dass sie es ernst meinte. »Du bist noch ein bisschen jung. Wenn du zehn bist …«
»Vielleicht taucht aber bis dahin wieder irgendeine Kreatur auf«, fiel ihr Elena ins Wort. »Ich bin nicht doof. Du bist eine Vampirin, und ich weiß, dass es noch sehr viel mehr von euch gibt. Und Werwölfe, wie diesen Comte. Die können doch wieder bei uns aufkreuzen und uns umbringen wollen. Was machen wir denn dann, wenn du nicht da bist, Tante Sia?«
Gute Frage. Sia versuchte ein Lachen, das nicht echt klang. Man hörte die Lüge in ihrer Stimme. »Nein, ich bin jetzt immer für euch da und passe auf.«
Elena legte den Kopf besserwisserisch schief. »Auch bei grellem Sonnenschein im August?«
Schiff versenkt. »Hör mal, Elena, ich …«
Das Mädchen beugte sich nach vorne. »Du musst mich ausbilden! Es geht doch gar nicht anders. Ich bin jung, ich lerne schnell, und ich habe keine Angst vor dem, was ich von dir erfahren werde. Ich verspreche es!«
Wieder wurde Sia die Andersartigkeit ihrer Nichte bewusst. Eine Andersartigkeit, die sie von sich kannte, von damals, im siebzehnten Jahrhundert, als ihr Vampirvater erschienen war, um sie nach dem Tod der Mutter mitzunehmen. Sie hatte Dekaden in seiner ausgebauten Mühle zwischen Büchern verbracht, um Wissen in sich aufzusaugen: über die Kinder des Judas, über Naturwissenschaften und Sprachen, über Gott und die Welt – und natürlich über das Kämpfen. Kaum jemand konnte es mit ihr und ihren Dolchen aufnehmen.
Jetzt saß mehr als dreihundert Jahre danach ein kleines Mädchen vor ihr und verlangte mit ernstem Blick, die Tradition der Ausbildung wieder aufzunehmen.
Sie ist viel weiter, als ich es damals war. Dennoch sträubte sich Sia dagegen. Sie hatte Angst, dass nach der Ausbildung früher oder später Elenas Umwandlung in eine Vampirin anstand. Vielleicht verbreitete sich der untote Keim schon in der Brust des Kindes, wucherte in jede Zelle. Dieses Schicksal sollst du nicht mit mir teilen. Du darfst es einfach nicht!
»Wir warten noch ein wenig damit«, beharrte Sia und strich über Elenas rechte Wange. »Lass uns darüber nicht streiten, bitte.« Dann fiel ihr ein, wie sie Zeit schinden konnte. Unfair, aber wirkungsvoll. »Ich brauche dazu das Einverständnis deiner Mutter. Ohne das kann und möchte ich es nicht tun.«
Elena verzog den Mund, entgegnete jedoch nichts.
Sia stand auf und konnte die unausgesprochene Antwort des Mädchens dennoch hören: Was machen wir, wenn Mama nicht mehr aus dem Koma erwacht?
Elena packte ihre Schulsachen zusammen und band sich die Schnürsenkel fester. »Ich muss jetzt los, Tante Sia. Ich bin mit Trisha und ihrer Mutter verabredet. Ich bringe Trisha ein paar Schulbücher, und danach gehen wir Schlittschuh laufen. Heute Abend bin ich wieder da, wie abgemacht.« Sie schnappte sich den Ranzen und warf ihn über die Schulter. Dann trat sie ans Bett ihrer Mutter und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Sia sah, dass sie etwas aus ihrer Tasche nahm und zwischen die Finger der Komatösen schob. »Tschüs!«
»Viel Spaß! Sechs Uhr, hier. Wir fahren dann zusammen nach Hause«, rief Sia ihr nach, doch Elena war bereits aus dem Zimmer verschwunden. Sie wandte sich zum Krankenbett und stellte sich neben Emma, schloss die Augen und streckte behutsam ihre Sinne aus – nach IHM.
Es gab dabei keinen Trick oder ein Ritual oder sogenannte Magie – wenn sich der Tod im Raum befand, wusste Sia es einfach.
Aber heute nahm sie ihn nicht wahr. Emma war sicher.
Sia öffnete die Augen. »Es tut mir leid, dass ich dir das alles eingebrockt habe«, sagte sie zum bestimmt hundertsten Mal zu Emma. »Ich hoffe, du hörst mich, und ich bitte dich, dass du mir verzeihst. Aber du musst aufwachen! Du darfst nicht in dem Niemandsland der Seelen hängenbleiben. Deine Tochter braucht dich. Ich bin ein schlechter Ersatz.« Sie küsste die heiße Stirn der Komatösen, drückte ihr die Hand.
Ich werde den Oberarzt gleich wegen dem neuerlichen Kernspintermin nerven, bevor er es vergisst oder denkt, dass andere wichtiger wären. Sia ging hinaus in den Korridor, in dem es roch, wie es in Krankenhäusern immer roch: Plastikfußboden, Desinfektionsmittel und gerade eben noch ein Hauch von Kaffee aus dem Schwesternzimmer; der Geruch des Mittagessens hatte sich bereits verflüchtigt.
Neben der Sorge, dass Emma im Koma gefangen bleiben könnte, existierte die Furcht vor ihrem Tod. Es war mehr als ein bloßer Verlust einer geliebten Person, denn es bestand die Gefahr, dass aus der Frau eine Blutsaugerin wurde wie Sia selbst. Eine Judastochter. Als Sias Nachfahrin, wenn auch nicht direkte Tochter, war die Wahrscheinlichkeit groß. Ebenso bei Elena.
Dann müsste ich ihr den Kopf abschlagen und ihre Leiche verbrennen, und das … will ich einfach nicht. Ich will es nicht mehr tun müssen. Nicht so früh … Sie ist viel zu jung.
Am Flurende tauchte der hochgewachsene Professor Kleinert auf, dem die älteren Schwestern den Spitznamen Sascha gegeben hatten. Sein echter Name lautete Axel, aber er war dem Schauspieler Sascha Hehn aus der Zeit der Schwarzwaldklinik zum Verwechseln ähnlich.
Sia marschierte los, um ihn abzufangen, bevor er in sein Büro verschwinden konnte.
Noch war ihr Leben kompliziert, weil sie mit zwei Namen unterwegs war. Im Krankenhaus kannte man sie als Theresia Sarkowitz, aber in ihrem gefälschten Personalausweis stand bereits ihr neuer Name: Jitka von Schwarzhagen.
Gleich ein paar Probleme hatten den Identitätswechsel notwendig gemacht. Für das Krankenhaus würde sie der Einfachheit halber Sia bleiben, auch Elena sprach sie so an. Für den Rest der Welt war sie Jitka geworden. Es war der Name, den sie als kleines Mädchen getragen hatte.
»Hallo, Sa… Herr Professor«, rief sie und eilte auf Kleinert zu. Er blieb stehen und hob den Arm zum Gruß. »Ich hätte eine dringende Bitte an Sie.«
2. Februar, Deutschland,Sachsen, Leipzig, 17.36 Uhr
Elena bohrte die hintere Kante des Schlittschuhs ins Eis und bremste, dann legte sie sich zur Seite und zog in engem Abstand an einem Paar vorbei. Wie kann man nur so langsam sein!?
Eigentlich war die Bahn ein gewaltiger, rechteckiger Brunnen, aber entweder hatte die Stadtverwaltung vergessen, das ungewöhnlich hohe Wasser vor Wintereinbruch ablaufen zu lassen, oder es war bewusst drin gelassen worden. Jedenfalls vergnügten sich an dem Tag etliche bekufte Leipziger auf der Eisfläche, und mittendrin kurvten Elena und Trisha. Findige Händler hatten Buden mit Glühwein- und Bratwurstverkauf aufgestellt. Das größte Getümmel war glücklicherweise schon vorbei, es leerte sich allmählich.
Der kalte Fahrtwind fuhr Elena durchs Gesicht und durch die Mütze, aber es war ihr egal. Sie mochte es, schnell unterwegs zu sein. Das hatte sie von ihrer Tante übernommen.
Aus den Augenwinkeln bemerkte sie einen älteren Mann mit grauem Mantel und Hut, der an der Rostwurstbude stand und in eine dampfende Thüringer biss. Seine Augen waren auf sie gerichtet. Absichtlich und nicht mal aus Zufall, wie es geschehen konnte, wenn man etwas tat und sich dabei umsah. Er schaute nicht einmal weg, als er verstand, dass sie seine Blicke gespürt hatte; dann schoben sich andere Eisläufer in ihr Gesichtsfeld, und der Unbekannte war verschwunden.
Was wollte der denn? Elenas Ausgelassenheit wurde getrübt, schlagartig erwachte der Argwohn. Die Erinnerungen an das Massaker hatten sich fest in sie eingebrannt. Die Erkenntnis, dass eine auf den ersten Blick harmlose Person zu den schlimmsten Dingen fähig war, hatte ihre Unbefangenheit zu weiten Teilen ausgelöscht.
Elena drehte eine weitere Runde auf dem Eis vor dem Völkerschlachtdenkmal und hielt Ausschau – aber den Mann sah sie nicht mehr. Erleichterung breitete sich in ihr aus.
»Schau mal, ich kann eine Pirouette!«, rief Trisha aus einiger Entfernung und gab sich zumindest Mühe, bei dem Versuch gut auszusehen. Ihre Mutter stand am Rand und applaudierte.
Elena klatschte auch. Trotzdem. »He, super!« Sie beschrieb einen engen Bogen und kehrte zu ihrer Freundin zurück; dabei wich sie mehreren entgegenkommenden Eisläufern geschickt aus, was einen durchaus waghalsigen Eindruck machte. Trishas Gesicht wurde lang: Elena war ihr weit überlegen, und das frustrierte sie deutlich.
»Na, machen wir Schluss für heute?«, rief Trishas Mutter, die einen Becher in der Hand hatte, aus dem es verdächtig nach Glühwein roch.
Elena fühlte ihre Zehen, Finger und Ohren nicht mehr, die Kälte hatte sie taub werden lassen. »Ja. Ich bin echt durchgefroren.« Ich fühle keine Schmerzen dabei. Erfrieren scheint wirklich nicht so schlimm zu sein.
Trisha hatte blaue Lippen und eine rote Nase. »Ich auch. Der Tee vorhin hat auch nicht geholfen.« Die beiden Mädchen ließen sich an den Rand zu ihren Sachen treiben und setzten sich, um die Schlittschuhe auszuziehen und in die Stiefel zu steigen.
»Oh, Mann. Die sind vielleicht kalt!«, stieß Trisha hervor und quietschte auf.
»Wir hätten den Tee da reinkippen sollen.« Elena fröstelte.
»Habt ihr Hunger?« Trishas Mutter nickte zum Glühweinstand, der auch Waffeln verkaufte.
»Au ja! Gute Idee!«, jubelten die Mädchen im Chor.
»Kriegt ihr das alleine hin?«, fragte die Mutter und zog einen Zehneuroschein aus dem Mantel, reichte ihn der Tochter. »Ich gehe schon mal zum Auto und lasse es warm laufen. Ihr wisst ja noch, wo wir parken?« Die Freundinnen nickten, und sie ging los.
Hand in Hand liefen die Mädchen zu der Bude, für zwei Euro gab es zwei kleine Waffeln mit Puderzucker obendrauf. Grinsend knusperten sie und betrachteten dabei die immer weniger werdenden Leipziger auf der Eisfläche; kichernd kommentierten sie deren Fahrkünste und die Mode. Trisha gab noch eine Runde Tee aus.
»Ach du Schande«, rief Trisha, nachdem sie auf die Uhr gesehen hatte. »Mama wartet ja auf uns! Kommst du?«
Elena sah auf ihren fast vollen Teebecher. Sie konnte es nicht leiden, im Gehen zu trinken. »Nee. Den trinke ich noch leer. Geh du nur, ich fahre mit der S-Bahn. Meine Tante hat es mir erlaubt.« Nur eine kleine, harmlose Flunkerei, um Trishas Mama zu beruhigen.
»Wir sehen uns morgen in der Schule.« Trisha nickte, nahm ihren Rucksack und lief los.
Elena beobachtete schlürfend weiter. Die letzten beiden Eisläufer gingen von der Bahn, die Buden schlossen ihre Läden, und die Scheinwerfer wurden ausgeschaltet. Es wurde immer dunkler auf dem Platz; nur noch das illuminierte Völkerschlachtdenkmal spendete durch die Reflexionen auf der sandsteinfarbenen Oberfläche Helligkeit.
Tante Sia wird bestimmt ärgerlich sein, aber ich habe noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Endlich hatte Elena den Becher geleert und machte sich in Richtung Straße auf den Weg. Als sie am Rand des Bassins vorbeiging und das zerkratzte, zerfurchte Eis sah, dachte sie an die Erklärungen von Schwester Hildegard über das Erfrieren.
Ihre Schritte wurden langsamer.
Es gab zwei gute Gründe, warum Elena sich mit dem Sterben beschäftigte.
Der eine war die feste Überzeugung, nach dem Tod als Vampirin zurückzukehren und nicht einfach so zu vergehen. Sie würde das Schicksal ihrer Vorfahren teilen. Und als Vampirin bekam sie die vielen Superkräfte, von denen sie gelesen und von denen ihre Tante erzählt hatte. Damit würde sie ihre Mutter vor allen Gefahren, die noch lauerten, beschützen können.
Der andere war, dass sich Sia standhaft weigerte, ihre Ausbildung zu Lebzeiten zu beginnen. Aber wenn ich zu einer Vampirin geworden bin, bleibt ihr gar keine andere Wahl mehr.
Eine Luftblase huschte unter dem klaren Eis hindurch.
Dass sie sich selbst umbringen würde, das hatte sie am dritten Tag im Krankenhaus beschlossen, als ihr klarwurde, wie wenig sie als Kind gegen Bedrohungen ausrichten konnte; als Vampirin dagegen … Aber sie hielt den Entschluss vor ihrer Tante geheim. Schwester Hildegard hatte wohl geplaudert, und vorhin, im Krankenhaus, hatte Elena Angst gehabt, dass Sia sie darauf ansprechen wollte. Die Unterredung war zum Glück ausgeblieben.
Die Frage nach der Methode des Selbstmords hatte sie noch nicht entschieden. Ihr Körper musste dabei intakt bleiben. Also flog alles von ihrer Todesliste, was Schaden zufügte, wie vor den Zug werfen oder von hohen Gebäuden springen oder sich vom Auto überfahren lassen. Sobald das Genick gebrochen oder der Kopf abgetrennt war, würde sich die Wandlung nicht vollziehen, und sie wäre einfach nur – tot. Es blieben zwar noch viele andere Möglichkeiten, doch hatte Elena Angst vor den Schmerzen.
Erfrieren ist wie Einschlafen. Sie legte die nackte Hand aufs Eis. Im Wasser müsste es noch schneller gehen.