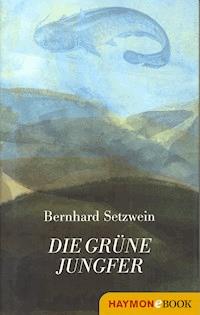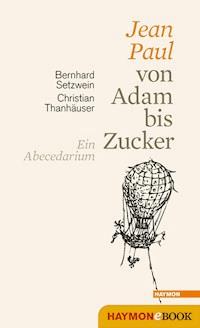Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: lichtung verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Keineswegs ist Franz Kafka 1924 in einem Sanatorium in Wien gestorben, wie die Welt glaubt. Seinen Tod hat er nur vorgetäuscht. Jetzt in den Nachkriegsjahren führt er ein unaufgeregtes Leben in Meran, von niemandem erkannt. Die erfolglose Schriftstellerei hat er aufgegeben, stattdessen arbeitet er als Billeteur in einem Kino. Eines Nachts führt ihn der Zufall mit Marek Hłasko zusammen, einem jungen Schriftsteller aus Polen. Das ungleiche Paar organisiert sich kurzerhand ein Fahrzeug, einen Fiat Ollearo, und die beiden brechen auf zu einer Reise. Ihr surrealer Trip führt sie nach Graz, Wien und München. Die Gespräche mit Hłasko und die Abenteuer unterwegs wecken bei Kafka Erinnerungen an eigene Werke und an Stationen seines früheren Lebens, zum Beispiel an die aufregende, aber kurze Beziehung zu Milena Jesenská, an seine letzte große Liebe Dora Diamant oder an das schwierige Verhältnis zu seinem Vater.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Setzwein
KAFKAS REISEDURCH DIEBUCKLIGE WELT
Roman
edition lichtung
Zum Buch
Keineswegs ist Franz Kafka 1924 in einem Sanatorium in Wien gestorben, wie die Welt glaubt. Seinen Tod hat er nur vorgetäuscht. Jetzt in den Nachkriegsjahren führt er ein unaufgeregtes Leben in Meran, von niemandem erkannt. Die erfolglose Schriftstellerei hat er aufgegeben, stattdessen arbeitet er als Billeteur in einem Kino.
Eines Nachts führt ihn der Zufall mit Marek Hłasko zusammen, einem jungen Schriftsteller aus Polen. Das ungleiche Paar organisiert sich kurzerhand ein Fahrzeug, einen Fiat Ollearo, und die beiden brechen auf zu einer Reise. Ihr surrealer Trip führt sie nach Graz, Wien und München. Die Gespräche mit Hłasko und die Abenteuer unterwegs wecken bei Kafka Erinnerungen an eigene Werke und an Stationen seines früheren Lebens, zum Beispiel an die aufregende, aber kurze Beziehung zu Milena Jesenská, an seine letzte große Liebe Dora Diamant oder an das schwierige Verhältnis zu seinem Vater.
Der Autor
Bernhard Setzwein wurde 1960 in München geboren und studierte Germanistik. 1990 zog er in die Oberpfalz, er lebt heute in Waldmünchen und in München. Setzwein ist Autor von Lyrikbänden, Essays, Reisefeuilletons und Romanen. Außerdem hat er ein Dutzend Theaterstücke und zahlreiche Radio-Features verfasst. Oft befassen sich seine Werke mit dem mitteleuropäischen Kulturraum. Bernhard Setzwein erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Friedrich-Baur-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Seine Werke wurden u. a. ins Tschechische, Rumänische und Französische übersetzt.
eBook-Ausgabe 2024
© lichtung verlag GmbH
94234 Viechtach Bahnhofsplatz 2a
www.lichtung-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Unbefugte Nutzungen wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übetragung können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.
Umschlaggestaltung: Florian Toperngpong, Regensburg
Foto Kafka: Österreichische Nationalbibliothek Wien: Pf 1544:C(3)
Foto Hłasko: Der Rechteinhaber konnte trotz sorgfältiger Recherche nicht ermittelt werden. Der Verlag bittet um Nachricht, sollte ein Rechteinhaber identifiziert werden können.
ISBN 978-3-941306-66-0
Das Buch ist unter der ISBN-Nummer 978-3-941306-64-6 auch als gedrucktes Exemplar erschienen.
»… als wäre ich eines zweiten Lebens ganz gewiß.«
Franz Kafka, Tagebuch, 21. Februar 1911
»Die Möglichkeiten waren unendlichund man konnte auch im Leben sterben.«
Franz Kafka an Milena Jesenská
»Dabei sind meist nicht die Tatsachenausschlaggebend, es ist vielmehreine reine Frage der Atmosphäre.«
Dora Diamant in einem Interview
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 34
Kapitel 34
Kapitel 35
Nachbemerkung
1
Nun hatte es sich der Doktor, immerhin war er schon siebenundsiebzig Jahre alt, doch noch so einzurichten gewusst, dass er sagen konnte: Das Leben ist unproblematisch. So unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind ja nur wir Lenker, weil wir nicht wissen, wie man das Leben zu fahren hat. Auch diejenigen, die eine Mitfahrgelegenheit suchen, können ein Problem sein, indem sie den Lenker irritieren, manchmal sogar unvermittelt ihm ins Steuer greifen, sie sind schuld, wenn das Leben im Graben landet. Schließlich die Straßen selber mit ihren hinterhältigen Straßengräben, die gehören zu den problematischsten Seiten der Lebensfahrt überhaupt. Sie machen die Sache erst so richtig kompliziert, weil sie nicht einfach geradeaus führen, an einen Ort, von dem man behaupten könnte, er sei das Ziel. Die unablässige Bosheit der Straßen besteht darin, Kurven zu machen, insbesondere in einem alpinen Gelände wie dem rund um Meran, wo der Doktor nun schon seit geraumer Zeit lebte.
Er war hier nach dem Krieg untergetaucht, in dieser hinter dem Alpenhauptkamm gut verborgenen Gegend. Niemand aus seinem alten Leben wusste, dass er hier war. Freilich, es waren die meisten von früher auch schon tot, umgebracht in Lagern, die man jetzt, da das volle Ausmaß des Grauens nach und nach offengelegt wurde, anfing, Tötungsfabriken zu nennen. Von seiner Familie war es allein dem Doktor gelungen, sich zu retten, was ausgerechnet ihm niemand zugetraut hätte. Alle waren sie der Meinung gewesen: Der Doktor ist sowieso verloren.
War er aber nicht. Oder höchstens verloren im Sinne von verschwunden. Seit dem vierundzwanziger Jahr war er das. Damals hatten alle geglaubt, er sei gestorben. Und fingen an, ihn posthum hochleben zu lassen. Während er, nach langem Hin- und Hertreiben durch die Mitte Europas, sein ideales Versteck gefunden hatte. In einer Gegend freilich, die herausforderte, das hatte er schnell bemerkt und das gefiel ihm auch. Er musste sie ja, in seinem Alter, nicht noch selber ausprobieren, all die rasiermesserscharfen Grate, Klettersteige, Steilwände und halsbrecherischen Passstraßen, aber zuschauen vom sicheren Platz am Rand her, das mochte er schon. Und somit auch ein wenig teilhaben an dem Gefühl, das einem sagte: Solange man dem Absturz entkommt, ist man am Leben. Und das Am-Leben-Sein war das Unproblematischste überhaupt, vorausgesetzt man hatte seinen Tod, so wie der Doktor, schon hinter sich.
Dann war es möglich, sich allem auszusetzen, sogar einer Bergwelt wie der rund um Meran. Außerdem schien hier 300 Tage im Jahr die Sonne. Genau das Richtige für den Doktor, der noch immer dieselbe dunkle Hautfarbe trug wie in seinen jungen Jahren. In einer solcher Gegend war man vom ersten Tag an überredet zum Übermut. Und wenn’s nur das Zuschauen beim Übermut der anderen war, der Jüngeren, Risikofreudigeren. Das Fenster zur Gasse hatte der Doktor dieses Lebensgefühl einmal genannt, und jenes Fenster hatte er schon früh als Ausweg für all diejenigen erkannt, die verlassen lebten, so wie er. Nur waren es längst nicht mehr Pferde und in ihrem Gefolge Wagen und Lärm, die einen zu menschlicher Eintracht mitrissen, sondern beispielsweise Motorradfahrer. Lärm machten die sogar noch mehr, und so sah der Doktor ihnen gerne hinterher, wie sie das Passeiertal hinaufjagten, um sich dem Jaufenpass in kämpferischer Absicht zu stellen. Sie, die neuen Âventiure-Ritter, waren bereit für Abenteuer, bei denen ihr Leben jederzeit aus der Kurve fliegen konnte … und scherten sich nicht darum. Das war es, was dem Doktor imponierte.
Solche Schauspiele auf der Messerschneide zwischen Leben und Tod hatte er schon viele Jahren zuvor beobachten können, im neunzehnhundertneuner Jahr, als er nämlich mit seinem Prager Freund Max Brod unterwegs gewesen war. Damals waren sie auch schon durch Südtirol gekommen und hatten die verwegenen Haarnadelkurvenkünstler erlebt, die immer halb über den Abgründen hingen, um im allerletzten Moment dem drohenden Absturz doch noch davonzurasen auf ihren höllischen Motorrädern der ersten Generation. Und dann erst die noch viel tollkühneren Frauen und Männer in ihren fliegenden Kisten bei der Flugschau in Brescia, dem eigentlichen Ziel ihrer Reise. Denen genügten die Straßen und Kurven unten auf der Erde nicht und daher gravierten sie die aberwitzigsten Serpentinen oben in den Himmel, mit den Dunststreifen aus ihren Etrichmotoren. Die schrieben dann in den lombardisch blauen Himmel, das Leben ist unproblematisch, und der junge Doktor hatte ungläubig zu dieser Wahrheit hinaufgestaunt und sie gerade noch entziffern können, ehe die Geheimschrift auch schon wieder verschwunden war.
Vielleicht war es aber auch einfach nur eine Vision des Zukünftigen gewesen und ein kurzer Fingerzeig des Himmels, dass das Glück, wenn überhaupt, südlich des Alpenhauptkammes zu finden war, jedenfalls nicht im grauen, oft nebeligen Prag, woher die beiden jungen Männer gekommen waren. Dass das Mütterchen, das sie zur Welt gebracht hatte, Krallen hatte und nie loslassen würde, war eine Tatsache, die dem Doktor lange schon bewusst gewesen war, er hatte sie einfach nur nicht ändern können. Dazu hatte noch sehr viel passieren müssen. Tode waren zu sterben gewesen und eine Neu- und Wiedergeburt durchzumachen. Aber dann landete er doch noch dauerhaft hier im Paradiesgarten, wo Palmen, Pinien und Zedern in der Erde wurzelten und ganzjährig wuchsen und der Himmel voller Trauben und Äpfel, Walnüsse und Kastanien hing, lauter Geschenke der Natur, die längst zu seiner Leibspeise geworden waren. Er ernährte sich von nichts anderem mehr, Kochschokolade und Vanillenudeln vielleicht ausgenommen.
Und noch etwas kam hinzu: Man sprach hier deutsch, wenn auch nicht auf den Ämtern und am Gericht. Aber das kannte er ja schon von Prag nach 1918 her, und das hatte er auch gemeistert, ja es hatte ihn sogar inspiriert. Deutsch sprach man hier in der ehemaligen Grafschaft unterhalb der offiziellen Sprache, im Geheimen, es war ein Sprechen wie in Katakomben, kam es dem Doktor vor, vielleicht auch aufgrund der Enge der Gassen unterhalb des Pulverturms, der viel zu schmalen Himmelsausschnitte über manch kleiner Piazza im Steinach-Viertel. So wie es einmal ein Prager Deutsch gegeben hatte, mittlerweile war es verschwunden, auf ewig und immer, so gab es hier gleichfalls ein anderes Deutsch, immer noch, ein kleines, ohnmächtiges, das der Doktor, trotz der vielen Jahre, die er jetzt schon hier wohnte, nicht immer in allen Augenblicken des Alltags verstand. Aber das machte nichts. Er liebte dieses Deutsch und er würde es verteidigen, so wie er seinerzeit das Deutsch der Niklasgasse, des Altstädter Rings, der Geistgasse und des Ghettos verteidigt hatte. Nicht indem er etwas aufschrieb, das Schreiben hatte er aufgehört, längst schon. Oder doch wenigstens völlig in sich hineinverlegt, hineinversenkt, ohne jede äußeren Anzeichen wie Schreibgerät und Papier. Wenn es noch da war, war es ein heimliches Schreiben geworden, ein in ihm vergrabenes, er fuchtelte nicht mehr mit der Axt in der Schreibhand wie wild herum, er war ganz ruhig geworden. Wenn er am Feierabend – er ging noch immer einem Brotberuf nach, sein inszenierter Tod hatte ihn aller Pensionsansprüche beraubt – in seiner winzigen Wohnung saß oder in einer der Trattorien, dann sah er zwar noch immer den Vorbeigehenden nach, hörte ihren Gesprächen hinterher, aber nichts davon schrieb er mehr auf. Er war still geworden. So still, dass er manchmal glaubte, ein leises Knacken und Splittern tief in sich drinnen zu spüren und zu hören. Dann wusste er: Die Axt, für die er das Schreiben immer gehalten hatte, war jetzt tatsächlich angekommen, sie arbeitete an dem gefrorenen Meer in ihm, und keiner würde auch nur das Geringste davon erfahren.
2
Endlich hatte der Doktor doch noch sein Erez Israel gefunden, nur dass es unerwarteterweise die Gestalt eines liebenswürdigen Südtiroler Städtchens angenommen hatte. Auswanderungspläne mit dem Ziel Palästina waren längst ad acta gelegt und vergessen. In seinem alten Leben hatte er an einem bestimmten Punkt geglaubt, dass er niemals aus Böhmen hinausfinden würde, dass er nur mehr auf Prag eingeschränkt sei (und da, genau genommen, auch nur auf die wenigen Straßenzüge rund um den Altstädter Ring), dann auf sein Zimmer, schließlich sein Bett, letztlich auf eine bestimmte Körperlage und dann … auf nichts mehr. Auf eine solche Möglichkeit, wie sie ihm dann Meran angeboten hatte, hatte er nicht mehr zu hoffen gewagt.
Bald nachdem er hier gestrandet war, hatte er sich aufgemacht, eine Stellung zu finden. Der Besitzer des Apollo war schließlich nachsichtig gewesen und hatte über das fortgeschrittene Alter des Doktors großzügig hinweggesehen. Schließlich suchte er für sein winziges Kino, es hatte nur einen einzigen Vorführraum, dringend einen Billeteur, idealerweise jemanden, der durch seine Erscheinungsweise ein gewisses Gegengewicht zu der schrulligen Alten darstellen würde, die er gezwungen war, an der Kasse zu beschäftigen. Als der Doktor zur Bewerbung in seinem obligaten Dreiteiler erschien, hatte er im Grunde schon so gut wie gewonnen, denn dem Kinobetreiber war sofort klar, ein solcher Herr, noch dazu mit solchen Umgangsformen, wie sie sich ihm im Gespräch schnell offenbarten, würde sein bescheidenes Filmtheaterchen zu einem fast schon Lichtspielpalast aufwerten. Außerdem erhoffte er sich, dass sein vorwiegend jugendliches Publikum den neuen Billeteur aufgrund seiner Erscheinung als Respektsperson ansähe und es nicht mehr wie in der Vergangenheit dazu kommen würde, dass sich besonders gewitzte Halbstarkenbürscherl einfach ohne Eintrittskarte in die Aufführungen hineinmogelten.
Dem war auch so. Zumindest in der Anfangszeit der neuen Aufgabe für den Doktor. Er nahm sein Amt als Einlasskontrolleur zum Kinomatographenparadies gerade so ernst wie all die Türwächter in seinen Geschichten, die er früher geschrieben hatte. Das heißt, an ihm war unmöglich ein Vorbeikommen. Und doch mochte er die vielen jungen Menschen, die das Kintopp genauso liebten, wie er es geliebt hatte in seinen jungen Jahren. Mit der Zeit wurden sie immer vertrauter, die Kinogeher und der Billeteur, bis er ihnen sogar eines Tages seinen Vornamen verriet. Von da ab war er für alle nur mehr der »Franz«, den man alles fragen konnte, die große, weite Filmwelt betreffend. Er wusste nicht nur, was die kommende Woche auf dem Programm stehen würde, er konnte beinahe jeden beliebigen Film, auch der Vergangenheit, in einer kurzen Inhaltsangabe zusammenfassen, die auftretenden Stars beim Namen nennen und vor allem ein stets treffendes Urteil darüber abgeben, ob sich der Besuch der Aufführung lohne oder nicht. Und so konnte es irgendwann nicht mehr ausbleiben, dass »der Franz« in seiner Gutmütigkeit den einen oder die andere durchwinkte, wenn er den Eindruck hatte, er oder sie müsse unbedingt La Dolce Vita von Fellini oder die Schachnovelle mit Curd Jürgens sehen, auch wenn gerade unglücklicherweise das nötige Kleingeld dazu fehlte. Vor allem bei jungen Pärchen konnte er nicht anders, als ein Auge zuzudrücken. Zu oft war er dann nämlich an seine eigenen jungen Jahre erinnert, als er für seine Sinn- und Nutzlosigkeit, seine grenzenlose Einsamkeit nur mehr die eine Rettung wusste, nämlich ins Kinomatographentheater zu gehen, der einzige Ort, wo er weinen konnte und denken, »ich bin ganz leer und die vorüberfahrende Elektrische draußen auf der Straße hat mehr lebendigen Sinn als ich«.
In der Straße vor dem Apollo Kino fuhr allerdings gar keine elektrische Tramway. Auch saßen hier nur glückliche Menschen, die meisten in Umarmungen mit denjenigen, die sie begleiteten. So jedenfalls kam es dem Doktor vor, wenn er von seinem Notsitz aus ganz hinten im kleinen Vorführungssaal dies alles betrachtete. Und er selber durfte mit dabei sein in diesem magischen, rubinfarbenen Raum, wenn die bewegten Höhlenbilder vorne über die große Leinwand flimmerten. Am frühen Nachmittag spazierte er meist noch den Weg zur Pferderennbahn hinaus und wieder zurück, und um fünf Uhr nachmittags begann dann seine Arbeit, die ihm der Himmel geschickt haben musste, obwohl er an den gar nicht glaubte. Der Verdienst war gering, und es dauerte auch nicht lange, bis der Doktor begriff, dass der Besitzer des Apollo selber in beträchtlichen Geldnöten steckte. Aber das alles machte nichts, weil der Doktor brauchte nicht viel, er bewohnte ja lediglich ein möbliertes Zimmer bei der Familie Wischkin. Das heimliche Glück, jeden Tag, ganz hinten im Kinosaal auf dem Notsitz versteckt, gleich mehrere Filme sehen zu dürfen und das verzauberte Kinogeherpublikum mit dazu, war sowieso mit keinem Geld aufzuwiegen. Und so kam der Doktor letztlich zu dem Schluss: Alles war gut.
Freilich gab es auch immer wieder Zwischenfälle, Nichtigkeiten, abgefeimte Versuche, ihn spüren zu lassen, dass seine Tarnung durchschaut werden konnte. Einzelne, besonders gemeine und böse nicht Mit-, sondern Gegenmenschen versuchten gar, ihn ansatzweise all das spüren zu lassen, was zum Beispiel seinen Schwestern samt deren Familien angetan worden war. Doch das, was er im Vergleich zu seinen Angehörigen auszuhalten hatte, waren Bedeutungslosigkeiten und gingen als Angriff im Grunde ins Leere. Auch wusste der Doktor sich dagegen zu schützen. Er verkroch sich in einem labyrinthischen Bau, den er unterhalb der Lebensoberfläche der alltäglichen Verrichtungen anlegte, kein Mensch hatte die geringste Ahnung davon. Zusätzlich tarnte sich der Doktor mit größtmöglicher Distanziertheit und einer stets nur lächelnden Einsilbigkeit, die nicht wenige für eine Form erstaunlich kultiviert wirkenden Blödseins hielten.
Daher ließen die allermeisten den Doktor so sein, wie er war, und billigten ihm die Rolle eines Sonderlings zu. Jedes Städtchen sollte eine Handvoll von ihnen haben, warum also nicht auch Meran? Wenn tatsächlich einmal irgendwo, in einer Espresso-Bar oder in der Warteschlange vor einem Ufficio postale, das Zischen oder Fauchen irgendwelcher Ewiggestrigen hörbar wurde, dann hätte der Doktor eigentlich allen Grund gehabt, das nicht auf sich zu beziehen, es wusste doch niemand etwas Näheres über ihn. Im Grunde blieb rätselhaft, wer gemeint sein sollte, wenn in hasserfüllter, unterdrückt mordgieriger Weise geraunt wurde, ob die denn noch immer da seien und warum man die oder den, jene oder jenen eigentlich beim Vergasen vergessen habe. Im dreiundvierziger Jahr hatte man die letzten dreihundert Meraner Jüdinnen und Juden zusammengetrieben und weggebracht, so gut wie niemand von ihnen kam mehr zurück und folglich konnte es im Grunde gar keine Adressaten mehr für solcherlei Anfeindungen geben. Wenn der Doktor also in einem ungeschützten Moment und während eines plötzlichen Erschreckens eine dieser giftigen Verwünschungen aufschnappte und auf sich bezog, war das allein sein Problem. Denn niemand ahnte das Geringste über seine Abkunft mütterlicherseits von den Löwys aus Podiebrad und von den landjüdischen Fleischhauern der Vaterfamilie aus Wossek. Er konnte also gar nicht gemeint sein. Und was das Problem in seiner Grundsätzlichkeit betraf, da hatte er doch bereits seit seiner Kindheit damit zurechtkommen müssen, dass es auf dem gesamten Erdball nicht einen einzigen Platz gab, nirgendwo, wo nicht Leute lebten, die einen bis zur Mordlust gehenden Hass auf Menschen wie ihn hatten. Warum also nicht auch in Meran? Was half es? Am besten, man legte sich eine Art Käferpanzer zu, etwas, was der Doktor schon vor Zeiten getan hatte. So ließ sich dann auch in Meran leben. Und gar nicht einmal schlecht.
3
Das hatte der Doktor schon bei seinem ersten Besuch 1920 festgestellt, da war er noch als Kurgast gekommen und drei Monate lang geblieben. In der Maiastraße in der Pension Ottoburg war er untergekommen, nachdem er zuvor zwei Nächte im Hotel Frau Emma in der Nähe des Bahnhofs logiert hatte. Schnell hatte er eingesehen, der Frau Emma nicht gewachsen zu sein, sie war eben das erste Haus am Platz und für den Doktor schlichtweg zu nobel. Er suchte sich besser etwas Günstigeres und bezog schließlich ein Zimmer in der Pension Ottoburg. Dort logierten ausschließlich Kurgäste, die Linderung für ihre sie nur mäßig einschränkenden Leiden suchten. Der Doktor mit seinen 37 Jahren – vom Aussehen her wirkte er bedeutend jünger, beinahe wie ein Student – stach unübersehbar aus dem Gesamtbild der Ottoburg hervor. Es wurde nämlich fast nur von Rentiers und Pensionären bestimmt, allesamt in Begleitung ihrer Gattinnen, die sich aus Mitleid, ehelicher Solidarität und Praktikabilität dieselben Malaisen zugelegt hatten wie ihre Männer. Dass der gutaussehende junge Herr aus Prag, der sich nur vorübergehend von seinem Beamtendienst in der Prager Arbeiter- und Unfallversicherung hatte freistellen lassen, alleine reiste, wurde genauestens registriert und hinter vorgehaltener Hand auch kommentiert. Darüber hinaus hatte niemand Gravierenderes an ihm auszusetzen. Allenfalls sein auffälliges Bemühen, stets allein zu bleiben und sich abzusondern, fand nicht bei allen Billigung.
Vor allem ein aus Deutschland stammender pensionierter Armeeoberst mochte es aufgrund seiner früheren Profession gar nicht leiden, wenn jemand versuchte, sich von der Truppe zu entfernen. Zum Beispiel indem er sich einbildete, er könne sein Abendessen im Speisesaal ganz allein an einer Art Katzentisch einnehmen. Wieder und wieder forderte der Oberst den jungen Prager auf, sich doch zu ihnen an den Tisch zu setzen, eine immer mehr den Befehlston annehmende Einladung, der sich der Doktor schließlich nicht länger entziehen konnte, wollte er nicht eine tatsächliche Brüskierung riskieren. Und so saß er denn nach kurzer Zeit und für den Rest seiner drei Meraner Monate an einer Tafel zusammen mit dem Oberst, dessen Frau sowie einem weiteren Ehepaar, das aus Graz stammte, wo der Mann einen Laden für Eisenwaren betrieb. Zu einem weitergehenden Austausch mit den Grazern konnte es freilich vorerst nicht kommen, weil im Folgenden der Einzige, der bei diesen Abendrunden das große Wort führte, der Oberst war.
Er kommandierte die Conversation so, wie er wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg irgendwo an der Westfront seine Truppenteile kommandiert hatte. Kaum hatte sich der Doktor mit an den Tisch gesetzt, schickte der Oberst seine ersten Angriffswellen gegen ihn los, indem er dessen eigenartige Ernährungsgewohnheiten ins Trommelfeuer seiner Nachfragen nahm. Die Provokation begann ja im Grunde schon damit, dass sich der junge Mann aus Prag sein eigenes Essen an den Tisch mitbrachte, anstatt sich vom Personal der Ottoburg das vorbereitete Menü auftragen zu lassen. Sein Speiseplan für das Abendessen bestand lediglich aus Nüssen, Äpfeln und gelegentlich einem Glas Milch. Der Oberst besah sich das jeden Abend aufs Neue so, als ob ihm gerade der größte Essensfrevel seit der Erfindung des Feuers präsentiert werde. Er nahm die feindliche Frontlinie sofort unter Dauerbeschuss, indem er eine Frage nach der anderen abfeuerte, ungefähr des Inhalts, wozu dieser ganze Unsinn überhaupt gut sei – etwa das Herumkauen auf jedem einzelnen Bissen, bis davon nichts mehr übrig sei als ein völlig gleichförmiger Brei.
Der Doktor hätte erklären wollen, dass er sich bereits seit vielen Jahren, im Grunde seit seinem Kuraufenthalt bei Dr. Lahmann in dessen Sanatorium Weißer Hirsch bei Dresden, eingehend mit Fragen einer gesunden Lebensführung beschäftigt habe. Buchstäblich seine Leib- und Magenlektüre seit dieser Zeit sei das Hygienische Kochbuch zum Gebrauch für ehemalige Curgäste. Dort lese man nicht nur von der richtigen Speisenwahl, sondern auch von der sachgemäßen Zubereitung in Form von Bettelmann-Aufläufen, Grünkern-Puddingen und vegetarischen Ragouts. Von Fleisch kein einziges Wort bei Lahmann! Und dann erst der richtige Verzehr, von dem hätte er noch reden wollen. Exakte zweiunddreißig Mal sei jeder Bissen zu kauen, man müsse förmlich den Versuch wagen, beim Essen zu verhungern, erst dann sei es richtig praktiziert. Und das Müllern müsse unbedingt auch noch dazukommen, die Leibesübungen bei geöffnetem Fenster, wie sie der dänische Gymnasialturnlehrer Johann Peder Müller empfehle, auch davon hätte der Doktor noch gerne begeisterte Reden geführt … aber er sah schon an den Gesichtern der anderen, dass er damit nicht weit kommen würde. Man las ihnen förmlich den Unglauben ab: Wie konnte das alles richtig sein, wenn es den jungen Mann, der nicht einmal halb so alt war wie die Fleischesser am Tisch, offenbar schon seit Jahren von einem Sanatorium ins nächste verschlage? Und helfen konnte ihm offenbar niemand, war er denn schon so etwas wie ein hoffnungsloser Fall? Dem Doktor fielen wieder all die Gespräche ein, die er daheim am elterlichen Essenstisch hatte führen müssen, vor allem mit dem Vater, dem Fleischerssohn aus Wossek, und die hatten auch immer damit geendet, dass sich der Vater ein weiteres Bratenstück nahm, es sich reichlich mit Soße übergoss und die Debatte damit beendete, dass er sagte: Komplett meschugge müsse man sein, wenn man all diesen Unsinn glaube. Kampflos überließ der Doktor daher dem Oberst das Feld.
Als alter Praktiker und Taktiker des Kriegshandwerks wusste der aber nur zu genau, wenn er jetzt nicht nachsetzte, würde er einen großen Fehler begehen. Er blinzelte den jungen Herrn aus Prag, der sich partout zu keinem Widerspruch provozieren ließ, schon eine Spur feindseliger an und brachte, sehr zum betreten schweigenden Missfallen der Damen am Tisch, die Politik aufs Schlachtfeld des ganz allein von ihm dominierten Gesprächs. Ob er schon einen Verdacht hatte und genau wusste, welche Schwachstelle in der Deckung des Gegenübers er nun offenzulegen hatte? Er machte jedenfalls eine überraschende Ausfallbewegung, als er eines Abends plötzlich in Richtung typisch jüdische Lumpereien losstürmte und die übrige Tischgesellschaft damit überrumpelte. Aus irgendeinem Grund war man auf die erst wenige Monate zurückliegenden Münchner Ereignisse zu sprechen gekommen, womit nichts anderes gemeint war als der Umsturz, die Revolution und die Münchner Räteregierung, die in den Augen des Oberst das allergrößte Übel darstellte. Gott sei Dank sei der innerhalb kürzester Zeit der Garaus gemacht worden, und zwar durch Männer wie ihn, Männer vom Fach, Militärfach. Die hatten eilig Truppen zusammengestellt, kernige Burschen aus dem Oberland, wo jeder brave Patriot seinen Karabiner im Bauernschrank versteckt hielt, und mit denen war man in Richtung München marschiert, wo man leichtes Spiel gehabt hatte. Denn im Sündenpfuhl am Isarufer hatte man es ja beinahe durchwegs nur mit verweichlichten Kohlrabiaposteln und Jesuslatschenjüngern zu tun gehabt, über die mit echten Knobelbechern schnell hinweggetrampelt war.
Der Hauptfeind waren dabei die Aufwiegler zu dieser sogenannten Novemberrevolution gewesen, allesamt Juden und zwar von der allerschlimmsten Sorte, nämlich grässliche Machwerke zusammenschmierende Literatenjuden. Die hatten das alles angezettelt und die waren völlig zu Recht, wie der Oberst fand, ohne viel Federlesens sofort an die Wand gestellt worden oder in den Zuchthäusern, in die man sie warf, auf wenig überraschende Weise tödlich verunglückt.
»Was sagt man da?«, bot der Oberst in seinem Redeschwall eine kurze Gelegenheit zum Einhaken an, die aber niemand zu ergreifen die Geistesgegenwart besaß. Und so konnte der Oberst abschließen: »Ein Segen ist das für Deutschland, dass es mit diesen mosaischen Bengeln und diesen jüdischen Frechheiten so schnell ein Ende hatte.«
Immer wieder kam er auf dieses Thema zurück, auch an den folgenden Abenden, und immer insistierender wollte er wissen, was denn der junge Herr aus Prag zu der ganzen Angelegenheit meine. Man sah dem jungen Mann an, wie sehr er unter diesen ständigen Nachfragen litt. Der Doktor wand sich wie eine Schlange, die man mit einer Astgabel unmittelbar hinter dem Kopf auf die Erde drückt. Wie alle klugen Schlangen blieb er dabei vollkommen stumm. Dennoch war das Schauspiel kaum mehr auszuhalten. Diejenige, die es schließlich gar nicht mehr ertrug, war die Ehefrau des Grazer Eisenwarenhändlers. Sie war es, die sich in der höchsten Not dem Doktor zuneigte, um ihm zuzuflüstern, leise, aber nicht leise genug, sodass es alle hören konnten: »So sagen Sie es doch ruhig, man kann es doch zugeben, sagen Sie es, dass Sie selber Jude sind.« Sie wollte einfach nur, dass das ständige Bedrängen des Oberst endlich ein Ende habe.
Diesen Ratschlag konnte sie aber auch nur deshalb geben, weil sie und ihr Mann nach und nach und ohne dass der Oberst dabei war in ein immer engeres Verhältnis zu dem jungen Herrn Doktor aus Prag gekommen waren, bis sie sich schließlich gegenseitig verraten konnten, was eh schon jeder vom anderen ahnte. Man hatte sich viele Nachmittage lang immer wieder zu gemeinsamen Spaziergängen verabredet, am Ufer der Passer entlang, aber auch oben auf eigens für die Kurgäste angelegten Wegen durch die Meraner Weinberge und Apfelgärten, und dabei so manches erzählt und besprochen. Warum also nicht auch dieses Thema, dass nämlich die Ehe der Facklers eine gemischt-konfessionelle war. »Ach, das ist ja dann wie bei meiner kleinen Schwester Ottla«, hatte der Doktor beinahe erfreut ausgerufen, denn sie war in diesen Wochen gerade dabei, ihre Hochzeit vorzubereiten, was gewisse Komplikationen mit sich brachte, war ihr Bräutigam doch ein katholisch getaufter Tscheche.
»Sie sollten den Brautvater erleben, meinen gestrengen Herrn Papa«, hatte der Doktor nur Andeutungen zu machen brauchen, da hatte der Grazer Ehemann schon gleich abgewunken und gemeint, »dasselbe mit meinen Schwiegereltern … generationenlang im Pelzhandel tätig, in der besten Gegend von Budapest, und somit aus ganz anderen Sphären kommend wie unsereiner, der lediglich einen Eisenwarenladen in der Grazer Altstadt betreibt«. Und doch wusste man von da ab voneinander Bescheid. Und so traute sich die Gattin des Eisenwarenhändlers nun, aufzubegehren gegen die ständigen Sticheleien des Oberst, indem sie den Doktor gewissermaßen zum Offenbarungseid aufforderte: »So sagen Sie es doch ruhig, Sie sind ja nicht der Einzige am Tisch«. Das hatte sie mit einem kampfeslustigen Hochwerfen des Kinns und einem Seitenblick auf die Reaktion des Oberst gesagt, dann aber Angst vor ihrer eigenen Courage bekommen und schnell einen Rückzug angetreten, indem sie die weiße Stoffserviette nahm und sich damit den Mund abtupfte.
Der Doktor nützte die Gesprächspause, um etwas klarzustellen. Er machte seine Bemerkung leise und beinahe schüchtern, wie es eben seine Art war. Immerhin wussten die anderen und vor allem der Oberst, der normalerweise um keine spitze Bemerkung verlegen war, darauf erst einmal nichts zu erwidern. Der Doktor sagte: »Was habe ich mit den Juden gemein? Ich habe ja kaum etwas mit mir selber gemein.«
4
Die allabendlichen Kämpfe im Speisesaal der Ottoburg hatte der Doktor nur deshalb ausgehalten und über sich ergehen lassen, weil er mit seinen Gedanken ganz woanders war und all das, was sein Kontrahent vorbrachte, ihn im Grunde überhaupt nicht erreichen konnte. Er war nämlich mit all seinem Denken, Suchen und Träumen bei einer Person, die sich genau in jenem Moment in sein Leben hineingeschlichen hatte, als er in Prag aufgebrochen war, um nach Meran zu reisen. Sie hieß Milena Jesenská, war Pragerin, lebte jetzt aber in Wien und hatte dem Doktor eine briefliche Anfrage geschickt, ob er damit einverstanden sei, wenn sie eine seiner literarischen Erzählungen ins Tschechische übersetzen würde, eine Idee, auf die zuvor noch niemand jemals gekommen war. Der Doktor hatte der Frau von Prag aus noch eine kurze Mitteilung geschickt, daraufhin aber erst einmal keine Antwort mehr bekommen. Er versuchte es von Meran aus ein weiteres Mal, mit einem Zettel, der, wie er selber schrieb, eigentlich keiner Antwort bedurfte, aber es kam anders. Nun flogen innerhalb kürzester Zeit die Briefe in immer kürzeren Abständen hin und her, bald schon zwei, drei an nur einem einzigen Tag. Sie rasten in so rascher Folge zwischen Meran und Wien hin und her, dass sie sich unterwegs beim mehrfachen gegenseitigen Kreuzen eigentlich hätten zuwinken können, aber dazu war keine Zeit, denn sie mussten ihr Gegenüber ja so schnell als möglich erreichen.
Nichts sehnte der Doktor allabendlich mehr herbei, als die quälende Conversation im Speisesaal hinter sich zu bringen und von der Tafel des Herrn Oberst wieder an das kleine Schreibtischchen in seinem Zimmer fliehen zu können. Er stand am ebenerdigen Fenster, welches regelrecht eingesenkt war in den davorliegenden Garten, mit Blick auf all die Pinien, Palmen und Zypressen, die sich erfolglos mühten, mit ihrem Grünen auf sich aufmerksam zu machen. Der Doktor übersah sie einfach. Stattdessen war er bemüht, andere Bilder vor seinen Augen erstehen zu lassen, zum Beispiel die Umrisse dieser Frau, von der er wusste, er hatte sie ein paar Mal gesehen, zu der Zeit, als sie noch in Prag gelebt hatte. In irgendwelchen Literaten-Cafés musste das gewesen sein, dass sie einander begegnet waren. Jetzt aber musste er sich eingestehen – und er schrieb ihr das auch –, dass er sich an ihr Gesicht eigentlich in keiner bestimmten Einzelheit mehr erinnern könne, »nur wie Sie dann zwischen den Kaffeehaustischen weggingen, Ihre Gestalt, Ihr Kleid, das sehe ich noch«. Seltsam war das mit dem Erinnern.
An dem Schreibtischchen vor dem Fenster erfasste den Doktor in den folgenden Wochen ein regelrechtes Fieber. Zur Kur war er nach Meran gekommen und damit es ihm besser gehe, doch nun wurde er stattdessen immer kränker. Allerdings war es eine Krankheit, die sich an keinerlei Blutwerten ablesen ließ, und für Laien, wozu selbstverständlich sämtliche Ärzte gehörten, war sie im Grunde überhaupt nicht erkennbar. Das Körpergewicht nahm sogar dekagrammweise zu, vielleicht weil dem Doktor das Herz immer schwerer wurde, mit jedem Brief, den er aus Wien erhielt. Denn in ihnen standen Dinge, die waren oft traurig und niederschmetternd und mussten tage- aber vor allem auch nächtelang im Kopf um und um gewälzt werden. Schon im zweiten oder dritten Brief, der nach Meran geflogen gekommen war, gestand ihm Milena, dass sie lungenkrank sei. Doch wem schrieb sie das! Einem, bei dem dasselbe schon drei Jahre früher begonnen hatte, und zwar mitten in der Nacht mit einem Blutsturz. Das Hausmädchen, das am Morgen noch die Spuren in der Waschschüssel entdeckt hatte, hatte zu ihm im mitleidlosesten Tonfall gesagt, dass es der junge Herr nun sicher nicht mehr lange machen werde, das stehe einmal fest. Milena aber schrieb er, um sie zu beruhigen, dass so eine Lungenkrankheit oft mehr Gutes als Schlimmes bringe. An sich selber zum Beispiel hatte er beobachtet, dass seine Lungenkrankheit wahrscheinlich das Ergebnis höchst schwieriger und immer wieder vor dem Abbruch stehender Verhandlungen war, Verhandlungen, die sein Gehirn mit seiner Lunge führte. Dieses Ringen musste schrecklich gewesen sein und war lange Zeit ganz ohne das Wissen des Doktors vonstatten gegangen. Erst am Blutsturz hatte er erkannt, dass die Verhandlungen mit einem Mal zu einem Ende gekommen sein mussten. Das Verhandlungsergebnis besagte, dass die Lunge nun bereit war, ihren Teil der Last und Verantwortung zu übernehmen – und sei es auch nur für ein Weilchen.
Solche Dinge schrieb der Doktor der Frau Milena nach Wien. Dafür gab er jetzt seine Nächte hin und opferte oft seinen ganzen Schlaf … der Morgen dämmerte schon draußen im Garten vor dem Fenster, wenn er bemerkte, dass er immer noch in der Straßenkleidung am Tisch saß und sich allenfalls ein kurzes halbes Stündchen angezogen aufs Bett gelegt hatte, auf und nicht unter die Bettdecke, wach bleibend und nach Worten suchend. Das war es, was er im Grunde seit Jahren machte, wach bleiben und nach Worten suchen, um diese auf ein Stück Papier zu werfen, ungefähr so wie man im Judo einen Gegner auf die Kampfmatte wirft. Einmal hatte er eine vollständige Erzählung, viele Seiten lang, in nur einer einzigen Nacht niedergerungen, am Morgen lag sie da, besiegt, und das Urteil war gesprochen. In der darauffolgenden Nacht wollte er dasselbe gleich noch einmal wiederholen, er glaubte allen Ernstes, er habe nun endlich den Dreh gefunden, wisse jetzt, wie es gehe, aber tatsächlich konnte er dann auf Wochen hinaus wieder gar nichts mehr schreiben.
In solchen quälenden Zeiten halfen die Briefe aus. Briefe ließen sich immer schreiben. Freilich brauchte man eine Adressatin. Vor der Frau Milena in Wien hatte es das Fräulein Felice in Berlin gegeben. Das war ein anderer und gleichzeitig ähnlicher Fall gewesen. Anders, weil das Fräulein Felice eine preußisch-jüdische Mischung war, Milena dagegen Tschechin, und was für eine. Einer ihrer Vorfahren war nach der Schlacht auf dem Weißen Berg von den Habsburgern auf dem Altstädter Ring hingerichtet worden, seit 1918 stand nun ihr Familienname auf einer Bronzetafel gleich neben dem Rathaus. So eine war die Jesenská, sie trug einen patriotischen Namen, den abzulegen für sie niemals in Betracht gekommen wäre, voller Stolz, was dem Doktor gefiel. Ähnlich dagegen war, dass auch das Fräulein Felice stark, unzerbrechlich und sieghaft gewesen war. Allen Frauen fühlte der Doktor sich unterlegen, vor allem in einer ganz bestimmten Sache, und vielleicht war das auch der Grund, warum letzten Endes immer alles in einem unerbittlichen Kampf hatte enden müssen, bis auf das eine Mal mit Dora (die hatte er durch seinen Tod verloren, verlieren müssen, anders ging es nicht, und darüber wäre er dann beinahe tatsächlich und unwiderruflich gestorben).
»Fast fünf Jahre habe ich auf sie eingehauen«, berichtete der Doktor Milena über seinen Kampf mit Felice, wie er ihr überhaupt alles beichtete und gestand, gleich von Anfang an, es ging ja nicht anders. Wenn der Doktor zu etwas vollkommen unfähig war, dann war es, in der Unwahrheit zu leben. Die Grausamkeit aber einer solchen Haltung zu sich selber und zu allen anderen ließ sich nur dadurch abmildern, indem er die Wahrheit so paradox ausdrückte, dass man sie beinahe nicht als solche erkennen konnte. Später, als sie sich schon monatelang Briefe geschrieben hatten, Briefe mit allem, was an Schwüren, Geständnissen und Versprechen nur möglich war, bedrängte Milena ihn bis aufs Äußerste, nun müsse er aber auch endlich, endlich zu ihr kommen, nach Wien, müsse leibhaftig vor ihr erscheinen, sich anschauen und anfassen lassen, und alles weitere. Da lag er dann wieder nächtelang angezogen auf dem Bett und suchte nach den einzig möglichen Formulierungen für eine Antwort. Erst schrieb er »ich komme ganz bestimmt nicht«, dann machte er ein Komma, überlegte, setzte hinzu »sollte ich aber doch«, … er hielt nochmals inne, machte eine Parenthese, die er in Gedankenstriche setzte (schließlich hatte er lange nachgedacht), »– es wird nicht geschehn –«, um dann endlich den vollendeten Schluss hinzusetzen: »Ich komme ganz bestimmt nicht, sollte ich aber doch – es wird nicht geschehn – zu meiner Überraschung in Wien sein, dann brauchte ich weder Frühstück noch Abendessen, sondern eher eine Bahre, auf der ich mich ein Weilchen niederlegen kann.« Jetzt konnte sie es sich heraussuchen, was sie für die Wahrheit würde halten wollen. Und in seinem Abschiedsgruß schrieb er: »Also auf Wiedersehen (aber es muss nicht in Wien, kann auch in Briefen sein).« Er jedenfalls war wieder einmal ehrlich geblieben bis in die allerletzte Windung seines über alles geliebten Satzbaus hinein.
Freilich ließ sich so etwas nur schwer sagen. Dazu musste man Briefe schreiben, gut überlegte, sehr lang ersonnene, manchmal erst nur konzipierte, später dann zusammengeknüllte, im ernstesten Fall nie abgeschickte (so war es zum Beispiel mit seinem ellenlangen Brief an den Vater gewesen). Deshalb war es gut, wenn die Adressatin weit weg war, in Wien oder Berlin. Wenn mit einem plötzlichen Stehen vor der Tür und womöglich rabiaten Einfordern einer Aussprache absolut nicht zu rechnen war. Noch besser war es, wenn Krieg herrschte. So war es während des Kampfes mit Felice gewesen, die Grenzen unpassierbar, nur die Post verkehrte noch immer. In Briefen ließ sich alles schreiben. Milena hatte der Doktor einmal mitgeteilt, er suche Deckung hinter irgendeinem Möbel, zittere besinnungslos in einer Ecke, mit einer solchen Gewalt nämlich brause der Orkansturm ihres Briefes zu ihm herein und gleich beim Fenster wieder hinaus, »ich kann doch so einen Sturm nicht in meinem Zimmer halten«. Noch verheerender konnte nur sein, wenn plötzlich die ganze Frau und nicht nur ihr Brief vor der Tür seines kleinen Zimmerchens in der Ottoburg stünde und zwar in ihrer ganzen Körperlichkeit, mit ihrem Geruch und ihrem Atem, den Haaren und der Hitze … bei dieser Vorstellung spürte der Doktor eine herannahende Ohnmacht. Das würde zu viel sein.
Und dennoch schrieb er ihr, „Du darfst in Wien nicht weiterleben, es ist unmöglich“. Sie hatte ihm von ihren Schwierigkeiten berichtet und er forderte sie auf, ihr Leben zu ändern. Er brachte sich selber als eine Möglichkeit ins Spiel, wusste aber gar nicht, ob er das auch wirklich wollte. Jedenfalls schrieb er ihr, sein Geld, das er als Beamter bei der Arbeiter- und Unfallversicherung verdiene, reiche für sie beide, und auch die Bezüge, die er bekäme, wenn er gar nicht mehr zurückkehren würde an seinen Schreibtisch, wären immer noch genug. Und damit sprach er ja eigentlich von der Möglichkeit, mit Milena zusammenzuleben, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen, etwas, das er sich noch mit keiner Frau zuvor jemals hatte vorstellen können. Bei ihr war es anders. Nur acht Wochen und Dutzende Briefe später forderte er sie auf – ohne es offen auszusprechen –, mit ihm zusammenzugehen: „Du darfst in Wien nicht weiterleben, es ist unmöglich.“ Dummerweise stand dem Zusammenleben aber eine Winzigkeit entgegen: Milena war verheiratet. Noch dazu mit einem Mann, den der Doktor kannte, sie waren schon in den Prager Literaturcafés zusammengesessen, er und dieser Ernst Polak, von dem der Doktor, wenn er ehrlich war, zugeben musste, „ich fürchte mich vor ihm, er ist mir sehr überlegen“. Wie sollte es ihm gelingen, ausgerechnet diesem Mann seine Frau auszuspannen? Und dann war da auch noch der Umstand, dass der Doktor ja selbst frisch verlobt war und daheim in Prag eine Julie auf ihn wartete. Vielleicht war das Ganze nur deshalb überhaupt eine Möglichkeit, weil es eh vollkommen aussichtslos war. Sie mussten also, es konnte keinen Zweifel geben, füreinander bestimmt sein. Unbedingt musste ihnen beiden die Zukunft gehören, schon allein deshalb, weil sie ihnen genommen war.
5
So hatte sich damals in Meran ein Knoten geschürzt, von dem der Doktor nicht wusste, wie er ihn zerschlagen sollte. Und es gelang ihm ja auch nicht. Wie ihm so vieles nicht gelungen war, in jenem ersten Leben, vor seinem Tod. Manchmal kam es ihm vor, als ob alles, was er angepackt und sich vorgenommen hatte, stets in einem vollkommenen Desaster endete. Die Dinge, die er schreiben hatte wollen zum Beispiel, sie blieben Stückwerk. Die drei großen Bücher, die er angefangen hatte – er vermied es, das Wort Roman auch nur zu denken –, versandeten jedes, trockneten ein, verschrumpelten zu einem unansehnlichen, ekelhaften Kadaver. Deren Reste waren sowieso schon nichts, aber selbst von diesem Nichts verlangte der Doktor, dass es verbrannt werde. So jedenfalls hatte er es Max Brod aufgetragen, wohlwissend, dass sich der Freund daran nicht halten würde. Da hätte es schon eine andere Art von Nachlasszerstörer gebraucht, aber einen solchen einzusetzen hatte der Doktor lieber dem Zufall überlassen. Der hatte dann auch zugeschlagen, der Zufall, etwa in Gestalt zweier Gestapo-Leute, die in die Wohnung von Dora eindrangen und alles mitnahmen, was dort an Manuskripten von ihm lag. Kein Blatt davon tauchte jemals wieder auf.
Alles, was er geworden war, hatte er nie werden wollen. Beamter zum Beispiel, einmal sogar Chef einer Asbestfabrik. Alles andere dagegen, was er sich sehnlichst gewünscht hatte zu werden, Ehemann, Vater oder auch, als es gar keinen Ausweg mehr gab, einmal sogar Soldat, war unerreichbar für ihn geblieben. Die Geschichte mit Milena gehörte ebenfalls zu diesen Niederlagen und sie war untrennbar mit Meran verbunden. Von daher wäre es nur verständlich gewesen, er hätte Meran gemieden und einen weiten Bogen um diesen Ort inmitten der Berge gemacht, aber er hatte es nicht getan. Er kam drei Jahrzehnte nach der Meraner Katastrophe wieder hierher, lief sogar, immer wieder einmal, durch die Maiastraße und an der Ottoburg vorbei, um sich selber zu beweisen, das alles war vorbei, überstanden, es gehörte zu seinem früheren, anderen Leben und berührte ihn nicht mehr. »Da in dem Zimmer bist du immer gesessen, an dem Tischchen dort«, erklärte er sich dann selber, »und hast diese unsinnigen Briefe an Milena geschrieben«, aber das alles war ja längst vergangen. Nur ab und zu gelang es einem Augenblick, einer Szene, einem Halbsatz von damals noch einmal vor ihm aufzutauchen, wie eine abgerissene, lumpige Gossengestalt aus der Vergangenheit. Und dann erschrak der Doktor für einen kurzen Moment. Und so war es vielleicht auch an diesem heißen Spätsommerabend des Jahres 1960, als er sich auf seinem Spaziergang durch die Straßen des Stadtviertels Untermais Richtung Passer treiben ließ. Er ließ sich vom kühlen Lufthauch, den der Fluss selbst an den heißesten Tagen aus dem Hochgebirge mitbrachte, umwehen und ging dann weiter über die Petrarca- und Rätiastraße Richtung Bahnhof. Um kurze Zeit später ein weiteres Mal zu erfahren: Ja, das Leben ist unproblematisch. Nur die Straßen, die sind das Problem.
Aber auch die Hoffnung und die Lösung. Vor allem dann, wenn an deren Rändern plötzlich jemand steht und mitgenommen werden will, mitgenommen werden muss. Normalerweise war der Doktor keiner, der solche Angebote des Lebens angenommen hätte. »Bleib am Rand, geh vorbei, bleib Zuschauer«, hatte er sich unzählige Male in solchen Situationen zugeflüstert. Die Zeiten, da er sich in Abenteuer gestürzt hatte, die hatte es zwar gegeben, aber sie waren lange vorbei. Doch an diesem Abend sollte es noch einmal anders sein.
Er ging die Freiheitsstraße stadtauswärts Richtung Bahnhof. Das war sein gewöhnlicher Weg. Am Mazziniplatz machte er für gewöhnlich eine Kehre zurück in die Stadt. Es genügte ihm auf seinem beinahe täglichen Rundgang einen Blick auf das Hotel Frau Emma zu werfen, den Ort, wo alles begonnen hatte zwischen ihm und Meran. Auch heute blieb er auf dem Platz vor dem Prachtbau stehen, ganz nahe der leicht geschwungenen Auffahrt, die zu dem von zwei Säulen getragenen Portal hinaufführte. Sie war freilich nur für Gäste bestimmt, die sich vorfahren ließen, alle anderen nahmen die wenigen Treppenstufen. Der Doktor hielt nur kurz inne und wollte schon wieder den Heimweg antreten, da sah er, wie ein junger Mann durch die hohe Eingangstüre auf das Pflaster der Auffahrt herausgeflogen kam. Seltsam genug mit dem Rücken voraus und grimmig sich bauschenden Jackettschößen, die gegen diesen offensichtlich recht rabiaten Hinauswurf vehement protestierten. Instinktiv eilte der Doktor dem Gestrauchelten die wenigen Schritte über die Auffahrt entgegen und griff ihm unter die Arme, half ihm hoch.
Doch da kam dem Hinausgeworfenen schon ein Reisekoffer hinterher, dessen sich Frau Emma auf dieselbe die Luft durchwirbelnde Art entledigte. Er flog, von unsichtbarer Hand geworfen, aus dem Eingangsportal heraus, was bei einem Hotel, das von jedermann als das erste am Platze eingestuft worden wäre, seltsam genug anmutete. Der Koffer klappte noch während des Fluges seine beiden mit Holzleisten verstärkten Papphälften auf, wahrscheinlich war er gar nicht richtig verschlossen gewesen, sondern nur nach einem schnellen Zusammenraffen unter den Arm geklemmt worden, sodass es ihm nun umso leichter fiel, nach dem unsanften Aufprall vor den Füßen des Doktors sehen zu lassen, was in ihm verstaut war. Nämlich Rasierzeug, zwei Hemden, eine Whiskeyflasche, die erstaunlicherweise nicht gleich in Scherben ging, sondern ein Stück weit davonrollte, sowie zu Knäuel zusammengedrehte Socken, eine Reiseschreibmaschine und ein Stapel Manuskriptblätter, die sich sogleich zur Beurteilung durch wen auch immer auf dem Pflaster der Auffahrt lachhaft ordentlich aufzufächern begannen. Später, als der Doktor noch lange über diesen seltsamen Beginn seiner Geschichte mit dem jungen Mann nachdachte, wurde ihm bewusst, dass es wohl der Anblick dieser plötzlich in völliger Nacktheit vor ihm liegenden Manuskriptseiten gewesen sein musste, der ihn in solche Rage versetzte, dass er seinerseits den jungen Mann, der sich noch immer an ihm festhielt, in Richtung des Hoteleingangs zurückwarf, also gewissermaßen retour in die Arme der Frau Emma. Aus irgendeinem Grund war der Doktor wohl der Ansicht, der Mann gehöre dorthin und die Liaison mit der Dame könne unmöglich jetzt schon und vor allem auf diese Art und Weise beendet sein.
Dem stand aber nun ein Kerl entgegen, der sich so in der Eingangstür des Hotels postiert hatte, dass dort kein Vorbeikommen mehr war. Er hatte eine Livree an, wie sie alle Hotelpagen bei Frau Emma