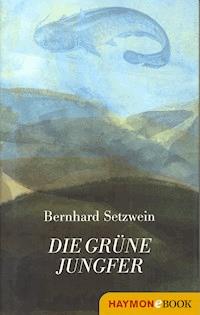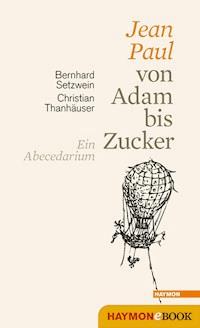Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von 1881 bis 1888 verbringt Friedrich Nietzsche die Sommermonate in Sils-Maria im Oberengadin, dessen gestochen klare Landschaft und kalte Gebirgsluft ihn in ihren Bann ziehen. Es ist die Zeit, in der Nietzsche bereits zahlreiche freundschaftliche Kontakte abgebrochen hat und die Einsamkeit der gedanklichen Höhenluft sucht. Die Idee des Übermenschen, dessen Adlerauge jenseits menschlichen Gebrechens Wesentliches erspäht, gärt in ihm, er fühlt sich halbblind wie ein Maulwurf, als Gefangener seiner Menschlichkeit, nicht kalt genug für seine eigene Philosophie. Er mietet sich beim Kolonialwarenhändler Durisch ein, mit dessen Tochter Adrienne ihn ein Band des mitleidenden Verstehens verbindet: Auch sie ist von schwacher Natur. Der Philosoph fühlt sich von den einfachen Menschen besser verstanden als von den ihm nachreisenden Schülern und Schülerinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Setzwein
NICHT KALT GENUG
Roman
Haymon
Ungekürzte E-Book Ausgabe 2014
© 2000
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7714-9
Cover: Benno Peter
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
»Es ist durchaus nicht nötig, nicht einmal erwünscht, Partei [...] für mich zu nehmen: im Gegenteil, eine Dosis Neugierde, wie von einem fremden Gewächs, mit einem ironischen Widerstande, schiene mir eine unvergleichlich intelligentere Stellung zu mir.«
der Professor
DER ERSTE SOMMER
»Niemand ahnte, mit welchen ungeheuren weltbewegenden Gedanken mein Bruder beschäftigt war, und daß er die freundlichen Plaudereien dazwischen nur als Erholungen betrachtete. Alle aber, die ihn damals in Sils-Maria kennen lernten, erzählen das gleiche, daß wenn sie ihm dann auf seinen einsamen Wanderungen begegnet wären, er gar keine Notiz von ihnen genommen hätte und ihnen wie ein ganz anderer in einer fernen Welt versunken erschienen wäre.«
Elisabeth Förster
1
Er kam mit der fünfspännigen Postkutsche, die täglich zwischen St. Moritz und Maloja verkehrte, und saß oben auf dem Dach, des besseren Überblicks und der Erhebung über die anderen wegen. 6000 Fuß über dem Meer und noch ein bißchen höher als die Mitreisenden unten im geschlossenen Pferdewagen. Dort saß man vor Regen und Wind geschützt, die Verwegenen aber und etwas Abenteuerlustigeren kletterten über die geschwungene Holztreppe außen an der Kutsche auf das Dach, wo in Längsrichtung zwei Bänke befestigt waren, man saß Rücken an Rücken, den Blick unverstellt auf die Oberengadiner Berge gerichtet.
– Jenseitig, fast schon jenseitig, murmelte er, die Matten und Geröllfelder und die schneebedeckten Gipfel vor Augen.
Er saß dort oben in seinen Plaid gehüllt und mit dem Schlapphut auf dem Kopf, seine abgewetzte, schäbige Ledertasche mit den Papieren und Schreibzeug umgehängt.
Angemeldet war er in Sils-Maria nicht.
Das Gepäck hatte er vorausgeschickt, es sollte am Bahnhof in St. Moritz für ihn aufbewahrt werden. Es bestand lediglich aus einer Korbkiste voller Bücher und einem großen Koffer. Wo es letzten Endes gelandet war, wußte er nicht. In St. Moritz jedenfalls nicht. Er selbst hatte sich dreimal verfahren, war, mehr tastend als sehend, in falsche Züge gestiegen, hatte das Umsteigen vergessen, war eingeschlafen. Alles falsch und dumm gemacht. Er, der seit zwei Jahren ohne festen Wohnsitz war, alle paar Monate die Unterkunft wechselte, hin- und herpendelte zwischen Naumburg, der Schweiz und der Côte d’Azur, er war im Grunde ganz und gar reiseunfähig. Halbblind stand er vor Fahrplänen, wählte den falschen Perron, ließ sich hin- und herstoßen und hastete prompt in den falschen Zug.
War es also letzten Endes der Zufall gewesen, der ihn nach Sils-Maria gebracht hatte? – Zufall gab es nicht. Nicht bei einem wie ihm! Bei ihm war alles Vorsehung, bedeutungsvolle Koinzidenz.
– Sils-Maria, 6000 Fuß, Dach der Welt, dachte er, und ich jetzt hier. Sils-Maria von mir entdeckt, dem Aufdecker, Hinaufsteiger, Hinübergeher!
Dabei war er gar nicht selbst hier heraufgestiegen mit der Zielstrebigkeit eines Erstersteigers und Gipfelstürmers, sondern der Zug hatte ihn hergebracht, der falsche, von ihm nur aus Versehen bestiegene Zug. Das hatte er ebenso schnell wieder vergessen wie den jungen Schweizer, dessen Bekanntschaft er im Zug gemacht hatte und der auf dem Weg von Neapel nach Hause war ins Oberengadin, und der war es gewesen, der dem Professor geraten hatte:
– Sils-Maria! Das könnte Ihnen gefallen. Da sind Sie ganz für sich.
Als die Kutsche neben dem Gemeindehaus von Silvaplana hielt, entschloß er sich auszusteigen, war aber, was ihm unangenehm auffiel, keineswegs der einzige. Eine sehr blaßhäutige Dame und ein älterer Herr, der sich schon in St. Moritz ungefragt und sehr soldatisch als General a. D. Justus Simon vorgestellt hatte, stiegen ebenfalls aus. Der Professor stolperte von seiner Bank auf dem Kutschendach hoch, der junge Kondukteur, noch keine 16 Jahre alt und von ledern-brauner Gesichtsfarbe, half dem Professor, die schmale, gewundene Treppe herunterzufinden.
Jetzt stand er auf dem Dorfplatz von Silvaplana. Weiter ging es nur noch mit Privatdroschken der einzelnen Hotels nach Sils-Maria. Die ältere Dame und der General wurden von einem Dienstmann erwartet, der auf seiner Schirmmütze die Aufschrift Hotel Alpenrose trug.
Auf den Professor wartete niemand. Er machte sich, befreit von den verlorengegangenen Gepäckstücken, auf Richtung Sils-Maria. Zu Fuß.
2
Ein Hotel kam nicht in Frage. Viel zu teuer. Und erst die damit verbundenen gesellschaftlichen Verpflichtungen: diese Frühstückssaalheiterkeit, diese Büfettverbindlichkeiten, diese Souperbanalitäten!
– Ich suche ein einfaches Zimmer, eine denkbar schlichte Kammer. Idealiter eine Hundehütte. Ich möchte es mir einrichten wie in einer Höhle, verstehen Sie.
Der auf dem Dorfplatz angesprochene Postbeamte wunderte sich schon etwas über die seltsame Ausdrucksweise des Fremden sowie über seinen Aufzug (der Plaid war schon arg zerschlissen, der Schlapphut verwegen breitkrempig). Häuser wie das Edelweiß oder die Alpenrose schienen in der Tat für so einen wenig geeignet. Der brauchte einen Platz, wo ihn möglichst wenige zu Gesicht bekamen.
– Schauen Sie mal beim Gian vorbei, kann sein, daß der noch etwas frei hat.
Das Haus des Gian Durisch lag am Ortsrand. Auf der Rückseite des Gebäudes ragte unmittelbar eine steile Felswand empor, zwischen Berg und Haus standen noch ein paar Lärchen, regelrecht walddunkel war es auf dieser rückwärtigen Seite, was dem Professor sehr angenehm war: Er vertrug kein Sonnenlicht.
– Haben Sie nicht noch eine Kammer frei? fragte er den Mann hinter der Ladentheke. Im Erdgeschoß nämlich war eine kleine Kolonialwarenhandlung. Als der Professor den Laden betrat – die Türoberkante stieß gegen ein kleines Glockenspiel –, wehte ihn ein Geruch von Petroleum und Juchten, von Pfefferminze, Lavendel und Kernseife an.
Statt einer Antwort kam der Mann wortlos hinter der Theke hervor, ging am Professor vorbei, hinaus auf den Hausflur, die enge Holzstiege hinauf in den ersten Stock. Dort zeigte er dem Fremden ein Zimmer mit Ausblick aufs Dorf, hell, freundlich, dem Inn zugewandt.
– Haben Sie nicht noch ein anderes? Nach hinten hinaus? Ein dunkleres? Ja, es darf regelrecht finster sein. Je weniger Licht, desto besser.
– Wenn Sie meinen.
Er zeigte ihm die Kammer des Sohnes. Genau die war es: vor dem Fenster nur Wald und Fels.
– Ich brauch nur ein Bett, eine Couch, einen Tisch und eine Waschgelegenheit. Mehr brauche ich nicht. Man muß einfach leben können, wissen Sie, Herr ...
– Durisch. Gian Durisch.
– Einfach bis zur völligen Bedürfnislosigkeit. Nur das Denken, das aus der allereinfachsten Existenz kommt, verdient überhaupt ein solches genannt zu werden. Es macht mir nichts aus, wenn mich die Leute einen Höhlenbewohner nennen wegen meiner dunklen Behausungen, Sie können mich auch einen Maulwurf nennen, das ist mir gleich, ich komme in der Tat aus dem Unterirdischen, ich bin ein Untergra ...
– Also, dann sag ich dem Robert, er soll die Kammer frei machen.
Er redete etwas viel, fand Durisch, ansonsten konnte er an seinem neuen Logiergast nichts finden, was ihn störte. Gut, er machte etwas viel Aufsehen von wegen seinem einfach leben, was war schon dabei, sie, die Durischs, lebten seit Generationen so, es durfte ruhig auch einmal etwas weniger einfach sein. Immerhin hatten sie jetzt das Haus, das zwar eines der einfacheren in Sils-Maria war, aber: es hatte zwei Stockwerke, war fest gemauert und bot Platz für den Gemischtwarenladen.
– Wenn das möglich wäre, mir sagt dieses Zimmer außerordentlich zu, Herr Durisch.
– Dann muß er raus, der Robert. Soll nach vorne gehen, ins größere, hellere.
– Robert?
– Ja, mein Sohn.
– Wenn ihn das nicht stört.
– Nun ja, wenn Sie es partout finster haben wollen.
– Jaja, unbedingt. Wissen Sie: Mein Nervensystem, die ungeheure Thätigkeit, das Vorhaben!
Durisch verstand gar nichts. War ihm auch egal. Hauptsache, er zahlte pünktlich.
3
Und wie Robert das störte! Sein Zimmer aufgeben, wegen eines solchen Schnauzbartes. Der sah doch aus wie der Gallierführer Vercingetorix in seinem Schulbuch.
Doch da war alles Murren umsonst. Wenn der Vater es so bestimmte.
– Das zahl’ ich ihm heim, dachte sich Robert. Mit einer Blindschleiche im Bett, zum Beispiel. Die ringelte sich Tage später tatsächlich dem Professor um den nackten Fuß, als der unter die Bettdecke geschlüpft war. Er erschrak aber nicht, besah sich vielmehr das Tier eingehend, lächelte schließlich: der Adler und die Schlange. Die Schlange und der Adler. Sie waren Freunde.
Die nächsten Tage zählte er die Sonnenstunden und schrieb sie auf. Juli und August sollten in diesem Jahr ungewöhnlich heiß werden. Selbst die Silser erinnerten sich nicht, jemals einen solch brütenden Sommer erlebt zu haben. Der Professor rieb sich jeden Morgen das Gesicht, wenn er die wenigen Stufen vor Durischs Haustüre hinunterstieg, um sich aufzumachen zu seinem Morgenspaziergang. Es waren die allerersten Strahlen, die über die Berggipfel strichen. Der Professor rieb sich mit der Morgensonne regelrecht ein, wie sie so angenehm wärmend auf seine Backen schien.
Natürlich bekam er Kopfschmerzen. Und auch Atemnot, wenn das Thermometer spätnachmittags bis auf 24 Grad Reaumur stieg. Doch das war in Kauf zu nehmen.
– Dem Gipfel nah sein, dachte der Professor, wer auf dem Gipfel sein will, der muß die allergrößte Nähe zur Sonne ertragen können. 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit ... da wird die Luft dünn! Der Kopf will explodieren, natürlich. Hier zeigt sich, ob einer eine starke Natur ist.
Hatte nicht schon Cäsar seine Kopfschmerzen und seine Kränklichkeit dadurch kuriert, indem er die größten Gewaltmärsche auf sich nahm? Und gab es einen gewaltigeren Gewaltmarsch als den hier herauf, an den Silser See, in dessen Wasser sich ein Äther spiegelte, der genauso stahlblau und eisig-kalt war wie sein Denken. Daß es die Pferdekutsche gewesen war, die ihn von St. Moritz aus hier heraufgebracht hatte und folglich allenfalls die Gäule von etwaigen Kopfschmerzen kuriert worden wären – wenn überhaupt –, das hatte er schon wieder vergessen.
Er prüfte frühmorgens und abends den Puls: 60 Schläge die Minute.
Genau wie Napoleon, schrieb er in sein Notizbuch. Und dann noch: Kein Zufall!!!
Er horchte in sich hinein, befühlte die Schläfen. Kündigten sich schon wieder die gefürchteten Schmerzen an? Er lauschte auf die Funktionen des Magens, belauerte die Regungen des Unterleibs.
Alles war bestens, seit er hier war.
Der Mutter schrieb er, Aussehen und Gesundheit seien blendend, Muskulatur die eines Soldaten. Eigentlich wollte er ihr nicht mehr schreiben. Nie mehr! In Genua hatte er all ihre Briefe ungeöffnet zusammengepackt und wieder zurückgeschickt. Nach Naumburg. Diese unerträglichen Vorhaltungen und Ermahnungen wieder zurückgeschickt. Wieder ins Maul zurückgestopft.
Dann aber tat sie ihm doch leid: eine Mutter ohne Nachricht von ihrem Sohn. Er würde ihr erlauben, wieder ein Paket zu schicken. Mit einer dieser vortrefflichen Würste, Thüringer Rauchwurst. Und, fiel ihm noch ein: Handschuhe! Lange Handschuhe mit Daumen!! Alles mußte man ihr haarklein auftragen.
Der Schwester schrieb er, er habe endlich jenen Ort gefunden, wo es ihm möglich sei, sein ungeheures Vorhaben auszuführen.
– In Anbetracht dessen, was ich die nächsten 10 Jahre vorhabe, brauche ich eine Höhle in der Höhe wie diese. Nur durfte sie unter keinen Umständen irgend jemandem sagen, wo er sich aufhielt. Zusendungen lediglich unter Silvaplana, poste restante.
– Niemals aus der Deckung kommen, dachte der Professor. Endlich aus der Welt verschwinden. Zumindest für eine Zeitlang. Er würde schon wiederkommen. Aber wie! Sein erneuter Auftritt, seine Wiederkehr!, würde einer Weltgeburt gleichkommen. Nach und mit ihm alles neu. Die ganze Welt neu!
War er Gott?
Wenn ja, war Gott zwischenzeitlich nur mehr poste restante zu erreichen.
4
Ab und zu hatte der Professor so seltsame Anwandlungen. Da fing er plötzlich das Tanzen an in seiner Kammer. (Manchmal auch ganz nackt.) Natürlich war es etwas eng. Er stolperte dann schon mal über den Stiefelknecht, der auf dem Boden herumlag, mit dem darin steckenden Schuh. Oder er stieß sich am Tischeck an, am Waschkommödchen. Einmal fiel die porzellanene Schüssel hinunter. Er lachte nur. Zu Durisch sagte er, während der die Scherben zusammenkehrte:
– Ich geb Ihnen eine guten Rat, lieber Durisch: Glauben Sie nur an einen Gott, der auch tanzt!
– Also nein, der Professor! stöhnte der Durisch dann unten in der Wohnstube.
– Ja, der Professor, sagte seine Frau.
Sie hatten ein Nachsehen mit ihm. Wo er doch soviel arbeitete und immer denken mußte. Das war überhaupt der einzige Fehler, den Durisch an seinem Logiergast feststellen konnte, daß er zuviel arbeitete. Das mußte doch ungesund sein.
Daher natürlich auch diese Kopfschmerzen. Klar, daß die einen etwas närrisch machten.
– Er versucht sie abzuschütteln, suchte Durisch nach einer Erklärung für sich und seine Frau, er tanzt und hopst, damit diese furchtbaren Schmerzen aus seinem Kopf fallen ... herauspurzeln! Andere Leut’ rennen gegen die Wände. Na freilich, das gibt es!
Manchmal hörte es sich tatsächlich an, als ob auch der Professor gegen die Wände seiner engen Kammer liefe. Oder er redete mit sich selbst. Das heißt, er schrie mehr. Man verstand wenig. Eine seltsame Sprache war das. Mehrere Sprachen eigentlich, durcheinander.
Die kleine Adrienne, das Nesthäkchen der Durischs, traute sich schon nicht mehr die Holzstiege hinauf in den oberen Stock zu gehen, seit der neue Gast mit seinen seltsamen Angewohnheiten dort oben wohnte. Anders ihr Bruder Robert, der weder Angst noch Scheu hatte und erst gestern wieder dem Professor den irdenen Krug mit dem Deckelchen vor die Tür gestellt hatte, in dem normalerweise die Milch war. Diesmal aber eine fette, glupschäugige Kröte.
– Jetzt schreit er sich wieder selbst an, der Professor, hieß es im Hause Durisch, wenn das Gebrüll in mehreren Sprachen von oben aus der Kammer zu hören war.
So war er ja ein ganz liebenswürdiger Herr, angenehmer Logiergast, zahlte pünktlich den Mietzins, wobei er die Scheine und Münzen jedesmal zum Monatsersten akkurat auf die Theke des Gemischtwarenladens zählte – man spürte, daß einer wie er auf jeden Rappen schauen mußte. Er bezog, wie er einmal erklärte, nur eine kleine Invalidenrente von der Staatskasse Basel, von wegen seiner Sehschwäche. Der Heuslersche Vermächtnisfonds für hilfsbedürftige Professoren legte auch noch etwas dazu.
Nur manchmal, da hatte er halt seinen Rappel.
– Der schreit sich halt selber an, sagte der Durisch-Vater zu der kleinen Adrienne, die nur langsam die Scheu abzulegen begann vor dem Mann mit dem ungeheuren Schnauzbart.
– Der ist halt ein Seehund, sagte er auch noch, aber woher sollte ein sechsjähriges Mädchen im Engadin wissen, was ein Seehund ist.
– Warum rasierst du dich nicht, fragte sie ihn ein paar Wochen später, da war sie schon nicht mehr so ängstlich, hatte sie doch mit der Zeit bemerkt, daß unter dem Schnauzbart, wenn auch nicht sichtbar, ein Mund verborgen war, der freundliche Worte wußte.
– Ich hab keine Zeit, Adrienne. Zum Rasieren hab ich keine Zeit.
– Was machst du denn den ganzen Tag. Mußt du wieder die Wände anschreien? Papa sagt, du schreist manchmal dich selbst an. Oder die Wände.
Er lächelte und gab keine Antwort.
Wenn die Eltern solche Gespräche belauschten, dachten sie zum einen, daß sie in Zukunft besser aufpassen müßten, was sie in Gegenwart der Tochter, die immer aufgeweckter wurde, sagten; zum anderen ermahnten sie Adrienne ziemlich unwirsch, zu dem Logiergast Herr Professor zu sagen, aber der wehrte nur sanft lächelnd ab.
– Lassen Sie sie doch.
Ihm war das Mädchen lieb. Nicht nur deshalb, weil sie sich nicht an den Streichen der übrigen Dorfjugend, eingeschlossen ihres Bruders, beteiligte. Das war eine rechte Rasselbande, immer darauf aus, einen halb blinden, schutz-und kraftlosen Mann wie ihn mit Bosheiten zu überziehen. Auch wenn’s nur kleine Kinderbosheiten waren, ihn trafen sie ins Mark, ihn traf alles ins Mark, die Bosheiten wie die Schönheiten, das konnte sich nur niemand vorstellen. Zum Beispiel, daß er mit Tränen in den Augen von seinem ersten Spaziergang an den Silser See zurückkam: er mußte weinen vor so viel Schönheit. Er litt, voller Wonnen, selbst an der Schönheit.
Wer litt noch wie er?
Wer hatte noch solches Talent dazu?
Gott vielleicht?
5
Einmal hatten sie ihm kleine Steinchen in seinen zusammengeklappten Regenschirm getan. Regenschirm konnte man eigentlich nicht sagen, er nahm ihn bei jedem Wetter mit hinaus, bei Sonnenschein eigentlich noch mehr als bei Regen, wo er ihn schon mal vergaß. Es war mehr ein Lichtschirm, denn was seine kranken Augen absolut nicht vertrugen, war gleißendes Licht. Er, die Inkarnation des Dionysos, des Griechensohns, konnte keine Sonne vertragen, absolut keine Sonne. Deshalb der Schirm. Das war gleich das erste, was er Durisch aus seinem Gemischtwarenladen abgekauft hatte: einen leuchtend roten Schirm. Der stand nun stets griffbereit neben der Haustür, zusammengeklappt. Und da hatten ihm die Buben ein paar Handvoll kleine Steinchen hineingetan. Als er nun vor das Haus trat, sich über den herrlichen Sonnentag freute – er liebte die Sonne, auch wenn er sich vor ihr schützen mußte, sie war genauso gnadenlos wie er – und seinen Schirm aufspannen wollte, prasselte ihm ein Steinchen-Regen entgegen. Hinter einem Hartriegelbusch lauerte schon die Meute der Buben und feixte schadenfroh.
Der Professor drehte auf der Schwelle um, polterte unter Flüchen die Treppe zu seiner Kammer hoch ... und bekam augenblicklich Kopfschmerzen!
– So schlimm ist es nun auch nicht gewesen, sagten die Durischs. Aber unser Professor halt!
In Zukunft sorgten sie dafür, daß die Buben von dem Herrn Professor fernblieben. Nur die Adrienne, die durfte zu ihm. Beinahe jederzeit. Von ihr ließ er sich gerne stören. Nachdem er drei Tage im Bett gelegen war mit Kopfschmerzen von wegen der Hagelschläge aus dem Regenschirm, war sie es, die wieder in seine Kammer kam und fragte, ob sie nicht einen Spaziergang machen wollten, die Sonne scheine so schön.
Er hatte schon des öfteren Spaziergänge mit ihr gemacht. Mit ihr war es schön. Er konnte mit ihr reden wie mit einer Erwachsenen. Das heißt, er mußte