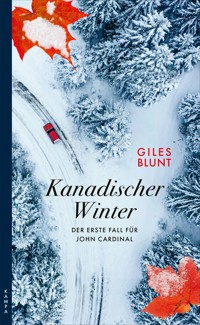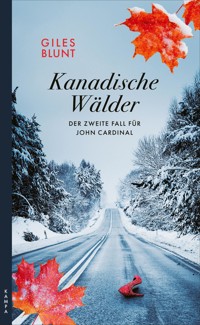Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für John Cardinal
- Sprache: Deutsch
Es ist Frühling in Algonquin Bay. Wie jedes Jahr wird die Gegend im Südosten Kanadas von einer lästigen Mückenplage heimgesucht. Detective John Cardinal und seine Partnerin Lise Delorme ermitteln in einem seltsamen Fall: Eine junge Frau mit feuerrotem Haar sitzt in der World Tavern, der ältesten Spelunke im Dorf, weiß weder ihren Namen, noch woher sie kommt. Sie scheint wie aus dem Nichts aufgetaucht zu sein – mit einer Schusswunde im Kopf und völligem Gedächtnisverlust. Dann wird in einer Höhle in den Wäldern der Biker und Drogendealer Walter »Wombat« Guthrie tot aufgefunden. Rätselhafte Felsenmalereien an den Wänden und die Verstümmelungen der Leiche deuten auf einen Ritualmord hin. Es scheint unwahrscheinlich, dass die beiden Fälle etwas miteinander zu tun haben, aber Cardinal und Delorme stoßen immer wieder auf den selbsternannten Schamanen Red Bear, der überall seine Finger im Spiel zu haben scheint, und müssen bald feststellen, dass nicht nur die Mücken auf Blut aus sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giles Blunt
Kanadische Jagd
Der dritte Fall für John Cardinal
Kriminalroman
Aus dem kanadischen Englisch von Anke und Eberhard Kreutzer
Kampa
Für Janna
1
Wer schon einmal, egal, wie lange, in Algonquin Baygewesen ist, dem fallen viele Gründe dafür ein, weshalb man besser woanders leben sollte. Zunächst einmal die Entfernung von der zivilisierten Welt, worunter Kanadier Toronto, etwa zweihundertfünfzig Meilen im Süden, verstehen. Dann der schleichende Verfall des einstmals schmucken Zentrums – Opfer der doppelten Plage vorstädtischer Einkaufszentren und einer unglücklichen Serie von Bränden. Schließlich die strengen, schneereichen und langen Winter. Es kommt nicht selten vor, dass die klirrende Kälte sich bis in den April hineinzieht, und die letzten Schneefälle gibt es oft im Mai.
Nicht zu vergessen die Kriebelmücken. Jedes Jahr brechen aus den Betten zahlloser Flüsse und Bäche im nördlichen Ontario Schwärme von Kriebelmücken hervor, um sich am Blut von Vögeln, Vieh und anderen Bewohnern rund um Algonquin Bay zu laben. Dafür sind sie hervorragend ausgestattet. Auch wenn die Kriebelmücke nur einen halben Zentimeter misst, so ähnelt sie doch stark einem Kampfhubschrauber, mit je einem Saugrüssel und einem fiesen kleinen Haken vorne und hinten. Schon eine einzige dieser Kreaturen kann einem Menschen übel mitspielen. Ein ganzer Schwarm davon kann ihn schnell in den Wahnsinn treiben.
Die World Tavern war an diesem Freitag vielleicht nicht gerade der Wahnsinn, doch der Barkeeper Blaine Styles hatte eine leise Ahnung, dass es Probleme geben würde. Die Kriebelmückensaison brachte nicht unbedingt das Beste in den Menschen hervor, zumindest nicht in denen, die tranken. Blaine war sich zwar nicht hundertprozentig sicher, aus welcher Ecke der Ärger kommen würde, doch es gab ein paar Kandidaten.
Da war schon mal das Deppen-Trio an der Bar – ein Kerl namens Regis und seine beiden Freunde in Baseballkappen, Bob und Tony. Sie tranken still vor sich hin, hatten aber ein bisschen zu lange mit Darla, der Kellnerin geflirtet, und sie legten eine Rastlosigkeit an den Tag, die für später nichts Gutes versprach. Und dann der Tisch hinten unter der Karte von Afrika. Sie hatten seit Stunden Bier gepichelt. Mäßig, aber regelmäßig. Schließlich dieses Mädchen, diese Rothaarige, die Blaine noch nie gesehen hatte, die sich langsam von Tisch zu Tisch bewegte, und zwar auf eine Weise, die er – aus beruflicher Sicht – beunruhigend fand.
Eine Flasche Labatt Blue flog durch den Raum und traf die Karte von Kanada direkt über Neufundland. Blaine schoss hinter dem Tresen hervor und setzte den Besoffenen, der sie geworfen hatte, vor die Tür, bevor der auch nur einen Muckser herausbrachte. Es machte Blaine zu schaffen, dass er den Zwischenfall nicht einmal hatte kommen sehen. Der Blödmann hatte mit ein paar anderen Typen in Lederjacken unter Frankreich gesessen, und Blaines Radarschirm hatte ihn nicht einmal erfasst. In der World Tavern, der ältesten Spelunke von Algonquin Bay, konnte es, besonders in der Kriebelmückensaison, an einem Freitagabend schon mal brenzlig werden, und Blaine zog lieber beizeiten die Grenze.
Er kehrte wieder hinter den Tresen zurück und schenkte ein paar Krüge für den Tisch bei der Afrikakarte ein – an dem es, wie er feststellte, eine Idee lauter wurde. Als Nächstes hielt ihn eine Bestellung von sechs Continental und ein paar eisgekühlten Margaritas auf Trab. Danach konnte er ein bisschen verschnaufen. Er stellte den Fuß auf einen Bierkasten, um seinen Rücken zu entlasten, während er ein paar Gläser spülte.
Heute Abend waren kaum Stammgäste zu sehen; er war froh. Fernsehserien versuchten einem immer weiszumachen, die Stammgäste in einer Bar seien Exzentriker mit einem Herzen aus Gold, doch nach Blaines Erfahrung waren sie einfach nur hoffnungslose Idioten mit einem ernsten Problem in Sachen Selbstvertrauen. Weiter als bis zu den fleckigen, schellacküberzogenen Karten an den Wänden der World Tavern würden diese Leute vermutlich nie über Algonquin Bay hinausgelangen.
Jerry Commanda saß, seine übliche Cola light mit einem Spritzer Zitronensaft in der Hand, am Ende der Bar und las in seinem Maclean’s. Ein bisschen rätselhaft, dieser Jerry. Im Großen und Ganzen konnte Blaine ihn ganz gut leiden, obwohl er ein Stammkunde war – jedenfalls respektierte er ihn, auch wenn er mit dem Trinkgeld knauserte.
Jerry war mal ein schwerer Trinker gewesen – kein hoffnungsloser Säufer, aber doch ein schwerer Trinker. Hatte damit angefangen, als er noch an der Highschool war, und so weitergemacht bis irgendwann Anfang zwanzig. Dann hatte ihn irgendetwas ausgenüchtert, und er rührte keinen Tropfen Alkohol mehr an. Fünf, sechs Jahre hatte er keinen Fuß mehr in eine Bar gesetzt. Aber auf einmal hatte er damit angefangen, freitagabends in die World Tavern zu kommen und seinen knöchernen Hintern ans Ende der Bar zu schieben. Von da aus hatte man einen guten Überblick.
Blaine hatte ihn einmal gefragt, wie er von der Flasche losgekommen sei, ob er es mit den zwölf Schritten der AA geschafft hätte.
»Konnte die zwölf Schritte nicht verknusen«, sagte Jerry. »Genauso wenig wie diese Treffen. Wo sie alle davon quatschen, wie hilflos sie sind, und dann Gott weiß wen bitten, ihnen aus der Bredouille zu helfen.« Jerry benutzte ab und zu solche Begriffe, obwohl er erst um die vierzig war. Altmodische Wörter wie verknusen, Bredouille oder Bursche oder zänkisch. »Aber als ich erst mal kapiert hatte, dass ich mit Denken aufhören muss, war es ziemlich leicht, den Alkohol aufzugeben.«
»Niemand kann mit Denken aufhören«, hatte Blaine gesagt. »Denken ist wie atmen. Oder schwitzen. Das tut man von selbst.«
Daraufhin ließ Jerry einen abwegigen psychologischen Kokolores vom Stapel. Sagte, sicher, man könne die Gedanken nicht daran hindern zu kommen, aber man könne anders mit ihnen umgehen, Ausweichmanöver finden. Blaine erinnerte sich genau an seine Worte, weil Jerry vierfacher Kickbox-Meister von Ontario gewesen war und, als er von Ausweichmanövern sprach, das Gemeinte mit einer wendigen Bewegung unterstrich, die, na ja, irgendwie gekonnt aussah.
Jerry Commanda hatte also gelernt, seinen Gedanken aus dem Weg zu gehen, und das hatte zur Folge, dass er sich jeden Freitagabend mit seiner Cola light und dem Zitronenspritzer für eine Stunde oder so am Ende der Bar aufpflanzte. Blaine hegte den Verdacht, dass er damit nicht zuletzt ein paar der Jungs aus dem Reservat daran hindern wollte, allzu tief ins Glas zu schauen. Ziemlich schwierig für sie, sich gehen zu lassen, wenn Jerry an der Bar hockte, seine Zeitschrift las und seine Cola schlürfte. Ein paar von denen brauchten ihn nur zu sehen, und schon machten sie einen Abgang.
Blaines müder Barkeeper-Blick schweifte über sein Reich. Am Afrikatisch ging es eindeutig ziemlich hoch her. Hoch her war ja in Ordnung, aber zum Überschwappen durfte es nicht kommen. Blaine legte den Kopf schief und horchte auf die üblichen Zeichen – barsche Drohungen und das empörte Gebrüll, das unweigerlich auf das Ratschen der Stuhlbeine folgte. Von dem Flaschenwerfer einmal abgesehen, schien es jedoch ein friedlicher Abend zu sein. Dem Flaschenwerfer und diesem Mädchen.
Blaine warf einen kurzen Blick in die entfernteste Ecke hinter der Jukebox. Es blitzte rot auf. Die Kleine hatte dichte rote Locken, die bei jeder Kopfbewegung in die eine oder andere Richtung wippten, sodass sich das Licht darin fing. Sie trug von oben bis unten blauen Denim – gute Jeans, kurze, eng anliegende Jacke –, die Klamotten waren okay, auch wenn es so aussah, als hätte sie drin geschlafen. Wieso wanderte sie von einem Tisch zum anderen? Das war schon der dritte, an dem sie in den letzten anderthalb Stunden gesessen hatte. Zwei Frauen und zwei Männer, Postangestellte, für deren Verhältnisse es ein bisschen spät geworden war; ganz offensichtlich fanden die beiden Frauen es überhaupt nicht amüsant, wie sich die Kleine in Jeans an ihrem Tisch dazwischendrängelte. Die Kerle dagegen schienen nicht das Geringste dagegen zu haben.
»Drei Blue, ein Creemore, einen Wodka Tonic.«
Blaine holte vier Flaschen Bier aus dem Eis und stellte sie Darla aufs Tablett.
»Was ist mit dem Rotschopf los, Darla? Was trinkt die Kleine?«
»Nichts, soweit ich weiß. Der letzte Tisch hat ihr einen spendiert, um mit ihr anzustoßen, aber sie hat nicht ausgetrunken.«
Blaine goss einen Wodka ein und stellte ihn zu den Bierflaschen. Darla füllte das Glas mit Soda aus dem Siphon auf.
»Ist sie high? Wieso hüpft sie von einem Tisch zum anderen?«
»Keine Ahnung, Blaine. Vielleicht macht sie irgendwelche Geschäfte.« Darla hievte ihr Tablett auf die Schulter und stürzte sich wieder in den Zoo, wie sie es nannte.
»Chef!«
Blaine drehte sich zu dem Trio am Tresen um. Der Typ namens Regis war ein alter Bekannter von der Highschool, er schaute vielleicht zweimal im Jahr vorbei. Seine Freunde mit den Baseballkappen waren neu. Wenn dich einer Chef nennt, dann weißt du, dass er dir gleich auf die eine oder andere Art lästig wird.
»Hey, Blaine«, sagte Regis. »Wann verrätst du uns, was sie mit deinem Gesicht gemacht haben, Mann?«
»Ja«, sagte eine der Baseballkappen. »Du siehst wie ein Chinese aus.«
»War Sonntag mit dem Kanu draußen. Die Kriebelmücken waren in Hochform.«
»Die Mücke muss ’n Elefant gewesen sein, Mann. Siehst aus wie ’n Sumoringer.«
Die ganze Woche bekam er nun schon zu hören, er sähe wie ein Sumoringer aus. Um diese Jahreszeit waren die Mücken immer eine Plage, aber so hatte sie Blaine noch nie erlebt. Millionen von den Viechern in Schwärmen wie riesige schwarze Wolken. Er hatte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, eine Kappe aufgesetzt, die Hosenbeine in die Socken gestopft, aber die Schwärme waren so dicht, dass man nicht mal Luft holen konnte, ohne sie einzuatmen. Die kleinen Biester waren ganz und gar verzückt von ihm und stachen ihn im ganzen Gesicht. Bis Montagmorgen waren seine Augen so zugeschwollen, dass er nichts mehr sehen konnte.
Er tippte die drei Bier in die Kasse ein. Als er sich wieder umdrehte, stand der Rotschopf plötzlich da.
»Hallo«, sagte die Kleine und kletterte auf einen Hocker.
»Was darf’s denn sein?«
»Einfach nur Wasser wäre nett. Bier scheint mir nicht zu bekommen.«
Blaine goss ihr ein Glas Eiswasser ein und stellte es auf eine Serviette.
»Sie sind aber groß.«
»Kann mich nicht beklagen.«
Blaine räumte hinter der Bar ein paar Gläser weg.
»Sie scheinen ein netter Kerl zu sein.«
Blaine lachte. Der Rotschopf war schätzungsweise Mitte zwanzig, mit einer Menge Sommersprossen im Gesicht. Sie hatte wirklich das vollste, lockigste Haar, das ihm je untergekommen war. Schien sich allerdings nicht sonderlich zu pflegen. Wie Blaine hatte auch sie eine Menge Mückenstiche, und in ihren Haaren steckten kleine Stücke von Blättern.
»Wie heißen Sie?«, fragte sie.
»Blaine.«
»Blaine? Das ist ein hübscher Name.«
»Wenn Sie meinen. Und Sie?«
»Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein. Ist das nicht seltsam?«
Blaine hatte ein komisches Gefühl in der Magengegend. Das Mädchen wirkte nicht high; ihre Art war freundlich und ruhig. Sie rutschte jetzt von ihrem Hocker und ging zu Regis und seinen Baseballkumpeln hinüber.
»Ihr seht nett aus.«
»Aber hallo«, sagte Regis. »Sie sind auch nicht ohne. Dürfen wir Ihnen einen Drink spendieren?«
»Nein, danke. Ich hab keinen Durst.«
»Chef! Ein Molson für die junge Dame hier.«
»Kann ich nicht machen«, antwortete Blaine. »Sie sagt, sie will nicht.«
»Danke vielmals, Blaine. Du mich auch.« Regis schob den Arm über die Theke und schnappte sich eins der Gläser, die dort auf dem Ständer zum Trocknen standen. Er goss von seinem Bier ein und reichte es der Rothaarigen.
»Danke. Wirklich nett von Ihnen.« Sie nahm einen Schluck und verzog das Gesicht.
Blaine nahm ihr Glas Wasser von der Bar und stellte es ihr hin.
»Oh, danke, echt nett.«
Nett, nett, alles ist nett. Schätzchen, du hast noch ’ne Menge zu lernen.
»Ich heiße Regis. Das hier ist Bob, und der da ist Tony. Wie heißen Sie?«
»Das weiß ich im Moment nicht.«
Sie lachten.
»Geht schon in Ordnung«, sagte Regis. »Sie müssen es uns nicht sagen.«
»Wir nennen Sie einfach Red«, sagte der Kerl, der Tony hieß.
»Wir nennen Sie einfach Anonymus«, schlug sein Freund namens Bob vor.
»Anonymus Sex«, sagte Regis, und sie lachten alle. »Klingt wie Tyrannosaurus Rex.«
Er fummelte an ihrer Jeansjacke herum.
»Das ist niedlich.«
»Ja, ich mag sie.«
Dieser Tony legte ihr den Arm um die Schulter und strich ihr mit der Hand durchs Haar. Er zog einen Blattfetzen heraus.
»Mann, du hast das tollste Haar, das ich je gesehen habe. Ein bisschen belaubt, aber toll.«
»Ihr seid alle so freundlich.«
»Du aber auch«, meinte Regis. »Hast ein paar üble Stiche abgekriegt, aber ich weiß ein Mittel dagegen.« Er lehnte sich vor und küsste sie auf die Wange.
Das Mädchen lächelte und rieb sich das Gesicht.
Blaine schob sich näher zu ihnen heran.
»Miss, meinen Sie nicht, es ist Zeit, nach Hause zu gehen?«
»He, kümmer dich um deinen eigenen Dreck, Blaine.« Regis schlug mit der Hand auf den Tresen und warf eine Schale Erdnüsse um. »Sie ist nicht betrunken, sie hat nur ein bisschen Spaß.«
»Nein, ihr habt Spaß, was sie hat, weiß sie nicht.«
Das Mädchen lächelte, ohne einen von ihnen anzusehen.
»Zwei Creemore, drei Blue, ein Export!«
Blaine ging hinter dem Tresen zu Darla hinüber, um die Bestellung fertig zu machen. Als er zurückkam, saß der Rotschopf bei Regis auf dem Schoß.
»Schätzchen, ich glaube, wir müssen dann mal, haben noch einen langen Ritt vor uns«, sagte Regis.
»Ihr Jungs seid wirklich witzig.«
Bob hatte inzwischen die Finger in ihrem Haar. »Ich glaube, du solltest auf unseren Ritt mitkommen«, sagte er. »Uns besser kennenlernen.«
Regis’ Hand glitt ihre Jeansjacke hoch. Das Mädchen lächelte und fing an, etwas zu summen. Regis’ Hand glitt unter die Jacke.
»Lass sie in Ruhe.«
Regis lehnte sich zurück und schielte den Tresen entlang, bis sein Blick auf Jerry Commanda traf.
»Was hast du gesagt?«
»Ich sagte, lass sie in Ruhe.«
»Wie wär’s, wenn du dich um deinen eigenen Dreck scheren würdest?«
Jerry rutschte von seinem Hocker und kam zur Mitte des Tresens.
»Wissen Sie, wie Sie heißen?«, fragte er das Mädchen.
»Hey, Alter«, sagte Regis. »Halt dich da raus.«
»Halt du den Mund. Wissen Sie, wie Sie heißen?«
»Nein«, sagte das Mädchen. »Ist mir momentan entfallen.«
»Wissen Sie, welcher Tag heute ist?«
»Ehm, nein.«
Regis schob sie von seinem Schoß und stand auf. »Ich glaube, du und ich, wir beide haben draußen was zu regeln.«
Jerry ignorierte ihn. »Wissen Sie, wo Sie sind?«, fragte er das Mädchen weiter.
»Jemand hat es mir vorhin gesagt, aber ich hab’s vergessen.«
»Hast du mich nicht gehört?«, fragte Regis. »Ich kann ja verstehen, dass du vielleicht keine Lust hast, zu deiner Squaw nach Hause zu gehen, aber das gibt dir noch lange nicht das Recht …«
Jerry würdigte ihn keines Blickes. Er fasste nur in seine Jackentasche und zog seine Dienstmarke heraus, um sie dem Kerl vor die Nase zu halten.
»Oh, Mann, tut mir leid. Das hab ich nicht gewusst.«
»Können Sie sich irgendwie ausweisen?«, fragte Jerry das Mädchen. »Haben Sie eine Brieftasche dabei? Kreditkarten? Etwas, wo Ihr Name draufsteht?«
»Nein, ich hab nichts dergleichen.«
Regis tippte Jerry auf die Schulter, während er die Ich-bin-der-netteste-Kerl-auf-der-Welt-Masche abzog. »Nichts für ungut, okay? Meinen Sie, ihr fehlt was? Ich mach mir irgendwie Sorgen um sie.«
»Würden Sie wohl mitkommen, Miss? Ich möchte Sie wohin bringen, wo Sie in Sicherheit sind.«
Das Mädchen zuckte die Achseln. »Klar, warum nicht.«
Blaine sah zu, wie Regis ihnen bis zur Tür folgte und sich die ganze Zeit entschuldigte. So was tat einem Barkeeper gut.
Im Wagen fragte Jerry die junge Frau, woher sie käme.
»Ich weiß nicht. Das ist ein schöner Wagen.«
»Wo sind Sie denn untergekommen?«
»Untergekommen?«
»Ja. Ich nehme mal an, Sie sind nicht von hier. Bei wem wohnen Sie?«
»Ich weiß nicht. Das ist ein netter Bau, ist das eine Schule?«
Sie ließen die École secondaire Algonquin links liegen und fuhren bergauf. In der McGowan bog Jerry links ab.
»Sie haben eine Menge Kriebelmückenstiche abbekommen. Waren Sie draußen im Wald?«
»Ach, das sind Mückenstiche?« Geistesabwesend fasste sie sich mit der Linken an die Stirn und rieb sich die roten Pusteln am Haaransatz. »Sie jucken. Ich hab sie auch überall an den Knöcheln. Tun ein bisschen weh.«
»Waren Sie draußen im Wald?«
»Ja. Heute Morgen bin ich da aufgewacht.«
»Sie haben draußen geschlafen? Haben Sie deshalb Blätter in den Haaren?«
»Blätter?« Wieder hob sie die blasse, sommersprossige Hand an die Locken.
Kein Ehering, registrierte Jerry.
»Red, tun Sie mir den Gefallen und sehen Sie in Ihren Taschen nach, ob Sie irgendwelche Ausweispapiere bei sich haben, ja?«
Sie klopfte sich die Taschen ab und fühlte von innen. Sie zog ein paar Münzen sowie einen Nagelknipser aus der Jeans. Sie bot Jerry ein Pfefferminz an, doch er lehnte dankend ab.
»Mehr hab ich nicht«, sagte sie.
»Keine Schlüssel?«
»Keine Schlüssel.«
Jemand musste ihr die Sachen abgenommen haben, da war sich Jerry ziemlich sicher. Normalerweise ging man nicht ohne Schlüssel aus dem Haus. Er stellte den Wagen auf dem Parkplatz an der Notaufnahme des Städtischen Krankenhauses ab. Die Lichter von der Algonquin und Maine folgten einem weiten Bogen den Hügel hinab. »Wissen Sie, ich glaube nicht, dass ich deswegen ins Krankenhaus muss. Es sind doch nur Insektenstiche.«
»Schauen wir einfach mal, ob wir rausfinden, wo Sie Ihr Gedächtnis verloren haben, okay?«
»Okay. Sie sehen nett aus. Sind Sie ein Indigener?«
»Ja. Und Sie?«
»Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht.«
Ihre Antwort kam mit solchem Ernst heraus, dass Jerry lachen musste. Er konnte sich niemanden vorstellen, der weniger indigen aussah.
In der Notaufnahme reichte ihm ein junger Mann hinter der Empfangstheke ein Klemmbrett mit einem Formular.
»Wir werden keine einzige dieser Fragen beantworten können«, sagte Jerry. »Die junge Dame kann sich nicht ausweisen und an nichts erinnern.«
Der junge Mann zuckte nicht mit der Wimper, als ob jeden Abend Fälle von Amnesie bei ihm hereinspazierten.
»Füllen Sie es einfach für Mrs. X aus, und das Übrige Pi mal Daumen. Die Aufnahmeschwester ist auf dem Weg.«
Das Mädchen saß da und summte, während sie warteten, ohne erkennbare Melodie vor sich hin. Jerry füllte das Formblatt aus, indem er immer wieder unbekannt schrieb. Allmählich wurde es voller im Raum. John Cardinal kam mit einem Mann im mittleren Alter herein, der wie das Opfer eines tätlichen Überfalls aussah. Er nickte Jerry zu. In der Notaufnahme lief man nicht selten einem Kollegen über den Weg, und freitagabends war es geradezu vorprogrammiert. Die Schwester kam herüber und sprach etwa drei Minuten mit ihnen, gerade lange genug, um eine Laboruntersuchung anzuordnen und ihren Fall dringend zu machen. Irgendwann kam Dr. Michael Fortis aus einem Untersuchungszimmer und besprach sich mit der Schwester. Jerry gesellte sich zu ihnen; er hatte schon viel mit Fortis gearbeitet.
»Nicht viel los für einen Freitag«, sagte Jerry. »Schickt ihr sie alle zum St. Francis?«
»Sie hätten vor einer Stunde hier sein sollen. Wir hatten unabhängig voneinander zwei Auffahrunfälle, auf dem Highway 11 gab’s Streit zwischen ein paar Pkw und einigen Elchen. Der eine in dem Allradwagen war nicht so schlimm dran, aber der Kerl im Miata kann von Glück sagen, wenn er je wieder laufen kann. Passiert immer um diese Jahreszeit. Die Kriebelmücken treiben die Elche aus den Wäldern, und rums.«
»Ich hab ein bisschen was Ungewöhnlicheres für Sie.«
Zwanzig Minuten später kam Dr. Fortis aus dem Untersuchungszimmer und zog die Tür hinter sich zu.
»Diese junge Frau ist sowohl zeitlich als auch räumlich vollkommen desorientiert. Außerdem leidet sie unter Affektminderung und einer dramatischen Amnesie. Sie könnte schizophren oder bipolar sein und unter Medikamentenentzug stehen. Wissen wir irgendetwas über sie?«
»Nichts«, sagte Jerry. »Sie kann von hier stammen, aber das würde ich eher bezweifeln. Sie sagt, sie ist im Wald aufgewacht.«
»Ja, ich hab die Stiche gesehen.«
Ein Angestellter reichte dem Arzt ein Klemmbrett. Er blätterte ein-, zweimal um. »Ihre Laborwerte. Rauschmittelbefund negativ. Ich ruf wohl besser mal in der Psychiatrie an und frag, ob bei ihnen eine Patientin entlaufen ist. Falls nicht, werde ich einen Kollegen von der Psychiatrie zurate ziehen, aber nicht vor morgen früh. Inzwischen machen wir ein Schädel-Röntgenbild. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was wir sonst noch tun sollen.«
Er öffnete die Tür zum Untersuchungszimmer und holte das Mädchen heraus.
»Wer sind Sie?«, fragte sie Jerry.
»Erinnern Sie sich an mich?«, fragte Dr. Fortis.
»Nein, eigentlich nicht.«
»Ich bin Dr. Fortis. Dieser Gedächtnisverlust, den Sie da haben, ist gewöhnlich ein Traumasymptom. Ich nehme Sie jetzt mit dort rüber und mache eine Aufnahme von Ihnen.«
Jerry kehrte wieder ins Wartezimmer zurück, das sich jetzt allmählich mit den üblichen fluchenden Betrunkenen oder mit Kindern füllte, die wegen ihrer Koliken oder Mückenstiche schrien. Er rief im Präsidium an, um zu hören, ob es eine Vermisstenmeldung gab, die auf den Rotschopf passte. Der diensthabende Sergeant alberte ein bisschen mit ihm herum; Jerry war inzwischen bei der OPP, der Provinzpolizei von Ontario, hatte aber früher bei der Kripo Algonquin Bay gearbeitet, und der Sergeant war ein alter Freund. Keine Rotschöpfe vermisst gemeldet.
Jerry überlegte, was zu tun war. Für diesen Fall war Algonquin Bay zuständig, nicht er, doch falls das Krankenhaus sie nicht aufnahm, mussten sie das Mädchen irgendwo unterbringen, vielleicht im Frauenhaus. Und falls sich herausstellte, dass sie überfallen worden war, dann musste er in die Bar zurück und rausbekommen, ob irgendjemand sie kannte; musste zurückverfolgen, wann sie reingekommen war und von wo. Er fragte sich, wie sie in den Wald geraten war. Sie war nicht wie zum Campen angezogen.
Er traf Cardinal dabei an, wie er Formulare unterschrieb und mit dem jungen Mann hinter der Theke sprach. Der Angestellte hörte zu und nickte aufmerksam. Cardinal hatte es schon immer verstanden, den Leuten das Gefühl zu geben, dass das, was sie taten und wie sie mit den Details umgingen, wichtig sei. Dieser Unterschied konnte darüber entscheiden, ob man einen Fall löste oder vermasselte. Jerry wartete, bis er fertig war.
»Ich glaub, ich hab hier einen Fall für Sie«, sagte er. »Ich weiß doch, dass Sie nicht ausgelastet sind.«
»Hab ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie hier nichts mehr zu suchen haben, Jerry?«
»Ich weiß, aber ohne Sie bin ich nur ein halber Polizist, und mein Leben ist wüst und leer.«
»Lange nicht gesehen. Ich nehme mal an, Sie waren zum Schnorcheln unten in Florida oder so.«
»Schön wär’s. Hab bei ’ner Überwachung in Reed’s Falls rumgehangen. Aber heute Abend bin ich über was gestolpert. Ziemlich merkwürdig, das Ganze.« Jerry erzählte ihm vom Rotschopf.
»Keine Drogen? Klingt fast so, als hätte sie eins auf den Nischel bekommen.«
»Ja, genau. Keine Ausweispapiere dabei, keine Schlüssel, kein gar nichts.«
Dr. Fortis kam von der Radiologie zurück und machte ein besorgtes Gesicht.
»Etwas Unerwartetes«, sagte er zu Jerry. »Kommen Sie, sehen Sie selbst.«
»Wir sollten John einbeziehen. Vermutlich wird das ein Fall für die Kripo. Sie kennen Detective Cardinal?«
»Selbstverständlich. Kommen Sie.«
Cardinal folgte ihnen durch den Flur in einen Praxisraum, in dem dunkle Röntgenbilder an Leuchttafeln geklemmt waren. Dr. Fortis knipste das Licht an, und die zierlichen Halswirbel und der Schädel der jungen Frau erschienen vor ihren Augen, von vorne und von der Seite.
»Ich glaube, wir wissen jetzt, wieso unsere rothaarige Freundin so sanftmütig ist. Wie die Dinge liegen, werden wir sie für einen chirurgischen Eingriff nach Toronto runterschicken«, sagte Dr. Fortis. »Sehen Sie das hier?« Er zeigte auf eine helle Stelle mitten in der Profilansicht.
»Ist es das, wofür ich es halte?«, fragte Cardinal.
»Ich kann Ihnen sagen, dass ich mir im Moment wie ein ziemlicher Stümper vorkomme. Ist mir bei der Untersuchung völlig entgangen. Ich kann mich allenfalls auf ihr dichtes rotes Haar rausreden.«
»Sieht nach Kaliber .32 aus«, sagte Jerry.
»Ist durch den rechten parietalen Bereich eingetreten und hat teilweise die Stirnlappen durchtrennt«, sagte Dr. Fortis. »Daher die Affektminderung.«
»Ist das reversibel?«, wollte Jerry wissen.
»Auf dem Gebiet bin ich kein Experte, aber es gibt die erstaunlichsten Fälle von Patienten, die sich von solchen Schädigungen erholt haben. Das hier ist allerdings wirklich ein Fall, der in die Medizingeschichte eingehen dürfte: selbst zugefügte Lobotomie.«
»Vielleicht nicht selbst zugefügt«, sagte Cardinal. »Frauen, die Selbstmord begehen wollen, erschießen sich in den seltensten Fällen. Sie nehmen eine Überdosis, sie machen es mit dem Auspuff ihres Autos. Wir werden veranlassen, dass die Kollegen von der Spurensuche eine Schussrückstandsanalyse an ihrer Hand vornehmen.«
»Vielleicht nicht nötig«, sagte Jerry.
Das Mädchen saß, von einem Pfleger begleitet, in einem Rollstuhl an der Tür und lächelte immer noch.
»Wir haben das EEG«, sagte der Pfleger.
Dr. Fortis sah sich den Ausdruck an.
»Sie sagen, die Eintrittswunde ist rechts?«, fragte Jerry den Arzt.
»Richtig. An der rechten Schläfe.«
»Hey, Red.« Jerry nahm einen Stift aus der Tasche. »Fang.« Er warf den Stift über den Kopf. Eine blasse Hand schoss in die Höhe und schnappte in der Luft zu. Es war die linke.
»Nun ja«, sagte Cardinal, »dann wäre der Selbstmord ja wohl vom Tisch.«
2
Algonquin Bay mit seinen 58000 Einwohnern und zweikleinen Krankenhäusern kann sich keine eigenen Neurochirurgen leisten, weshalb Cardinal eine Dreiviertelstunde später den Highway 11 Richtung Toronto, der vier Autostunden südlich gelegenen Metropole, hinunterbretterte.
Nach einem prüfenden Blick auf das EEG hatte Dr. Fortis Red eine Halskrause anlegen lassen und sie mit Antibiotika sowie krampfvorbeugenden Medikamenten vollgepumpt. Danach hatte er einen Krankenwagen bestellt. »Sie scheint stabil zu sein«, sagte er, »aber ich sehe gewisse Anzeichen für Krampftätigkeit in ihrem EEG. Die werden sie sofort operieren wollen.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Selbstmordversuch war«, sagte Cardinal, »aber ich werde ihre Hand auf Schussrückstände untersuchen lassen, bevor wir fahren.«
»Wir?«
»Ich werde sie wohl oder übel begleiten. Dabei sein, wenn sie ihr diese Kugel aus dem Kopf holen.«
»Sicher. Indizienkette und all diese Dinge. Aber Sie müssen sich ranhalten. Je schneller sie in den OP kommt, desto besser.«
Mit einer elektrischen Haarschneidemaschine rasierte Dr. Fortis dem Mädchen eine kleine Stelle an der Schläfe kahl. Um ihren Mund spielte ein friedliches Lächeln, ansonsten zeigte sie keinerlei Reaktion.
»Vollkommen runde Eintrittswunde«, stellte Cardinal fest. »Keine Brand- oder Schmierspuren, kein Tätowierungseffekt.«
»Dieser Schuss wurde auf keinen Fall aus einem halben Meter oder einer noch kürzeren Distanz abgefeuert«, sagte Jerry. »Ich hoffe, Sie finden den Kerl, der den Finger am Abzug hatte. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich fahr dann mal nach Hause und genieße, was von meinem freien Tag noch übrig ist.« Er winkte dem Mädchen zu. »Machen Sie’s gut, Red.«
Das Lächeln des Rotschopfs war wie festgefroren. Das krampfvorbeugende Präparat zeigte erste Wirkung.
Cardinal rief zwischendurch Detective Sergeant Daniel Chouinard zu Hause an.
»Was gibt’s, Cardinal? Ich sehe gerade meine Lieblingsfolge von Homicide.«
»Die Serie läuft doch längst nicht mehr.«
»Bei mir zu Hause schon. Ich besitze die gesamten ersten drei Staffeln auf DVD. Hat was Beruhigendes, Cops zu sehen, die sich mit deutlich schlimmeren Problemen rumschlagen als ich.«
Cardinal erzählte ihm von dem Mädchen.
»Also, da müssen Sie nach Toronto, um dabei zu sein, wenn sie diese Kugel rausholen. Sonst noch was?«
»Das war’s.«
»Gut. Dann geh ich mal wieder und schau mir an, wie diese Großstadtcops ihre Fälle lösen.«
Bob Collingwood von der Spurensuche traf wenige Minuten später im Krankenhaus ein. Er war der jüngste Detective im Dezernat und bei Weitem der stillste. Er machte ein paar Polaroidfotos von der Wunde und gab sie Cardinal. Anschließend nahm er Proben mit einem GSR-Tupfer, einem flachen, klebrigen Gegenstand, der einem Zungenspatel glich, und drückte ihn sowohl auf die Handrücken der jungen Frau als auch zwischen ihre Daumen und Zeigefinger. Sie schien es nicht zu merken; es war, als hätte sie sich aus dem Zimmer verabschiedet. Collingwood steckte den Tupfer in einen Beutel, den er Cardinal ohne ein Wort überreichte, bevor er wieder verschwand.
Als Cardinal nach Hause kam, war seine Frau wegen ihrer eigenen Reise nach Toronto schon ziemlich aufgeregt, obwohl sie erst in einer Woche stattfinden würde. Catherine sollte eine dreitägige Exkursion in die Großstadt leiten, die sie mit ihrem Fotografiekurs an der Northern University unternahm.
»Ich weiß nicht, wie ich es bis nächste Woche aushalten soll«, sagte sie. »Sicher, es lässt sich in Algonquin Bay ganz gut leben, aber, seien wir ehrlich, es strotzt nicht gerade vor Kultur. Ich werde in Toronto tausend Fotos machen, ich werde phantastisch essen gehen, und ich werde jede freie Minute in den Museen zubringen und mir Kunst, Kunst und nochmals Kunst ansehen!«
Sie überprüfte ihre Kameras, reinigte sie mit einem Luftstrahl aus der Dose, polierte die Linsen. Zwei Fotoapparate waren das Mindeste, was Catherine auf Reisen mitnahm, doch es sah so aus, als hätte sie genug Objektive für fünf. Ihre Frisur war völlig zerzaust, so wie immer, wenn sie mit einem Projekt beschäftigt war. Sie nahm eine Dusche und vergaß über dem, was sie gerade gefangen nahm, anschließend ihr Haar zu föhnen.
»Ich wünschte, ich könnte jetzt gleich mit dir runterfahren«, sagte sie. »Aber ich muss morgen noch eine Stunde geben, und am Donnerstag ist Dunkelkammer-Workshop.«
Cardinal warf ein paar Sachen in eine kleine Reisetasche.
»Wo willst du denn wohnen?«, fragte Catherine.
»Im Best Western, auf der Carlton. Die haben immer was frei.«
Cardinal wühlte in der Kommode nach seinem Rasierapparat. Er benutzte ihn nur unterwegs, und zwischen zwei Reisen wusste er nie, wo er ihn hingelegt hatte.
Catherine rief die Auskunft für Toronto an und ließ sich die Nummer des Hotels durchgeben, während sie unentwegt weiter mit Cardinal plauderte. Im Fernsehen gingen gerade die Elf-Uhr-Nachrichten zu Ende, doch Catherine kam erst richtig in Fahrt.
Cardinal merkte, wie dieses alte, beklemmende Gefühl in ihm aufstieg. Seine Frau war schon zwei Jahre nicht mehr in der Klinik gewesen. Sie hatte alles bestens im Griff. Nahm pünktlich ihre Medikamente, machte regelmäßig Yoga, sorgte für ausreichend Schlaf. Doch zu den schlimmsten Aspekten ihrer Krankheit gehörte es, dass Cardinal sich nie sicher sein konnte, ob seine Frau einfach nur glücklich und aufgeregt war oder kurz davor, in die abgehobenen Gefilde der Manie abzudriften.
Sollte ich was sagen? Es war, als hätten die Psychiater damals vor zwanzig Jahren, als sie Catherines Störung diagnostizierten, Cardinal mit diesem endlos wiederholten Mantra in den Orden besorgter Ehepartner aufgenommen: Sollte ich was sagen?
»Diese Reise wird phantastisch«, sagte Catherine. »Ich spür das einfach. Wir werden das Hafengelände fotografieren. Ein paar von den alten Industriebauten, bevor sie touristisch aufgemotzt werden und nicht mehr wiederzuerkennen sind.«
Cardinal trat hinter sie und legte ihr die Hände auf die Schultern. Catherine erstarrte, das Objektiv in der einen Hand, das Reinigungstuch in der anderen.
»Mir geht’s gut, John.« Ihre Stimme klang gereizt.
»Ich weiß, Liebling.«
»Du musst dir keine Sorgen machen.«
Sie drehte sich nicht zu ihm um. Kein gutes Zeichen.
Die Insekten prasselten wie Regen auf die Windschutzscheibe. Gelegentlich hing Cardinal hinter einem klapprigen Lkw, sodass er nicht vorankam, doch die meiste Zeit war die Straße leer. Er hatte den Krankenwagen irgendwo auf der Höhe von Huntsville hinter sich gelassen.
Cardinal beschloss in einem Kraftakt, sich nicht länger um Catherine zu sorgen, sondern sich auf den Rotschopf zu konzentrieren. Der Beutel und die Fotos lagen auf dem Beifahrersitz neben ihm. Er hegte nicht den geringsten Zweifel, dass er es hier mit einem Mordversuch zu tun hatte, doch nach zwanzig Jahren – zehn Jahren in Toronto und noch einmal so vielen in Algonquin Bay – war er lange genug bei dem Verein, um sich zu keinen voreiligen Schlüssen hinreißen zu lassen.
Am katholischen Jungengymnasium, auf das er gegangen war, hatten die Priester darauf bestanden, dass ein Jugendlicher, der auf Abwege geraten war, stets mit den Augen seines Schöpfers auf seine Taten blickte oder aber, falls das seine Phantasie überforderte, wenigstens mit den Augen seiner Mutter. In Cardinals Kopf war ein Verteidiger an die Stelle dieser Inquisitoren getreten und schnüffelte wie die Ratte nach dem Käse unablässig nach Gründen für jenen berühmten Zweifel herum.
»Und Sie sagen, Sie haben sie nicht auf Schmauchspuren untersuchen lassen, ist das korrekt, Detective?«
»Das ist korrekt.«
»Solange uns das Gegenteil nicht durch eine solche Untersuchung bewiesen ist, wäre es aber durchaus möglich, dass das Opfer sich die Kugel selbst in den Kopf geschossen hat, nicht wahr?«
»Zum einen ist sie Linkshänderin; zum anderen gab es keine Schmauchspuren an ihrer Kopfhaut. Es ist demnach höchst unwahrscheinlich, dass sie selbst geschossen hat.«
»Beantworten Sie einfach nur meine Frage, Detective. Ich habe Sie gefragt, ob es möglich ist.«
Cardinal ließ sich mit der Abteilung 52 der Kripo Toronto verbinden und forderte einen 24-Stunden-Personenschutz für das Mädchen an.
Dr. Melanie Schaff war kühl und effizient und zudem gut fünf Zentimeter größer als Cardinal. Sie legte diese reservierte Schroffheit an den Tag, die man oft bei Frauen antrifft, die sich ihren Aufstieg in eine Männerdomäne erkämpfen mussten; Cardinals Kollegin Lise Delorme war auch dieser Typ.
»Ihre Mrs. X hat eine partielle Lobotomie erlitten, und die Kugel steckt in der Nähe des Hippocampus fest«, erklärte Dr. Schaff. »Manchmal ist es sicherer, eine Kugel nicht zu entfernen, aber diese hier ist zu nah an einer der Gehirnarterien. Bei der Krampfaktivität, die wir in ihrem EEG sehen, können wir sie auf keinen Fall stecken lassen. Ein oder zwei starke Krämpfe, und es könnte das Ende für Mrs. X bedeuten.«
»Wie hoch ist das Risiko?«
»Geringfügig, verglichen mit den Folgen, wenn die Kugel drinbleibt. Ich habe ihr das erklärt, und sie scheint der OP gefasst entgegenzusehen.«
»Ist sie denn in der Lage, eine solche Entscheidung zu fällen?«
»Oh ja. Ihr Gedächtnis und ihre Affekte sind beeinträchtigt, aber nicht ihre rationale Denkfähigkeit.«
»Wie groß ist ihre Chance, sich vollkommen zu erholen?«
»Der vordere Stirnlappen ist nur partiell durchtrennt und nur auf einer Seite, die Chancen stehen somit nicht schlecht, dass sie einmal wieder über die ganze emotionale Bandbreite verfügt. Garantieren kann man natürlich für nichts. Wir können keine direkten Schäden an den Gehirnpartien feststellen, die Erinnerungen speichern, ich nehme daher an, dass sie sich vorübergehend in einem traumatischen Nebel befindet, der sich irgendwann lichtet. Zu diesem Zweck werde ich eine Therapie bei einem Neuropsychologen empfehlen. Also, was genau brauchen Sie von mir, einmal abgesehen von der Kugel?«
»Besteht die Möglichkeit, dass ihr irgendeine Erinnerung kommt, während Sie sie operieren?«
»Wir werden uns sachte an den Hippocampus herantasten. Auf jeden Fall gibt es eine reelle Chance, dass sie ein paar Erinnerungsfetzen hat. Ob das nun Träume oder tatsächliche Erinnerungen sein werden, kann ich nicht sagen. Aber Sie haben ja gesehen, in welchem Zustand sie ist. Ihre Äußerungen werden sich nicht einordnen lassen.«
»Wenn Sie nur bitte im Auge behalten, dass sie für uns vielleicht von Nutzen sind und ihr das Leben retten könnten. Wir wissen nicht, wer versucht hat, sie umzubringen.«
»Ist das alles?«
»Ich müsste eigentlich zusehen, wie Sie die Kugel rausholen.«
»In Ordnung. Dann stecken wir Sie mal in Handschuhe und Kittel. Wir arbeiten mit einem Instrument, das wir als Geheimstation bezeichnen. Es handelt sich um einen 3-D-Computertomographie-Scanner, der an das Mikroskop angeschlossen ist, mit dem ich arbeite. Wir werden Ihnen einen Logenplatz geben.«
Wie die meisten Cops hatte Cardinal schon eine Menge Blut gesehen – die zerfetzten Opfer von Verkehrsunfällen oder blutbespritzte Küchen, Schlafzimmer, Keller oder Wohnzimmer, in denen Männer sich gegenseitig Gewalt angetan hatten oder, häufiger, Männer Frauen. Man entwickelt eine Hornhaut dagegen, wie beim berühmten Zimmermannsdaumen. Woran sich Cardinal allerdings nie hatte gewöhnen können, war der OP. Aus irgendeinem Grund, den er nicht durchschaute – er hoffte, dass es nicht einfach nur Feigheit war –, drehte sich ihm beim bloßen Anblick der blitzenden Instrumente der Magen um, und zwar in einem Maße, das er bei Verbrennungen, Verstümmelungen oder Stichverletzungen nicht kannte.
Dr. Schaff ließ sich von zwei Ärzten und zwei OP-Schwestern assistieren. »Red«, wie Cardinal sie im Stillen nur noch nannte, war von den Beruhigungsmitteln sowie dem krampfvorbeugenden Präparat zwar schläfrig, doch bei Bewusstsein. Um die Eintrittswunde hatte man ihr inzwischen eine größere Stelle kahl rasiert, und über eine riesige subkutane Infusion war ihr ein Lokalanästhetikum verabreicht worden. Eine Vollnarkose war nicht nötig, da das Gehirn schmerzunempfindlich ist.
Mit Mundschutz und im Kittel stand Cardinal seitlich zu Reds Füßen, wo er gleichzeitig den Eingriff auf einem Overhead-Monitor verfolgen und der Chirurgin bei der Arbeit zusehen konnte.
»Okay, Red«, sagte Dr. Schaff. »Wie fühlen Sie sich?«
»Du liebe Zeit. Sie haben alle so schöne Augen.«
Cardinal sah in die Runde. Das Mädchen hatte recht: Zwischen dem Mundschutz und den OP-Hauben wurden die Augen betont; alle wirkten freundlich und weise.
»Mit Schmeicheln erreichen Sie alles«, sagte Dr. Schaff. Sie legte eine Spezialbrille an, mit der sie wie ein gutartiges Alien aussah. »Sind Sie so weit? Es wird nicht wehtun, versprochen.«
»Ich bin so weit.«
Cardinal hatte gedacht, er wäre ebenfalls so weit, bis Dr. Schaff ein Skalpell zur Hand nahm und einen Schnitt rund um eine Stelle in Reds Kopfhaut legte. Einen Moment lang bildeten die Linien ein scharlachrotes geometrisches Muster, doch dann quollen sie an und verliefen, und Cardinal wünschte sich, woanders zu sein.
Dr. Schaff bat um die Knochensäge. Cardinal verbrachte eine Menge Freizeit mit Holzarbeiten, und zu seinem Staunen sah er, dass das Instrument, das in ihren Händen schimmerte, aus seinem Keller hätte stammen können. Es machte ein hohes, heulendes Geräusch wie ein Zahnarztbohrer, doch sobald es auf Knochen stieß, klang es ziemlich ähnlich wie beim Zersägen einer Sperrholzplatte. Red blinzelte nicht einmal, als Dr. Schaff das Stück Knochen herausnahm und beiseitelegte. Sie würden es konservieren und in ein, zwei Tagen wieder einsetzen, sobald eventuelle Schwellungen des Gehirns zurückgegangen waren.
Vor allem richte keinen Schaden an, fordert der hippokratische Eid. Von allen ärztlichen Bemühungen ist die Gehirnchirurgie vermutlich diejenige, bei der die Mediziner mehr als irgendwo sonst diese Vorschrift des Hippokrates im Hinterkopf haben. Dr. Schaff machte sich daran, mit geradezu unerträglicher Behutsamkeit Schicht um Schicht ins Hirngewebe vorzudringen. Außer dem Piepton der Monitore und dem gelegentlichen leisen Klirren von Metall herrschte äußerste Stille. Ab und zu bat Dr. Schaff um ein anderes Instrument – einen »McGill«, einen »Foster«, einen »Bircher«.
Während Cardinal zusah, wie ein Stück rostfreier Stahl von beträchtlicher Länge millimeterweise immer tiefer in das Gehirn des Mädchens vordrang, fühlten sich seine Knie definitiv wie Pudding an. Es half auch nicht, aufzuschauen. Der Monitor zeigte denselben Vorgang in seitlicher Großaufnahme. Er fühlte sich, als taumelte er in Zeitlupe einen Aufzugschacht hinab. Unter seiner OP-Kappe sammelte sich der Schweiß.
Zwei Stunden vergingen. Drei. Die Ärzte machten gelegentliche Bemerkungen, kommentierten den Puls, den Blutdruck der Patientin. Es wurde nach Arterienklemmen und Spreizern und einem Kauter verlangt. Dr. Schaff sprach Red gelegentlich an, während sie sich weiter in ihr Hirn vorarbeitete.
»Geht’s, Red? Alles klar?«
»Mir geht’s gut, Doktor. Alles bestens.«
Um seinen Magen zu beruhigen, konzentrierte sich Cardinal auf die Hintergrundgeräusche, den Piepton der Monitore, das Surren der Klimaanlage und der Lampen. Auf dem Bildschirm erschien das Instrument als ein Strich aus leuchtendem Metall etwa acht bis zehn Zentimeter im Kopf des Mädchens.
»Nähern uns dem Hippocampus …«
Red fing zu singen an. »Im Frühtau zu Berge wir zieh’n, fallera …«
»Ja, wir kommen auch ganz gut voran, Red. Ich denke, wir haben’s gleich.«
»Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen …«
»Okay, wir sind da«, sagte Dr. Schaff. »Ich schnapp sie mir jetzt.«
Auf dem Monitor befand sich der dunkle Fleck der Kugel nun im richtigen Greifwinkel der flachen Klemmbacken. Das Instrument trat langsam den Rückzug an. Cardinal hatte eine Tochter etwa im gleichen Alter wie Red, vielleicht ein bisschen älter. Ihn überkam ein mächtiger Vaterinstinkt, die Hand auszustrecken und die junge Frau irgendwie zu beschützen – was streng genommen absurd war, da sie nicht die geringsten Schmerzen empfand.
Red meldete sich im Plauderton. »Die Wolken waren unglaublich.«
»Tatsächlich?«, erwiderte Dr. Schaff. »Wolken, heh?«
Auf dem Monitor bewegte sich die Kugel stetig durch den engen Kanal. Cardinal wandte den Blick zu Dr. Schaff. Ihre Handschuhe waren glitschig rot.
Auf einmal klang Red ganz anders. »Die Fliegen«, sagte sie in gedämpftem, fast ehrfürchtigem Ton. »Mein Gott, die Fliegen.«
Dr. Schaff beugte sich über ihre Patientin. »Reden Sie mit uns, Red?«
»Sie hat die Augen geschlossen«, sagte jemand anders. »Es ist eine Erinnerung. Oder vielleicht ein Traum.«
Cardinal wartete gespannt, was das Mädchen noch sagen würde, doch sie machte die Augen wieder auf und starrte ins Leere.
Wenig später zog Dr. Schaff die Kugel heraus. Eine Schwester hielt ihr einen Beutel hin, in den die Ärztin das Projektil fallen ließ. Cardinal nahm ihn entgegen. Er ging in den Vorbereitungsraum und zog seine OP-Sachen aus. Als er den Beutel in seine Brusttasche steckte, spürte er einen Moment später an der Stelle etwas Warmes – die Wärme von Reds Gehirn.
3
Cardinal schlief drei Stunden in der blütenweißen Bettwäsche des Best-Western-Hotels. Nach einer kochend heißen Dusche, die glatt eine Hautschicht abtrug, ging er in die Cafeteria hinunter, wo er auf einem zähen Kotelett herumkaute, während er den Globe and Mail überflog. Draußen fiel die Morgensonne schräg über die Ufer und die Versicherungsgebäude. Die Luft war frisch, und mit Genugtuung registrierte Cardinal, dass es keine Kriebelmücken gab. Er ging zum Institut für Gerichtsmedizin in der Grosvenor Street und lieferte die Kugel ab, wozu einige Formulare auszufüllen waren. Sie sagten, er solle in einer Stunde wiederkommen.
Cardinal kehrte ins Hotel zurück und bezahlte seine Rechnung.
Er war schon nach einer Dreiviertelstunde zurück. Der junge Mann in der Abteilung für Schusswaffendelikte, der mit dem Fall betraut worden war, hieß Cornelius Venn. Er trug ein weißes, kurzärmeliges Hemd mit blauer Krawatte und hatte das sauber-adrette, ein wenig einfältige Aussehen eines Pfadfinderführers. Cardinal tippte auf eine stattliche Sammlung Modellflugzeuge.
Venn nahm die Polaroidfotos, die Cardinal ihm gegeben hatte, und heftete sie an eine Korkwand. »Sauberes rundes Loch. Keine Verbrennung, keine Rußpartikel, nur eine Spur Tätowierungseffekt.«
»Und das sagt Ihnen was?«
»Oh, nein, auf die Kiste lasse ich mich nicht ein. Auf keinen Fall werde ich eine Entfernungsbestimmung vornehmen, ohne dass ich eine Waffe in Händen habe.«
»Geben Sie mir einfach nur Schätzwerte. Wir brauchen sie vielleicht gar nicht vor Gericht.«
»Es gibt keinen Schätzwert. Nicht ohne eine mutmaßliche Tatwaffe. Wie soll ich Ihnen einen Richtwert geben, ohne dass ich die Lauflänge kenne? Selbst wenn ich die Waffengattung kenne, weiß ich noch nicht, ob die hier nicht irgendwie verändert wurde, was wiederum die Schussbahn beeinflussen würde.«
»Dann geben Sie mir also keinen Anhaltspunkt?«
»Wie gesagt, ich kann nicht.«
»Na ja, Selbstmord haben wir praktisch ausgeschlossen. Das Opfer ist Linkshänderin. Und für mein nicht eben fachmännisches Auge sieht es so aus, als wäre die Schusswaffe irgendwo zwischen dreißig und fünfzig Zentimetern entfernt gewesen.«
»Dazu kann ich mir wie gesagt keine Meinung bilden«, antwortete Venn. »Aber bei Selbstmord würde man eine Kontaktwunde oder etwas in der Art erwarten. Falls Ihre Mrs. X nicht über einen Meter lange Arme hat, kann sie sich diese Wunde unmöglich selber beigebracht haben.«
»Ein Strafverteidiger könnte behaupten, es sei ein Unfall gewesen.«
»Ein Unfall? Aus einer Entfernung von vielleicht einem halben Meter? Sie halten jemandem eine geladene Waffe an den Kopf und geraten versehentlich an den Abzug? Also, da dürften doch dem einen oder anderen berechtigte Zweifel kommen.«
Cardinal deutete mit dem Kopf auf das Spektroskop, das auf ein Werbeposter für einen Van-Damme-Film Schatten warf. »Was ist mit den Ergebnissen der Schussrückstandsanalyse? Helfen die uns irgendwie weiter?«
»Ist gar nicht durchgeführt worden. Sehen Sie mich nicht so an, Detective. Hat überhaupt keinen Sinn, jemanden auf Schmauchspuren zu untersuchen, auf den gerade aus kurzer Entfernung geschossen wurde. Man würde in jedem Fall welche finden, ob die Person nun selber geschossen hat oder nicht.«
Da hatte er recht. Cardinal hätte sich dafür ohrfeigen können, dass er nicht daran gedacht hatte.
Venn heftete ein Blatt Papier an die Pinnwand, auf dem eine Reihe grauer Streifen unterschiedlicher Intensität zu sehen war.
»Und nun zum Geschoss«, sagte er. »Wir haben es mit einem einfachen, nicht ummantelten Bleigeschoss Kaliber .32 zu tun. Nach meinem Eindruck einem langen 32er. Normalerweise würde man bei einem Schädeldurchschuss davon ausgehen, dass das Projektil abgeflacht wird, sodass man es kaum noch einordnen kann. In diesem Fall haben wir einen Schuss in die Schläfe – viel dünnerer Knochen –, und die Kugel ist noch ziemlich intakt. Ich nehme mal an, Sie haben keine Hülsen?«
»Wir haben nur das, was wir Ihnen gegeben haben.«
»Dann wird Ihnen das hier nicht allzu viel helfen, aber schauen wir mal.« Während er sprach, zeigte er auf den Ausdruck; sein Fingernagel war restlos abgenagt. »Sie haben sechs rechte Züge mit einem Feld-Zug-Verhältnis von eins bis eins Komma soundso viel. Züge sind null Komma sechsundfünfzig; Felder null Komma sechzig.«
»Pistole?«
Venn nickte. »Pistole. Und in einer Hinsicht haben Sie Glück.«
»Tatsächlich?«
»Die Riefelung in der Waffe hat einen Linksdrall. Das grenzt die Möglichkeiten schon mal von vornherein ein. Sie suchen vermutlich nach einem Colt.«
Venn rollte seinen Drehstuhl vor seinen Computer. Er fing an, Zahlen in eine Datenbank einzutippen. »Nach allem, was Sie über die Verletzung erzählt haben – minimale Bewegung im Schädel, minimale Gewebeschädigung –, haben Sie es, glaube ich, mit Munition zu tun, die entweder sehr alt oder irgendwann nass geworden ist. Oder es ist eine defekte Waffe. Falls der Schlagbolzen schief genug sitzt, kann das zu einem Fehlschuss wie diesem hier führen. Aber das wissen wir natürlich erst, wenn Sie uns eine Hülse bringen. Oder womöglich gar die Waffe selbst.«
»War’s das? Wir haben es also vielleicht mit einem Colt Kaliber .32 zu tun?«
Venn sah ihn an. »Sie sind so ungeduldig, Detective, dass Sie mich nicht mal ausreden lassen.«
Cardinal musterte Venn, um festzustellen, ob das nur als Witz gemeint war. War es nicht.
»Dieser Linksdrall in Verbindung mit diesem Feld-Zug-Verhältnis grenzt unser Problem auf zwei Möglichkeiten ein. Sie suchen entweder nach einer J.C. Higgins, Modell 80, oder einem Colt ›Police Positive‹.«
»Und ich möchte wetten, es gibt ’ne ganze Reihe von der Sorte?«
»In Ontario? Gehen Sie von mehreren Hundert aus.«
Zehn Minuten später atmete Cardinal wieder die Chlor- und Verbandsgerüche des Städtischen Krankenhauses von Toronto ein. Mrs. X war in ein Zimmer im dritten Stock verlegt worden. Der Polizeiposten an der Tür hatte so viel Ausrüstung an den Hüften hängen, dass seine Gestalt vage an einen Kegel erinnerte. Cardinal zeigte ihm seine Dienstmarke und wurde hereingewunken. Die rothaarige Unbekannte lag in ihrem OP-Hemd halb aufgerichtet im Bett und las Chateleine. Bei seinem Eintreten lächelte sie ihm entgegen; an ihrer Schläfe blitzte ein kleiner weißer Verband.
»Sind Sie mein Arzt?«
»Nein. Ich bin von der Polizei. John Cardinal. Wir haben uns gestern Abend kennengelernt.«
»Von der Polizei? Tut mir leid. Ich erinnere mich nicht.«
»Das macht nichts. Ich möchte wetten, Ihr Gedächtnis funktioniert bald wieder.«
»Das hoffe ich. Im Moment weiß ich nicht mal, wer ich bin.«
»Dr. Schaff hat mir gesagt, sie ist ziemlich sicher, dass es wiederkommt.«
»So große Sorgen mache ich mir nicht mal darum.«
Cardinal verschwieg, dass Dr. Schaff sich hinsichtlich ihrer normalen Affekte weitaus weniger optimistisch geäußert hatte.
Das Mädchen drehte sich um und stopfte sich die Kissen zurecht. Cardinal erhaschte einen Blick auf blasse Brüste und schaute weg.
»Red, ich brauche Ihre Hilfe.«
»Gerne.«
»Ich brauche Ihre Erlaubnis, Ihre Kleider durchzusehen, um festzustellen, ob Sie doch irgendetwas dabeihatten, mit dessen Hilfe wir Sie identifizieren können.«
»Ach so, klar, bedienen Sie sich.«
Zweifellos war das seitens des Krankenhauses längst geschehen, doch Cardinal öffnete trotzdem den Spind. An einem Drahtbügel hing eine Jeansjacke, daneben eine Jeans. In einem Fach lagen T-Shirt, BH und Schlüpfer. Cardinal notierte sich die Markennamen: Levi’s, Lucky, GAP. Dann kramte er in den Jeanstaschen. Keine Schlüssel, keine Ausweispapiere, keine Quittungen oder Fahrkartenabschnitte, nur ein paar Münzen und ein Nagelknipser. Er griff in die Seitentaschen der Denimjacke und zog eine halbe Rolle Pfefferminz heraus. Nichts Brauchbares zu finden.
Als er sich wieder umdrehte, sah Red mit leerem Blick aus dem Fenster, als wäre er Luft. Zwischen den Gebäuden hingen kleine weiße Wolken in den rhombenförmigen Ausschnitten blauen Himmels. Dahinter der Betonschaft des CN Tower, des Wahrzeichens von Toronto.
»Noch etwas«, sagte Cardinal. »Dürfte ich Sie wohl fotografieren?«
»Ja, warum nicht.«
Cardinal zog die Jalousien herunter, um eine örtliche Zuordnung anhand des Hintergrunds zu vermeiden. Dann setzte er die junge Frau davor und ließ sie den Kopf so drehen, dass die kahl rasierte Stelle nicht zu sehen war. Er machte eine Nahaufnahme mit seiner Polaroid.
Als er ihr das Ergebnis zeigte, kam keinerlei Reaktion.
»Morgen werden Sie wieder nach Algonquin Bay überstellt«, sagte Cardinal. »Geht das für Sie in Ordnung?«
»Ich weiß nicht, wo das ist«, sagte sie. »Ich weiß nicht mal, ob ich von da stamme.«
»Davon müssen wir so lange ausgehen, bis wir etwas Gegenteiliges wissen.«
Eine blasse, sommersprossige Hand tastete die Ränder des Verbandsmulls ab. Cardinal rechnete fest mit der unangenehmen Frage, wo sie in Algonquin Bay wohnen würde, doch sie sagte nichts. Nur dieses unverändert friedliche Lächeln. Umso besser, dann musste Dr. Schaff das übernehmen.
»Hören Sie, ehm, Red, entschuldigen Sie bitte, ich nenne Sie nur so, bis wir Ihren Namen wissen …«
»Schon in Ordnung, das macht mir nichts.«
»Wir werden sehr bald eine Vermisstenmeldung zu Ihrer Person rausgeben. Eine junge Frau wie Sie verschwindet nicht einfach so, ohne dass es einer merkt. Dann werden wir wissen, wer Sie sind und woher Sie stammen. Bis dahin stehen Sie unter Polizeischutz, rund um die Uhr.«
»Ja, gut.«
Sie protestiert nicht, sie fragt nicht, warum, dachte Cardinal. Sie scheint keine Angst zu haben und nicht einmal neugierig zu sein.
Umso mehr fühlte er sich verpflichtet, auf die Fragen, die sie selbst nicht stellte, die Antwort zu finden.
4
Die Polizeidienststelle Algonquin Bay ist nicht so ein Drecksloch, wie man es von Krimiserien über die New Yorker Polizei kennt. Seit der Eröffnung des neuen Präsidiums vor zwölf Jahren hat sich die Kripo das fade Dekor einer kleinen Bausparkassenfiliale bewahrt. Die Fenster an der Ostseite gewähren – zumindest morgens – gutes Licht und dazu einen ausgezeichneten Blick über den Parkplatz.
Cardinal war gerade im Sitzungssaal und packte seine letzten Aktenordner in eine Kiste – und mit ihnen einen Fall, der ihn ein halbes Jahr lang seine ganze Kraft gekostet hatte. Es war dabei um eine kriminell veranlagte Familie gegangen, die auf dem Wege einer Klage wegen Lärmbelästigung über den angeblichen Krach beim Grillen den Gartengrill einer Nachbarsfamilie eingesackt hatte. Eines der Familienoberhäupter war mit dem Gesicht nach unten in der Worcestersoße gelandet, als es einem Herzinfarkt erlag. Cardinal hatte Monate in die Ermittlungsarbeit gesteckt, die am Ende einen stinknormalen Unfalltod bestätigte.
Alle naselang drang das Tak Tak Tak vom Einhämmern eines Nagels in seine Gedanken. Frances, langjährige Sekretärin und Polizeichef Kendalls Mädchen für alles, hängte gerade eine Gruppe neu gerahmter Fotos an die Kieferntäfelung. Bis jetzt hatte sie erst eins von Chief Kendall beim Amtseid angebracht und ein Weiteres von Ian McLeod, in voller Montur und klatschnass, nachdem er soeben eine Mutter von drei Kindern vor dem Ertrinken im Trout Lake gerettet hatte.
»Was halten Sie von dem hier?«, fragte Frances.
Ein Schwarz-Weiß-Foto im Format zwanzig mal fünfundzwanzig von einem beträchtlich jüngeren Jerry Commanda während seiner Zeit bei der Kripo Algonquin Bay, mit Baseballkappe und Sonnenbrille. Er stand vor einem Steintor, auf dem ein gusseiserner Adler thronte – die Klauen angespannt, die schwarzen Schwingen wie zum Flug gespreizt.
»Ist das Eagle Park?«, fragte Cardinal.
»Hmhm.«
»Daran kann ich mich noch erinnern. Es war ein Wohltätigkeitsspiel gegen die Feuerwehr.«
»Ist es zu fassen, wie dürr Jerry da noch war?«
»Ist er immer noch. Ein weiterer gewichtiger Grund, wenn man denn einen bräuchte, um ihn irritierend zu finden.«
»Nun machen Sie aber mal einen Punkt, alle lieben Jerry.« Frances war gegen Ironie so immun wie eine Heilige.
»Noch ein Grund«, sagte Cardinal.
»Also, Sie …«
Cardinal verfiel wieder in Schweigen. Das Konferenzzimmer war im Vergleich zu ihrem Großraumbüro der reine Luxus. Es verfügte sogar über Teppichboden, in Königsblau, mit einem tiefen Flor, der einiges von Frances’ Gehämmer sowie dem Getöse aus dem Gewahrsamstrakt schluckte. Allerdings war er nicht tief genug, um das Gezeter eines gewissen Jasper Colin Crouch zu dämpfen.
Jasper Colin Crouch war Langzeitarbeitsloser und als Bauarbeiter nicht mehr zu vermitteln, von der Gestalt eines Grizzlybären und im Wesen noch viel schlimmer. Crouch war, darin entsprach er ganz dem Klischee, der Polizei einschlägig bekannt, was er seiner Neigung verdankte, in nüchternem Zustand seine Frau und in betrunkenem seine zahlreichen Sprösslinge zu verprügeln. Detective Lise Delorme hatte ihn einige Tage zuvor wegen Körperverletzung einkassiert, nachdem sein zwölfjähriger Sohn mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus musste. Der Junge stand jetzt vorübergehend unter der Vormundschaft des Jugendamts Ontario.
Als ein gewaltiges Gebrüll ertönte – eine Art lauter Elchschrei, könnte man sagen –, sah Cardinal auf. Er wusste genau, woher das kam. Dem Brüllen folgte ein ebenso gewaltiges Krachen.
»Du liebe Güte«, sagte Frances und griff sich ans Herz.
Cardinal sprang auf und rannte zum Gewahrsamstrakt.
Der Boden war überflutet – Crouch war wohl über den Wasserkühler gestolpert. Jetzt türmte er sich angriffslustig vor Delorme mit ihren eins sechzig auf, die gegenüber diesem Bollwerk aus Fett und Muskelmasse noch beträchtlich kleiner wirkte. Delorme hatte eine Platzwunde über dem Auge und kniete mit einem Bein im Wasser.
Bob Collingwood hielt Crouch von hinten fest, doch Crouch zuckte mit einer bühnenreifen Bewegung die Achseln, und Collingwood flog im hohen Bogen davon. Bevor Cardinal einschreiten konnte, spannte sich Crouch an, um mit voller Wucht Delorme einen Tritt zu verpassen. Delorme wich zur Seite aus, erwischte seine Ferse mit der linken Hand und erhob sich halb.
»Mr. Crouch, Sie hören sofort auf, oder ich mache Ernst.«
»Leck mich doch.« Er zuckte mit seinem Bein, doch Delorme hielt fest.
»Das war’s«, sagte sie. Sie legte sich seinen Fuß auf die Schulter und stand auf. Crouchs Schädel machte mit dem gefliesten Boden Bekanntschaft, und er war so schlagartig weg, als hätte jemand den Ausknopf an einer Fernbedienung gedrückt. Es gab tosenden Applaus.
»Das muss genäht werden«, sagte Cardinal, als Delorme aus dem Waschraum zurückkam. An ihrer linken Augenbraue klaffte eine tiefe Platzwunde von mindestens acht Millimetern.
»Ich werd’s überleben.« Sie setzte sich im Großraumbüro in die Kabine neben seiner. »Wie geht’s unserer Mrs. X?«
Cardinal hatte Delorme angerufen, nachdem er sich den Ballistikbericht abgeholt hatte.
»Mrs. X ist unverändert Mrs. X«, sagte er. »Die Neurochirurgin glaubt, sie kriegt ihr Gedächtnis wieder, aber niemand weiß, wann.«
»’ne Kugel im Kopf – also, ich geh doch recht in der Annahme, dass wir keine Anzeigen mit der Frage Kennen Sie diese Frau? in die Zeitung setzen?«
»Nein. Derjenige, der auf sie geschossen hat, soll nicht erfahren, dass wir sie gefunden haben, geschweige denn, dass sie noch lebt. Du hast noch nichts zu der Waffe ausgegraben?«
»Du meinst, ob sie bei früheren Verbrechen verwendet wurde?« Delorme schüttelte den Kopf. »Nichts Passendes«, und sie fügte in einem beiläufigen Ton hinzu: »Allerdings hab ich die Liste der als gestohlen gemeldeten Schusswaffen überprüft. Überraschung – wie sich rausstellt, hatten wir vor drei Wochen genauso eine.«
»Du machst Witze. Eine 32er Pistole?«
Delorme hielt einen Zettel hoch, auf den sie einen Namen und eine Anschrift geschrieben hatte.
»Vermisst. Eine Pistole. Kaliber .32. Hersteller: Colt. Modell: ›Police Positive‹.«
Rod Milcher wohnte in einem gepflegten Halbgeschosshaus im Stadtteil Pinedale, dereinst eine feine Adresse, inzwischen aber, dank der Ausbreitung trister Betonwohnblöcke, eine Gegend für frisch verheiratete Paare. Pinedale ist das Viertel, in dem man, im Maklerjargon, Erstkäufer-Eigenheime findet.
Anders als Jasper Crouch war Milcher der Polizei nicht einschlägig bekannt. Genauer gesagt, überhaupt nicht bekannt. Und sein Haus mit dem sauber getrimmten Rasen und der hübschen Zedernhecke wirkte nicht wie das eines Kriminellen – wie das eines Zahnarztes vielleicht. Das einzig Ungewöhnliche an diesem Domizil prangte in der Einfahrt: ein dralles, chromblitzendes Motorrad.
»Eine Harley, Baujahr fünfundsechzig«, sagte Cardinal, bevor sie auch nur ausgestiegen waren.
»Keine zehn Pferde würden mich auf so ’n Ding kriegen«, sagte Delorme. »Ein Freund von mir ist mit sechsundzwanzig auf so was tödlich verunglückt. Hat gegen einen Betonmisch-Lkw den Kürzeren gezogen.«
»Enger Freund?«
»Hmm. Hielt sich für einen harten Burschen, war er aber nicht.«
Cardinal klopfte am Seiteneingang. Es war kurz nach sechs; sie hatten so lange gewartet, bis Milcher voraussichtlich zu Hause wäre. Eine Frau, vielleicht Mitte dreißig und im Straßenkostüm, erschien an der Tür. Wie um den Chefetagen-Look mit etwas Häuslichem auszugleichen, hielt sie einen Kochtopf in der Hand. »Ich interessiere mich nicht für Religion«, sagte sie durch die Fliegengittertür. »Wie oft muss ich das denn noch sagen?«
Delorme hielt ihre Dienstmarke hoch. »Ist Rod Milcher wohl zu Hause? Wir hätten ein paar Fragen.«
Die Frau drehte den Kopf zur Seite, ohne sich sonst zu rühren, und brüllte: »Rod, die Polizei für dich! Pack schon mal deine Zahnbürste ein!«
Sie öffnete die Gittertür. »Machen Sie schon. Sonst kommen die Insekten rein.«
Die Seitentür führte durch einen Vorraum in die Küche. Cardinal und Delorme blieben neben einem für zwei gedeckten Resopaltisch stehen, während die Frau sich mit einem Schäler an einen Berg Kartoffeln begab.
»Darf man fragen, was es für Probleme gibt?«, rief ihnen von der Dielentür ein winziger Mann in kariertem Hemd und Kakihose zu, die er nicht annähernd auszufüllen vermochte.
»Mr. Milcher, Sie sind der registrierte Eigentümer einer Pistole Kaliber .32, ist das richtig?«, fragte Cardinal. »Eines Colt ›Police Positive‹?«
»Ja. Und? Haben Sie ihn gefunden?«
»Können Sie uns Näheres dazu sagen, wie Ihnen die Waffe gestohlen wurde?«
»Das hab ich doch schon angegeben. Steht alles im Bericht.«
»Wir würden es aber gerne noch mal von Ihnen hören«, sagte Delorme.
»Meine Frau und ich waren übers Wochenende in Toronto. Als wir zurückkamen, war die Pistole weg. Zusammen mit ein paar anderen Sachen – der Stereoanlage und der Kamera.«
»Und wieso haben Sie überhaupt einen Waffenschein?«
»Ich leite die Abwicklungsstelle für Zellers. Ich muss häufig nachts beträchtliche Summen einzahlen, wenn der gepanzerte Wagen schon weg ist.«
»Arbeiten Sie nach wie vor dort?«
»Ja.«
»Wie wär’s, wenn Sie uns zeigen würden, wo die Stereoanlage stand?«, schlug Cardinal vor.
Milcher blickte von Cardinal zu Delorme und wieder zu Cardinal.
»Hier drin.«
Sie folgten ihm in ein Wohnzimmer, das fast vollständig weiß eingerichtet war: weißer Teppich, weiße Gardinen, weißes Kunstledersofa und passender Lehnstuhl. Milcher deutete auf eine Vitrine mit einer Yamaha-Stereoanlage und den dazugehörigen Lautsprechern.
Delorme ging hinüber und sah sie sich an.
»Sie haben aber ziemlich schnell Ersatz gefunden.«
»Die ist alt, ich hab sie aus dem Keller geholt.«
»Sieht gar nicht alt aus.«
»Sieht eigentlich zu teuer aus, um im Keller zu stehen«, fügte Cardinal hinzu.
Milcher zuckte die Achseln. »Ich sehe nicht, was das alles mit meiner Pistole zu tun hat. Haben Sie sie nun gefunden oder nicht?«
»Wo hatten Sie die Waffe denn aufbewahrt?«, fragte Delorme.
»In dem Kästchen da.« Milcher wies auf eine kleine Eichenschatulle in der Vitrine. Der Verschluss war aufgebrochen.
»Wer wusste sonst noch, dass Sie sie dort aufbewahren?«
»Niemand. Na ja, meine Frau, aber sonst keiner. Hören Sie, Sie haben mir immer noch nicht gesagt, ob die Pistole wieder aufgetaucht ist oder nicht. Ich hab sie ordnungsgemäß gemeldet. Ich denke, ich hab ein Recht, es zu wissen.«
»Ihre Pistole ist noch nicht wieder aufgetaucht«, sagte Cardinal. »Aber wir glauben, eine Ihrer Kugeln schon.«
»Ich verstehe nicht ganz.«
»Haben Sie die Munition zusammen mit Ihrer Waffe aufbewahrt?«
»Ehm, ja. Die Kugeln wurden auch gestohlen. Waren allerdings schon ziemlich alt. Ich war nicht mal hundert Prozent sicher, ob sie noch funktionieren würden, um ehrlich zu sein.«
»Kennen Sie diese Frau?«, fragte Cardinal. Er reichte Milcher das Foto von Red, das er an dem Morgen im Krankenhaus gemacht hatte. Der Verband war nicht zu sehen, und auch sonst verriet nichts, wo sie sich befand. Sie sah aus, als hätte man sie beim Tagträumen überrascht.
»Die hab ich noch nie gesehen«, sagte Milcher. »Wieso?«
»Weil, wie’s aussieht, eine von Ihren Kugeln in ihrem Schädel steckte«, sagte Cardinal.
»Oh, mein Gott. Das ist ja schrecklich. Aber ich hab damit nichts zu tun. Verdammt. Ich hab das Ding als gestohlen gemeldet, sobald ich merkte, dass es nicht mehr da ist.«
»Und woher sollen wir wissen, dass Sie das nicht nur getan haben, weil Sie genau wussten, was Sie damit vorhatten?«
»Hören Sie, ich hab diese Frau noch nie gesehen. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich hab die gestohlene Waffe gemeldet und hab nicht den blassesten Schimmer, wer sie gestohlen hat, Punkt.«
»Hör mal, was hat der ganze Quatsch eigentlich zu bedeuten, Rodney?«
Alle drei drehten sie sich zu Mrs. Milcher um, die jetzt mit einem Backofenhandschuh im Türrahmen stand.
»Halt du dich da raus, Lorraine.«
Mrs. Milcher ließ einen theatralischen Seufzer vom Stapel. »Um die Wahrheit zu sagen, ist mein Mann nie erwachsen geworden. Wenn Sie das Zweirad in der Einfahrt gesehen haben, dürfte Ihnen klar sein, dass er von so was wie Easy Rider träumt. Er würde immer noch am liebsten mit den großen Jungs rumfahren.«
»Ich bin mit ihnen rumgefahren«, sagte Milcher. »Vor zehn Jahren war es vorbei, und ich hab bei nichts anderem mitgemacht, was sie so getrieben haben. Aber ich bin viel mit ihnen rumgefahren.«
»Sicher doch. Und ich hab mal bei den Spice Girls gesungen.«
»Von wem ist hier eigentlich die Rede?«, fragte Delorme. »Wer sind die sogenannten großen Jungs?«
»Die Viking Riders«, sagte Mrs. Milcher. »Ich meine, hält die nicht jeder für Helden?«