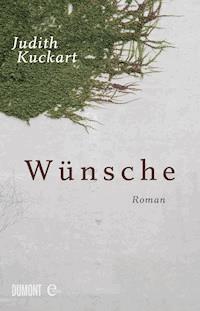9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sonntagabend, Flughafen Tegel: Im Café in der Abflughalle kommt sie mit einem Mann ins Gespräch. Robert Sturm ist sechsunddreißig, achtzehn Jahre jünger als sie. Er ist auf dem Weg nach Sibirien. Am Ende ihrer und seiner Arbeitswoche wird er zurückkommen. Am Samstag. Darauf wartet sie … Als sie 1981 mit achtzehn nach Westberlin kam und Medizin studierte, lernte sie Viktor kennen, der doppelt so alt war wie sie. Er war die andere, die politische Generation und eröffnete ihr die Welt. Er selbst jedoch blieb ihr verschlossen. Das Leben mit Viktor war ein Abenteuer, aber eines, dessen Gefahren sie nicht teilten. Mit sechsunddreißig – inzwischen in Neurobiologie promoviert – trifft sie zur Jahrtausendwende Johann. Er ist so alt wie sie. Gemeinsam hangeln sie sich durch ihre Liebe; prekär sind nicht nur ihre Arbeitsbiografien. Samstagvormittag, wieder Flughafen Tegel: Sechs Tage lang haben ihr Alltag und ihre Erinnerungen sich verwoben und einander zu erklären versucht. Warum sind die Männer in ihrem Leben immer sechsunddreißig? Ist sie noch die, an die sie sich erinnert? Oder ist sie, die sich in Sachen Gehirn auskennt, eigentlich das, was sie vergessen hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wir sind, was wir vergessen haben.
Sonntagabend, Flughafen Tegel: Im Café in der Abflughalle kommt sie mit einem Mann ins Gespräch. Robert Sturm ist sechsunddreißig, achtzehn Jahre jünger als sie. Er ist auf dem Weg nach Sibirien. Am Ende ihrer und seiner Arbeitswoche wird er zurückkommen. Am Samstag. Darauf wartet sie.
Als sie 1981 mit achtzehn nach Westberlin kam und Medizin studierte, lernte sie Viktor kennen, der doppelt so alt war wie sie. Er war die andere, die politische Generation und eröffnete ihr die Welt. Er selbst jedoch blieb ihr verschlossen. Das Leben mit Viktor war ein Abenteuer, aber eines, dessen Gefahren sie nicht teilten. Mit sechsunddreißig – inzwischen in Neurobiologie promoviert – trifft sie zur Jahrtausendwende Johann. Er ist so alt wie sie. Gemeinsam hangeln sie sich durch ihre Liebe; prekär sind nicht nur ihre Arbeitsbiografien.
Samstagvormittag, wieder Flughafen Tegel: Sechs Tage lang haben ihr Alltag und ihre Erinnerungen sich verwoben und einander zu erklären versucht. Warum sind die Männer in ihrem Leben immer sechsunddreißig? Ist sie noch die, an die sie sich erinnert? Oder ist sie, die sich in Sachen Gehirn auskennt, eigentlich das, was sie vergessen hat?
© Burkhard Peter
Judith Kuckart, geboren 1959 in Schwelm (Westfalen), lebt als Autorin und Regisseurin in Berlin und Zürich. Sie veröffentlichte bei DuMont den Roman ›Lenas Liebe‹ (2002), der 2012 verfilmt wurde, den Erzählband ›Die Autorenwitwe‹ (2003), die Neuausgabe ihres Romans ›Der Bibliothekar‹ (2004) sowie die Romane ›Kaiserstraße‹ (2006), ›Die Verdächtige‹ (2008), ›Wünsche‹ (2013) und ›Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück‹ (2015). Judith Kuckart wurde mit zahlreichen Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet.
Judith Kuckart
Kein Sturm, nur Wetter
Roman
Die Autorin dankt dem Literaturfonds Darmstadt e.V. für die Unterstützung durch ein Werkstipendium. Außerdem dankt sie dem deutsch-amerikanischen Institut für die wertvollen Erfahrungen und inhaltlichen Anregungen sowie die finanzielle Unterstützung im Rahmen des Autorenprojekts »Geist und Wissenschaft«.
Erich Fried, Was es ist aus: Ders.: Es ist was es ist. Liebesgedichte Angstgedichte Zorngedichte © 1983, 1994, 1996 Verlag Klaus Wagenbach
eBook 2019 © 2019 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagmotiv: © plainpicture/Lucja Romanowska Satz: Angelika Kudella, Köln
23.12.
Heute Nacht kommt eine junge Frau an mein Bett und stellt mir eine Flasche Borjomi hin, Mineralwasser, das schon Breschnew gegen seinen Wodkakater trank. Die Frau in meinem Traum würde gern etwas sagen, das sehe ich ihr an. Sie zieht die Bettdecke zurecht, faltet einen Pullover, hebt meine Strümpfe auf. Endlich sagt sie: So viel Schnee und so viel Licht im Dunkeln.
DER SONNTAG
Wohin fliegen Sie?
Ich fliege gar nicht, und Sie?
Sibirien, sagt er, darf ich mich setzen?
Si-bi-ri-en, wiederholt sie und denkt, mein Gott, ist der jung.
Sie hat sich im vergangenen Herbst angewöhnt, regelmäßig zum Flughafen Tegel zu fahren, am liebsten am Wochenende. Das sind die leichteren Tage. Wenn sie Glück hat, ist auch der Tisch, den sie ihren Tisch nennt, im Café der Abflughalle frei. Sobald die ersten Abendflüge angezeigt werden, holt sie sich am Tresen ein kleines Pils. Auch heute wird sie hier sitzen, bis ein letzter Bus zurück in die Stadt fährt. Es gibt eine Art Ereignislosigkeit, die der Meditation ähnelt. Ein länglicher Hund läuft an diesem frühen Sonntagabend vorbei, ein Hund wie eine Wurst mit Kopf. Er zerrt einen kleinen Mann hinter sich her. Gestern, als sie heimgefahren ist, hat hinter dem Busfahrer eine Frau mit Spitzenhandschuhen gesessen und leise nach vorn geredet. Ob die Frau nach Dienstschluss mit dem Fahrer nach Hause gehen und dort die Spitzenhandschuhe ausziehen wird, hat sie sich beim Aussteigen gefragt.
Eingangshalle Flughafen Tegel. Auf der Anzeige für Ankunft und Abflug verändern Städtenamen, Flugnummern, Uhrzeiten und Gates unermüdlich ihre Positionen. Früher hat den Vorgang ein Klackern hörbar begleitet. Jetzt ist er digitalisiert und stumm.
Der Flieger nach Zürich hat seine Position zuoberst verlassen und ist auf dem Weg in den Himmel über Berlin.
Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bestellen?
Sie sieht in die blauen Augen des Mannes, der gleich nach Sibirien fliegen wird. Sie sind blau wie die Karos seines Flanellhemds. Mit seinen großen Händen kann er sicher Kabel verlegen und Apfelbäume längs der sonnenbeschienenen Gartenmauer überreden, im Spalier zu wachsen. Wahrscheinlich fährt er einen alten Kombi, mit dem er seine Frau, zwei oder drei Kinder und einen großen Hund transportiert und die Bierkästen vom Getränkemarkt auch. Falls er nicht gerade auf Reisen ist. Wahrscheinlich ist er auch ein guter Liebhaber, still und herzlich und immun gegen die ganz großen Gefühle. Er sieht aus, als sei er leicht glücklich zu machen, aber auch genauso leicht zu deprimieren. Sie beneidet seine Frau. Ob er überhaupt verheiratet ist? Eigentlich brauchte so einer eine Ehefrau erst ab fünfzig, damit er nicht zu oft allein ist.
Wenige Male ist sie nach einem ihrer Ausflüge zum Flughafen Tegel mit einem Fremden in die Stadt zurückgefahren. Ist nicht in den Schnellbus, sondern in ein Taxi zu irgendeinem Hotel gestiegen. Sie hat an der Bar mit dem Fremden noch etwas getrunken, einen Whisky oder zwei, bis das Bedürfnis, einander über die Atemgrenze hinweg näher zu kommen, verstummte. Wenigstens bei ihr. Die Regel ist einfach. Das Verlangen entsteht aus dem Nichts. Wenn sie ihm keine Beachtung schenkt, verschwindet es so unberechenbar und schnell, wie es gekommen ist. Je älter sie wird, desto leichter fällt es, sie einzuhalten. So endeten die Abende bisher immer mit einem eins zu null für sie, ohne Verlängerung in die Nacht hinein.
Ich fliege mit der letzten Maschine nach Moskau, sagt er, zieht seine Jacke aus und hängt sie über die Rückenlehne des Barhockers. Morgen früh um sechs muss ich weiter mit einem Inlandsflug nach Wladiwostok, dann nach Nowosibirsk und Chabarowsk. Samstagmorgen bin ich zurück …
Aus Chabarowsk bei China?, fragt sie. Die Frauen dort sollen ja alle BWL studieren und sehr enge Röcke tragen, stimmt das? Sie schaut seinen Wirbel über der Stirn an, die Augen, die dunklen Wimpern und wieder die Hände. Früher einmal hat sie sich trotz hässlicher Hände verliebt, weil die Männer dazu auf ihnen laufen konnten. Als er vom Barhocker aufsteht, sucht sie mit den Augen das Jackett nach Hundehaaren ab.
Können Sie eigentlich auf den Händen laufen?, fragt sie, als er mit dem kleinen Pils für sie und dem großen für sich zurückkommt.
Nein, dafür bin ich zu alt.
Wie alt sind Sie denn?
Sechsunddreißig, und Sie?
Ich habe morgen Geburtstag, sagt sie, aber das ist eine glatte Lüge.
Er lächelt und schaut einer Frau in einem dünnen, grauen Mantel hinterher, bis sie beim Ausgang des Terminals C verschwindet.
Und wie heißen Sie?, fragt er und schaut sie an, als käme er aus einem Traum, der einfach abgerissen ist.
Ich?
Sie heißen Ich?
Er wischt über die Fläche seines Hockers und setzt sich erst dann. In dem kurzen Moment, den er fort gewesen ist, sind auf dem leeren Platz lauter kleine Vögel zusammengeflogen.
Ich laufe zwar nicht auf meinen Händen, sagt er, aber ich kann damit als deutsche Fachkraft Kompressoren installieren, die angeblich die besten der Welt sind. Ich reise von Ölraffinerie zu Ölraffinerie. In Chabarowsk bin ich in letzter Zeit häufiger, immer im gleichen Hotel mit Blick auf den Amur.
Amur, der Fluss?
Ja.
Sie schaut zum Ausgang des Terminals C, wo die Frau in dem dünnen, grauen Mantel verschwunden ist.
Sind Sie dort gern im Hotel?
Ja.
Und das Land, wie ist das so?
Dreck, Staub, Kot auf Gold und manchmal Marmor. Jetzt wundern Sie sich, dass ein deutscher Ingenieur so spricht? Das mit dem Dreck, Staub, Kot, Gold und Marmor sagt mein Kollege Sergej immer. Es verrottet, unser Land, sagt er, es ist das System, das verrottet. Ich selber bin immer erleichtert, wenn wieder Freitag ist. Samstags fliege ich zurück, aber am Freitag nimmt Sergej mich zum Wochenendtreffen seiner Freunde mit. Wir sitzen in einer Garage, trinken Bier und Wodka, jemand spielt Gitarre. Die anderen lachen und singen dazu. Ich auch. Die Mechaniker, die schon zu DDR-Zeiten nach Chabarowsk kamen, können oft kein Englisch. Ihr Russisch haben sie vergessen. Deswegen ist Tatjana, die Frau von Sergej, als Dolmetscherin mit dabei.
Er zögert, dann fügt er an, Tatjana weint schnell und unterrichtet auch Yoga.
Trägt sie einen dünnen, grauen Mantel? würde sie gern fragen.
Neulich ist Tatjana am Ende eines solchen Garagenabends vom Stuhl gefallen, einfach so. Nicht wegen zu viel Wodka, sondern vor Erschöpfung, sagt er. Man muss in dieser Gegend mit allem rechnen, und das tue ich auch. Ich rechne dort mit allem. Auch ich könnte eines Tages vom Stuhl fallen.
Sein Handy klingelt.
Er steht auf und entfernt sich ein paar Schritte vom Tisch. Sie schaut ihm nach. Mein Gott, welche Kindheit hat diesen gelassenen Gang nicht unterdrückt und diese fröhliche Unbefangenheit gestattet, mit der der Mann da drüben in kürzester Zeit dieses Flimmern in Herz und Hirn bei ihr verursacht hat, ohne selbst etwas davon zu ahnen? Woran erinnert sie seine Gegenwart? Daran, dass sie sich einmal hat verlieben können? Und wenn es so wäre, was würde das jetzt ändern?
Gegenüber dem Café ruckelt eine junge Verkäuferin mit müdem Gesicht einen Rollständer mit Twinsets vor ihrer Markenboutique zurecht, bis er parallel zum Schaufenster steht. Lila, sieht sie, ist in jeder Größe vorhanden. In Rot hängt nur noch ein Teil ganz vorn auf der Stange. Ist nicht früher statt der Boutique dort ein Kiosk für Zeitungen, Postkarten und durchsichtige Kinderregenschirme gewesen? Früher, wann war das?
Neben seinem Bierglas hat der Mann das Portemonnaie liegen lassen. Aus dem Fach für Geldscheine schaut der Rand einer Visitenkarte. Mit einem Ruck zieht sie sie heraus.
Sturm, steht da, Robert Sturm.
Kenn ich, denkt sie, Sturm kenn ich doch. Aber wer hat nicht schon einmal in seinem Leben einen Sturm kennengelernt? Sie schaut zu ihm herüber. Er telefoniert noch immer, hat den Rücken ihr zugewandt und wippt in den Knien. Ob am anderen Ende der Leitung seine Frau ist oder eins seiner Kinder? Wie alt mögen sie sein? Ob es zwei Mädchen sind, mit spitzen Gesichtern und Grübchen? Oder eher zwei Jungen, die sich ständig prügeln, weil das Häuschen, ein Reihenendhäuschen, zu klein für vier Personen mit Hund ist? Wie kommt sie eigentlich darauf, dass er in einem Reihenendhäuschen wohnt?
Sie steckt die Visitenkarte ein.
Eine halbe Stunde später nimmt er das Flugzeug, und sie fährt früher als sonst mit dem Bus zurück. Draußen ist August. Wladiwostok, Chabarowsk, Nowosibirsk. Die Städtenamen verbünden sich zu einem Rhythmus, der sich den Fahrbewegungen des Busses anpasst. Wladi-wostok-Cha-ba-rowsk-Nowo-sibirsk, nächsten Samstag wird er wieder in Tegel landen. Sie zieht die Visitenkarte aus der Hosentasche. Die Anschrift seiner Firma für Kompressoren steht fett gedruckt vorn und auf der Rückseite, klein und kursiv, die private. Der Bus federt und ruckelt weiter durch eine erste Dämmerung.
… Sturm, Robert Sturm! Wo der Wind ihn hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen …
Wie kommen die Zeilen in ihren Kopf? Aus der Erinnerung? Aus dem Vergessen? Egal, die zwei gehören eh zusammen wie Hefe und Teig. Sie legt die Schläfe an die Scheibe. Als der Bus eine breite Straße entlangfährt, die wie eine Flugschneise über einen Kanal hinwegführt, krümmt sie den Rücken, zieht den Kopf zwischen die Schultern und versucht, so viel Himmel wie möglich von ihrem Platz aus zu sehen.
… Schirm und Robert fliegen dort, durch die Wolken immerfort. Und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an …
30.12.
Der Plan: Als sie achtzehn ist, verliebt sie sich in einen Mann, der sechsunddreißig ist. Als sie sechsunddreißig ist, verliebt sie sich in einen, der wie sie sechsunddreißig ist. Wenn sie vierundfünfzig ist, wird sie sich wieder in einen verlieben, der sechsunddreißig ist. Ich weiß das, ich bin hier die Erzählerin.
Die Männer bleiben sechsunddreißig.
Was bleibt sie?
1.1.
Dass ich früher einer Freundin dabei zugeschaut habe, wie sie Häuser besetzte, bis ich schließlich auch einmal einen Stein geworfen habe, erzählte ich einem Mann auf der Silvesterparty gestern. Er darauf: Und ich bin in jenen Jahren Opel Kadett gefahren.
Welche Farbe?
Klatschmohn.
Baujahr?
Dreiundsechzig, sagte er, wie ich.
Und: Soeben auf einer Bank im Tiergarten mit ihm, der mal Opel Kadett fuhr und jetzt immer noch raucht. Unter der Bank eine leere Flasche Rotkäppchensekt und Hülsen aus einer Schreckschusspistole. Eine kickt er auf den Weg, schaut nicht mich an, sondern in die Sonne, als erwartete er noch jemanden, und sagt: Wer beim Boxen kontert, wird nicht verrückt.
Boxt du etwa?
Ja.
Verrückt, sage ich.
Und: Wie soll die Frau vom Flughafen jetzt eigentlich heißen? Irmgard? Geht gar nicht. Nina? Auch nicht. Konstanze? Nein. Laura? Vielleicht … möglich.
Wie ich?
Ich?
31.1.
Würdest du dir mit mir ein Ballett ausdenken?
Für wen?
Für einige Elefanten.
Wie alt?
Sehr jung.
(Pause)
DER MONTAG
Sie stellt eine Dose mit Teebeuteln auf den Tisch und schaut das Etikett an. English Breakfast. Mein Gott, wie lange sie schon in Berlin ist! Dieses Leben ist langsam um sie herumgewachsen, verlässlich vertraut, und es gibt nicht viel zu sehen, das es nicht bereits in früheren Stunden, Tagen, Jahren zu sehen gegeben hätte. Anfang der Achtziger ist sie mit zwei Koffern und der Bahn hergekommen, zu einer Zeit, als Zugfahren nach Westberlin kein einfaches von hier nach da mit dem ICE gewesen ist, sondern eine lange Reise auf grünen oder roten Kunstlederbänken, mit abgeschabten Armlehnen zwischen Mensch und Mensch. Im Winter ist mit dem Auftauchen der Grenzkontrollen regelmäßig die Heizung ausgefallen, sodass sie mehr als einmal mitten im Kalten Krieg an den deutsch-deutschen Verhältnissen beinahe erfroren wäre. Sie nimmt zwei Beutel aus der Teedose und gießt Wasser darüber. Sie erinnert sich. Das erste Mal in Berlin war sie mit Nina, auf Klassenfahrt. An der Grenze wurden die Mädchen still. Die Jungen mutierten zu James Bonds hinter verspiegelten Sonnenbrillen. DDR-Grenzer mit Bauchläden für Transitvisa gingen von Abteil zu Abteil, stempelten die Papiere für die flauschigen Kinder aus dem Westen in Nickipullovern, die gelernt hatten, dass es in der Zone keine Ölsardinen, keine ganzen Spargelstangen gab, nur deren Unterteile. Die Spargelspitzen wurden aus einem Unrechtsstaat namens DDR in den Westen exportiert. Glaub ich nicht, hatte Nina gesagt, das stimmt nicht. Am zweiten Tag der Klassenfahrt machten Nina und sie allein mit der U-Bahn einen Ausflug in den Wedding. Sie saßen am Fenster, denn es gab etwas zu sehen: unterirdische Geisterbahnhöfe im Ostteil, wo die Bahn nicht hielt, nur langsamer fuhr. Aufgeschüttete Kohleberge lagen vor den Ausgängen nach oben. Aushänge an Mitropa-Büdchen kündigten den Sieg der Volksrevolution oder einen Fußball-Länderkampf im Walter-Ulbricht-Stadion an. Volksrevolution, hatte Nina gesagt, so wie man ein Fremdwort wiederholt, das man sich einprägen will, und auf Uniformierte im Notlicht gezeigt, das grün von grün gekachelten Wänden zurückstrahlte. Hatten die sich in den abgedunkelten Gängen ihres eigenen Lebens verirrt? Waren diese Geisterbahnhöfe nur ein Echo aus dem Nichts? Das kann doch nicht sein, hatte Nina gesagt, und sie waren am letzten Tag der Klassenfahrt über die Grenze nach DDR-Berlin gegangen, um zu sehen, wie die Welt über den Geisterbahnhöfen aussah. Beim Übergang Tränenpalast erwischte sie ein plötzlicher Regen, der einen dünnen Vorhang über das gelbliche Scheinwerferlicht von Trabis, Ladas und Wartburgs in den Straßen warf. Unter den Linden roch es nicht nach Linden, sondern nach Abgasen, und in einer Milchbar am Alexanderplatz, die Eisbär oder Espressobar hieß, drängelten sich zwei Jungen, die Finger zum V gehoben und kaum älter als Nina und sie, in Schimmeljeans und blau getönten Brillengläsern mit ins Bild, auf dem sie alle später so aussahen, als hätte sie eine Schlange erschreckt. Oder war es die Erinnerung, die später den Film auf ihre Weise mit belichtete?
Sie nimmt die zwei Teebeutel aus der Kanne. Wie hatte das Desinfektionsmittel der Reichsbahn noch geheißen? Sicher hatte es noch Bestände gegeben, die in die Ukraine verkauft worden waren, oder weiter noch, in den Fernen Osten. Es hatte sich auf der Zugfahrt in Haaren und Kleidung festgesetzt wie der Geruch nach alter Erbsensuppe. Jetzt rochen wahrscheinlich die Nordkoreaner so. Aber wie das Zeug hieß, hatte sie vergessen. Egal. Sie fischt das Frühstücksei aus dem kochenden Wasser und toastet zwei Scheiben Weißbrot. Wie hatte ihr Professor für Philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie noch geheißen? Genau der, der in seinen Vorlesungen gern einen einzelnen Satz wiederholt hatte, um danach von seinem Manuskript aufzuschauen und den Satz in der Stille des Hörsaals größer werden zu lassen … Wir sind, was wir vergessen haben.
Aber wie hatte der Professor geheißen? Weißbach?
Sie legt das Weißbrot auf den Teller und wirft die Packung Frischkäse weg. Er hat Schimmel. Sie spült die Salatschleuder und trocknet sie ab. Als sie die Kurbel betätigen will, klemmt sie.
Ach, Johann, denkt sie, aber jenen Mann, der diesen Schaden mit seinen großen, geschickten Händen beheben könnte, gibt es nicht mehr in ihrem Leben.
Küss mich, hatte sie zu dem Mann gesagt, den die Freundin Nina ihr als Johann vorgestellt hatte. Sie schloss die Augen in jener Silvesternacht, während sein Atem, seine Lippen, seine Brust, sein Herzschlag sie berührten. Hinter ihren Lidern wirbelte Laub. Jedes Blatt ein Lachen. Sie, promovierte Medizinerin ohne angemessene Anstellung, war sechsunddreißig, seit achtzehn Jahren in Berlin und seit dreien von Viktor getrennt. Zahlen erzählen Geschichten. Auch ihre. Mehr und mehr Feuerwerkskörper gingen in die Luft. Der Himmel würde in spätestens fünf Minuten von einem rauchigen, schmutzigen Gelb sein. Es war am Ende nur so ein Bewegungsmelder, der am Rand der bemoosten Steinterrasse in Pankow sie und jenen Johann kurz nach Mitternacht aus der Gartendunkelheit riss, so ein dummes Licht, das bei jeder Katze, jeder Ratte aufschreit. Als es anging, blieben sie fest aneinandergezurrt stehen, als würde die geringste Veränderung zwischen ihnen sie vom Rand der Terrasse, vom Rand der Welt stürzen. Das neue Jahr und ein neues Jahrtausend hatten begonnen.
Sie war am frühen Nachmittag und schlecht gelaunt mit dem Zug vom Rand des Ruhrgebiets nach Berlin zurückgefahren. Die Tage zwischen den Jahren im achten Stock bei Mutter und Großmutter waren von grauer, boshafter Endlosigkeit gewesen und hatten eine Verzweiflung ausgelöst, die sie von früher kannte. Die Langeweile. Wäre es Sommer gewesen, hätte sie sich auf den Balkon zurückziehen und das Manuskript Ufer des Bewusstseins für einen wissenschaftlichen Verlag zu Ende korrigieren können, für den sie als freie Lektorin arbeitete. Aber es ging gar nicht, sich im überheizten Wohnzimmer hinter einem Stapel mitgebrachten Papiers zu verschanzen. Vieles ging gar nicht, dort, wo sie herkam.
Ankunft Gleis drei.
Der Bahnhof Zoo hatte vier Gleise und war damit nicht größer als irgendein Bahnhof in der deutschen Provinz. Komm nicht zu spät, hatte Nina gesagt, damit du unsere Aktion noch mitkriegst. Sie war mit der S-Bahn gefahren und hinter dem Hackeschen Markt in die Straßenbahn umgestiegen. Unsere Aktion, hatte Nina am Telefon gesagt, beginnt dort und zieht sich über die folgenden drei bis vier Stationen.
Als die Bahn losfuhr, stand eine junge Frau abrupt auf. Sie hatte ein breites Katzengesicht, ging durch den Wagen bis nach vorn, um den Halteknopf beim Fahrer zu drücken. Aus ihrer Einkaufstasche rann Milch. Sehen Sie das nicht?, fragte ein älterer Mann. Nein, sagte die Frau mit dem Katzengesicht im Abwenden. Sie stieg an der nächsten Haltestelle aus, während Kinder an ihr vorbei in den Wagen drängten und sich zu fünft auf einen Viererplatz quetschten, bis ein Mädchen den Jungen neben sich in die Seite stieß: Mensch, Alter, tu dich mal woandershin. Der Junge stand auf und hängte sich mit einer Hand an den Haltegriff. Milch rann aus seinem Rucksack. Jeder sah es, niemand sagte etwas. Auch sie nicht. Bei der nächsten Station stiegen die Kinder aus. Der Mann, der jetzt einstieg, war sechsunddreißig, so alt wie sie, erfuhr sie später, und trug einen schmuddeligen Jutebeutel über der Schulter, der nicht zu ihm passte. Er setzte sich auf den Platz gegenüber und sah ihr in die Augen. Sie schaute zurück. Seine Hand glitt in den Beutel. Er verzog den Mund. Daraus wurde ein Lächeln, vielleicht unsicher, vielleicht melancholisch, bis es auf halbem Weg stecken blieb. Die Bahn fuhr an.
Küss mich, hatte sie gedacht.
Küss mich oder wirf mich gegen die Wand, antwortete sein Blick, bevor er aufstand und durch den Wagen ging. Aus seinem Jutebeutel rann Milch. Hallo, rief da der ältere Mann wieder. Hallo, was soll das? Wie heißen Sie? Die Finger wie zum Ringkampf gespreizt, stand er auf, um nach ein paar breitbeinigen Schritten dicht vor dem Mann mit dem Jutebeutel stehen zu bleiben, der aber nur den Kopf senkte und seinem unfertigen Lächeln von eben die andere Hälfte hinzufügte. Ich habe meinen Namen vergessen, sagte er unbefangen und strahlend.
Mein Gott, ist der freundlich, dachte sie.
Bei der nächsten Haltestelle wartete Nina und hielt ein Schild hoch, auf dem fett die Frage stand, die auch der Titel ihrer Aktion war:
Mit wie viel Unmöglichem finde ich mich ab im Alltag?
Nina hielt das Schild höher, als die Bahn wieder anfuhr. Nina, die Freundin von früher, das Mädchen auf der anderen Seite vom Brachland, wo die gelbe Villa ihrer Eltern stand und warmes Licht aus den Fenstern Honig in die Nacht goss, während bei ihr zu laut eine Quizsendung im Fernsehen lief, die Mutter wiehernd auf dem durchgesessenen Sofa neben der Großmutter eine nächste Flasche Bier öffnete und sie selbst über der Betonbrüstung im achten Stock lehnte. Geplagt von Gefühlen der Leere …
Der Mann mit dem Jutebeutel stellte sich jetzt neben Nina. Ihre Schultern berührten sich, während er sich eine Zigarette anzündete.
Die sollen doch alle mal was Vernünftiges arbeiten, hatte da der ältere Mann gesagt und alle zehn Finger gegen ein Fenster gespreizt, während er an den beiden vorüberfuhr.
Die sollte man doch alle jagen!
Der Mann mit dem Jutebeutel hieß Johann, arbeitete am Theater, aber nicht auf der Bühne. Leider, sagte er. Die wichtigsten Dinge in seinem Leben waren für ihn trotzdem nicht die Künste, sondern Fußball, Fahrräder und Frauen. Also weihte er sie in jener Silvesternacht in eine alte Frage ein.
Warum bin ich nicht Lehrer geworden? Das ist zwar eine glanzlose, aber sichere Existenz.
Solche Zweifel kommen dir mit sechsunddreißig ein wenig spät, oder?, antwortete sie. Was machst du denn am Theater?
Ich bin Dramaturg. Er hatte etwas entschlossen Undepressives, als er das sagte.
Was genau macht so ein Dramaturg?
Mit ihrer Frage lockte sie ihn weg von der Party, zu der Nina sie beide mitgenommen hatte, lockte ihn auf die bemooste Steinterrasse, hinaus ins Kalte, Freie, wo sie allein waren zu zweit. Die anderen im Haus versammelten sich um ein Tablett mit Sektgläsern und fingen laut an zu zählen, während sie draußen sagte, küss mich, du liebst deine Freundin eh nicht mehr.
Welche Freundin?
Bist du nicht mit Nina hergekommen?
Du doch auch. Kennt ihr euch lange?
Ihr nicht?
Da küsste er sie viel zu kurz, bis dieser dumme Bewegungsmelder anging, und innen beim Panoramafenster Nina stand, die Hände in den Taschen ihrer weiten Hose, das weiße Männerhemd bis auf den obersten Knopf geschlossen. Nina, das Klappmesser, neben dem sie sich immer schon wie ein alter Radiergummi gefühlt hatte. Nina, charmant, hellwach, spöttisch und meistens arbeitslos, wenn sie nicht gerade eine Milch-Aktion wie die am Nachmittag anleierte.
Als das neue Jahrtausend noch ganz jung war, gingen Johann und sie ins Haus zurück, als wäre nichts geschehen, und tanzten zu Zehn kleine Jägermeister von den Toten Hosen mit den anderen Gästen im Kreis. Danach drückten sie sich in einer Ecke aneinander, wo sie die zugenähten Taschen seines neuen hechtgrauen Anzugs aufriss, um danach ihre Hände, ihre schamlose Freude und sich selbst darin zu vergraben.
Da war Nina bereits gegangen.
Obwohl die Straßen in jener Silvesternacht 1999 spiegelglatt gewesen waren, war sie wohl kurz entschlossen mit dem Rad heimgefahren. Johann und sie aber hatten bis morgens ins neue Jahrtausend hineingetanzt. Gegen fünf waren sie zu ihm gegangen. Er hatte sie feierlich ausgezogen: Halt still, meine Schöne. Um kurz nach sieben hatte sie auf die Leuchtziffern der Uhr neben seinem Bett geschaut, während sie nebeneinanderlagen, nackt und sie mit einem Aschenbecher auf dem Bauch, dessen kühles Metall bereits erzählte, wie die letzten Stunden sich angefühlt hatten. Johann drückte seine Zigarette aus. Lass das, sagte sie, aber es gefiel ihr.
Würde sie jemals erfahren, an wie vielen Tischen und nach wie vielen Jägermeister Nina welche Version dieser Nacht erzählte?
Oder würde Nina den Abend einfach vergessen und nur ihr Körper würde sich noch an ihn erinnern, wenn sie des Nachts auf einer spiegelglatten Straße allein mit dem Rad fuhr?
In einer der folgenden Nächte träumte sie, sie laufe durch eine Hügelgegend, in einem Wintermantel mit Seitentaschen, groß wie Satteltaschen. Ich habe hier tote Tiere drin, können Sie die mal rausnehmen?, fragte sie jeden, den sie traf. Frag Johann, antwortete ihr jeder. Immer weiter fragte sie, immer wieder kam die gleiche Antwort: Frag Johann. Schließlich stellte sie eine neue Frage: Wer ist denn Johann?
… und die Welt explodierte.
Sie heirateten nach einem Jahr.
Nein, sie heirateten nicht.
Montagmorgen. Sie stellt die Salatschleuder neben den Müllbeutel an der Eingangstür, läuft ins Bad und zieht Jeans und Bluse, die über der Heizung hängen, nicht an. Erst am nächsten Samstag wieder. Sie nimmt die Visitenkarte aus der hinteren Hosentasche und lehnt sie auf der Waschbeckenablage gegen das Zahnputzglas.
Robert Sturm, wo der Wind ihn hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen …
Geheimnisvoll lächelt der Name sie an. Dabei hat er ganz gewöhnlich eine Wohnung, Schenkendorfstraße 7, Berlin-Kreuzberg, hat Fax und Fon und ist auch mobil zu erreichen. Der Spiegel hinter dem Zahnputzglas öffnet sich wie ein Fenster zu einem zweiten Raum, in dem es alles nicht und doch noch einmal gibt. Es schneit. Das sind die Spritzer vom Zähneputzen auf dem Glas. Das sind die Flocken, die Robert Sturm nachts allein vor sich hertreiben durch Wladiwostok, Chabarowsk, Nowosibirsk, vorbei an Geschäften mit dunklen Fenstern und Räumen dahinter, die noch dunkler sind, jedoch Konturen von Menschen sichtbar werden lassen, die in einer ewigen östlichen Dämmerung ihren Beschäftigungen nachgehen oder einfach nur dasitzen, reden, rauchen und ihm, Sturm, den Weg weisen hinunter zum Amur, dem Fluss, der bei solchem Wetter kein Fluss mehr ist, sondern eine glitzernd weiße, tiefgefrorene Straße, auf der kreuz und quer Autos stehen, mit Anglern, die an der Fahrertür lehnen. Blutige kleine Köderfische zucken vor ihren Füßen am Rand von schwarzen Löchern, die sie ins Eis gebohrt haben. Ja, schwarz sind die Löcher, weiß ist der Schnee und rot ist das Blut der Fische in diesem sibirischen Wintermärchen, in dem sie neben Sturm jetzt hergeht, fort vom Amur und die Flusspromenade entlang, auf der er seinen Schirm aufspannt und über sie beide hält, bis er vor einer Bar stehen bleibt, den Schirm wieder schließt und in einer Ecke abstellt, in der zusammengerollt ein Hund schläft. Rasch zieht sie sich in der Schummrigkeit zwischen lauter russisch sprechenden Betrunkenen die Lippen nach, um dann dicht neben Sturm zu treten, der einzig ruhigen Gestalt im Raum, die sich ihr jetzt wegen zu großer, zu plötzlicher Nähe zuwendet, ein wenig spöttisch, doch auch erfreut. Mein Gott, was für herrliche Punkte sind da auf seinem Gesicht, die irgendein Gott ausgesät hat, damit er nur Freude erntet! Punkte, wie Spritzer vom Zähneputzen, aber nicht weiß, eher milchkaffeebraun. Seine Stimme klingt, als könnte er gut singen, als er sagt, mein Schirm dort, haben Sie es bemerkt? Er ist zwar schwarz, aber trotzdem ein Kinderschirm und eigentlich zu klein, um zwei Menschen zu beschützen. Egal, Musik spielt nun. Sie fangen an zu tanzen, quer durch den Raum und hinaus aus der Hintertür. Die führt auf einen dunklen Hof. Sie tanzen bis hin zu einem Überlandwagen, auf dessen Frontscheibe fette Flocken fallen. Sie wischt sie weg.
Sie fahren los.
Wohin?
Das weiß kein Mensch zu sagen.
Mit Müllbeutel und der kaputten Salatschleuder unter dem Arm, die auf dem Hof in einer Tonne für Berliner Wertmüll verschwindet, verlässt sie eine halbe Stunde später das Haus und macht sich auf den Weg zum Friseur. Es ist ihr freier Tag.
Ist das Wasser so angenehm?
Wieso?
Manchmal beschweren sich die Leute, dass die Temperatur schwankt.
Ach, die Leute, sagt sie. Sie ist die einzige Kundin beim Friseur, vielleicht weil Montag ist. Bereits auf dem Weg hierher hat sie sich auf diese Konzentriertheit gefreut, mit der er Shampoo und Spülung ins nasse Haar einmassieren und so eine angenehm anonyme Zärtlichkeit über der eineinhalb Kilogramm schweren und 37Grad warmen Biomasse unter ihrer Schädeldecke verbreiten wird. Wie oft er so schon die dunklen Vögel vertrieben hat, die in ihren Haaren Nester bauen wollten. Als er jetzt die Spezialspülung für Erdbeerblond auswäscht, wiederholt auch er: Ach, die Leute. Sie legt den Kopf weiter in den Nacken, schließt die Augen und sagt, ich glaube, kaum jemand kennt die Leute besser als Sie, wenn Sie täglich Ihr Programm Waschen/Schneiden/Reden durchziehen. Lassen Sie sie also reden, denn die reden nur so, die Leute.
Glauben Sie?
Die reden ja auch von der Gehirnforschung wie von einer neuen Religion.
Tatsache?
Dem Friseur fällt ein Kamm herunter. Er bückt sich. Als er sich mühsam, aber mit einem tapferen Lächeln wieder aufrichtet, sieht es so aus, als hätte er einen Bandscheibenvorfall.
Er greift ein feuerwehrrotes Handtuch.
So ein Turban steht Ihnen, Sie sind eine stille Schönheit, deswegen können Sie so etwas Auffälliges gut tragen, stellt er fest, während er sie zum Spiegel begleitet, wo sie Platz nimmt und er die Handtuchenden über ihrer Stirn fester ineinanderschiebt.
Kaffee? Wasser, Frau Doktor?
Beides, bitte.
Er verschwindet in seinem Kabuff hinter der Kasse, wo eine Maschine schnarrend anfängt, Filterkaffee zu produzieren, wie in ihrer Zeit damals auf der Neurochirurgie. Immer abgestanden hatte er geschmeckt, selbst wenn er frisch aufgesetzt war für die morgendlichen Besprechungen hinter der vorgezogenen Gardine, mit den Lichtspielen einer Sieben-Uhr-Morgensonne darauf. In den warmen Monaten war sie gerade über das Hausdach gegenüber geklettert. Draußen gingen die Bauarbeiten im Innenhof los, weswegen drinnen einer der müden Menschen in Weiß das gekippte Fenster schloss, um die ungarische Assistenzärztin besser zu verstehen, die mit Kaffeetasse auf dem Mülleimer hockend Rapport erstattete zu den Eingängen der letzten Nacht: Weibliches Polytrauma, Jahrgang 64, ist gegen halb eins eingeliefert worden, ist wohl aus dem 7. Stock ins Blumenbeet vorm Haus gefallen, nach einem Streit mit Freundin. Mittelschädelfraktur und Methadon-Pass. Liegt im Nachbarzimmer von unserem komplizierten älteren Herrn, der deutlich nach Urin riecht. Irgendwer hatte im Besprechungszimmer auf Station in solchen Momenten immer müde gelacht …
Milch, Zucker?, ruft der Friseur aus dem Kabuff.
Beides bitte, sagt sie, und ihr Handy auf der Spiegelablage sagt, es ist kurz vor vier.
Sie ist vierundfünfzig.
Ich glaube, du wirst im Alter noch schöner werden, meine Schöne, hatte Johann drei Monate nach jenem Silvester gesagt, an dem nicht nur das Jahr, sondern auch das Jahrtausend wechselte. Sie waren an dem Tag Ende März aus der Stadt hinausgefahren und hielten an einem Ausflugslokal, gingen aber nicht hinein. Sie waren beide sechsunddreißig. Sie saßen auf der Kühlerhaube eines alten, weißen Mercedes, rauchten und schauten immer tiefer in die Landschaft hinein. Er redete nicht. Egal, seine Gegenwart genügte ihr. Der Himmel über ihnen war von einem tiefen Blau. Wie sonst das Meer, dachte sie. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie den Wunsch, diesen Nachmittag zu beschreiben, nichts als den Nachmittag. Schon klar, sie war keine Erzählerin. Nina vielleicht, sie nicht.
Trotzdem – man konnte doch auch schreiben, ohne zu schreiben?
Sie schaute Johann an. Sein Blick war wieder so barfüßig wie vor wenigen Wochen in der Straßenbahn, kurz bevor die Milch aus dem Jutebeutel gelaufen war. In diesen langen Blick flocht sie hinein, was wie Fäden aus ihrer Erinnerung hing. Ihre Großmutter zum Beispiel, deren Herzlichkeit, als sie ihr mit 398Mark Monatslohn, verdient beim Matratzen-Nähen am Fließband, die tausend Mark am Ende der Schulzeit schenkt, sagt »mach was draus«, dann weint, sich deswegen wegdreht zum Hängeschrank in der winzigen Küche im achten Stock, um für sie beide ein Brot mit Kunsthonig zu streichen. Mit Zigarette im Mundwinkel und nur noch wenigen gefärbten Haaren auf dem Kopf. Die Großmutter gehörte mit in dieses Gefühl des Augenblicks hinein, saß auf der Kühlerhaube des weißen Mercedes dabei, unpassend zwar, aber doch willkommen.
Erinnerst du dich an den Apfelbaum damals?, fragt sie. Erkennst du ihn wieder, wenn du auf das Blech der Kühlerhaube zwischen dir und diesem Mann schaust? Ihr spiegelt euch dort, ihr zwei, und der Apfelbaum ist mit dabei, unter dem du damals ganze Tage standest, im Kinderwagen, und die Unterseite seiner Blätter angestrampelt hast. Deren hellere Bäuche. Hätte dich damals einer gefragt, du hättest zahnlos glücklich zu Protokoll gegeben, die Welt sei ein freundlicher, ein warmer Ort. Selbst beim Geradeausgucken. Erinnerst du dich? Und sag mal, hast du eigentlich bei deinem Studium am Gehirn herausbekommen, wo deine Erinnerungen sind, wenn du sie nicht hast? Oder wo eines Tages die Erinnerung an diesen Mann neben dir sein wird, der sich jetzt eine Zigarette anzündet mit einem Feuerzeug, dessen schneidendes Klack-Klack zur Tongabel dieses geglückten Nachmittags werden wird? Wo wird die Erinnerung an diesen Nachmittag sein, wenn du ihn vergessen hast? Und wo die an diesen Mann neben dir, wenn er einmal fort sein wird? Du könntest ihm jetzt, solange euer Nachmittag noch ganz Gegenwart ist, von deinem guten Abitur erzählen, von der Angst zu versagen und von dem Leberfleck in der Leiste, links, den man beobachten sollte. Ja, den sollte man beobachten, aber dich auch, sagt die Großmutter mit ihrer Stimme aus Glas.
Glück und Glas, wie leicht bricht das …
Soll ich dir mal ein Kompliment machen,? hatte Johann in dem Moment gesagt.
Ja.
Ich liebe dich, meine Schöne.
Er setzte einen Fuß auf die Stoßstange und sah wie ein Cowboy aus, auch ohne die passenden Stiefel dazu. Danach schauten sie weiter in die Landschaft, die sich im Ungefähren verlor. Was für eine Gegend, über die der Himmel zog in der langsamen Geschwindigkeit der Erde. Sie merkte, dass sie das alles hier bereits kannte, auch wenn sie vergessen hatte, woher, dass sie das alles schon mal gesehen, schon einmal erlebt und auch genau diesen Gedanken schon einmal gehabt hatte. Den Gedanken, dass sie genau diesen Gedanken schon einmal gehabt hatte und dass diese Kühlerhaube des weißen, alten Mercedes keine Erinnerung war, ebenso wenig die Erinnerung an eine frühere Erinnerung. Auch dieser Mann neben ihr war kein Déjà-vu, nein, er und die Erinnerungen waren, was sie waren. Leben.
Später, wenn sie Momente in ihrer Vergangenheit suchen würde, an die sie nur zurückdenken musste, um ihre Gegenwart zu verstehen, würde sie sich an jenen Nachmittag auf der Kühlerhaube erinnern.
Nochmals die Frage: Sie heirateten nach einem Jahr?
Nein, sie heirateten nicht.
Im Jahr darauf aber zogen sie am Rhein zusammen. Sie verließ mit einem Arbeitsvertrag auf Zeit Berlin, wo sie achtzehn Jahre lang gelebt hatte, erst mit, dann ohne Viktor.
Johann folgte aus Magdeburg, erst mit, dann ohne Auto.
Seine Büros waren von Anstellung zu Anstellung kleiner geworden. Die Theater, an denen er angestellt worden war, ebenfalls. Anfangs war er mehrere Jahre lang an einem Haus geblieben. Später wurden seine Dramaturgenverträge auf zwei oder drei Jahre befristet und nie verlängert.
Weiter, meinte er dazu, einfach weitermachen, es gibt eben Wandermenschen und Sofamenschen.
Aber entschied ein Wandermensch sich immer freiwillig dafür, so wenig sesshaft zu sein? Verdammt wurzellos, sagten Johanns Freunde, die in der Stadt geblieben waren, aus der er kam. Johann fand solche alten Freunde einfach nur alt.
Was soll ich mit Wurzeln, wenn ich sie nicht mitnehmen kann, meine Schöne?
Sein vorletztes Büro am Theater Dresden hatte unterm Dach neben dem Männerklo gelegen, und das letzte in den Kammerspielen Magdeburg musste er mit einem jüngeren Kollegen teilen.
Netter Kerl, meine Schöne, der raucht nämlich auch.
Ob er auch zu Nina Meine Schöne gesagt hatte?
Die letzte Kündigung in Magdeburg hatte Johann durch diskrete, freundliche Arbeitsverweigerung erreicht. Jetzt war er arbeitslos. Umso entschlossener warfen sie ihre Leben zusammen und zogen an den Rhein. Ob sie es dort schaffen würden, war nicht klar, aber dass sie einander auf eine aufmerksame Art mochten, schon.
Über Nina sprachen sie nie.