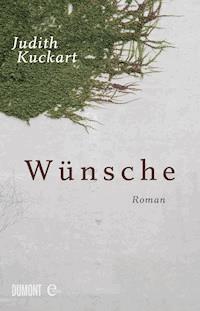19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Alles ist gewesen, nichts war genau so. »Am 17. Juni, Tag der Deutschen Einheit, wurde ich geboren. Ich blieb das einzige Kind. Am 2. Juni 1967 saß ich im Trikot des Kinderballetts vor der Tagesschau. Benno Ohnesorg war erschossen worden. Ich schlug meinem Vater während der Meldung auf's Knie: Papi, wenn ich groß bin, erschieß ich dich auch. 1977 schenkte mir meine Großmutter, Fließbandarbeiterin in einer Fabrik für Babybadewannen aus Plastik, zum Abitur 1.000 DM. 1989 stand ich in der Oper Duisburg zum letzten Mal als Tänzerin auf der Bühne. Eine wichtige und schüchterne Verlegerin saß im Publikum und meinte: Sie könnten auch mal einen Roman schreiben, Judith. Am 17. Juni 2024 steht der Titel für meinen neuen Roman fest. Und ich weiß, ab jetzt habe ich noch zwanzig grandiose Sommer vor mir - oder?« Mit einer sprachlichen Dichte, die berührt, erzählt Judith Kuckart entlang ihrer Biografie und beleuchtet damit eine ganze, ihre Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Ähnliche
Ich wuchs in einem rosa Haus neben einer Waschmaschinenfabrik auf. Meine Mutter legte mich im Hof unter einen Apfelbaum. Ich blieb das einzige Kind. 1977, als Baader, Ensslin und Raspe in Stammheim gerade noch lebten, schenkte mir meine Großmutter, Fließbandarbeiterin in einer Fabrik für Babybadewannen aus Plastik, zum Abitur 1.000 DM: Mach was draus, sagte sie und stellte ein Glas mit Kunsthonig auf das Sparbuch. 1989 stand ich zum letzten Mal als Tänzerin auf der Bühne. Die Musik zu einem »Ballett« über Frauen, die aus politischen Gründen morden, kam von den Einstürzenden Neubauten. Choreografie und Texte waren von mir. So ist dann alles gekommen. Eine wichtige und schüchterne Verlegerin saß im Publikum. Seit 1990 sind meine Schuhe flacher geworden, Hausflure riechen nicht mehr nach Bohnerwachs, und ich will auch aus politischen Gründen niemanden mehr erschießen, aber habe seit dem Treffen mit der schüchternen Verlegerin elf Romane geschrieben, weil ich Geld verdienen muss und weil ich sterben muss …
Judith Kuckart erzählt von Momenten ihrer Biografie, in denen Erinnern und Erfinden eins werden, nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind, und sich die Frage stellt:
Wie würden andere diese Geschichten erzählen, die Teil einer größeren sind.
© Martin Rottenkolber
Judith Kuckart wurde 1959 in Schwelm (Westfalen) geboren und lebt als Schriftstellerin und Regisseurin in Berlin. Sie veröffentlichte bei DuMont den Roman ›Lenas Liebe‹ (2002), der 2012 verfilmt wurde. Ihr Roman ›Kaiserstraße‹ stand 2006 auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse, ihr Roman ›Wünsche‹ 2013 auf der Longlistdes Deutschen Buchpreises. Zuletzt erschienen ›Kein Sturm, nur Wetter‹ (2019) und ›Café der Unsichtbarem‹ (2022). Judith Kuckart wurde mit zahlreichen Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet.
Judith Kuckart
Die Welt zwischen den Nachrichten
Roman
Von Judith Kuckart sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Bibliothekar Lenas Liebe Die Autorenwitwe Dorfschönheit Kaiserstraße Die Verdächtige WünscheDass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück Kein Sturm, nur Wetter Café der Unsichtbaren
E-Book 2024 © 2024 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildungen: siehe Fotonachweise Satz: Angelika Kudella, Köln E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck ISBN E-Book 978-3-7558-1058-2
www.dumont-buchverlag.de
Dackel
Auf der Papierbespannung eines Biertischs versuchte sie einmal ein Pferd zu zeichnen.
Ein Etwas mit vier kurzen Beinen kam dabei heraus. Ein Dackel? Für mich? Danke!
Liz schob den Bleistift hinter das Ohr:
Versuchen kann man’s ja mal …
Das Blut strömte ihr durch den Leib wie Wärme wie Freude.
Sie lachte.
Sie hätte Tänzerin werden können aber sicher nicht Malerin.
Man begegnet sich immer zweimal
Als sie nach S. kommt, hat Ellen den Zweiten Weltkrieg, die Flucht aus Polen und einen Zwischenaufenthalt auf einem Gutshof bei Riesa hinter sich. Dort, nahe Dresden, hat sie als Stenotypistin bei der SED-Kreisverwaltung gearbeitet. Als der Gutshof zwangskollektiviert wird, zieht die Familie, die einmal mit sieben Kindern nach Deutschland kam, westwärts und pachtet einen neuen Hof. Er liegt am Rand von S., am Rand des Ruhrgebiets.
S. ist klein. Auf der Straße begegnet man sich immer zweimal am Tag.
Ellen flirtet gern, sie flirtet viel. Sie ist anmutig, dunkelhaarig, sie hätte auch Tänzerin werden können. Sie heiratet, wird geschieden und lernt bald ihren zweiten Mann, einen deutschen Feldwebel, kennen. 1958 bekommt sie ein Kind. Als der Sohn drei ist, wird der Feldwebel in die Staaten abkommandiert. Sie ziehen zu dritt in die Military Road in Arlington/Virginia.
Schräg gegenüber liegt Washington.
Nur ein fröhlicher Fluss trennt sie von da drüben, wo John F. Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, im Weißen Haus wohnt. Ellen und ihre Familie leben ebenfalls in einem weißen Haus, in einem kleineren aber, mit einem altersschwachen Schaukelstuhl auf der Holzveranda. Auch im Winter steht er im Freien.
Früher hatten wir Hühner, sagt Ellen oft und lacht.
Fotomodell sei sie von Beruf, gibt sie auf Nachfrage in dem neuen Land an. Als Hostess lernt sie im Club in Capitol Hill den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten kennen. Ihre Affäre beginnt im Frühsommer 1963. Sie ist sechsundzwanzig, er sechsundvierzig. Das FBI rechnet Ellen einem organisierten Ring von deutschen Playgirls zu, die sich durch Partys, Orgien und Prostitution hervortun. Sie wird der Spionage verdächtigt und zum Sicherheitsrisiko erklärt. Kennedy ist mit Vietnam beschäftigt. Der Krieg wird noch Jahre dauern. Ellen wird des Landes verwiesen, kehrt mit Mann und Kind nach Deutschland zurück, wird als Alleinschuldige geschieden und zieht wieder zu ihren Eltern auf den Bauernhof am Rand von S.
Ellen R. melkt die Kühe, füttert die Schweine, geht in die Rüben, erzieht den Sohn und legt sich früh schlafen. Mit einem kleinen Lieferwagen verteilt sie freitags auf Bestellung Eier, Gemüse, Wurst und manchmal auch ein halbes Schwein unten in der Stadt. Manchmal fährt der Sohn mit.
Noch geht er nicht zur Schule.
Ich auch nicht.
Er spricht Englisch.
Ich nicht.
Manchmal kommt er an der Hand der Mutter in unser Wohnzimmer. Wir leben in der Parterrewohnung eines rosa Altbaus, der einmal zur leer stehenden Fabrik nebenan gehörte. Jetzt ist die ehemalige Villa des Fabrikanten nur noch ein heruntergekommenes Haus mehr in S. Unsere Wohnung ist groß, aber dunkel, kaum beheizbar, und die Miete ist niedrig. Meine Mutter bietet der Frau, die Eier und Blutwurst im Glas bringt, jeden Freitag eine Tasse Filterkaffee an.
Ellen R. sieht meiner Mutter ähnlich, sieht aus wie nicht von hier.
Der Flur zwischen meinem und dem letzten Zimmer unserer Parterrewohnung ist fünfzehn Meter lang. Nur im Wohnzimmer gibt es einen Ofen. Hier ist es warm, an diesem Novembertag des Jahres 1963. In den übrigen Räumen ahnt man nur, dass es irgendwo einen Ofen geben muss. Auch mein Zimmer, in dem früher Mülltonnen standen, ist kalt. Es ist acht Uhr abends, und ich bin sechs, als ich am Ende des langen Flurs meine Mutter schreien höre. Als ich fünfzehn Meter später die Wohnzimmertür aufreiße, versucht im Fernsehen eine dunkelhaarige Frau mit rosa Hütchen, über das Heck einer mit offenem Verdeck fahrenden Limousine ihrem großen Unglück zu entkommen.
Auch sie schreit.
Auch diese Frau, da drüben in Amerika, sieht meiner Mutter ähnlich. Wie Ellen R. – auch eine Schöne.
Spät am Abend kommt meine Mutter in mein Zimmer.
Am anderen Ende des Flurs.
Ihre Haare riechen frisch gewaschen.
Sie nimmt mich in den Arm.
Nicht so feste, Mama, sage ich.
Als Kennedy der erste Schuss in den Hals und der zweite in den Kopf traf, blieb er aufrecht sitzen. Er trug wegen Rückenproblemen ein Korsett. Drei Tage nach dem Attentat ist er nach der Totenmesse auf dem Nationalfriedhof Arlington, Virginia, bestattet worden, dort, wo nur ein fröhlicher Fluss das Weiße Haus von anderen, kleineren weißen Häusern trennt, auf deren Holzveranden auch im Winter altersschwache Schaukelstühle stehen.
Ist das so?
Ist das geklaut, erfunden, geträumt oder einmal erzählt worden? Am Tag der Beerdigung ihres Mannes trug Jackie Kennedy ein schwarzes Hütchen, ein schwarzes Kostüm und einen dünnen Schleier über dem Gesicht. Links hatte sie die Tochter an der Hand und rechts den Sohn. Draußen vor dem Kapitol waren die Bäume kahl, und hier und da rutschte ein wenig Schnee von Mauervorsprüngen. Ein Männerchor sang aus dem Innern auf Lateinisch, während sich internationale Trauergäste die Stufen zum Eingangsportal hinaufschoben. Ein Sicherheitsbeamter kaute Kaugummi. Ob an jenem Tag von den zwei dunklen, geduckten Kirchtürmen in S., denen der letzte Krieg die Helme vom Kopf gerissen hatte, auch Schnee rutschte?
Ob es auf dem Gutshof neben Kühen, Schweinen und Rüben einen Fernseher gab, im November 1963?
Ob an dem Tag die unsichtbare Wand zwischen Ellen und den Eltern noch höher wurde, genau dort, wo sie schon stand?
Ob Ellen wie immer früh zu Bett gegangen ist?
Ob ihr Sohn bei ihr geschlafen hat?
Ob die beiden im Dunkeln Englisch miteinander gesprochen haben?
Ob Ellen gesungen hat, gegen die Angst?
Oder geweint?
Finanzamt von S.
Das Finanzamt von S.
liegt schräg gegenüber dem Bahnhof
wo die schnellen Züge durchfahren.
Bei der Ankunft fällt es hässlich ins Auge und bei der Abreise noch einmal falls man sich umdreht.
Bin ich beim Yoga
mit dem Herz nah am Oberschenkel im herabschauenden Hund
taucht immer das Finanzamt von S. vor meinem inneren Auge auf. Das möchte ich in deinem nächsten Buch lesen hat neulich eine Freundin gesagt: Das Finanzamt von S. – immer? Das kann nur dir passieren!
Apfelbaum
Als ich geboren werde, ist der Juni so heiß, dass die Menschen die Schattenlinien der Häuser nicht zu verlassen wagen, als sei da, wo Sonne ist, ein Todesstreifen, auf dem Igel, Frösche und Vögel zermatscht, streunende Hunde zerquetscht und Rehe, Landstreicher und Radfahrer platt gefahren werden. Ich komme in der Nacht des Bloomsday zur Welt, aber das weiß ich lange nicht. In jener Nacht auf den 17. Juni liegt meine Mutter Liz im katholischen Krankenhaus in den letzten Wehen, während im Kolpinghaus gegenüber mein Vater Leo mit seinen Genossen aus der katholischen Arbeiterschaft zu Fats Domino und Little Richard versucht, eine Gemüseverkäuferin von Otto Mess über die Schulter zu werfen. Wenige Tage später geht er zum Standesamt von S. und meine Mutter mit mir auf dem Arm nach Hause. Liz redet nicht viel. Sie singt lieber, manchmal betörend schön.
Sie hat kein Bedürfnis nach Veränderung und lackiert ihre Fingernägel Perlmutt. Ich werde nie wieder arbeiten, sagt sie oft und ungefragt, wofür habe ich denn geheiratet. Für die Tochter hat sie andere Pläne. Die soll einmal unverheiratet bleiben, Lehrerin werden und mit einem zwölfteiligen Service namens Zwiebelmuster im Schrank und Müllschlucker in der Wand vom eigenen Einkommen leben. Auf dem Weg vom katholischen Krankenhaus nach Hause trägt Liz das Baby und ihre Schwester die alte Reisetasche. Noch immer ist es heiß, so heiß, dass sie nicht miteinander sprechen. Sie sprechen ohnehin nicht viel miteinander.
Im Hof legen sie mich unter einen Apfelbaum.
Ich bleibe das einzige Kind.
Wie nennen Sie Ihre Tochter?
Judith, sagte mein Vater. Auf den Stufen des Standesamts hatte ihn ein älterer Mann eingeholt. Auch er war gerade Vater geworden. Und wie nennen Sie Ihre?
Martina. Sind Sie sicher, dass Ihre Judith heißen soll?
Wieso nicht?
Ach, man weiß ja nie, in welche Situation man noch kommt. Wieso?
Ist ein jüdischer Name.
Judith?
Ja.
Ach, jetzt, wo Sie es sagen, sagte mein Vater.
Leo war die schmallippige Kopie von Anthony Perkins. Der andere Mann war einfach nur alt, sodass er über sein Aussehen nicht weiter nachdenken musste.
Über dem Eingang des Standesamts wehte die Deutschlandfahne, als der Jüngere dem Älteren die Tür aufhielt, und der Ältere sagte: Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie nennen Ihre Tochter Judith Martina und ich die meine Martina Judith. Ich weiß nicht, ob mein Vater sich sogleich oder erst später daran erinnerte, dass der Mann neben ihm nicht nur fünfundzwanzig Jahre älter war, sondern auch zehn nicht in S. gewohnt hatte, wo seiner Familie ein schönes Kaufhaus am Markt gehört hatte, dann nicht mehr und dann doch wieder. Ich weiß nicht, was in den Organismen so unterschiedlicher Männer vorgegangen sein muss, dass sie am Ende aus einer unbewussten Bewusstheit heraus ihre Töchter überkreuz nannten. Judith Martina – ich – und Martina Judith – das Mädchen, das für lange Zeit meine beste Freundin werden sollte. Der eine Vater jung und unsicher, ob eigentlich Blasmusik schöner ist als Jazz, und der andere, fast alt und wahrscheinlich fast weise. Ich stelle mir vor, wie die zwei Männer einen Moment auf den Stufen zum Standesamt innehalten und gleichzeitig den Kopf in den Nacken legen. Wie sie dabei beide die Deutschlandfahne übersehen, aber in der Ferne die zwei Kirchentürme von S. betrachten, genau die, denen der Krieg im März 45 die Helme vom Kopf geschossen hat, und wie sie dabei eine große Ruhe spüren, so mit erhobenem Kinn eine dem Himmel nahe Sache zu beschauen, die nur von dessen Farben umgeben ist.
Nach mir ist meine Mutter noch dreimal schwanger, immer im Sommer, und immer sind die Kinder tot. Das letzte wird auf Verlangen der Großmütter notgetauft, obwohl es nicht mehr atmet. Der Junge wird im Grab seines Großvaters beigesetzt. In einem Schuhkarton, behauptet irgendwer später. Liz leidet während der Schwangerschaften nachts an Schlaflosigkeit und morgens an Übelkeit. Der Arzt empfiehlt ein rezeptfreies Beruhigungs- und Schlafmittel, das keine Nebenwirkungen haben soll. Contergan. Auf der Wöchnerinnenstation des katholischen Krankenhauses hat nach jeder Totgeburt das kleine Gesicht von Liz noch kleiner, noch weißer in der Kuhle des Kopfkissens gelegen. Ich füttere sie löffelweise mit Dosenmilch. Bärenmarke steht auf dem Etikett. Sie soll wieder bärenstark werden.
Dass das Gefühl der Trauer so sehr dem der Angst gleicht, habe ich damals noch nicht sagen können.
Kantine eins
Das Bahnticket nach Berlin kauft Eva K. im Reisebüro.
Die Anzeige hatte sie spät erst im Netz gefunden, schrieb aber trotzdem eine E-Mail an die Statisterie Staatsoper Unter den Linden. Die Antwort kam prompt: Sehr geehrte Frau K., vielen Dank für Ihre Bewerbung. Treffpunkt ist am kommenden Dienstag, 28.2. ab 16:15 Uhr in der Kantine. Wir laden Sie herzlich ein. Klappt das bei Ihnen?
Die Komische Oper wäre ihr lieber gewesen.
Als Großmutter Elisabeth, meine Mutter Liz und mein Vater Leo mit seinem blinden Glauben an den Selbstmord der Rosa Luxemburg und die Jungfrauengeburt der Maria von Nazareth in den rosa Altbau zogen, stand Eva K. dort im ersten Stock am Fenster, hinter dem es einen Flügel, ein Dienstmädchen und ihre Eltern gab. Den zweiten Stock unter dem Dach teilten sich drei Familien mit jeweils zwei Kindern. Jede hatte 1 ½ Zimmer. Im Winter lag Schnee auf den Dachluken und machte die verrauchten Zimmer still. Unter den Fenstern standen die Klappsofas, auf denen die Kinder schliefen. Wütende, verschüchterte, blasse Blagen, fand meine Mutter Liz. Die Jungen hatten rote Fähnchen an ihren Fahrrädern. Kommunisten, sagte mein Vater Leo, kaum dass er mit seiner Familie in die düstere Wohnung gezogen war. Nebenan stand eine Fabrik für Waschmaschinen und Metallverarbeitung, die in wenigen Jahren pleitegehen sollte.
Im Hof hinter dem rosa Haus wuchs der Apfelbaum.
Bei der Technischen Universität nicht weit vom Bahnhof Zoo steigt Eva K. an dem Februardienstag, zu dem man sie in die Opernkantine eingeladen hat, noch einmal aus dem Bus, um ein Stück zu Fuß durch den Tiergarten zu laufen. Unter dem Mantel trägt sie eine fusselige Strickjacke. Du solltest Tänzerin werden, sagt Eva K. einmal, als ich im Hof einen Handstand gegen die warme Hauswand mache.
Einen sehr langsamen Handstand, der Zirkus, Zirkus rief.
Da war ich fünf. An dem Tag trug sie zum ersten Mal diese fusselige blaue Strickjacke wie in all den Jahrzehnten danach auch. Inspizientinnen-Jacke habe ich diese Strickjacke genannt. Eva K. war regelmäßig bis zu ihrer Pensionierung als Lehrerin für Englisch und Französisch mit ihren Mädchenklassen ins Theater oder die Oper der nächstgrößeren Stadt gefahren. Nach Wuppertal. Als ich alt genug war, blieb fast immer eine Karte übrig. Für mich. Eva K. wäre gern beim Theater gelandet. Meine Eltern kannten Theater gar nicht, wenigstens nicht von innen. Für meinen ersten Ausflug ins Weihnachtsmärchen hielt meine Mutter ein speckiges schwarzes, samtiges Ding über den Dampf des Küchenkessels. Mein Tanzstundentäschchen, sagte sie. Als ich dort ein Taschentuch, einen Fünfmarkschein und ein Hustenbonbon unterbringen wollte, fand ich im Seitenfach alten Traubenzucker und einen Rosenkranz.
Seit Jahrzehnten kennt Eva K. die Rückseite der TU und das Wohnheim dazu. Nicht mehr wie früher hängen Plastikbeutel an den Fensterbrettern, um Essensvorräte kühl zu halten. Die Fassadengestaltung ist bunter, aber nicht fröhlicher geworden. Sie legt den Kopf in den Nacken. Die Bäume, die ihre Zweige und Äste dunkel wie Tuschezeichnungen gegen den hellen Himmel recken, sind auch dicker geworden. Willkommen im Club, denkt sie und fasst sich mit beiden Händen in die Taille. Gleich wird sie Richtung Landwehrkanal gehen. Eine neue Verwaltung hat Sitzbänke über dem ganzen Gelände ausgewürfelt. Ihr Rot wärmt schon beim Hinschauen den Hintern.
Auf einer liegen zwei Äpfel und ein wenig Schnee, schreibe ich.
Eva K. ist in den Weg am Landwehrkanal eingebogen, der um diese Jahreszeit einem leeren Strand aus festgebackenem Sand ähnelt. Hier steht irgendwo das Denkmal für Rosa Luxemburg. Wer, fragt Eva K. sich, hatte noch mal behauptet, dass Luxemburg sich aus Verzweiflung über die Irrtümer der Kommunistischen Partei umgebracht hat? Franz Josef Strauß?
Der Nachbar unten im Haus? Leise wiederholt sie die Wörter Nachbar und Strauß, während der Zoo am anderen Ufer des Landwehrkanals bis zu ihr herüber nach Zoo riecht. In einem Gehege erkennt sie sieben Wölfe und hört den Rhythmus ihres Rudellaufs – ein synchrones Tapp-Tapp, Tapp-Tapp der Pfoten auf gefrorenem Laub, schreibe ich.
Und welches Wetter nimmst du eigentlich, wenn es ein Draußen in einer Szene braucht?, wird Eva mich später an diesem Februarnachmittag fragen.
Aber noch ist es nicht so weit.
Am Ende des Wegs, wo der Tiergarten an eine befahrene Straße stößt, steigt Eva K. in einen nächsten Bus. An meinem Tisch daheim mit Blick auf einen Hinterhof, wo ich keinen Handstand mehr gegen die Hauswand mache, speichere ich die letzten Sätze auf dem Computer, während Eva K. bei der Haltestelle Staatsoper Unter den Linden bereits wieder aus dem Bus steigt und sich rasch mit einem Kamm durch die Haare fährt, bevor sie Richtung Kantineneingang geht – sie, eine Dame im Alter von siebzig bis neunzig mit einer Körpergröße über 1,75 cm, genau so eine, wie sie laut Anzeige für die Komparserie im Ring gesucht wird. Wofür man bei Wagner wohl so was braucht? Singen kann sie jedenfalls nicht. Noch mal: Wofür braucht man in Wagners Ring große, alte Frauen?
Für eine Traumsequenz?
Für eine Schlachtszene, um das Ende der zivilisierten Welt darzustellen?
Für eine Pantomime?
Ich, an meinem Computer, schaue im Netz nach dem Programm der Staatsoper, während Eva K. bereits durch den Bühneneingang geht.
Carmen wird für heute angekündigt. Morgen spielen sie passend zum Wetter Im Nebel ein Licht – ein Janáček-Strauss-Abend.
In die Staatsoper gehe ich eigentlich nie.
Die Karten sind zum Schreien teuer.
Geschenkt, sage ich mir und suche meine Mütze.
Traum von Rudi
Die Manteltaschen sind groß und aufgesetzt.
Ein Tier springt in die linke beißt sich am Innenfutter fest und heißt Rudi weiß ich
als ich die zornigen Falten im Stoff sehe.
Ich gehe in eine Reinigung
schiebe Mantel und Rudi über den Tresen.
Lass doch das Tier in Ruhe sagt über Jahrzehnte hinweg meine Mutter.
Rudi
benannt nach Rudi Dutschke kreischt aus der Tasche.
Vierundzwanzig Stunden steht auf dem Abholzettel.
Es sind nicht alle Flecken rausgegangen.
Apothekertochter
Terroristin, sagen die Leute in S.
Keine Hübsche, meint Leo.
Ich finde Ina schön –
Ina ist die Tochter des Apothekers und dreizehn Jahre älter als ich. Sie will Schauspielerin werden. An Sonntagnachmittagen werde ich ihr anvertraut. Leo hat als Mann den Schulterwurf beim Rock ’n’ Roll und Liz und Leo haben als Paar das Kinderkriegen aufgegeben. Gegen ihre Menstruationsbeschwerden nimmt Liz nun die Pille, aber redet nicht darüber – auch mit Leo nicht. Sie reden ohnehin nicht mehr viel miteinander, aber gehen sonntags zusammen im Kolpinghaus tanzen. An den Nachmittagen nimmt Ina mich mit in die Roten Berge, Halden eines stillgelegten Eisenbergwerks am Rand von S., wo sie sich mit Jungen trifft, die dort in Baracken zwischen Müllhalde und Fußballplatz leben. Nissenhütten, sagen die Leute in S. Einer der Jungen trägt einen dunklen breitkrempigen Hut und schmutzige Stiefel.
Alle sind sie so fremd, so schön. Sie sind so anders.
Zigeuner, sagen die Leute in S.
Kann man sesshaft werden in der Sehnsucht?
Ina und die Jungen, sie raufen und sie küssen sich. Wenn Ina und ich später durch Müll, hohes Gras und Brennnesseln wieder nach Hause gehen, hat die Apothekertochter Heiserkeit und Übermut in der Stimme. Da haben wir uns ja ein widerliches Biest großgezogen, schreit Inas Vater, der Apotheker, an ihrem sechzehnten Geburtstag. Sie schreibt es auf. Jede seiner Beschimpfungen hält sie in ihrem Tagebuch fest. Die Schrift rast außer Rand und Band und schräg über das Papier. Kaum dass der Kuli ihr folgen kann: Das, schreibt sie, sagte er zu Mutti, genau das, was er schon immer auf der Zunge hatte, na ja, nun hat er es wenigstens gesagt. Ich bin keine Tochter, sondern eine alte Hexe! Ich geh dann mal zur Theaterprobe. Nächsten Samstag haben wir Premiere. Ich spiel die Braut, das ist die Hauptrolle.
Der Eintrag vom 12.6.1960 ist der letzte im Tagebuch, auf dessen abwaschbarem Einband fein gestrichelte Frauen tanzen wie Feuerwerksfunkenmariechen.
Sind das Blumen oder Frauen?
Nach dem Abitur heiratet die Apothekertochter den Sohn vom Uhrmacher und bekommt einen Sohn vom Briefträger.
Der Briefträger hat Zauber, der Uhrmachersohn die Sprache.
Sie geht mit dem Sohn des Uhrmachers und dem Kind vom Briefträger nach Berlin und politisiert sich im April 68, als ein Attentäter auf Rudi Dutschke schießt. Am 11. April taufe ich meinen Wellensittich Muck auf einen neuen Namen. Ab heute sollst du Rudi heißen, sage ich und schütte feierlich ein Milchkännchen voll Wasser durch die Gitterstäbe. Lass doch das Tier in Ruhe, kreischt meine Mutter. Rudi schüttelt die Federn aus. Da ist Ina bereits mit dem nächsten Mann zusammen. Er hat rote Haare, Ähnlichkeit mit einem Clown und zieht mit ihr in die Kommune I. Den Sohn vom Briefträger, der wie eine Tochter aussieht, holen die Großeltern nach S. zurück und schneiden ihm bereits im Zug die langen Haare ab. Er soll ja keine Hexe, kein Biest wie seine Mutter werden. Fritz ist sieben Jahre jünger als ich. Mit Nachnamen heißt er wie seine Großeltern. Niemand weiß, dass er der Sohn von Ina Siepmann ist. Auch ich weiß es lange nicht, habe auch ich Ina vergessen? Wo sind meine Erinnerungen, wenn ich sie nicht habe? Als Fritz auf das einzige Gymnasium der Stadt kommt, auf dem Ina einmal war und ich noch bin, tragen fast alle Parka und das Haar lang. In den großen Pausen rauchen die Biester und Hexen in einer Ecke neben dem Klo, während Fritz Jahr für Jahr Klassenbester ist.
Ina und ihr rothaariger Freund sind aus der Kommune I rausgeflogen und haben sich dem Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen angeschlossen. Später werden sie in einem Ausbildungscamp der palästinensischen Al Fatah gesehen, wo sie alles lernen, was man für das Leben im Untergrund braucht.
Wirklich alles?
Und was müssen sie verlernen?
Ob Ina ihre Herkunft als peinlich empfindet und sich deswegen im Untergrund versteckt?
Ob sie beim Basteln von Molotowcocktails geschickt war, geschickter als Ulrike Meinhof?
Ob sie nicht doch und immer noch lieber Schauspielerin geworden wäre?
Ob alles anfangs ein Spiel für sie war, mit den Männern dort, alle so fremd, so schön, so anders?
Ob sie sich mit ihrer hellen Haut oft einen Sonnenbrand geholt und sich noch öfter verliebt hat?
Ob sie so, unter Fremden, mutiger und nie einsam war?
Ob sie manchmal geweint hat? Aus Trauer? Aus Angst?
Ob die Apothekertochter wusste, dass die Tränen der Angst eine andere Rezeptur haben als die der Trauer?
Ina kommt nach Deutschland zurück. Es folgen ihre Banküberfälle im weißen Hosenanzug zwecks Geldbeschaffung. 1974 wird sie festgenommen und zu dreizehn Jahren Haft verurteilt, um 1975 gegen einen entführten CDU-Politiker von der Bundesregierung mit vier anderen aus der Bewegung 2. Juni ausgetauscht zu werden. In Begleitung eines Pastors wird sie in den Südjemen ausgeflogen. Ina aus S. und der Mann der Kirche verstehen sich gut. Bei der Abreise trägt sie eine lila Samthose und eine bestickte Afghanenjacke. In der Flugzeugtür, sehe ich im Fernsehen, dreht sie sich noch einmal um. Sie winkt. Ich winke zurück. Was machst du denn da, fragt meine Mutter, das ist doch nur die Tagesschau.
Im Sommer nach meinem Abitur arbeite ich nicht bei der Post, sondern in einer Lokalredaktion der Nachbarstadt. Von Sonntag bis Freitag fahre ich morgens um sieben mit dem Bus über einen Berg, dann durch einen kleinen Wald. Dahinter kommt ein Tal, das weder tief noch breit ist. Wo Ina ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie nicht im Fernsehen.
Im Bus lese ich regelmäßig die Zeitung von gestern. In der ersten Praktikumswoche reißt mir das Riemchen an meiner Sandale. Ich rutsche eine halbe Stunde mit nur einem Schuh auf dem Hocker bei Mister Minit herum. Das soll ein Schnellschuster sein? Er ist jung und sehr langsam. Neben mir auf dem Hocker sitzt der Bürgermeister des Orts in weißen Socken und starrt auf meinen nackten Fuß. Aus Ohren und Nase wachsen ihm Haare. Am gleichen Abend fange ich eine Freundschaft mit dem langsamen Schnellschuster an. Freundschaft plus, würde man heute sagen. Er heißt Hans, hat einen Ohrring und eine anhängliche Katze im Radkörbchen.
Jener Sommer ist lang wie ein letzter Kindersommer. An einem der wenigen Regentage interviewe ich für die Kulturseite Pierre
Brice. Er gibt den Winnetou auf einer Freilichtbühne im Sauerland. Ich frage ihn nicht, wie es als Soldat im Algerien- und Indochinakrieg war, frage ihn nicht, ob er nicht lieber in Paris Theater spielen würde, als auf Sägespänen im Sauerland den Häuptling der Herzen zu mimen. Ich frage ihn in meinem Schulfranzösisch, und seine Antworten kann ich schon am Abend nicht mehr richtig wiedergeben. Was ich nicht verstanden habe, erfinde ich. Die Fotos zum Interview sind bei einem meiner vielen Umzüge verloren gegangen. Auf den Abzügen hatten der Häuptling der Apachen und ich ähnlich lange schwarze Haare. Seine waren eine Perücke.
Auch Ina hat Perücken getragen. So getarnt hat sie bei ihren Banküberfällen mehrere Millionen D-Mark erbeutet, die sich die PFLP, die RAF und der 2. Juni geteilt haben sollen.
Sagt man.
So ist sie eine der meistgesuchten Terroristinnen der Bundesrepublik Deutschland geworden und auf den Fahndungsplakaten aufgetaucht, die überall hingen. Auch in der Sparkasse von S. Der Briefträger, der einen Sommer lang in S. die große Liebe seiner Aushilfsbriefträgerin Ina war, ist mittlerweile in den Innendienst versetzt. An einer Säule gegenüber seinem Postschalter 3 hängt ebenfalls ein Plakat. Ina, dritte Reihe von oben, dritte von links. Besonderes Merkmal: ein Leberfleck auf der Oberlippe. Was sonst an ihr besonders ist, sieht man auf dem Foto nicht, sieht nicht, dass sie einmal Gedichte auswendig lernte, die ihr größer zu sein schienen als sie selbst. Vor dem Spiegel sagte sie ihre Verse auf und stellte sich dabei auf die Zehenspitzen.
Ob Inas Briefträger noch heute im Telefonbuch von S. steht?
Vom 20. bis 23. März 1959, lese ich in ihrem Tagebuch, hat sie mit der Klasse eine Fahrt ins Sauerland gemacht. Nachts, in der Jugendherberge, fotografiert ein Junge alle Mädchen im Pyjama, danach schläft Ina nur vier Stunden. Tagsüber aber wandert sie sieben. Ziel ist die Burg Altena. Auf der Wanderung fangen alle mit allen was an. Aber ich, so tippe ich aus ihrem Tagebuch ab, habe natürlich keinen abgekriegt. Wenn ich wenigstens hübsch wäre, aber das bin ich 1. nicht, 2. habe ich keinen Charme, und 3. habe ich keine Formen …
Ob wenige Sommer später der verliebte Briefträger das anders sah? Ob noch später er ihr wohl von Schalter 3 aus zugenickt hat, wenn er seinen Dienst begann oder beendete?
Ob sie von der Säule gegenüber, so ganz aus der Ferne, zurücknickte?
Ob sie noch immer ihren Humor hatte?
Woher ich ihr Tagebuch habe?
– geschenkt, sagt das Tagebuch.
Im September 1982 soll sie als Mitglied einer palästinensischen Frauenbrigade im Libanon beim Massaker von Sabri und Schatila ums Leben gekommen sein.
Im Libanon ums Leben gekommen – warum bin ich mir eines Tages Ende der Achtziger, auf einem engen Balkon neben einem Mann namens Methusalem sitzend, plötzlich so sicher, dass ich eine Geschichte schreiben werde, die genau mit diesen fünf Wörtern beginnt: Im Libanon ums Leben gekommen.
Ich könnte Methusalem fragen. Er könnte ihr sogar begegnet sein, denn er ist so alt wie sie, kannte sich einmal mit Che, Schah Shit und überhaupt allem Revolutionären aus und weiß bis heute, was richtig links und was richtig falsch ist.
Aber ich lasse es.
Kurz bevor Ina offiziell als tot gemeldet wird, taucht sie mit einem kleinen Mädchen, das sie ihres nennt, bei der Deutschen Botschaft in Beirut auf, um eine Ausreisemöglichkeit in die Heimat zu erbitten – im Austausch für Insiderwissen über die RAF. Der unerwartete Besuch ist der Dame am Empfang unheimlich. Hat diese Frau nicht Blut in der Stimme? Die Dame verschwindet. Während die Diplomatie hinter geschlossener Tür noch zögert, soll auch Ina so schnell verschwunden sein, wie sie kam – ohne Spuren zu hinterlassen.
Es wird still um sie.
Die stille Frau, stelle ich mir vor, ist die letzte Mieterin in einem luxussanierten Haus in Frankfurt/Oder, Senftenberg oder Schwedt. Ihre Haare sind kurz und grau, den Namen hat sie geändert und den Leberfleck auf der Oberlippe wegmachen lassen, vor langer Zeit schon. Zwei Jahre lang hat sie auf Kosten eines Investors in einem Hotel verbracht. Jetzt kommt sie in die Wohnung zurück und geht auf die achtzig zu. Ihr Klavier kaputt. Die Finger wollen ohnehin nicht mehr gehorchen. Das Haus eingerüstet. Vor den Fenstern Folien. Ihr Leben sei futschikato, teilt sie aus dem Halbdunkel ihrer völlig unaufgeräumten Wohnung einer alten Genossin am Telefon mit, legt dann auf und tigert am Stock durch drei Zimmer, durch die kommende Nacht, durch schlechte Träume. Der Dunkelheit den Abgrund nehmen und dafür eine Tiefe geben – wie macht man das? Früher einmal löste die Knarre die Starre. Doch jetzt? Die stille Frau stolpert über ein Bild, das seit Jahren gegen die Fußleiste neben dem Bett lehnt. Straße in Ostende, sagt die Signatur. Hier wohnt niemand, sagen die Fenster der Häuser dort. In ihren Rahmen hängen Laken aus öliger Finsternis. Irgendwo in diesem Bild von Ostende läuft die Straße auf zwei Kirchtürme zu, beide mit Ziffernblatt, doch ohne Zeiger, ohne Zahlen, ohne Zeit.
Ein Auto steht am Straßenrand mit unwirklich weißem Nummernschild. Verfassungsschutz? Welche Verfassung soll denn hier noch geschützt werden?
Die von dem Mann oder Zivilen knapp vor dem Auto, bevor er nach rechts abbiegt?
Die von dem Mädchen, grau wie die Hauswand neben ihr, auf die sie keinen Schatten wirft?
Ist das ein Mädchen?
Eine Oblate?
Eine alte Frau? Etwa sie – ganz still?
1990 steht sie noch einmal auf der Liste derer, die aus der westdeutschen Terrorszene in der DDR untergetaucht sind. 1990 schreibe ich meinen ersten Roman. Er ist eine 173 Seiten lange Suchanzeige: Ina, bitte finde mich, ich bin jetzt schon über dreißig.
Im März 1998 taucht ihr Name in der Selbstauflösungserklärung der RAF auf.