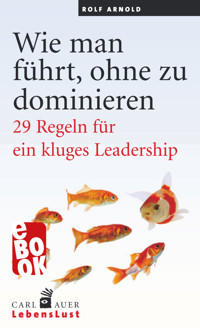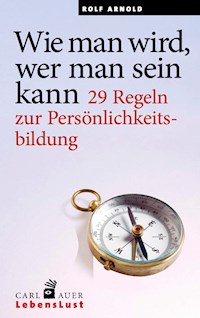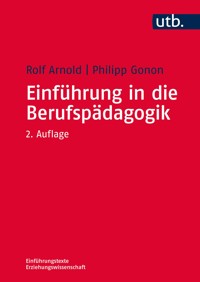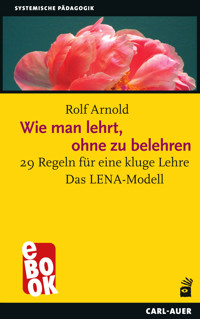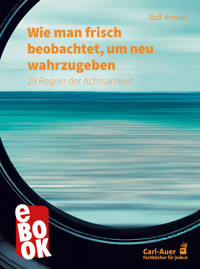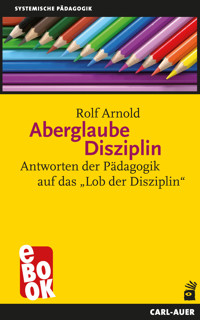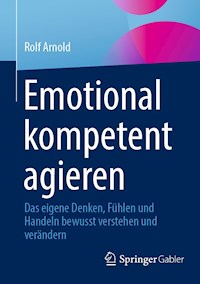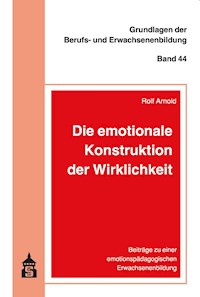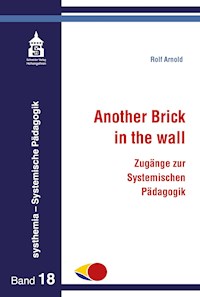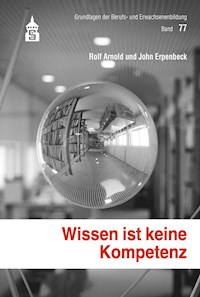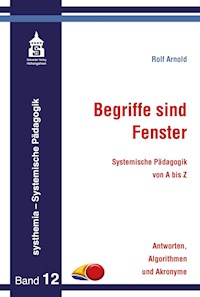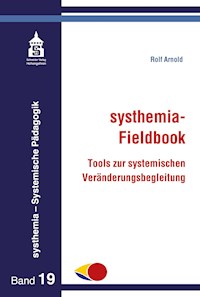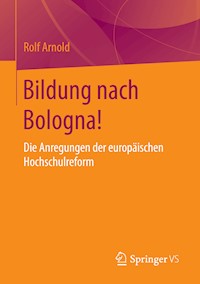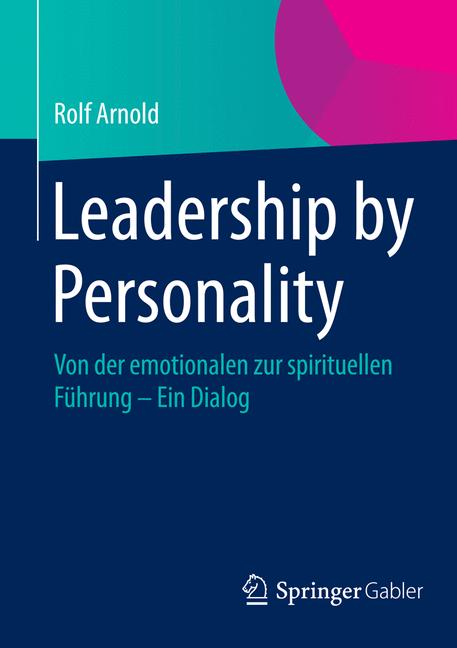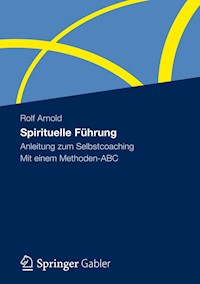Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Fachbücher für jede:n
- Sprache: Deutsch
Wer möchtest du am Ende gewesen sein? Wer sich dem Gedanken an die eigene Vergänglichkeit stellt, wird bald auf essenzielle Fragen stoßen: Was bleibt von mir? Wer werde ich am Ende gewesen sein? Wofür lohnt es sich, noch zu kämpfen? Der Erwachsenenbildungsforscher und systemische Berater Rolf Arnold lädt dazu ein, sich dem eigenen Leben und Sterben anhand ausgewählter Themen zuzuwenden: erkennen, wie wir erkennen; Muster unterbrechen; sich den großen Fragen stellen; das "Unkraut" lieben; Kontemplation üben; verzeihen. Die eingestreuten Geschichten und Fallbeispiele machen deutlich, dass es gar nicht so schwer ist, sein Leben neu zu justieren und zu der Person zu werden, die man sein könnte. Keine Zeit für grüne Bananen zu haben, bedeutet dann, sich nicht mit etwas aufzuhalten, was einen nicht wirklich weiterbringt; langweiligen Wiederholungen zu entschlüpfen; sich nur den Fragen zu widmen, die man tatsächlich klären kann. Der Autor: Rolf Arnold, Prof. Dr. Dr. h. c., Professor für Pädagogik; Senior Professor an der TU Kaiserslautern; systemischer Berater im nationalen und internationalen Rahmen. Schwerpunkte: Berufs- und Erwachsenenbildung, Systemische Pädagogik, Emotionale Bildung, Führungskräftebildung und Interkulturelle Bildung. Lehrtätigkeiten an den Universitäten Bern, Heidelberg und Klagenfurt sowie an der Pädagogischen Hochschule Luzern. Veröffentlichungen u. a.: Ich lerne, also bin ich (3. Auflage 2018), Seit wann haben Sie das? (3. Auflage 2019), Wie man ein Kind erzieht, ohne es zu tyrannisieren – 29 Regeln für eine kluge Erziehung (2. Auflage 2014), Wie man führt, ohne zu dominieren (4. Aufl. 2019), Wie man liebt, ohne (sich) zu verlieren (2. Auflage 2016), Wie man lehrt, ohne zu belehren (6. überarb. u. aktual. Aufl. 2024), Wie man wird, wer man sein kann (2. Aufl. 2019), Ach, die Fakten! (2018), Agile Führung aus Geschichten lernen (2021), Wie man frisch beobachtet, um neu wahrzugeben (2023).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf Arnold
KEINE ZEIT FÜR GRÜNE BANANEN
DIE AUFKLÄRENDE KRAFT DER VERGÄNGLICHKEIT
2025
Themenreihe: Fachbücher für jede:n
Umschlaggestaltung: B. Charlotte Ulrich
Umschlagmotiv: ©Richard Fischer • www.richardfischer.org
Redaktion: Nicola Offermanns
Reihengestaltung und Satz: Nicola Graf, Freinsheim, www.nicola-graf.com
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-0581-7 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8524-6 (ePUB)
© 2025 Carl-Auer-Systeme Verlag und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: www.carl-auer.de.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
INHALT
VORWORT
1
ERKENNEN ERKENNEN
2
DEM REPEAT-MODUS ENTSCHLÜPFEN
Erste Möglichkeit: Seinem idealen Ich Raum geben
Zweite Möglichkeit: In den Unterschied gehen
Dritte Möglichkeit: Poetisch denken und schreiben
3
IM BEWUSSTSEIN DER GROSSEN FRAGE LEBEN
4
UNKRAUT LIEBEN
Der Charme der Umkehr
Unterwegs zu einer Kultur der Abschiedlichkeit
5
BEDEUTSAM SCHWEIGEN
Leben im Ausdruck
Schweigen als entzogene Individuation?
Mit Hilfe der Sprache hinter die Sprache gelangen
6
KONTEMPLATION ÜBEN
Kontemplation als Lebensmodus
7
DER HOMO EMPATHICUS: VERZEIHEN ÜBERLEBT
Der Mensch verdankt sich nicht sich selbst
Der Mensch wirkt fort
Ewig leben: ein Horrorszenario?
Auswege aus der Individualisierungsillusion
Der größte Unterschied
8
SUBJEKTIVE ZEIT- UND RAUMPERSPEKTIVE
ÜBER DEN AUTOR
Vorwort
Es lässt sich nicht sicher ermitteln, von wem der Ausspruch »I have no time for green bananas!« ursprünglich stammt. Auch das Internet ist zur Klärung dieser Frage wenig hilfreich, liefert es doch zum Begriff bloß Kochrezepte sowie vertiefende Artikel zur heilenden Wirkung eines Konsums grüner Bananen. Doch wer will schon grüne Bananen essen? Die allermeisten meiden das Unreife und Unfertige. Sie setzen auf Ausgereiftes und Schmackhaftes – mag dieses nahrhaft oder bloß naheliegend, gewohnt oder überzeugend sein.
Dieser Essay widmet sich der aufklärenden Kraft der Vergänglichkeit. Der grundlegende Gedanke ist der, dass wir uns genau überlegen sollten, was wir zu uns nehmen, wenn wir erkannt haben, dass uns nicht viel Zeit für Abwägen oder Abwege bleibt. Dabei geht es nicht um schwer verdauliches Obst oder Gemüse, sondern um Irrwege und Abwege des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns in unserem Leben. Viel zu häufig wissen wir nicht, was wir tun oder warum wir dies – immer noch, immer wieder oder ohne Rücksicht auf Verluste – tun. Wir stolpern durch Lebenssituationen, getragen von Konzepten, Ideen, Sehnsüchten oder schlichten Irrtümern, und nicht selten verplempern wir unsere Zeit mit Hoffnungen und Vorhaben, von denen wir eigentlich längst wissen, dass diese zu nichts führen – außer zu einem Mehr desselben, nämlich nichts, worauf uns schon Paul Watzlawick verschiedentlich hinwies. Wir bleiben uns treu, folgen der Pfadabhängigkeit unserer einst entwickelten Besonderheiten und verpassen die Gelegenheiten, noch zu denen zu werden, die wir eigentlich sein könnten. Und nicht selten versäumen wir es auch, uns wirklich substanziell mit der sich für uns beständig verengenden Zeitperspektive bewusst auseinanderzusetzen. Wir blenden aus, worauf alles hinausläuft, und weichen einer wichtigen Reifungsaufgabe aus – eine Haltung, die durch den verbreiteten Jugendlichkeitswahn sowie das Todesvergessen der Moderne und die Verbannung des Alterns aus dem öffentlichen Bewusstsein zusätzlich befördert wird.
Mit dem vorliegenden Essay möchte ich diesem Trend entgegenwirken und dazu einladen, sich mit der eigenen Vergänglichkeit tief durchspürend zu befassen. Wer sind wir, wenn wir doch dereinst nicht mehr sein werden? Wofür kämpfen wir, wenn wir unseren Kampf dereinst verlieren müssen? Wer könnten wir noch werden, und warum sollten wir uns darum bemühen, wenn alles dereinst zur bloßen Erinnerung an uns wird?
Spätestens dann, wenn eigene Konzepte sich in Luft auflösen oder sich die Lebenszeit »unüberspürbar« dem Ende zuneigt, wird uns die Todesvergessenheit unseres bisherigen Lebensmodus – meist schmerzlich – bewusst. Dann trifft uns die Substanz des Vergänglichen unvorbereitet, obgleich wir doch unser ganzes Leben die Zeit hatten, um uns auf das Unvermeidbare denkend, spürend und handelnd vorzubereiten. Nicht wenige versuchen, ihre bisherigen Irrwege und Wiederholungen als grandioses biografisches Projekt darzustellen, um andere, aber vor allem sich selbst davon zu überzeugen, dass sich »gelohnt« hat, was gewesen ist. Doch was heißt das? Welcher Beobachter bzw. welche Beobachterin verfügt über die Kriterien und auch die Autorität, darüber zu befinden, ob es sich »gelohnt« hat, was wir aus uns, d. h. aus den biografischen Schaltstellen, Möglichkeiten und Entscheidungen, herausleben konnten? Und überhaupt: Muss sich Leben lohnen? Wem gegenüber sind wir Rechenschaft schuldig? Wem billigen wir letztlich die Autorität zu, über unsere Lebensbewegung zu urteilen – uns selbst, unseren (meist: bloß noch erinnerten oder imaginierten) Eltern oder Vorfahren? Der Dichter d’Lonra beendet sein Gedicht »Spät erwacht« mit den Zeilen:
Spät erwacht
(…)
Jetzt steh’ ich da, ganz ohne Panzer,
der weder Schutz noch glänzend ist,
und taste nach der Welt als ganzer
die unvertraut und fremd mir ist.
Ich lasse los, was meine Ahnen
mir dereinst in die Wiege gaben,
und trolle mich von falschen Bahnen,
um mich niemals mehr einzugraben,
zu verstecken, was ich denk und fühl,
in einer Welt, die bloß verdrängt,
und mir ein Umfeld gibt, das kühl,
mein Herz verschließt und nicht verschenkt.
Den Weg heraus aus kaltem Alten,
der ist mir fremd, weil unvertraut.
Ich will ihn gehen, um zu gestalten,
was ich mir niemals zugetraut.
Fürcht’ nicht, dass ich den Weg verlier,
muss meine Herzenskraft nur spüren,
diese trag ich auch in mir,
sie wird mich schließlich zu mir führen.1
Es ist diese Eigendrehung, die uns zu einem Lebensmodus ermutigen kann, der sich nicht mit unreifen Stoffen jeglicher Art zufriedengibt. Wer »erwacht« ist, weiß um die Einmaligkeit der Chancen und Gelegenheiten, die uns das Leben für unser Wachstum und die eigene Entfaltung immer wieder eröffnet. Und mit der dabei erwachten Klarheit kann sie oder er sich erneut der Aufgabe zuwenden, sich aus inneren Festlegungen zu lösen, um das noch verbleibende Leben von den Potenzialen her neu zu gestalten, die bislang ungenutzt als Möglichkeiten einer anderen Zukunft im Inneren schlummerten. Es braucht nicht allein »den Mut, sich seines Verstandes ohne fremde Hilfe zu bedienen«, wie Immanuel Kant (1724–1804) uns ins Stammbuch schrieb, es bedarf auch des Mutes zu durchspüren und zu erkennen, wie banal und berechenbar die uns durchwirkenden Mechanismen unseres Denkens, Fühlens und Handelns immer und immer wieder dafür sorgen, dass wir uns treu bleiben – unbeschadet der Weckrufe, Chancen und Möglichkeiten des Lebens. Das diesem Essay zugrunde liegende Motto lautet deshalb:
Habe Mut, deinen Verstand zu verstehen und deine Gefühle zu durchspüren, um zu der Person werden zu können, die du eigentlich noch werden kannst!
1 ERKENNEN ERKENNEN
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das um seine eigene Endlichkeit weiß und Kulturen des Todes entwickelt hat. Zahlreiche Riten, Mythen und Religionen gestalten seit Jahrtausenden den Umgang mit dem Sterben als einen bewussten Abschied von den geliebten Personen und einen mahnenden Hinweis auf das bevorstehende eigene Ende. Der Alltag in der Moderne ist demgegenüber weitgehend frei von jeglicher Abschiedlichkeit: Wir stehen am Grab des geliebten Menschen, des nahen Freundes oder der bekannten Nachbarin, trauern und trösten einander … und wenden uns dann wieder einer überlebenssichernden Todesverdrängung zu, die es uns erlaubt, weiter nach vorne zu streben, ohne wirklich zu begreifen, dass sich unsere eigene Zukunftsperspektive mit jeder Stunde verkürzt. Der eigene Tod kommt uns täglich näher, während wir uns anderen Dingen widmen, statt unserer eigenen Antwort auf die Endlichkeit durch unser Leben bewusst Ausdruck zu verleihen.
Es mag sein, dass diese Todesvergessenheit im Alltag die einzige Haltung ist, die es uns erlaubt, das Leben entschlossen fortzusetzen, ohne an der eigenen Vorläufigkeit letztlich zu verzweifeln. Und auch die mit einer solchen Haltung verbundene Verdrängung der Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens erweist sich möglicherweise als nützlich. Diese Frage ist durch tiefes Nachdenken oder wissenschaftliche Analysen nicht zu klären – zumindest wirft jede Antwort neue unbeantwortbare Fragen auf. Sie lassen uns auf der verzweifelten Suche nach der sogenannten »Letztbegründung«, wie die Philosophen sagen, von einer Sackgasse in die nächste torkeln, ohne wirklich den tragfähigen Grund zu finden, den wir zu finden hoffen. Viele der Suchenden wagen schließlich einen Sprung, der sie in eine religiöse, existenzialistische, nihilistische oder gar zynische Antwort befördert, auf deren Basis sie ihre ganz eigene Gewissheit dann zu leben versuchen. Dieser Sprung trennt sie von anderen, die diesen Sprung nicht vollziehen oder in eine andere Richtung springen. Jede dieser Richtungen kann unbemerkt zum Sektierertum verkommen, stiftet aber zugleich das warme Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich dazu entschlossen hat, den Glauben vor die Vernunft zu stellen. In solchen Glaubensgemeinschaften erstirbt der Diskurs über die Frage nach dem Sinn von Leben und Tod, und die Beteiligten bleiben unter sich und ohne Zweifel. Sie weichen der eigenen Verzweiflung aus, indem sie sich von den Ungläubigen abgrenzen und das Zweifeln aus ihrem Denken, Fühlen und Handeln endgültig verbannen.
Ohne Zweifel oder gar Selbstzweifel bleibt der Mensch hinter seinen Möglichkeiten eines reifen Erkennens und eines vernünftigeren Handelns zurück.
Er verlässt die Ebene des Beobachtens, des Denkens und der Auseinandersetzung mit Vernunftgründen und bleibt auf der Ebene der Behauptung – ohne Evidenzbasierung, wie man heute gerne sagt. Damit bleibt ihm im sozialen Austausch mit Andersdenkenden oder Andersgläubigen schließlich bloß der Kampf um die Wirklichkeit, der letztlich zum Krieg führen kann, wie ein Blick auf die Menschheitsgeschichte zeigt. Letztlich wurden alle Kriege von Parteien gestartet, deren Akteure für das eigene Leben und Sterben keine eigene Position finden konnten und deshalb den großen Erzählungen, die sie von anderem abgrenzten, ihr Leben widmeten und oft genug opferten – ein Ausweichen vor der Sinnfrage, die direkt in den Tod führt. Ein solches Verschieben der eigenen Antwort auf den Tod stiftet dem Leben keine eigene Substanz, sie erinnert vielmehr an denjenigen, der aus lauter Angst vor dem Sterben den Freitod wählt.
Wenn wir weder springen noch durch Abgrenzung oder gar Ausgrenzung unserem Leben Substanz stiften wollen, kommen wir an eigenem Denken und bewusstem Erkennen – auch der Grenzen des Erkennens – nicht vorbei. Dabei lautet eine erste Aufgabe, das Erkennen zu erkennen:
►
Was ist Erkennen?
►
Mit was bringt uns die eigene Beobachtung und Beurteilung tatsächlich in Berührung?
►
Wie viel Eigenes kontaminiert bereits unseren Eindruck von den Gegebenheiten und Möglichkeiten, sodass wir eigentlich bloß in der Lage sind, uns zu erinnern, d. h. wiederzuerkennen – mit der stets wirksamen Gefahr, das aktuell Gegebene mit der in uns bereits vorbereiteten Deutung beständig zu verwechseln?
►
Und schließlich: Entstammt nicht unsere Frage nach dem Sinn bereits selbst einer Denktradition, die sich daran gewöhnt hat, in jeder Erscheinung die Auswirkung einer Ursache zu vermuten – eine durchschaubare Beliebigkeit unserer Grammatik, weshalb auch die Frage, warum und wer wir sind, nicht ohne Grund ad acta gelegt werden kann?
Die Antwort auf diese Fragen ist ernüchternd. Erkenntnistheorie sowie Hirn- und Bewusstseinsforschung sind sich dabei einig: Wir kommen nicht als Tabula rasa auf die Welt, sondern reifen bereits im Mutterleib sowie in den ersten Lebensmonaten in einem sozialen »Uterus« heran, in dem wir zu erheblichen Teilen unsere emotional-kognitive Grundausstattung erwerben, unsere Talente entfalten und mit den Anregungen der signifikanten Menschen, die unseren Aufwuchs mit ihren Kommentaren und Impulsen – auch Grenzsetzungen – begleiten, unauflösbar vermengen und zu denen werden, die wir unter den gegebenen Bedingungen haben werden können. Dabei prägen uns nicht allein Gesichertheit oder Ungesichertheit unseres eigenen frühen Erlebens, sondern auch die unerledigten Themen unserer Eltern. Deren Besonderheiten und – nicht selten unbewältigten – Erlebnisse werden an uns intergenerational weitergereicht und bestimmen unser epigenetisches Erbe. Der Mechanismus, durch den diese Vererbung geschieht, ergibt sich aus dem, was in den Gesprächen im Elternhaus mit welchem Zungenschlag thematisiert wird oder eben in vielsagendem Schweigen ausgeklammert bleibt. Es ist dieses tägliche Eintauchen in die vorgefundene Kommunikationspraxis, die uns prägt und mehr und mehr selbst so denken, fühlen und handeln lässt, wie wir dieses Reden und Schweigen der Eltern zu spüren gelernt haben: zugewandt fröhlich, voller eigener Lebensfreude und Selbstwirksamkeitsgefühl oder in der eigenen Lebenshaltung angeknackst oder gar grundlegend erschüttert und ohne innerlichen Kontakt zu der eigenen Gefühlswelt.
Diese Gemengelage von eigenem Erleben und überlieferten Kränkungen oder gar Traumatisierungen gießt uns die Form, in die hinein wir unsere eigenen Ichstrukturen zu »performen« vermögen. Wir werden dadurch nicht diejenigen, die wir sein können, sondern folgen stets auch einer Formung, die unser eigenes Denken, Fühlen und Handeln sowie den Ausdruck unserer eigenen Bezogenheit bestimmt. Bisweilen ist diese Formung eine Verformung. Die Art und Weise, in der wir uns aufeinander beziehen können oder Bezogenheit in einem eindeutigen »Ja« zum Leben oder zu einem nahen Gegenüber auszudrücken vermögen, haben wir uns sozusagen nicht selbst ausgewählt oder bei Amazon bestellt, sondern als Grundausstattung mit auf den Weg bekommen. Doch nicht selten verteidigen wir unsere Strukturbesonderheiten im Kampf um die eigene Identität ein Leben lang, statt diese immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und uns zu befreiteren Formen des Umgangs mit uns selbst und dem Leben durchzuarbeiten.
Die Selbstbefreiung zu einem frischen Denken ist nicht leicht, wirken doch Epigenese sowie Emotion und Kognition in unserer Ichentwicklung unauflösbar zusammen.
Wir deuten die Welt nicht allein so, wie wir gelernt haben, sie zu deuten, sondern so, wie wir sie auszuhalten gelernt haben.
Wirklich nachhaltige Veränderungen unserer Art, die Welt zu sehen und in ihr zu handeln, resultieren deshalb auch selten aus Nachspüren, Wissen und Denken, sondern bedürfen eines Umfühlens und Umdeutens, zu dem man sich zunächst erst durcharbeiten muss – ein Prozess, der an Münchhausens Bemühen erinnert, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Erst dann können wir auch andere Formen, die Welt zu erkennen, aushalten und uns zu denjenigen entwickeln, die wir sein können – uns selbst transformierend, um in einem Multiversum und bezogener Eindeutigkeit zu leben.
Transformation ist schwierig; sie misslingt oft. Zu mächtig wirken die vertrauten Strukturen. Diese zwingen uns in die alten Muster und Gewohnheiten zurück und halten uns in der Welt des Bisherigen gefangen. Interessiert lesen wir, dass unser Gehirn plastisch sei. Es sei fähig, Rigidität des Denkens, Fühlens und Handelns zu überwinden und zu gelassenen und zulassenderen Formen des Ausdrucks zu gelangen, doch erfahren wir eher selten, wie wir bei dieser Selbstüberwindung vorgehen können, um dem Rückfall in die Rigidität vorzubeugen und nicht erneut in die eigenen Strukturbesonderheiten zurückzugleiten, um letztlich so bleiben zu »dürfen«, wie wir sind. Solche Rückfälle emergieren spontan. Im konkreten Fall ist es der durchschaubare Eindruck, dass unsere Wahrnehmung des aktuellen Geschehens uns zwar an ähnliche Lagen in unserem Leben erinnern mag, im jeweils konkreten Fall allerdings doch berechtigt und diesmal keine Wiederholung sei. Die Kernfrage der Selbsterkenntnis »An was aus meinem Leben erinnert mich meine aktuelle innere Bewegung?« wird zwar gestellt, hat aber ihre aufklärende Resonanz in uns längst eingebüßt bzw. niemals wirklich entfaltet. Ehe wir’s uns versehen, kann das vorwurfsvolle Leben sich wieder zu Wort melden. Wir erkennen:
Es gibt nichts Rigideres als die – zufälligen – Strukturbesonderheiten des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns. Diese können wir zwar spüren, reflektieren und erkennen, eine nachhaltige Transformation jedoch erfordert tägliche Fokusarbeit und bewusste Lebensführung.
Diese Fokusarbeit kann uns auch zu einem tieferen Verstehen unseres eigenen Verstehens führen. Wer einmal damit begonnen hat, seine eigene Wahrnehmung als Ergebnis seiner inneren Filter zu verstehen, dem gehen Beurteilungen, Stellungnahmen oder gar Ratschläge nicht mehr so leicht über die Lippen. Er oder sie wird mehr und mehr zu einer/einem schweigenden Selbstbeobachter:in. Diese wissen darum, dass jede Wahrnehmung auch eine Erinnerung ist; unbestellt melden sich in dem, wie sie konkrete Lagen zu sehen meinen, eigene emotionale Gewohnheiten, Traumatisierungen und Routinen zu Wort, die das, was der Fall zu sein scheint, kontaminieren und unseren selektiven Blicken ausliefern.
FÜHREN UND GEFÜHRTWERDEN
So reagieren z. B. Vorgesetzte durchaus unterschiedlich auf Kritik und Infragestellung. Während die einen darin das überbordende Engagement noch weniger erfahrener und – meist – jüngerer Mitarbeitenden zu sehen meinen und zu entsprechend väterlich-anerkennenden, aber gleichwohl Grenzen setzenden Reaktionen in der Lage sind, mobilisiert ein solches Verhalten in anderen Entrüstung und entschlossene Gegenwehr – bis hin zur Abmahnung und Kündigung. Das Verhalten, mit dem sich beide konfrontiert sehen, ist für einen nüchternen Beobachter dasselbe; die Wirklichkeiten, die es im jeweiligen Gegenüber hervorruft, könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein.
Die naheliegende Frage »Wer hat Recht?« führt deshalb in keiner Weise weiter, da sich die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung aus den jeweils im Inneren aufkeimenden Erinnerungen, Mustern und Erfahrungen speist. Diese sind berechtigt, aber nicht »wahr«. Es lohnt deshalb auch nicht, nach anderen Beobachterinnen und Beobachtern der Situation zu suchen, die den Sachverhalt ähnlich beurteilen. Das Einzige, was eine solche Erkenntnis-Kumpanei zutage fördern könnte, ist, dass Menschen mit ähnlichen Strukturbesonderheiten sich gegenseitig der Wahrheit ihrer Spontandeutungen versichern. Diese werden dadurch keineswegs wahrer; sie sonnen sich lediglich im Lichte einer vermeintlichen, weil in der Wahrnehmung geteilten »Objektivität«.
»MEINE FREUNDINNEN FINDEN AUCH, DASS DU EIN ELENDER MACHO BIST!«