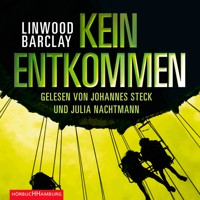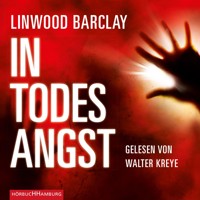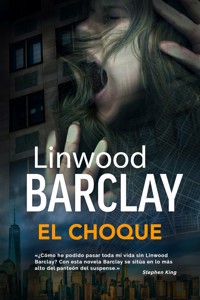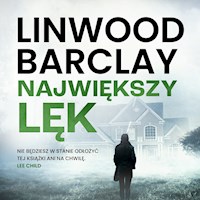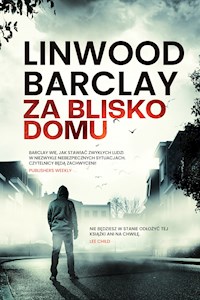9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»No one can thrill you and chill you better than Linwood Barclay.« Tess Gerritsen Niemand ist gefährlicher als der, von dem du es am wenigsten erwartest und niemand könnte brillanter in seinem neuen Thriller "Kenne deine Feinde" über die Abgründe einer Familie der US-Middle-Class schreiben als Linwood Barclay. Schonungslos seziert der Meister der »family in jeopardy«-Thriller wie ein Social-Media-Shitstorm und Mobbing das schwächste Glied einer Familie an den Rande des Abgrunds bringen. Privatdetektiv Cal Weaver soll als eine Art Bodyguard auf einen 18-Jährigen aufpassen, der Morddrohungen erhält, seit er alkoholisiert eine Mitschülerin überfahren hat. Weder Jeremy selbst noch seine Eltern scheinen das Ganze allerdings wirklich ernst zu nehmen, was Privatdetektiv Cal seinen Job nicht gerade erleichtert: In der Kleinstadt findet bald Mobbing pur gegen den Jungen statt, in den sozialen Medien startet ein Social-Media-Shitstorm - eine regelrechte Hexenjagd beginnt. Als der Privatermittler zufällig herausfindet, dass Jeremy für den tödlichen Autounfall gar nicht verantwortlich sein kann, stolpert er mitten in eine Schlangengrube aus Verrat, Gier und tödlicher Skrupellosigkeit. Mit einem Thriller des kanadischen Bestseller-Autor Lindwood Barclay erlebt man Thrill-Time de luxe. Er seziert die Gesellschaft und ihre Abgründe schonungslos und liefert einen meisterhaft konstruierten und erzählten Thriller, der den Leser über viele Stunden fesseln wird. »Ein wahrer Spannungsmeister.« Stephen King
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Linwood Barclay
Kenne deine Feinde
Thriller
Aus dem Englischen von Silvia Visintini
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»No one can thrill you and chill you better than Linwood Barclay.« Tess Gerritsen
Niemand ist gefährlicher als der, von dem du es am wenigsten erwartest und niemand könnte brillanter in seinem neuen Thriller »Kenne deine Feinde« über die Abgründe einer Familie der US-Middle-Class schreiben als Linwood Barclay. Schonungslos seziert der Meister der »family in jeopardy«-Thriller, wie ein Social-Media-Shitstorm und Mobbing das schwächste Glied einer Familie an den Rande des Abgrunds bringen.
Privatdetektiv Cal Weaver soll als eine Art Bodyguard auf einen 18-Jährigen aufpassen, der Morddrohungen erhält, seit er alkoholisiert eine Mitschülerin überfahren hat. Weder Jeremy selbst noch seine Eltern scheinen das Ganze allerdings wirklich ernst zu nehmen, was Privatdetektiv Cal seinen Job nicht gerade erleichtert: In der Kleinstadt findet bald Mobbing pur gegen den Jungen statt, in den sozialen Medien startet ein Social-Media-Shitstorm – eine regelrechte Hexenjagd beginnt. Als der Privatermittler zufällig herausfindet, dass Jeremy für den tödlichen Autounfall gar nicht verantwortlich sein kann, stolpert er mitten in eine Schlangengrube aus Verrat, Gier und tödlicher Skrupellosigkeit.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Für Neetha
1
Cal Weaver
Unlängst traf ich zufällig eine Frau, die mich noch aus meiner Zeit als Polizist hier in Promise Falls kannte, bevor ich nach Griffon in der Nähe von Buffalo zog und Privatdetektiv wurde.
»Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie wieder da sind«, sagte sie. »Wie geht’s Donna? Und Ihrem Jungen? Scott, stimmt’s?«
Bis heute weiß ich eigentlich nicht, was ich auf Fragen dieser Art antworten soll. »Na ja, ich lebe jetzt allein«, sagte ich dann aber.
Sie sah mich mitfühlend an und nickte verständnisvoll: »So was passiert leider«, sagte sie. »Hoffentlich hat sich alles gütlich regeln lassen und Sie reden noch miteinander.«
»Wir reden jeden Abend miteinander«, sagte ich und rang mir ein Lächeln für sie ab.
»Na, das ist doch schön«, sagte sie und lächelte zurück.
2
Detective Barry Duckworth von der Polizei Promise Falls saß an seinem Schreibtisch, als das Telefon klingelte. Er hob ab.
»Duckworth.«
»Bayliss hier.« Trent Bayliss vom Empfang, zuständig für den Publikumsverkehr.
»Was gibt’s?«
»Ich hab hier ’ne ganz schrille Type für Sie.« Bayliss konnte seine Heiterkeit nicht verbergen.
»Soll heißen?«
»Sie haben ihn gerade reingebracht. Der Mann wurde in der Innenstadt aufgegriffen und besteht darauf, mit jemand von der Kriminalpolizei zu reden. Also schick ich ihn zu Ihnen. Er sagt, er heißt Gaffney. Brian Gaffney. Aber Ausweis hat er keinen dabei.«
»Und was hat er zu erzählen?«, fragte Duckworth.
»Das soll er Ihnen lieber selber sagen. Ich will Ihnen den Spaß nicht verderben.« Bayliss legte auf.
Auch Barry Duckworth legte auf. Im Gegensatz zu Bayliss war er nicht amüsiert, sondern genervt. Für ihn war sein Beruf nicht mehr das, was er einmal gewesen war. Vor etwas mehr als einem Jahr hätte ihn die Ausübung seiner Pflicht beinahe das Leben gekostet. Dieses Ereignis hatte nicht nur seine Einstellung zu seiner Arbeit, sondern zum Leben überhaupt geändert.
Er nahm nichts mehr für selbstverständlich. Hoffte es wenigstens. Es klang ziemlich abgedroschen, das wusste er, aber er betrachtete jeden Tag als Geschenk. Jeden Morgen dachte er an die Stunden zurück, als sein Leben am sprichwörtlichen seidenen Faden gehangen hatte. Er hatte auch eine Weile gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Einen Krankenhausaufenthalt inklusive eines chirurgischen Eingriffs im Gesicht hatte ihm das Ganze auch eingebracht.
Die unglaublichste Entwicklung des vergangenen Jahres war aber vielleicht, dass er ordentlich abgespeckt hatte. Vor vierzehn Monaten hatte er fast hundertdreißig Kilo auf die Waage gebracht, jetzt wog er nur noch hundertfünf. Nach seinen Berechnungen ein Minus von knapp fünfundzwanzig Kilo. Eine Zeit lang hatte er noch seine alten Hosen getragen. Um sie nicht zu verlieren, hatte er neue Löcher in den Gürtel gestanzt und ihn enger geschnallt. Bis seine Frau Maureen ihn darauf hingewiesen hatte, dass er langsam lächerlich aussehe, ihn zum Herrenausstatter geschleppt und ihm neue Sachen gekauft hatte. Wie einem Fünfjährigen.
Seine alten hatte er aber behalten. Für alle Fälle. Vielleicht kam ja wieder einmal eine Zeit, in der er den Verlockungen von Dunkin’ Donuts nicht mehr widerstehen könnte.
Es war schon eine Weile her, dass er sich Donuts gegönnt hatte.
Und es wäre eine glatte Lüge gewesen, zu behaupten, er könne gut darauf verzichten. Worauf er allerdings noch weniger verzichten wollte, war das Leben und eine bessere Gesundheit.
Maureen hatte ihn unterstützt, wo sie nur konnte. Früher hatte sie immer wieder versucht, ihn dazu zu bewegen, seine Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Direkt nach dem Vorfall war sie jedoch so glücklich gewesen, ihn lebend zurückbekommen zu haben, dass sie ihn mit selbst gemachten Kuchen und Torten verwöhnte – Maureens Zitronen-Baiser-Torte war nicht zu toppen. Schließlich hatte Barry sie gebremst. Er habe es sich überlegt, sagte er. Ab jetzt würde er sich um seine Gesundheit kümmern. Würde überhaupt besser auf sich achten.
Deshalb die Banane auf dem Schreibtisch. Die braune Banane, die seit dem Vortag da lag.
Soweit es seine Gesundheit betraf, wusste Barry Duckworth, was er wollte. Beruflich war er sich nicht so sicher. Denn es war seine Rolle als Kriminalpolizist, die ihn beinahe das Leben gekostet hätte.
Er überlegte, ob er sich eine andere Arbeit suchen sollte. Das Problem war, er hatte keine Ahnung, was das sein könnte.
Nach mehr als zwanzig Jahren als Polizist konnte er schlecht wieder die Schulbank drücken, um auf Zahnarzt umzusatteln. Gut, Zahnarzt kam sowieso nicht infrage. Wie kam überhaupt jemand auf die Idee, Zahnarzt werden zu wollen? Lieber würde Barry hundert Tatorte am Stück abklappern, als anderen Leuten die Finger in den Mund zu stecken. Aber Buchhalter, das war doch ein hübscher, ungefährlicher Beruf. Niemand schlug einem das Gesicht zu Brei, nur weil man Buchhalter war.
Doch nicht nur Duckworth war damit beschäftigt, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, nachdem er es beinahe verloren hätte. Die ganze Stadt kämpfte sich in die Normalität zurück. Hunderte Bürger von Promise Falls waren bei einer Katastrophe im vergangenen Jahr gestorben. Rechtschaffene und weniger rechtschaffene. Wochen-, ja, monatelang waren die Ereignisse Tagesgespräch gewesen. Aber mittlerweile verging schon mal ein Tag, vielleicht auch zwei, ohne dass jemand darauf zu sprechen kam.
Das eigentliche Problem waren die Leute von auswärts. Der Vergleich hinkte zwar, aber ein bisschen ging es zu wie nach dem Einsturz der Zwillingstürme des World Trade Center, als die Touristen sich unbedingt am Ground Zero fotografieren lassen wollten. Promise Falls, dieses Nest im Staat New York, war zum Synonym für Rache geworden, und fast täglich konnte man jemanden sehen, der ein Selfie von sich und dem Ortsschild schoss.
Duckworth lehnte sich zurück und richtete den Blick auf die Tür seines Büros, das er sich mit den anderen Kollegen von der Kriminalpolizei teilte. Die Tür ging auf, und im Rahmen stand ein Mann, der mit verstörter Miene hereinsah.
Er war mager, bestimmt nicht mehr als fünfundfünfzig Kilo schwer, weiß, Anfang zwanzig und gut eins fünfundsiebzig groß. Kurz geschorenes schwarzes Haar und Dreitagebart. Er trug Jeans und ein dunkelblaues Hemd mit langen Ärmeln und Button-down-Kragen. Nervös blickte er sich im Zimmer um. Duckworth stand auf.
»Mr Gaffney?«
Der Mann sah ihn an und blinzelte. »Der bin ich.«
Duckworth winkte ihn herein und zeigte auf den Stuhl neben seinem Schreibtisch. »Nehmen Sie doch Platz.«
Brian Gaffney setzte sich. Die Hände im Schoß verschränkt, den Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, als wolle er sich kleiner machen, saß er da und blickte sich um. Er sah hinauf zur Zimmerdecke wie jemand, der eine Höhle betritt und nach Fledermäusen Ausschau hält.
»Mr Gaffney?«
Gaffney richtete seinen ängstlichen Blick auf Duckworth. »Ja?«
»Ich bin Kriminalpolizist.« Barry hielt einen Stift gezückt, um sich Notizen zu machen. »Können Sie mir Ihren Namen buchstabieren, Mr Gaffney?«
Gaffney folgte der Aufforderung.
»Und Ihr zweiter Vorname?«
»Arthur«, sagte Gaffney. »Sind wir hier in Sicherheit?«
»Wie bitte?«
Ruckartig, wie ein Vogel, der seine Umgebung in Augenschein nimmt, bewegte Gaffney den Kopf, beugte sich zu Duckworth und sagte mit gesenkter Stimme: »Die beobachten mich vielleicht noch.«
Der Polizist legte dem Mann sanft eine Hand auf den Arm. Gaffney betrachtete sie, als sei er sich nicht sicher, womit er es hier zu tun hatte.
»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen«, versicherte ihm Duckworth und dachte, dass nur jemand wie Bayliss sich über diesen Mann amüsieren konnte. Gut möglich, dass das, wovor Gaffney sich fürchtete, nur in seinem Kopf existierte, doch die Angst, die Duckworth in seinen Augen sah, war echt.
Der Mann zitterte. »Ganz schön kalt hier.«
Es herrschten weit über zwanzig Grad im Raum, und eigentlich hätte sich die Klimaanlage bereits einschalten müssen.
Duckworth stand auf, zog sein Sakko aus und legte es dem Mann um die Schultern. »So besser?«
Gaffney nickte.
»Möchten Sie Kaffee?«, fragte der Polizist. »Dann wird Ihnen vielleicht ein bisschen wärmer.«
»Ja, gut«, sagte Gaffney leise.
»Sahne, Zucker?«
»Ich … egal, Hauptsache, warm.«
Duckworth ging zu dem Tisch, auf dem die Kaffeemaschine stand, füllte einen einigermaßen sauberen Becher mit Kaffee, fügte ein Stück Zucker sowie eine Portion Kaffeeweißer hinzu und reichte Gaffney den Becher, der ihn mit beiden Händen umfasste, zum Mund führte und einen Schluck trank.
Duckworth setzte sich und nahm seinen Stift wieder. »Wann sind Sie geboren, Mr Gaffney?«
»Sechzehnter April 1995.« Der Ermittler machte sich Notizen, und Gaffney sah ihm dabei zu. »Ich bin in New Haven geboren.«
»Derzeitige Adresse?«
»Sie sind vielleicht hier«, sagte Gaffney wieder mit gesenkter Stimme. »Vielleicht haben sie menschliche Gestalt angenommen.«
Duckworths Stift stoppte. »Wer denn, Mr Gaffney?«
Gaffney blinzelte. »Ich wohne in der Hunter Street 87. Einheit zwei-null-eins.«
Duckworth dämmerte etwas. »Ist das eine Wohnung?«
»Ja.«
»Leben Sie allein, Mr Gaffney?«
»Ja.« Gaffney nickte. Sein Blick hing jetzt an der Banane auf Duckworths Schreibtisch.
»Was machen Sie beruflich?«
»Fahrzeugaufbereitung. Essen Sie die noch?«
Duckworth beäugte das braune Stück Obst. »Mh, wollen Sie sie?«
»Ich glaube nicht, dass die mir was zu essen gegeben haben. Ich hab schon lang nichts mehr zwischen die Zähne gekriegt.«
Duckworth reichte Gaffney die Banane. Der nahm sie vorsichtig in die Hand und steckte sich dann ein Ende in den Mund, ohne sich lange mit Schälen aufzuhalten. Mit einem kräftigen Biss durchtrennte er die Schale, kaute rasch und biss gleich ein zweites großes Stück samt Schale ab.
Noch im Kauen fragte er: »Wissen Sie, was Fahrzeugaufbereitung ist?«
Duckworth war durch das, was er eben gesehen hatte, ein wenig aus dem Konzept gebracht. »Wie bitte?«
»Fahrzeugaufbereitung.« Gaffney schluckte das letzte Stück Banane und spülte es mit einem Schluck Kaffee hinunter. »Wissen Sie, was das ist?«
»Nein.«
»Das heißt, Sie lassen Ihren Wagen nicht waschen, sondern aufbereiten. Eine Super-super-Reinigung. Ich arbeite bei Albany.«
»Also in der Nähe von Albany?«
Gaffney schüttelte den Kopf. »Nein, hier in Promise Falls. Der Laden heißt Albany Fahrzeugaufbereitung. Ist so ein Franchise.«
»Mr Gaffney, Sie wurden von der Polizei aufgegriffen, weil Sie ziellos durch die Innenstadt liefen. Als man Sie hierherbrachte, haben Sie gesagt, Sie wollen mit jemand von der Kriminalpolizei sprechen.«
»Genau.«
»Also, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich hab einen Fehler gemacht«, sagte Gaffney.
»Wie meinen Sie das?«
Wieder sah Gaffney sich prüfend um. Es musste wohl das zehnte Mal sein. »Fällt nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich«, flüsterte er dann.
»Das tut mir leid.«
»Ich meine, was können Sie schon tun?« Gaffney zuckte die Achseln. »Sie festnehmen?«
»Festnehmen? Wen denn?«
»Was für einen Tag haben wir heute?«
»Mittwoch.«
Gaffney überlegte einen Moment. »Also … zwei Nächte. Montagabend bin ich ausgegangen, und jetzt haben wir Mittwoch, das sind dann zwei Nächte. Außer es ist schon, na ja, der nächste Mittwoch, dann waren’s neun Tage.«
Duckworth hatte seinen Stift weggelegt. »Zwei Nächte – was?«
»Dass sie mich hatten.« Er stellte den Kaffeebecher ab, fuhr sich mit der Hand übers Kinn, spürte die Bartstoppeln. »Müssen doch nur zwei sein. Wenn’s neun gewesen wären, hätte ich jetzt schon fast einen Bart.«
Duckworth runzelte die Stirn. »Dass sie Sie ›hatten‹? Was meinen Sie damit?«
»Ich glaube, ich wurde entführt«, sagte Gaffney und leckte sich die Lippen. »Betty und Barney Hill. Sagen Ihnen die Namen was?«
Duckworth notierte sie sich rasch. »Die haben Sie entführt?«
Gaffney schüttelte schnell den Kopf. »Nein, über die gibt’s ein Buch. Ich hab ein Exemplar. Ein altes Taschenbuch. Die unterbrochene Reise, von John G. Fuller. Die haben wirklich gelebt. Und denen ist das auch passiert.«
»Was ist passiert, Brian?«
»Die sind eines Nachts von den Niagarafällen nach Hause gefahren. Nach New Hampshire. Am 20. September 1961 war das. Waren sogar hier in der Nähe. Vielleicht sechzig, siebzig Kilometer von Promise Falls entfernt.«
»Aha.«
»Er war schwarz, und sie war weiß. Hat aber eigentlich nichts damit zu tun, was ihnen passiert ist. Obwohl, wer weiß?«
»Und weiter?«
»Die Hills haben so ein helles Licht am Himmel gesehen, was dann passiert ist, wissen sie nicht, aber auf einmal waren sie wieder auf der Straße, fast schon zu Hause. Was in der Zeit dazwischen war, wissen sie nicht. Deshalb sind sie zu einem Hypnotiseur gegangen.«
»Und was haben sie sich davon versprochen? Was sollte der für sie tun?«
»Ihnen helfen, sich zu erinnern, was in diesen fehlenden Stunden mit ihnen passiert ist.«
»Und? Ist’s ihm gelungen?«
Gaffney nickte. »Sie wurden auf ein Schiff gebracht. Die Außerirdischen machten Experimente mit ihnen, steckten ihnen Nadeln und so Zeugs rein, und dann haben sie dafür gesorgt, dass sie das alles vergessen.« Er schüttelte gedankenverloren den Kopf. »Ich hätte nie gedacht, dass mir auch so was passieren könnte.«
»Verstehe«, sagte Duckworth. »Sie meinen also, dass auch Ihnen zwei Tage fehlen?«
»Ja«, sagte Gaffney. Er zitterte, als hätte er einen elektrischen Schlag erhalten, und trank noch einen Schluck Kaffee.
»Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern können?«
»Ich bin ins Knight’s gegangen, um was zu trinken. So um acht vielleicht. Kennen Sie das Knight’s?«
Aha, dachte Duckworth. Eine der bekanntesten Kneipen der Stadt.
»Kenn ich«, bestätigte er.
»Ich hab ein paar Bier getrunken und ferngesehen. Danach weiß ich nicht mehr so genau.«
»Wie viele Bier?«
Gaffney zuckte die Schultern. »Vier, fünf. Dabei sind aber bestimmt anderthalb Stunden vergangen.«
»Und Sie sind sicher, dass es nicht mehr waren.«
»Ganz sicher.«
»Sind Sie mit dem Auto hingefahren?«
Entschiedenes Kopfschütteln. »Nee. Ich kann da von mir zu Hause aus hinlaufen und brauch mir keine Gedanken zu machen, dass mich die Polizei aufhält. Haben Sie noch eine Banane?«
»Leider nicht. Ein paar Fragen noch, dann schau ich, was ich noch für Sie finde. Können Sie sich erinnern, dass Sie die Kneipe verlassen haben?«
»Möglich. Als ich rauskam, hat mich jemand gerufen. Von dem Durchgang, der nach hinten zum Parkplatz führt.«
»Wer hat Sie gerufen? Ein Mann oder eine Frau?«
»Eine Frau, glaub ich. Sah jedenfalls aus wie eine Frau.«
Duckworth gab sich damit zufrieden. »Was hat sie gesagt?«
Gaffney schüttelte den Kopf. »Ist alles ziemlich verschwommen. Und dann ist da zwei Tage lang fast gar nichts, bis ich an genau derselben Stelle wieder aufwache. Bin wahrscheinlich aus diesem Durchgang rausgekommen und rumgetaumelt, und da bin ich den Polizisten aufgefallen. Ich hatte keinen Ausweis dabei. Meine Brieftasche ist weg und mein Handy auch.«
»Wär’s möglich, dass Sie zwei Tage lang in diesem Durchgang waren?«
Gaffney schüttelte langsam den Kopf. »Da laufen doch ständig Leute durch. Irgendwer hätte mich doch gesehen. Außerdem hätten sie dort die Experimente doch gar nicht machen können.«
Brian Gaffneys Atem beschleunigte sich. »Was ist, wenn die mich irgendwie infiziert haben? Mir eine Krankheit angehängt haben?« Er stellte seinen Becher wieder ab und legte sich eine Hand auf die Brust. »Was ist, wenn ich jetzt ein Überträger bin? Wenn ich Sie angesteckt hab? O Mann!«
»Wir wollen doch nicht gleich die Nerven verlieren, Brian«, sagte Duckworth gelassen. »Zuerst lassen Sie sich mal untersuchen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass man Experimente mit Ihnen angestellt hat?«
»Sie … haben mich woanders hingebracht. Hätte schon ein Schiff sein können, aber ich glaub’s eigentlich nicht. Da waren Lichter, und ich hab auf einem Bett oder so was gelegen, auf dem Bauch. Ich erinnere mich, dass es gestunken hat. Da haben sie’s gemacht.«
»Was haben sie gemacht?«
»Ich hab gespürt, wie sie mich gestochen haben. Hat sich angefühlt wie tausend Nadeln. Haben wahrscheinlich Proben genommen. DNA vielleicht?«
Der verängstigte Ausdruck trat wieder in sein Gesicht. Sein Blick wanderte zur Decke, als könne er durch sie direkt in den Himmel sehen.
»Warum ich?«, schrie er. »Warum mussten sie mich nehmen?«
Vom anderen Ende des Büros sahen zwei von Duckworths Kollegen herüber. Barry legte Gaffney wieder die Hand auf den Arm. »Brian, sehen Sie mich an. Sehen Sie mich an.«
Gaffney senkte den Blick und sah Duckworth in die Augen. »Vielleicht war’s ein Fehler, dass ich hergekommen bin. Tut mir leid.«
»Das war kein Fehler. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Noch mal zurück zu diesen Nadeln. Was lässt Sie vermuten, dass Sie gestochen wurden?«
»Mein Rücken«, sagte Gaffney. »Der ist richtig wund. Fühlt sich ganz zerstochen an. Und brennt wie die Hölle.«
»Soll ich ihn mir mal ansehen?«, fragte Duckworth nach einigem Zögern.
Auch Gaffney zögerte, als wäre er sich nicht sicher, ob er wirklich wissen wollte, was mit ihm los war. Doch dann sagte er: »Wenn’s Ihnen nichts ausmacht.«
Die beiden Männer erhoben sich. Gaffney wandte Duckworth den Rücken zu, zupfte sein Hemd aus der Hose, knöpfte es auf und zog es sich von unten über die Schulter.
»Geht’s so?«, fragte er.
»Reicht schon.«
Duckworth starrte auf Gaffneys Rücken. In grob tätowierten, fünf Zentimeter hohen, schwarzen Buchstaben stand dort:
ICH PSYCHO
HABE SEAN
UMGEBRACHT
»Mr Gaffney, wer ist Sean?«
»Sean?«
»Ja, Sean.«
Gaffneys Schultern hoben und senkten sich. »Ich kenne niemand, der so heißt. Wieso?«
3
Cal
Der Name Madeline Plimpton war mir ein Begriff.
Sie entstammte einer in Promise Falls alteingesessenen Familie. Ich bin zwar nicht gerade ein Experte für die Geschichte unserer Stadt, aber so viel wusste ich immerhin: Die Plimptons gehörten zu den Familien, die im 19. Jahrhundert die Stadt gegründet hatten. Sie hatten die erste Lokalzeitung, den Promise Falls Standard, ins Leben gerufen, und Madeline Plimpton durfte sich die außerordentliche Ehre ans Banner heften, ihm das Totenglöcklein geläutet zu haben.
Ich hatte keine Ahnung, warum sie mich sprechen wollte. Am Telefon wollte sie es mir jedenfalls nicht sagen. Das wollen Klienten eigentlich nie. Es ist schon schlimm genug, es persönlich tun zu müssen.
»Es ist heikel«, meinte sie.
Das war es eigentlich immer.
Ich würde ihr Anwesen zwar nicht gerade als Herrensitz bezeichnen, aber für Promise Falls war es ziemlich exklusiv. Die viktorianische Villa, die aus den 1920er-Jahren stammte, war bestimmt vier- bis fünfhundert Quadratmeter groß, ein gutes Stück von der Straße zurückversetzt, und beeindruckte mit einer kreisförmigen Auffahrt. Gut vorstellbar, dass in früheren Zeiten im gepflegten Rasen vor der Villa eine dieser kleinen Statuen eines schwarzen Jockeys gestanden hatte. Sollte dem so gewesen sein, war seither immerhin jemand klug genug gewesen, sie verschwinden zu lassen.
Ich saß am Steuer meines neuen, wenn auch längst nicht mehr nagelneuen Honda. Ich hatte meinen uralten Accord gegen einen nur alten mit manueller Schaltung eingetauscht und konnte mich jetzt der Illusion hingeben, wieder jünger und sportlicher zu sein. Mein erstes Auto war vor ungefähr dreißig Jahren ein Toyota Celica mit manuellem 4-Gang-Getriebe gewesen. Danach war ich nur mehr mit Automatikschaltung gefahren. Bis jetzt.
Ich parkte den Honda vor dem Haupteingang mit seiner zweiflügeligen Tür, wo er sein Dasein vorübergehend im Schatten eines schwarzen Lexus SUV, einer weißen viertürigen Acura-Limousine und eines 7er BMW fristen musste. Der Gesamtwert dieser drei Autos überstieg wahrscheinlich meine Einkünfte der vergangenen zwei Jahrzehnte.
Ich klingelte und erwartete beinahe, von einem Dienstmädchen oder einem Butler empfangen zu werden, doch es war Madeline Plimpton selbst, die mir öffnete und mich ins Haus bat.
Ich schätzte sie auf siebzig. Sie war dünn und sah ziemlich gut, ja beinahe majestätisch aus in ihren schwarzen Hosen, dem schwarzen Oberteil und der geschmackvollen einreihigen Perlenkette um den Hals. Ihr nackenlanges Silberhaar war wohlfrisiert, und sie musterte mich durch eine Brille mit Goldrand.
»Danke, dass Sie gekommen sind, Mr Weaver«, sagte sie.
»Gern geschehen. Bitte nennen Sie mich Cal.«
Sie forderte mich nicht auf, sie Madeline zu nennen.
Von der Eingangshalle führte sie mich ins Speisezimmer, wo ein Teetisch gedeckt war. Porzellantassen sowie ein Milchkännchen und ein Zuckerwürfelbehälter aus Silber.
»Möchten Sie eine Tasse Tee?«, fragte sie.
»Ja, bitte.«
Sie schenkte ein und nahm dann am oberen Tischende Platz. Ich setzte mich rechts neben sie.
»Ich habe Gutes über Sie gehört«, sagte sie.
»Ich nehme an, als ehemalige Zeitungsverlegerin haben Sie gute Quellen«, sagte ich lächelnd.
Sie zuckte ganz leicht zusammen, wahrscheinlich weil ich das Wort ehemalig verwendet hatte. »Das stimmt. Ich kenne fast jeden in dieser Stadt. Ich weiß, dass Sie hier früher Polizist waren. Dass Sie einen Fehler gemacht haben, weggezogen sind und ein paar Jahre in Griffon als Privatdetektiv gearbeitet haben. Und dann sind Sie zurückgekommen.« Sie hielt inne. »Nach einer persönlichen Tragödie.«
»Ja«, sagte ich.
»Jetzt sind Sie seit zwei Jahren wieder hier.«
»Ja.« Ich ließ ein Stück Zucker in meinen Tee fallen. »Meine Leumundsprüfung hab ich dann wohl bestanden. Wo liegt das Problem?«
Ms Plimpton holte tief Luft. Dann führte sie ihre Tasse zum Mund und blies darauf. Der Tee war heiß.
»Es geht um meinen Großneffen«, sagte sie.
»Aha.«
»Den Sohn meiner Nichte. Sie haben im vergangenen Jahr einiges durchgemacht.«
Ich wartete.
»Meine Nichte und ihr Sohn wohnen in Albany. Aber das Leben dort ist für sie untragbar geworden.«
Ich glaubte zu wissen, was dieses Wort bedeutete.
»Und aus welchem Grund?«, fragte ich.
Sie antwortete nicht gleich. »Jeremy – das ist mein Großneffe – hatte dieses Jahr eine Sache bei Gericht, was ein recht unerfreuliches öffentliches Aufsehen erregte. Es macht ihm das Leben in Albany sehr schwer. Einige Leute, die der Justiz anscheinend keine große Wertschätzung entgegenbringen, drangsalieren Jeremy und meine Nichte. Nächtliche Anrufe, das Haus wurde mit Eiern beworfen. Es gab sogar eine Todesdrohung im Briefkasten. Sie wurde mit Malkreide auf ein mit Exkrementen beschmiertes Blatt Papier geschrieben. Können Sie sich so etwas vorstellen?«
»Eine Sache bei Gericht? Was meinen Sie damit, Ms Plimpton?«
»Ein Malheur beim Autofahren. Es wurde schrecklich aufgebauscht. Ich meine, ich will damit nicht sagen, dass es keine Tragödie war, aber was daraus gemacht wurde, war einfach überzogen.«
»Ms Plimpton, vielleicht erzählen Sie mir alles von Anfang an.«
Ihr Kopf bewegte sich kaum merklich von einer Seite zur anderen. »Ich halte das nicht für notwendig. Ich möchte Ihre Dienste in Anspruch nehmen, aber dazu ist es nicht notwendig, dass Sie alle Einzelheiten kennen. So viel kann ich Ihnen immerhin sagen: Gloria ist mehr wie eine Tochter als wie eine Nichte für mich. Sie hat als Jugendliche bei mir gelebt, unser Verhältnis ist also …«
Ich erwartete, dass sie »enger« sagen würde.
»Kompliziert«, beendete Ms Plimpton schließlich den Satz.
»Ich weiß nicht, was für Dienste Sie von mir erwarten«, sagte ich.
»Ich will, dass Sie meinen Jeremy beschützen.«
»Was meinen Sie mit beschützen? Wollen Sie mich als Leibwächter für ihn engagieren?«
»Ja, das würde wahrscheinlich dazugehören. Ich möchte, dass Sie feststellen, inwieweit er womöglich gefährdet ist, und, wie Sie sagen, eine gewisse Leibwächterfunktion übernehmen.«
»Ich bin kein Leibwächter. Vielleicht sollten Sie’s mit einem Rausschmeißer probieren.«
Madeline Plimpton seufzte. »Nun, vom Fachlichen her sehen Sie sich möglicherweise nicht als Leibwächter. Aber Sie waren früher Polizist. Sie hatten mit kriminellen Elementen zu tun. Ich würde meinen, dass Ihre Tätigkeit als Leibwächter sich gar nicht so sehr von dem unterscheiden würde, was Sie eigentlich machen. Und ich bin selbstverständlich bereit, Sie rund um die Uhr zu bezahlen, solange Ihre Dienste benötigt werden. Einer der Gründe, warum ich mich für Sie entschieden habe, ist der Umstand, dass Sie meines Wissens keine – und ich möchte nicht gefühllos erscheinen, Mr Weaver –, aber meines Wissens haben Sie keine Familie. Es wäre also in mancher Hinsicht nicht so beeinträchtigend wie vielleicht für jemand anderen.«
Ich war mir nicht sicher, ob mir Madeline Plimpton sympathisch war. Andererseits – sich die Klienten danach auszusuchen, ob man mit ihnen befreundet sein wollte, war ein Luxus, den man sich in meiner Branche nicht leisten konnte.
»Wie alt ist Jeremy?«
»Achtzehn.«
»Und wie heißt er mit Nachnamen?«
Sie biss sich kurz auf die Lippe. »Pilford«, sagte sie beinahe im Flüsterton.
Ich kniff die Augen zusammen. »Jeremy Pilford? Ihr Großneffe ist Jeremy Pilford?«
Sie nickte. »Ich nehme an, der Name ist Ihnen geläufig?«
Der Name war dem ganzen Land geläufig.
»Das Riesenbaby«, sagte ich.
Diesmal zuckte Madeline Plimpton unübersehbar zusammen. Sie sah mich an, als hätte ich ihr meinen heißen Tee über die geäderte Hand geschüttet.
»Ich wünschte, Sie hätten das jetzt nicht gesagt. Diese Worte wurden von der Verteidigung nie benutzt. Das hat die Anklage lanciert und die Presse übernommen, und es war beleidigend. Erniedrigend war es. Nicht nur für Jeremy, sondern auch für Gloria. Es hat ein schlechtes Licht auf sie geworfen.«
»Aber es ergab sich aus der Strategie der Verteidigung, oder, Ms Plimpton? Das war doch im Wesentlichen das, was Jeremys Verteidiger gesagt hat. Das war das Argument. Dass Jeremy so verwöhnt war, so völlig entbunden davon, je selbst irgendetwas zu tun, je Verantwortung für etwas in seinem Leben zu übernehmen, dass er überhaupt nicht auf die Idee kam, einen Fehler zu begehen, als er –«
»Ich weiß, was er getan hat.«
»– als er feiern ging, sich völlig betrunken ans Steuer setzte und jemanden tötete. Bei allem Respekt, Ms Plimpton, ich würde das nicht als ein Malheur beim Autofahren bezeichnen.«
»Vielleicht sind Sie nicht der Richtige für diese Aufgabe.«
»Vielleicht nicht«, sagte ich, stellte meine Tasse weg und schob meinen Stuhl zurück. »Danke für den Tee.«
Sie streckte die Hand aus. »Warten Sie.«
Ich wartete.
»Bitte«, sagte sie.
Ich rutschte mit dem Stuhl wieder an den Tisch heran und legte die Hände auf die Platte.
»Vermutlich war es ziemlich unrealistisch, von Ihnen eine andere Reaktion zu erwarten als von irgendjemand anderem, an den ich mich wenden würde. Jeremy verstand es nicht, die Menschen für sich einzunehmen. Aber der Richter hat entschieden, ihn nicht ins Gefängnis zu stecken. Der Richter hat entschieden, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Der Richter ließ sich von Mr Finch überreden, dass –«
»Mr Finch?«
»Jeremys Verteidiger, auf den Sie gerade angespielt haben. Grant Finch. Mr Finch hat sich diese Verteidigungsstrategie ausgedacht, und ehrlich gesagt, niemand hat sich große Hoffnungen gemacht, dass der Richter dieser Argumentation folgen würde. Aber er tat es, und wir konnten unser Glück kaum fassen. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn der Junge zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden wäre. Schließlich ist er doch noch ein Junge. Das wäre sein Todesurteil gewesen. Und so schlimm die Reaktion auf das Urteil auch war, sie ist immer noch besser, als wenn Jeremy jetzt hinter Gittern säße.«
»Wenn man davon absieht, dass er jetzt in Angst lebt«, warf ich ein.
Madeline beugte ein wenig den Kopf. Ein kleines Zeichen der Zustimmung. »Richtig, aber das geht vorbei. Jeremy hätte für mehrere Jahre ins Gefängnis gehen können. Die gesellschaftliche Entrüstung über das Urteil wird sich in ein paar Monaten gelegt haben, würde ich meinen. Die Welt wartet immer auf den nächsten Anlass, über den sie sich echauffieren kann. Einen Trophäenjäger, der in Afrika einen Löwen abschießt. Eine Frau, die einen Witz über Aids twittert. Ein Schwachkopf von einem Politiker, der glaubt, der weibliche Körper weiß, wie er nach einer Vergewaltigung eine Schwangerschaft verhindern kann. Der Richter, der einen Jungen mit einer milden Strafe davonkommen lässt, der ein bewusstloses Mädchen vergewaltigt hat. Wir finden es so aufregend, uns über etwas aufzuregen, dass wir uns jede Woche ein neues Ziel für unsere Wut wünschen. Irgendwann wird sich niemand mehr an Jeremy erinnern, und dann wird er wieder ein normales Leben führen können. Aber bis dahin braucht er Sicherheit.«
Ich fragte mich, wie lange es dauern würde, bis die Familie des Mädchens, das Jeremy getötet hatte, wieder ein normales Leben würde führen können, verzichtete aber darauf, die Frage laut zu stellen.
»Und was Ihre Bemerkung von vorhin angeht: Ja, er wurde als Riesenbaby abgestempelt. Ein Teenager, der wie ein Kleinkind verhätschelt wurde. Der Staatsanwalt sagte es einmal ganz nebenbei, aber für die Medien war es ein gefundenes Fressen. CNN protzte mit Jeremy als Aufmacher. Das Riesenbaby. Ein spektakulärer Fall mit vielen bunten Bildchen.«
»Sie haben doch selbst mal eine Zeitung herausgegeben, da müssen Sie doch wissen, wie so was läuft.«
»Allerdings«, sagte sie. »Aber nur, weil ich einmal Herausgeberin eines Informationsmediums war, muss ich noch lange nicht alles gutheißen, was die Medien tun.«
»Ich glaube wirklich nicht, dass ich Ihnen helfen kann, Ms Plimpton«, sagte ich. »Aber ich könnte Ihnen wahrscheinlich ein paar Profis empfehlen. Leute, die mit Ermittlungen, wie ich sie führe, nichts am Hut haben. Das sind eher harte Kerle, die man engagieren kann.«
»Ich will nicht, dass Jeremy von irgendwelchen Schlägertypen begleitet wird.«
Ich zuckte die Schultern.
»Wären Sie zumindest bereit, sie einmal zu treffen?«, fragte sie. »Jeremy und meine Nichte? Nur ein Treffen, und dann können Sie immer noch entscheiden, ob Sie den Auftrag annehmen wollen. Ich bin sicher, wenn Sie sich einmal mit ihnen unterhalten haben, werden Sie feststellen, dass sie nicht die Karikaturen sind, als die sie gezeichnet wurden. Es sind richtige Menschen, Mr Weaver. Und sie haben Angst.«
Ich holte meinen Notizblock und meine Feder aus der Innentasche meiner Sportjacke. Ich zog die Kappe von der Feder.
»Geben Sie mir doch ihre Adresse in Albany«, sagte ich.
»Ach, das ist gar nicht nötig«, meinte Ms Plimpton. »Sie sind hier. Schon seit ein paar Tagen. Sie sind hinten auf der Veranda und warten darauf, mit Ihnen sprechen zu können.«
4
Barry Duckworth wollte Brian Gaffney im Krankenhaus untersuchen lassen und bot ihm deshalb an, ihn ins Promise Falls General zu fahren. So hätte er unterwegs die Gelegenheit, den Mann noch eingehender über die möglichen Ereignisse der vergangenen beiden Tage zu befragen. Duckworth hatte jeden Gedanken an einen alkoholbedingten Blackout Gaffneys verworfen, als er die Worte gesehen hatte, die diesem auf den Rücken tätowiert worden waren.
ICH PSYCHO HABE SEAN UMGEBRACHT. Kein auch nur annähernd vernünftiger Mensch würde sich so ein Tattoo als dauerhaften Körperschmuck zulegen. Und ein sturzbesoffener genauso wenig.
Der Mann schien keine Ahnung zu haben, was das auf seinem Rücken war, falls doch, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. Also machte Duckworth ein Foto, solange Gaffneys Hemd noch hochgeschoben war, und zeigte es ihm.
»Menschenskind«, sagte der Tätowierte. »Das … das kapier ich überhaupt nicht.«
»Ich glaube, damit ist Ihre Theorie über das, was Ihnen zugestoßen ist, vom Tisch«, sagte Duckworth behutsam.
Gaffney sah drein wie ein Vierjähriger beim Versuch, einem Vortrag von Stephen Hawking zu folgen. »Ich … also … das sieht mir nicht so aus wie etwas, was Außerirdische tun würden.«
»Genau«, pflichtete Duckworth ihm bei. »Hier haben wir’s eher mit jemand ziemlich Irdischem zu tun.«
Gaffney nickte. Er war noch immer fassungslos. »Tut mir leid«, sagte er.
»Wieso das denn?«
»Ich steh ja da wie ein Verrückter. Ich bin aber nicht verrückt.«
»Natürlich nicht«, beruhigte ihn der Polizist.
»Ich meine, ein bisschen anders bin ich schon. Sagt jedenfalls mein Vater immer. Aber nicht verrückt. Wissen Sie, was ich meine?«
»Natürlich.«
»Mir ist nur keine andere Erklärung eingefallen. Vielleicht hab ich zu viele Bücher über Ufos gelesen.« Er betrachtete noch einmal das Foto auf Duckworths Handy. »Sind Sie sicher, dass das ein richtiges Tattoo ist? Ist es nicht vielleicht nur ein Filzstift oder sonst was, was man wegwischen kann?«
»Eher nicht.«
»Das ist da jetzt für immer drauf?«
»Ich bin kein Experte für Tätowierungen«, meinte Duckworth. »Vielleicht kriegt man das auch wieder weg.« Er bezweifelte es allerdings. »Haben Sie eine Idee, wer Ihnen das angetan haben könnte?«
Gaffney wandte den Blick von Duckworths Handy ab, sodass dieser es wieder einstecken konnte. Dem jungen Mann stiegen Tränen in die Augen. Er biss sich auf die Lippe. »Nein. Da hätte das mit den Außerirdischen ja noch mehr Sinn ergeben. Dass die sich irgendwen krallen und an ihm rumexperimentieren. Aber das hier … das ist doch total verrückt.«
»Na, kommen Sie«, sagte Duckworth. »Jetzt lassen Sie sich erst mal untersuchen.«
Sie fuhren in Duckworths Dienstwagen zum Krankenhaus. Unterwegs erkundigte der Ermittler sich nach den Lebensumständen seines Beifahrers. »Haben Sie Familie, Brian? Eltern? Geschwister? Eine Freundin?«
Gaffney sprach langsam und leise. »Meine Leute wohnen drüben in der Montcalm Street. Ich bin vor ungefähr einem halben Jahr ausgezogen. Sie meinten – mein Dad meinte –, es wäre Zeit, dass ich allein lebe. Da hab ich mir dann dieses Zimmer in der Innenstadt gesucht. Ich hab eine Schwester. Monica. Sie ist neunzehn. Sie würde gern ausziehen, aber sie hat nicht genug Geld.«
»Wie lange leben Sie schon in Promise Falls?«
»Werden so fünfzehn Jahre sein. Seit meine Eltern von Connecticut hergezogen sind.«
»Freundin?«
»Sozusagen. Hab mich ein paar Mal mit dieser jungen Frau getroffen. Sie hat ihr Auto waschen lassen, und irgendwie hat’s gefunkt.«
»Wie heißt sie denn?«
»Jess. Also, Jessica Frommer.«
»Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«
Brian dachte eine Weile nach. »Vor einer Woche vielleicht. Wir haben uns erst ein paar Mal getroffen, meistens außerhalb oder bei mir zu Hause. Wenn ich’s mir recht überlege, hätte ich sie gestern anrufen sollen.« Er machte ein bestürztes Gesicht. »Scheiße! Sie wird sich fragen, was mit mir ist.«
»Und Ihnen fällt niemand ein, der Sean heißt? Ein Freund, der Freund eines Freundes, ein entfernter Verwandter?«
»Niemand«, antwortete Gaffney. »Kann ich das Foto noch mal sehen?«
Duckworth zog sein Handy aus der Tasche und rief das Foto auf. Gaffney starrte es an und sagte: »Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mein Rücken sein soll. Das gibt’s doch gar nicht. Wer könnte Sean denn sein?«
»Ein Mann oder eine Frau«, bemerkte Duckworth.
Gaffney gab ihm das Handy zurück. »Ich bin zu einem Monstrum mutiert.«
Als sie an einem McDonald’s vorbeikamen, kaufte Duckworth ihm am Drive-in-Schalter einen Kaffee und ein Brötchen mit Ei und Wurst. Gaffney verschlang es fast so schnell wie davor die reife Banane.
In der Notaufnahme war nicht viel los. Es dauerte keine zehn Minuten, bis Gaffney drankam. Duckworth sagte Dr. Charles – einem jungen, indisch aussehenden Arzt –kurz, worum es ging, und dass er ihn nach der Untersuchung noch einmal sprechen wolle. Dann verließ er das Gebäude. Er wollte etwas im Internet recherchieren, und der Empfang im Krankenhaus war grottenschlecht.
Er zückte sein Handy, öffnete einen Browser und tippte die Begriffe »Sean« und »Mord« ein. Es gab über eine Million Treffer, doch die ersten Seiten, die er aufrief, lieferten nichts, was ihm relevant erschien. Einige Ergebnisse waren Bücher oder Zeitungsartikel über Mord, deren Verfasser mit Vornamen Sean hieß. Er engte die Suche ein, indem er »Promise Falls« hinzufügte, doch dabei kam gar nichts heraus.
Also kehrte er in die Notaufnahme zurück und setzte sich. Ein paar Minuten später tauchten Brian Gaffney und Dr. Charles wieder auf.
»Wie steht’s denn um unseren Mr Gaffney?«
»Darf ich mit dem Polizisten über Ihre Ergebnisse sprechen?«
Gaffney nickte schicksalsergeben.
»Mr Gaffneys Allgemeinzustand ist gut«, sagte Dr. Charles. »Er ist noch ein bisschen angeschlagen von dem Mittel, mit dem er betäubt wurde, was immer das war.«
»Haben Sie eine Ahnung, was es gewesen sein könnte?«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Aber ich würde Mr Gaffney gern zur Beobachtung hierbehalten und ein paar Bluttests mit ihm machen. Haben Sie eine Ahnung, wer ihn tätowiert hat? Dann könnten wir nämlich feststellen, ob irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, sterile Nadeln und so.«
»Wir wissen nichts«, sagte Duckworth.
Dr. Charles schnalzte mit der Zunge. »Tja, wenn die Geräte mit infiziertem Blut verunreinigt waren, besteht vielleicht das Risiko, dass Mr Gaffney Hepatitis B oder C oder Tetanus bekommt.«
»Ach, Mann«, sagte Gaffney.
»Ich bin da, wenn Sie noch Fragen haben sollten«, sagte der Arzt und entschuldigte sich.
Duckworth legte Brian die Hand auf den Arm, um ihn zu beruhigen. »Ich will ein Foto von Ihnen machen«, sagte er.
»Häh?«
»Ich geh ins Knight’s. Mal sehen, ob sich dort jemand an Sie erinnert.«
Gaffney nickte resigniert. Duckworth knipste ihn mit seinem Handy und vergewisserte sich, dass das Bild brauchbar war. »Soll ich mich mit Ihren Eltern in Verbindung setzen?«
Gaffney überlegte. »Wär vielleicht nicht schlecht«, sagte er schließlich.
»Warum so zögerlich?«
»Es ist …«
»Was ist, Brian?«
»Ich meine … ich schäme mich. Es ist mir peinlich, dass mir das passiert ist.«
»Ist doch nicht Ihre Schuld«, sagte Duckworth, obwohl er sich da nicht hundertprozentig sicher war. Vielleicht hatte Brian ja viel mehr getrunken, als er zugab. Vielleicht hatte ihn jemand mit seiner Zustimmung tätowiert, nur wusste er nichts mehr davon. Doch Barrys Bauchgefühl sagte ihm, dass dem nicht so war.
Gaffney hob die Schultern ein wenig. »Wär vielleicht nicht schlecht, wenn Sie’s ihnen sagen.«
Duckworth gab ihm sein Notizbuch und ließ ihn die Adresse und Telefonnummer seiner Eltern aufschreiben. Er würde den Eltern einen Besuch abstatten, bevor er ins Knight’s ging. Als er aus dem Parkplatz fuhr, klingelte sein Handy. Es war Maureen.
»Hey«, sagte er über sein Bluetooth-Mikro. »Bist du im Geschäft?«
»Ja. Bei uns herrscht grad Flaute.« Maureen arbeitete in einem Brillenladen im örtlichen Einkaufszentrum. »Hab ich eine schlechte Zeit erwischt?«
»Schon in Ordnung.«
»Wie geht’s dir?«
Eine ganz harmlose Frage. Sie hatte sie auch früher schon gestellt, wenn sie ihn anrief. Doch wenn sie jetzt fragte, wollte sie eigentlich mehr wissen, das war ihm klar. Sie wollte wirklich wissen, wie es ihm ging. Wollte wissen, wie er sich fühlte. Wie er zurechtkam.
Auch zehn Monate nach der Rückkehr in seinen Job noch.
Und so wie Maureen fragte auch er sich jeden Tag, wie es ihm eigentlich ging.
»Mir geht’s gut«, sagte Duckworth schnell. »Was gibt’s?«
»Nichts.«
Aber ihr Ton verriet ihm, dass es sehr wohl etwas gab. Und die Person, um die sie sich, nach ihm, die meisten Sorgen machte, war Trevor, ihr gemeinsamer Sohn. Er war jetzt fünfundzwanzig, wohnte wieder bei seinen Eltern und war auf Arbeitssuche.
Eine Zeit lang hatte Trevor als Fahrer für Finley Quelle gearbeitet. Randall Finley, der Firmeninhaber, war vor zehn Jahren Bürgermeister von Promise Falls gewesen, hatte es sich dann aber mit seinen Wählern verscherzt, als seine Affäre mit einer minderjährigen Prostituierten bekannt wurde. Doch letztes Jahr war ihm, nach seinem unwahrscheinlichen Aufstieg zu einer Art Lokalheld, ein Comeback gelungen, und jetzt saß er wieder auf dem Bürgermeistersessel.
Es gab immer noch Zeichen und Wunder. Und, fügte Duckworth in Gedanken stets hinzu, genügend Wahlvieh, das sich für dumm verkaufen ließ.
Wie sein Vater verachtete auch Trevor Finley und alles, wofür er stand, und warf seinen Job in der Wasserabfüllanlage hin, als sich ihm ein anderer bei einem örtlichen Holzhändler bot. Doch leider kränkelte der Bausektor noch immer, und die mangelnde Nachfrage nach Baumaterialien führte dazu, dass Trevor diesen Job drei Monate später wieder verlor. Sechs Wochen behielt er seine Wohnung noch, dann wurde sein Geld so knapp, dass er kündigte. Er zog wieder zu seinen Eltern und machte sich auf die Suche nach Arbeit.
Barry und Maureen hätten natürlich Trevors Miete bezahlen und ihm so die Wohnung erhalten können. Doch beide hatten das Gefühl, sich auf unbestimmte Zeit zu etwas zu verpflichten, was sie sich eigentlich gar nicht leisten konnten, und so boten sie ihm sein altes Zimmer an. Als Trevor das Angebot annahm, sahen sie der neuen familiären Dreisamkeit mit gemischten Gefühlen entgegen, doch wie sich herausstellte, bekamen sie von der Anwesenheit ihres Sohnes recht wenig mit. Meistens ging er abends aus und kam erst nach Hause, wenn Barry und Maureen schon alle Lichter gelöscht hatten.
»Geht’s um Trevor?«, fragte Duckworth.
Er hörte Maureen seufzen. »Er ist in letzter Zeit so anders als sonst.«
»Wie denn?«
»Ist dir nichts aufgefallen?«
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Und dabei heißt es immer, Polizisten seien scharfe Beobachter menschlichen Verhaltens.«
Duckworth war sich nicht sicher, ob sie nur stichelte oder es ernst meinte. Vielleicht beides.
»Da liegen wir aber weit abgeschlagen an zweiter Stelle hinter Müttern«, sagte er.
»Ja, klar, mach dich nur lustig über mich«, schmollte Maureen.
»Ich mach mich nicht lustig über dich.«
»Und ob. Du hältst mich für eine unverbesserliche Glucke.«
»Sag mir doch, was du bemerkt hast, aber mir in meinem Stumpfsinn entgangen ist.«
»Na gut, es ist nichts Konkretes. Aber mir kommt es vor, er zieht sich immer mehr zurück.«
»Es geht ihm halt viel durch den Kopf«, meinte Barry. »Er hat keinen Job und wohnt bei seinen Eltern. Nicht sehr spaßig, oder?«
»Er verbringt so viel Zeit am Computer.«
»Wahrscheinlich studiert er Stellenanzeigen. Heutzutage stehen die ja nicht mehr in der Zeitung.«
»Wahrscheinlich hast du recht.«
Sie hatten beide überlegt, ob Trevor vielleicht eine Ausbildung machen sollte. Nach seiner Rückkehr von einer Europareise mit seiner Freundin hatte er an der Universität in Syracuse Politikwissenschaften studiert, sich wacker geschlagen und seinen Abschluss gemacht. Seine Eltern erwarteten keineswegs von ihm, dass er, in welcher Form auch immer, in die Politik einsteigen würde, hatten aber doch gehofft, dass er mit seinem Abschluss etwas Besseres fände als einen Job als Wasserausfahrer bei einem narzisstischen Arschloch, das jetzt Bürgermeister von Promise Falls war.
»Wenn ich nur wüsste, wo er abends immer hingeht«, sagte Maureen.
»Das wussten wir doch auch nicht, als er nicht bei uns gewohnt hat. Er hat ein Recht auf Privatleben. Was er nachts treibt, geht uns nichts an.«
»Ja, schon. Ich – muss Schluss machen. Kundschaft.«
»Wir hören uns später«, sagte Duckworth.
Als er bei Brian Gaffneys Eltern ankam, war es fast fünf Uhr nachmittags. Sie lebten in einem einfachen, aber gepflegten zweistöckigen Haus, in dessen Einfahrt zwei Mittelklassewagen standen, jeder etwa fünf Jahre alt.
Duckworth klingelte, und Sekunden später öffnete ihm eine korpulente Frau Mitte fünfzig.
»Ja?«
»Ms Gaffney?«
»Stimmt.«
»Ihr Vorname?«
»Constance. Wer sind Sie?«
Er stellte sich vor und zeigte ihr seinen Polizeiausweis, den sie misstrauisch beäugte. Duckworth war es gewohnt, dass die meisten Leute mit mehr oder minder großem Unbehagen seinen Ausweis in Augenschein nahmen – ein Polizist vor der Tür verhieß normalerweise nichts Gutes –, aber Constance Gaffneys Reaktion schien ihm schon übertrieben wachsam.
»Ist Ihr Mann zu Hause?«, fragte er.
»Worum geht’s denn?«, fragte sie zurück.
»Wenn Ihr Mann zu Hause ist, würde ich die Angelegenheit gern mit Ihnen beiden besprechen.«
»Albert? Albert!«, rief sie über die Schulter hinweg ins Haus.
Kurz darauf tauchte ein Mann mit schütterem Haar auf. Albert Gaffney war korpulent wie seine Frau, in den Schultern jedoch so breit, dass sie völlig hinter ihm verschwand, als er sich vor sie drängte.
»Was ist los?«, fragte er und lockerte die Krawatte, die er zu seinem weißen Hemd trug. Er warf rasch einen Blick auf Duckworth und dessen Ausweis und sah plötzlich drein, als hätte er einen schlechten Geschmack im Mund.
»Worum geht’s denn?«
»Um Ihren Sohn«, antwortete Duckworth. »Brian«, fügte er hinzu.
»Was ist mit ihm?«, fragte Constance und trat zur Seite, um den Polizisten ins Haus zu lassen.
»Alles in Ordnung«, sagte Duckworth rasch. »Er ist im Krankenhaus, sie machen da ein paar Tests mit ihm.«
»Tests?«, wiederholte Albert. »Was ist denn passiert?«
»Er wurde … überfallen. Und möglicherweise einige Zeit festgehalten.«
»Was soll das heißen?«, fragte der Vater. »Überfallen? Wurde er … ich meine, hat ihn jemand …?«
Duckworth konnte sich denken, was der Mann fragen wollte. »Er wurde betäubt und …«
Wie beschrieb man, was Brian widerfahren war? Zu sagen, er sei außer Gefecht gesetzt und dann tätowiert worden, war zu wenig. Denn es wurde dem Verbrechen, das an ihm verübt worden war, nicht gerecht. Man musste Brian gesehen haben, um es ganz zu begreifen. Duckworth dachte daran, den Eltern die Fotos zu zeigen, die er mit dem Handy geschossen hatte, doch irgendwie schien ihm das nicht angemessen.
»Das Beste wäre, wenn Sie ihn besuchen würden«, sagte er.
»Um Himmels willen, Albert, schnapp dir die Schlüssel«, sagte Constance Gaffney. Sie warf ihrem Mann einen strengen Blick zu und sagte: »Ich hoffe, du bist zufrieden.«
Albert wollte etwas darauf sagen, überlegte es sich jedoch anders, als er ihren Blick sah, und wandte sich stattdessen an Duckworth.
»Wer war das?«, fragte Albert. »Wer hat meinen Sohn verletzt?«
»Die Ermittlung ist im Gange«, antwortete der Polizist. »Ich möchte Sie was fragen.«
Albert wartete.
»Kennen Sie jemand, der Sean heißt und möglicherweise einen Bezug zu Ihrem Sohn oder Ihrer Familie hat?«
»Sean?«, wiederholte Brian Gaffneys Vater. »Hat der das getan?«
Duckworth schüttelte den Kopf. »Nein. Sagt Ihnen der Name etwas?«
»Nein.« Albert Gaffney warf seiner Frau einen Blick zu und fragte dann: »Ist das Ganze in seiner Wohnung passiert?«
Duckworth verneinte. »Brian sagt, es ist in einer Kneipe losgegangen. Im Knight’s.«
»Siehst du?«, sagte Albert zu Constance, wie um sich zu rechtfertigen. »Es hätte auch so passieren können. Da ist er schon hingegangen, als er noch bei uns gewohnt hat.«
Doch ihr war anzusehen, dass da trotzdem etwas war, für das sie ihm die Schuld gab. »Ich hole meine Tasche«, sagte sie.
»Schlüssel«, sagte Albert, während er seine Hosentasche abklopfte. »Wo, zum Teufel, sind meine Schlüssel?«
Er folgte seiner Frau ins Haus, und Duckworth ging zu seinem Wagen. Da kam ein alter grüner VW Käfer angerattert und blieb vor dem Haus stehen. Die junge Frau am Steuer schaltete den Motor ab, stieg aus und ging auf das Haus zu.
Duckworth fiel wieder ein, dass Brian von einer Schwester gesprochen hatte.
»Sind Sie Monica?«, fragte er sie.
Sie sah ihn misstrauisch an. »Wer sind Sie?«
Er fasste kurz zusammen, was er schon ihren Eltern erzählt hatte, und ließ ihr Zeit, den ersten Schreck über diese Nachricht zu verdauen. »Wann haben Sie zuletzt mit Brian gesprochen?«
»Ich hab ihn gestern angerufen, aber er ist nicht rangegangen. Gesehen hab ich ihn wahrscheinlich vergangene Woche zum letzten Mal. Hab ihn auf der Arbeit besucht.«
»Monica, kennen Sie jemand, der Sean heißt? Einen Bekannten Ihres Bruders?«
»Sean?«
»Genau.«
»Ich kenne niemand, der so heißt. Mann oder Frau?«
»Weiß ich nicht.«
»Wenn es jemand ist, mit dem er sich trifft, dann muss ich diejenige nicht unbedingt kennen.«
»Dieser oder diese Sean ist möglicherweise nicht mehr unter uns.«
»Tot?«
Duckworth nickte. »Hilft das Ihrem Gedächtnis irgendwie auf die Sprünge?«
Sie wollte schon den Kopf schütteln, hielt jedoch inne. »Nein, dieser Sean kann es nicht sein.«
»Was für ein Sean?«
Sie deutete mit einer Kopfbewegung auf das gegenüberliegende Haus. »Das war der Hund der Alten da drüben. Mrs Beecham. Brian hat ihn beim Rückwärtsfahren überfahren. Gleich nachdem er den Führerschein gemacht hatte.«
»Er hat ihren Hund getötet?«
Monica nickte. »Aber das ist schon Jahre her. Eigentlich war es ja ihre Schuld, sie hätte ihn nicht frei rumlaufen lassen sollen. Trotzdem war sie stinksauer deswegen. Aber jetzt wäre ihr das sowieso egal.«
»Wieso das?«
Monica zuckte die Schultern. »Mrs Beecham ist meistens total neben der Spur.«
5
Cal
Ms Plimpton führte mich vom Speisezimmer durch eine Küche, die größer war als meine ganze Wohnung, auf eine rundum mit Fliegengitter geschützte Veranda, von der man auf einen weitläufigen Garten samt Springbrunnen blickte. Die Veranda war mit schicken weißen Korbsesseln herausgeputzt, auf denen prall gefüllte, geblümte Sitzkissen thronten. Vier der Sessel waren besetzt.
Ich hatte mich darauf eingestellt, zwei Personen zu treffen, nicht eine ganze Entourage.
Die Frau in dem mir am nächsten stehenden Sessel war wahrscheinlich Ms Plimptons Nichte, Gloria Pilford. Um die vierzig, weiße Hosen, korallenrotes Oberteil und hochhackige Sandalen. Mit dem auf üppig getrimmten blonden Haar wirkte ihr Kopf zu groß für ihren schmalen Körper. Sie sprang auf, als Ms Plimpton und ich die Veranda betraten, und ihre hohen Absätze gestatteten es ihr, mir direkt in die Augen zu sehen. Sie lächelte mich an, doch es war nur ein krampfhaftes Anspannen der Muskeln, bei dem sich ihr Gesicht wie Krepppapier kräuselte.
Sie hielt mir die Hand hin, und ich ergriff sie.
»Das ist wunderbar«, sagte sie. »Ich freue mich sehr, dass Sie uns helfen werden.«
Ehe ich etwas sagen konnte, hob Madeline warnend die Hand. »Er hat sich bereit erklärt, euch zu treffen, Gloria. Nicht mehr. Fürs Erste.«
Glorias Lächeln erlosch schlagartig, doch gleich darauf rang sie sich ein neues ab. Sie wandte sich den übrigen drei Personen – lauter Männer – zu, die sich nicht erhoben hatten. Nur bei einem von ihnen war ich mir sicher, mit wem ich es zu tun hatte. Es war der Einzige, der noch nicht richtig erwachsen war: Jeremy.
»Mr Weaver, das ist mein guter Freund und Partner, Bob Butler.«
Der erste Mann stand auf. Eins fünfundachtzig, silbernes Haar, breiter Brustkasten und kantiges Kinn, blaue Augen. Knapp fünfzig, oder vielleicht knapp darüber. Maßgeschneiderte Hosen, weißes Hemd mit offenem Kragen, kariertes Sportsakko. Auch er streckte mir die Hand entgegen. Der Druck war fest.
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte er. »Madeline hat nur Gutes von Ihnen erzählt.«
Der zweite Mann erhob sich. »Und das«, sagte Gloria Pilford, »ist Grant Finch.«
Er war der Einzige mit Anzug, und wahrscheinlich war auch die Rolex an seinem Handgelenk die einzige in diesem Raum. Vermutlich gehörte ihm auch der BMW in der Auffahrt. Er war nicht ganz so groß wie Bob Butler, doch sein Händedruck war nicht minder kräftig.
»Ich habe auch nur Gutes gehört«, sagte er mit einem Lächeln, das jeder Buchstabenfee zur Ehre gereicht hätte. Dieses makellose Gebiss hatte ihn wahrscheinlich genauso viel gekostet wie sein Auto. »Sie wissen wahrscheinlich schon, warum ich hier bin. Ich habe Jeremy vor Gericht vertreten.«
»Der berühmteste Strafverteidiger des Landes«, sagte ich.
Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Oder berüchtigtste, je nachdem, wen man fragt. Ein, zwei Wochen, dann ist es vorbei. Dann kräht kein Hahn mehr nach mir, es sei denn, HBO macht in zwanzig Jahren eine Miniserie aus dem Ganzen.«
So wie er es sagte, rechnete er fest damit.
Gloria schob die beiden Männer beiseite, damit ich freie Sicht auf den Jüngling hatte, der in dem Sessel am äußersten Ende der Veranda lümmelte. Mit einer Geste, die Tada! sagte, streckte sie den Arm aus und sagte: »Und zu guter Letzt, mein Sohn, Jeremy.«
Der junge Mann mit dem kurzen schwarzen Haar war schon so weit nach unten gerutscht, dass ich fürchtete, er würde gleich den Boden berühren. Er besaß die Körperspannung von Wackelpudding. Sein Kopf war nur wenige Zentimeter von der Grenzlinie zwischen Sitz- und Rückenkissen entfernt, der Blick starr auf das Mobiltelefon in seinem Schoß gerichtet. Er hielt es in beiden Händen, seine Daumen bewegten sich blitzschnell.
Seine Großtante hatte gesagt, er sei achtzehn, doch er hätte auch Anfang zwanzig sein können. Seine teigige Gesichtsfarbe ließ vermuten, er habe mehr Zeit damit verbracht, auf Displays zu glotzen, als sich auf dem Baseballfeld zu tummeln. Angesichts seiner reptilienartigen Verrenkung war seine Größe nur schwer zu schätzen, aber bestimmt war er kleiner als eins achtzig.
Ohne von seinem Handy aufzublicken, sagte Jeremy: »Hey.«
»Jeremy, ich bitte dich, gib dem Mann die Hand«, forderte seine Mutter ihn auf. Als sei ich ein Hündchen, das er streicheln sollte.
Ich hob die Hand. »Schon gut«, sagte ich. »Nett, dich kennenzulernen, Jeremy.«
Gloria lächelte mich verlegen an. »Bitte haben Sie Nachsicht mit ihm. Er ist müde und steht ziemlich unter Stress.«
»So wie wir alle«, sagte Bob Butler.
Gloria hatte Bob als ihren Freund und Partner bezeichnet. Demnach war er nicht Jeremys Vater.
»Natürlich«, sagte ich.
»Jeremy«, sagte Gloria, bemüht, sich den frischen Klang ihrer Stimme zu bewahren, »kann ich dir was bringen?«
Er brummte etwas.
Sie wandte sich an mich. Ein neuerlicher Anlauf, sich in Gastfreundlichkeit zu üben. »Und Sie, Mr Weaver? Möchten Sie etwas trinken?«
»Für mich nicht, danke«, sagte ich. »Ihre Tante hat Tee gemacht.«
Sie seufzte. »Ich könnte was Stärkeres gebrauchen«, sagte sie leise. »Gehen wir doch in die Küche und unterhalten uns dort weiter.«
Grant Finch legte mir leutselig die Hand auf die Schulter, als wir – alle außer Jeremy – die Veranda verließen. »Wir haben alle ziemlich viel mitgemacht, aber jetzt hat der Albtraum langsam ein Ende«, sagte er.
Kurz darauf hatten wir uns um die Kücheninsel gruppiert, und Gloria öffnete die Tür des überdimensionalen Edelstahlkühlschranks, um eine Flasche Wein herauszuholen.
»Mag jemand?«, fragte sie.
Sie musste allein trinken.
»Vielleicht könnten Sie mir von den Belästigungen erzählen, denen Sie ausgesetzt sind«, sagte ich.
»Es ist ja nicht nur Jeremy«, sagte Gloria, während sie den Korken aus der Flasche zog. Die Flasche war bereits halb leer. »Ich bekomme auch genug ab. Die Leute im Internet sagen unglaubliche Dinge über mich. Dass ich die schlechteste Mutter der Welt bin.« Sie seufzte wieder. »Vielleicht stimmt das ja auch.«
»Ganz bestimmt nicht, Gloria«, sagte Bob. »Gloria liebt Jeremy mehr als alles andere auf der Welt. Sie ist eine wunderbare Mutter. Das kann ich bezeugen.«
Ms Plimpton verzog keine Miene. Sie wandte sich ab und holte das Teegeschirr aus dem Speisezimmer.
Ich sah Bob an. »Sie und Mrs Pilford …« Ich ließ den Satz unbeendet.
Gloria schmiegte sich an Bob, schob ihren Arm unter den seinen und stellte ihre Hand zur Schau, damit ich nur ja nicht den Klunker an ihrem Finger übersah. »Bob und ich sind verlobt. Zurzeit der einzige Lichtblick in meinem Leben.« Sie schnitt eine Grimasse. »Nein, ich nehme das zurück. Dass Jeremy nicht ins Gefängnis muss, das war auch wunderbar.«
Bob lächelte unbehaglich. »Gloria muss zwar noch einiges unter Dach und Fach bringen, bevor wir heiraten können. Aber wir sind schon ein paar Jahre zusammen.«
Gloria nickte. »Ich muss Jack noch loswerden, dann können wir nach vorne schauen. Meinen Ex.« Sie verdrehte die Augen. »Ich warte nur darauf, dass die Scheidung endlich durch ist. Bob ist ja so geduldig. Er ist so gut zu mir.«
Und dann biss sie sich auf die Unterlippe.
»Na, das ist doch großartig«, sagte ich.
»Und mein zweiter Held ist der Mann hier«, sagte sie und zeigte auf Grant Finch. »Wenn er nicht gewesen wäre, säße mein Junge jetzt im Gefängnis.« Sie drückte Bobs Arm. »Und auch Grant habe ich nur dir zu verdanken.«
»Na ja, mir und Galen«, sagte Bob.
Bei der Erwähnung dieses Namens entzog Gloria Bob ihren Arm und ging ein Weinglas holen.
»Galen hat mich an Grant verwiesen«, fuhr Bob fort. »Als Jeremy in Schwierigkeiten geriet, dachte Galen sofort an Grant, und es war eine geniale Empfehlung.«
»Galen?«, fragte ich.
Bob nickte. »Entschuldigen Sie. Galen Broadhurst. Mein Geschäftspartner. Ich bin in der Immobilienbranche, Grundstückserschließung und solche Sachen.«
»Ist er da?«, fragte ich.
»Er wollte eigentlich noch kommen.«
»Ohne Sie hätten wir es nie geschafft, Grant«, sagte Gloria zu Finch und füllte ein langstieliges Glas mit Wein. Ihre Augen wurden schmal. »Auch wenn Sie mich dabei wie eine Idiotin haben aussehen lassen.«
Zum ersten Mal hatte sie etwas gesagt, das klang, als käme es wirklich von Herzen.
»Nun«, sagte Grant, »wir wollten doch alle dasselbe. Jeremy vor dem Gefängnis bewahren. Dieses Schicksal hat er nicht verdient.«
»Ganz bestimmt nicht«, sagte Gloria ausdruckslos.
»Was ist mit Jeremys Vater?«, fragte ich. »Jack haben Sie gesagt?«
Gloria nahm ihren ersten Schluck Wein. Besser gesagt: Stürzte ihn hinunter. »Wir haben uns vor drei Jahren getrennt.« Sie schüttelte den Kopf. »Als Geschäftsmann kann er Bob nicht das Wasser reichen.« Sie machte eine Pause. »Das hatte aber nichts mit unserer Trennung zu tun.«
»Es ist alles sehr kompliziert«, sagte Bob und fügte mit einem gequälten Lächeln hinzu: »Wie auch sonst alles, stimmt’s?«
»Kann man wohl sagen«, pflichtete Gloria ihm bei.
»Und während des Verfahrens?«, fragte ich. »Hat Jack sich irgendwie eingebracht?«
»Eingebracht? Inwiefern?«, fragte Gloria.
Ich zuckte die Schultern. »Finanziell? Moralischer Beistand?«
»Aber klar doch«, sagte Gloria und verdrehte wieder die Augen.
»Wenn du ihn nicht ausgeschlossen hättest, hätte er sich vielleicht mehr um Jeremy bemüht«, sagte Bob Butler. Er sah mich an. »Ich habe den Großteil der Anwaltskosten getragen. Grant Finch kriegt man nicht für ’n Appel und ’n Ei.«
Finch versuchte, so zu tun, als wäre ihm das peinlich, doch es gelang ihm nicht.
»Und auch Galen hat sich an Grants Rechnung beteiligt. Er fühlte sich irgendwie dazu verpflichtet. Ich meine, nichts für ungut, Gloria, aber du allein hättest ihn dir nie im Leben leisten können.«
»Nein«, sagte sie. »Ohne dich hätte ich es nicht geschafft.« Dankbarkeit war aus dieser Antwort nur schwer herauszuhören.
Bob warf die Hände in die Luft. »Wie dem auch sei, ich bin sicher, dass Sie das ganze Drumherum nicht interessiert, Mr Weaver. Vermutlich möchten Sie gern mehr über das wissen, womit wir’s jetzt zu tun haben.«
»Erzählen Sie mir davon.«
»Gloria«, sagte er, »zeig ihm dein Handy.«
Sie kramte in ihrer Handtasche, die an einem der Stühle hing, zog ein iPhone heraus und tippte drauflos.
»So«, sagte sie und gab mir das Handy. »Das ist meine Facebook-Seite. Sehen Sie sich an, was die Leute in meiner Chronik so posten. Es waren noch viel, viel mehr, aber die habe ich gelöscht. Das sind die, die seit dem Frühstück reingekommen sind.«
Ich las, was auf dem Display stand. Ein paar Kostproben:
Du bist das Riesenbaby, nicht dein Sohn.
Schlechteste Mutter der Vereinigten Staaten von Amerika
Kinder müssen wissen, dass alles Konsequenzen hat. Dein dummes Kind kann einem nur leidtun, dass es eine Mutter wie dich hat. Was für eine Riesenscheiße schon deine eigene Mutter gebaut haben muss, damit so ein Arschloch wie du dabei rauskommen konnte.
Und eine einfache, unverschnörkelte Meinungsäußerung: Blöde Fotze.
Gloria, die neben mir stand und alles mitlas, zeigte auf den letzten Post und sagte leise: »Lassen Sie mich den gleich löschen. Ich will nicht, dass Madeline ihn sieht.«
»Dass ich was nicht sehe?«, fragte Ms Plimpton, die gerade das Tablett mit Teetassen, Sahne- und Zuckerbehälter hereinbrachte.
»Nichts«, sagte Gloria. Sie löschte den Kommentar. »Gut, weiter.«
Ich las noch ein paar.
Deine Blage sol grepiren und du auch.
Ihr Sohn ist frei, aber das Mädchen, das er umgebracht hat, wird nicht wieder lebendig. Wie schlafen Sie da nachts?
Eine Kugel in den Kopf wäre noch zu gut für Sie.
Glaubst du, du kannst dich vor uns verstecken? Egal, wohin du gehst, jeder in Amerika weiß Bescheid. Alle haben dich und deine Arschgeburt auf dem Kieker.
Das Gift überraschte mich nicht. Was mich verblüffte, war, wie unbekümmert die Leute auch noch ihre richtigen Namen daruntersetzten.
Ich legte das Handy weg. »Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihre Facebook-Seite zu löschen? Damit geben Sie den Leuten doch erst die Möglichkeit, Sie zu kontaktieren. Nehmen Sie ihnen doch dieses Ventil.«
»Ich muss mich doch verteidigen«, sagte Gloria. »Ich kann doch nicht zulassen, dass die Leute solche Dinge über mich sagen.«
»Sie geben ihnen doch erst die Möglichkeit.«
Sie schloss kurz die Augen und seufzte. Offensichtlich musste sie sich öfter für diese Haltung rechtfertigen.
»Sie würden es so oder so sagen. So weiß ich wenigstens, wer das sagt, und kann darauf reagieren.« Im Winkel ihres rechten Auges bildete sich eine Träne. »Die verstehen das nicht. Die haben doch keine Ahnung.«
»Wie sind diese Leute denn überhaupt Ihre Freunde geworden?«, erkundigte ich mich. »Müssen die Ihnen nicht erst die Freundschaft anbieten, und Sie müssen sie annehmen?«
Grant Finch sah mich genervt an. »Darüber haben wir schon gesprochen.«
»Ich will wissen, wer meine Feinde sind«, sagte Gloria trotzig.
»Das ist, als hätten Sie ihnen Ihre Haustür geöffnet«, sagte ich. »Was ist mit Telefonanrufen? Hat man Sie auch auf diesem Weg bedroht?«
Sie schüttelte den Kopf. »Bob hat darauf bestanden, dass wir uns neue Nummern geben lassen. Geheimnummern. Die Anrufe kamen zu jeder Tageszeit.«
»Es gibt noch mehr als das Zeug auf Facebook. Madeline, hast du deinen Laptop bei der Hand?«