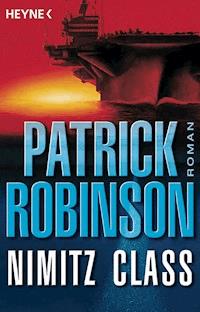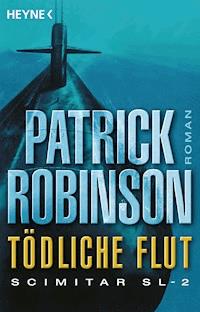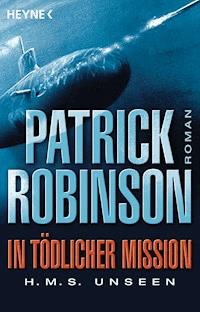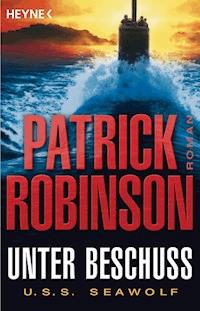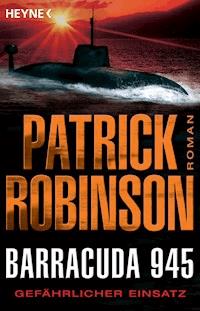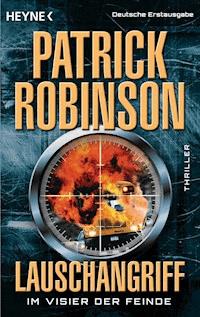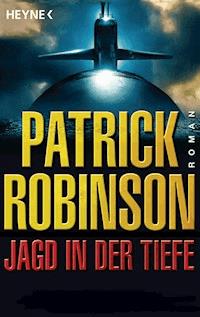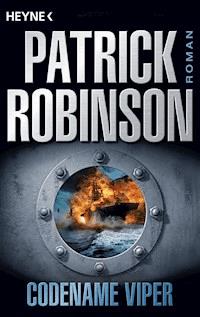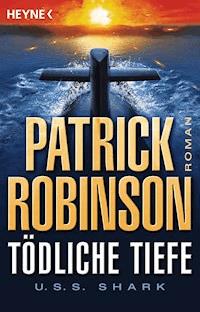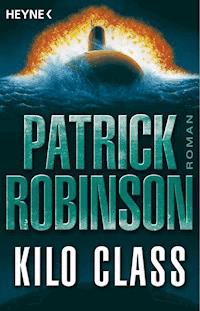
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach Nimitz Class der neue U-Boot-Thriller von Patrick Robinson. China rüstet zur Seemacht auf, um Taiwan an sich zu reißen. Russland braucht Geld und verkauft U-Boote. Die USA sehen ihre Interessen bedroht. Eine tödliche Jagd beginnt und von ihrem Ausgang hängt der Weltfrieden ab.
Ein packendes militärisches Planspiel über die nahe Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 824
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Ein packendes militärisches Planspiel im Jahre 2002: China rüstet zur Seemacht auf, um Taiwan an sich zu reißen. Zu diesem Zweck haben die Chinesen in Russland zehn U-Boote der Kilo-Klasse geordert – hochmoderne Unterwasserfahrzeuge mit dieselelektrischem Antrieb, leise und praktisch nicht zu orten. Für die amerikanischen Flottenverbände in der Formosastraße, die den freien Handel des US-Verbündeten Taiwan gewährleisten sollen, stellen die U-Boote eine tödliche Gefahr dar.
Drei „Kilos“ befinden sich bereits im Besitz der Chinesen, da gibt der amerikanische Präsident seinem Sicherheitsberater, Vize-Admiral Arnold Morgan, freie Hand: Die weitere Auslieferung der U-Boote muss um jeden Preise verhindert werden. Navy und Marine führen die verdeckten Militäroperationen zu Wasser, zu Lande und in der Luft erfolgreich durch – die Katastrophe scheint abgewendet, das Ziel, den amerikanischen Verbündeten vor den Toren Chinas zu schützen, erreicht.
Doch plötzlich stellen die Amerikaner fest, dass Taiwan, scheinbar Spielball internationaler Interessen, heimlich an einer Atombombe bastelt. Die Spur führt zu den unwegsamen Kerguelen-Inseln im südlichen indischen Ozean.
Der Autor
Patrick Robinson, geboren in Kent/England, schrieb zahlreiche Sachbücher zum Thema Seefahrt und schaffte mit seinem Aufsehen erregenden Debüt Nimitz Class auf Anhieb den Durchbruch als Romanautor. Mit den folgenden U-Boot-Thrillern, die zu internationalen Erfolgen wurden und alle bei Heyne erschienen sind, konnte er sich im Genre Militärthriller etablieren. Patrick Robinson lebt heute in Irland und den USA.
Außerdem liegen vor: Barracuda 945/Gefährlicher Einsatz – Tödliche Flut/Scimitar SL-2 – Unter Beschuss/U.S.S. Seawolf – Tödliche Tiefe/U.S.S. Shark
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch widme ich voller Respekt der Unterseebootstreitkraftder U.S. Navy – den Männern, die die Delphine an der Uniformtragen und im tiefen Wasser operieren.
HAUPTPERSONEN DER HANDLUNG
Oberste Militärführung
Der Präsident der Vereinigten Staaten (Oberster Befehlshaber der US-Streitkräfte)
Vice-Admiral Arnold Morgan (Nationaler Sicherheitsberater)
Admiral Scott F. Dunsmore (Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs)
Harcourt Travis (Außenminister)
Rear Admiral George R. Morris (Direktor der National Security Agency)
Oberkommando der U.S. Navy
Admiral Joseph Mulligan (Chief der Marineoperationen [CNO])
Vice-Admiral John F. Dixon (Oberkommandierender der Unterseebootflotte Atlantik [COMSUBLANT])
Rear Admiral John Bergstrom (Oberkommandierender des Special War Command [SPECWARCOM])
USSColumbia
Commander Cale »Boomer« Dunning (Kommandant)
Lieutenant Commander Mike Krause (Erster Offizier)
Lieutenant Commander Lee O’Brien (Ingenieur im Offiziersrang)
Chief Petty Officer Rick Ames (Lieutenant Commander O’Briens Stellvertreter)
Petty Officer Earl Connard (Chefmechaniker)
Lieutenant Commander Jerry Curran (Waffensystemoffizier)
Lieutenant Bobby Ramsden (Sonaroffizier)
Lieutenant David Wingate (Navigationsoffizier)
Lieutenant Abe Dickson (Decksoffizier)
U.S. Navy SEALs
Lieutenant Commander Rick Hunter (Gruppenführer der SEAL-Kampfgruppe und Einsatzleiter)
Lieutenant Junior Grade Ray Schaeffer
Chief Petty Officer Fred Cernic
Petty Officer Harry Starck
Seaman Jason Murray
U.S. Air Force B-52H Bomber
Lieutenant Colonel Al Jaxtimer (Pilot, Fünftes Bombergeschwader von der Minot Air Base, North Dakota)
Major Mike Parker (Copilot)
Lieutenant Chuck Ryder (Navigator)
Central Intelligence Agency (CIA)
Frank Reidel (Chef der Fernost-Abteilung)
Carl Chimei (Agent in Taiwan)
Angela Rivera (Agentin in Osteuropa und Moskau)
Chinesische Militärführung
Der Große Vorsitzende (Oberster Befehlshaber der Volksbefreiungsstreitkräfte)
General Quiao-Jiyun (Generalstabschef)
Admiral Zhang Yushu (Oberbefehlshaber der Marine der Volksbefreiungsstreitkräfte)
Vizeadmiral Sang Ye (Admiralstabschef)
Vizeadmiral Yibo Yunsheng (Befehlshaber der Ostflotte)
Vizeadmiral Zu Jicai (Befehlshaber der Südflotte)
Vizeadmiral Yang Zhenying (Politischer Kommissar)
Kapitän zur See Kan Yu-Fang (U-Boot-Kommandant)
Russische Marine
Admiral Witali Rankow (Admiralstabschef)
Korvettenkapitän Lewizki
Korvettenkapitän Kasakow
Russische Seeleute
Kapitän Igor Wolkow (Tolkatsch-Kapitän)
Iwan Wolkow (sein Sohn und Steuermann)
Oberst Karpow (Offizier auf der Michail Lermontow)
Oberst Borsow (Ex-KGB-Offizier und Offizier auf der Juri Andropow)
Pjotr (Steward)
Torbin (Oberkellner)
Passagiere auf russischen Ausflugschiffen
Jane Westenholz (aus Greenwich, Connecticut)
Cathy Westenholz (ihre Tochter)
Russischer Diplomat
Nikolaj Ryabinin (Botschafter in Washington)
Nukleare Planungsgruppe in Taiwan
Der Präsident von Taiwan
General Chou Jin-Chun (Verteidigungsminister)
Professor Liao Li (Nationaluniversität Taiwan)
Chiang Yi (Baulöwe aus Taipeh)
Crew derYonder
Commander Cale »Boomer« Dunning
Jo Dunning (seine Frau)
Lieutenant Commander a. D. Bill Baldridge
Laura Anderson (seine Verlobte)
Roger Mills
Gavin Bates
Jeff Hewitt
Thwaites Masters
Mannschaft derCuttyhunk
Kapitän Tug Mottram (Kapitän des Forschungsschiffs des Ozeanographischen Instituts in Woods Hole)
Bob Lander (Erster Offizier)
Kit Berens (Navigator)
Dick Elkins (Funker)
Wissenschaftler an Bord der Cuttyhunk
Professor Henry Townsend (Leiter der Expedition)
Professor Roger Deakins (Chef-Ozeanograph)
Dr. Kate Goodwin (vom Massachusetts Institute of Technology)
Zeitungsreporter
Frederick J. Goodwin (Chefreporter der Cape Cod Times)
PROLOG
7. September 2003
Die aus vier Fahrzeugen bestehende Autokolonne verlangsamte ihre Fahrt nur unwesentlich, als sie durch den Eingang an der West Executive Avenue in das Anwesen Pennsylvania Avenue Nummer 1600 einfuhr. Die Wachen am Tor winkten die Limousinen ohne weiteres durch, was von den vier Secret-Service-Agenten im ersten Fahrzeug mit einem knappen Kopfnicken quittiert wurde. Auf den Vordersitzen der nächsten beiden Wagen, die zum Fuhrpark des Pentagon gehörten, saßen jeweils zwei Sicherheitsleute der Navy, und den Schluß der Kolonne bildete wieder ein Fahrzeug mit Secret-Service-Männern.
Vor dem Eingang zum Westflügel warteten vier weitere der 35 im Weißen Haus diensttuenden Agenten und überreichten den Neuankömmlingen aus dem Pentagon ihre Besucherausweise. Nur Admiral Scott F. Dunsmore bekam keinen, denn als Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs verfügte er über einen Dauerausweis fürs Weiße Haus.
Derselben Limousine wie Dunsmore entstieg auch Admiral Joseph Mulligan, der früher einmal Kommandant eines Atom-U-Boots der Trident-Klasse gewesen war und jetzt das Amt des CNO innehatte – des Chief of Naval Operations. Als Chef der Marineoperationen war der großgewachsene Mulligan der Oberbefehlshaber der U.S. Navy.
Der dritte Mann in dem Wagen war Vice-Admiral Arnold Morgan, der brillante, für seinen Jähzorn gefürchtete Leiter der streng geheimen National Security Agency in Fort Meade, Maryland.
Im zweiten Wagen des Pentagon saßen zwei der ranghöchsten Offiziere der amerikanischen Unterseebootwaffe: Vice-Admiral John F. Dixon, Oberkommandierender der Unterseebootflotte Atlantik (COMSUBLANT) und Rear Admiral Johnny Barry, der Befehlshaber der Unterseebootflotte Pazifik (COMSUBPAC). Die beiden waren am frühen Morgen aus dem Bett geholt und nach Washington beordert worden. Jetzt war es 16 Uhr 30.
Fünf so ranghohe Militärs in voller Uniform konnte man selbst im Weißen Haus nur selten auf einem Fleck versammelt sehen. In gewissen Ländern hätte der Anblick des Generalstabschefs, flankiert von zwei der ranghöchsten Befehlshaber und einem hohen Geheimdienstmann, durchaus Gedanken an einen Miltärputsch aufkommen lassen können. Hier allerdings, im Sitz des amerikanischen Präsidenten, spornte er lediglich die Secret-Service-Agenten zu besonderem Diensteifer an.
Der Präsident war zwar nominell der Oberbefehlshaber aller amerikanischen Streitkräfte, aber diese Männer hatten das Oberkommando über die wichtigsten Instrumente der militärischen Macht: die mächtigen, auf allen Weltmeeren patrouillierenden Trägerkampfgruppen und die stets schlagbereiten Atom-U-Boote.
Auch in unmittelbarer Nähe des Präsidenten hatten die Untergebenen dieser Männer wichtige Funktionen inne. So war nicht nur der Landsitz Camp David eine Einrichtung der Marine, sondern auch die bombensichere Krankenstation im Bethesda Marinehospital, die dem mächtigsten Mann der Welt für den Notfall zur Verfügung stand.
Während das 89. Lufttransportgeschwader der Air Force unter dem Befehl des Air Mobility Command die Präsidentenmaschine Air Force One flog und wartete, stellten die US-Marines sämtliche Hubschrauber des Präsidenten. Die Fahrer und Wagen des Weißen Hauses hingegen gehörten zur Army, und das Verteidigungsministerium kümmerte sich um sämtliche Kommunikationsmittel.
Wenn der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs zusammen mit ranghohen Offizieren ins Weiße Haus kommt, ist er viel mehr als nur ein gewöhnlicher Besucher. Er und seine Begleiter sind die Männer, die das höchste Vertrauen in den Vereinigten Staaten genießen und deren Standfestigkeit und natürliche Autorität jeden politischen Machtwechsel überdauert. Sie sind die Männer, die keine Angst vor Politikern haben, Männer, denen auch ein Präsident Hochachtung zollen muß.
Und so war es nicht verwunderlich, daß an diesem sonnigen Spätsommernachmittag der 43. Präsident der Vereinigten Staaten bereits vor den Flaggen der Navy, der Marines und der Air Force im Oval Office wartete, um seine Besucher gebührend zu empfangen.
Verbindlich lächelnd sprach er jeden der fünf Männer mit dem Vornamen an, selbst den Befehlshaber der U-Boote im Pazifik, den er zum ersten Mal sah. »Ich habe schon eine Menge von Ihnen gehört, Johnny«, sagte er, während er ihm die Hand gab. »Es freut mich sehr, Sie endlich auch persönlich kennenzulernen.«
Die Besucher nahmen in fünf bequemen Stühlen vor dem riesigen Schreibtisch des Präsidenten Platz.
»Mr. President«, begann Admiral Dunsmore, »wir haben ein Problem.«
»Das habe ich mir beinahe gedacht, Scott.«
»Das Problem ist uns seit längerem bekannt, aber bisher war es noch nie so dringend. Ehrlich gesagt, wir haben lange Zeit nicht geglaubt, daß es wirklich akut werden würde. Aber genau das ist jetzt eingetreten.«
»Und um was für ein Problem handelt es sich?«
»Um die zehn U-Boote der Kilo-Klasse, die China bei den Russen bestellt hat.«
»Zwei von denen wurden doch bereits ausgeliefert, wenn ich mich nicht irre.«
»Das stimmt, Sir, und zwar während der letzten fünf Jahre. Wir haben jetzt allerdings Anlaß zur Vermutung, daß auch die restlichen acht Boote demnächst nach China gehen sollen. Sie stehen alle in verschiedenen russischen Werften kurz vor der Fertigstellung.«
»Könnten wir denn mit den beiden leben, die die Chinesen schon haben?«
»Ja, Sir. So wie es aussieht, ist meist nur eines davon einsatzbereit. Mehr aber dürfen wir auf keinen Fall tolerieren. Wenn die Chinesen wirklich die restlichen acht U-Boote erhalten sollten, dann könnten sie mit drei, vier von denen die Formosastraße zwischen Taiwan und dem Festland komplett dichtmachen. Selbst wir könnten dann in diesen Gewässern nicht mehr operieren, und wenn das der Fall wäre, dann ist Rotchina in der Lage, innerhalb weniger Wochen die Insel zu erobern und zu besetzen.«
»Großer Gott!«
»Wenn diese Kilos dort sind«, sagte Admiral Mulligan, »dann können wir keinen Flugzeugträger mehr in die Formosastraße entsenden. Die Boote brauchten sich nur auf die Lauer zu legen und ihn zu versenken, und dabei könnten sie sich auch noch darauf berufen, daß wir unberechtigt in chinesische Hoheitsgewässer eingedrungen seien.«
»Hm«, brummte der Präsident. »Sehen Sie denn eine Lösung für dieses Problem?«
»Ja, Sir. Wir müssen die Auslieferung der restlichen acht Kilo-Boote verhindern.«
»Meinen Sie damit, daß wir die Russen dazu überreden sollen, den Auftrag nicht zu erfüllen?«
»Nein, Sir«, sagte Admiral Morgan. »Das ist kaum möglich. Wir haben es zwar schon versucht, aber genausogut könnten Sie einen Drogensüchtigen davon überzeugen, daß er kein Geld für seinen Stoff braucht.«
»Und was sollen wir statt dessen tun?«
»Wir sollten auf andere Weise dafür sorgen, daß die Kilos nicht ausgeliefert werden. Und zwar so lange, bis die Chinesen keine russischen U-Boote mehr haben wollen.«
»Sie meinen, daß wir …«
»Ja, Sir.«
»Aber das würde für internationalen Aufruhr sorgen.«
»Natürlich würde es das, Sir«, antwortete Admiral Morgan. »Aber nur, wenn man wüßte, wer was getan hat. Wenn das aber niemand erfährt …«
»Werde ich es denn erfahren?«
»Nicht unbedingt. Ich kann mir schwer vorstellen, daß wir Sie wegen ein paar verschwundenen dieselelektrischen U-Booten behelligen werden, Sir.«
»Dann gehe ich wohl richtig in der Annahme, daß Sie eine sogenannte ›schwarze Operation‹ planen, meine Herren?«
»Ja, Sir. Eine Aktion, die niemandem zugeschrieben werden kann«, antwortete der CNO.
»Brauchen Sie dafür meine offizielle Zustimmung?«
»Zunächst nicht, Sir. Wir müssen nur sicher sein, daß Sie hinter uns stehen«, sagte Admiral Dunsmore. »Sollten Sie allerdings eine solche Aktion ausdrücklich untersagen, so würden wir das natürlich respektieren. Ihre offizielle Erlaubnis bräuchten wir erst kurz bevor wir zuschlagen. Aber bis dahin ist noch Zeit.«
»Ich verlasse mich wie immer auf Ihre sachliche Kompetenz, meine Herren. Bitte tun Sie das, was Sie für richtig halten. Sie, Scott, halten mich auf dem laufenden.«
Nach diesen Worten betrachtete der Präsident das Gespräch als beendet. Er stand auf und gab den fünf Offizieren die Hand. Als sie das Oval Office verließen, fragte er sich, weshalb er sich in der Gegenwart solcher Männer immer wie ein kleiner Junge fühlte, und sinnierte einmal mehr über die Verantwortung nach, die sein hohes Amt mit sich brachte.
KAPITEL EINS
I
Kapitän Tug Mottram konnte fast spüren, wie der Luftdruck unaufhörlich fiel. Der Wind, der zwei Tage lang beständig mit 40 Knoten aus Nordwest geweht hatte, wurde jetzt böiger und erreichte, wenn er krimpte, bisweilen eine Geschwindigkeit von über 50 Knoten. Erste Schneeschauer fegten bereits auf die hoch gehende, bleifarbene See herab, und alle 40 Sekunden rauschte eine gigantische, eine halbe Meile lange Welle unter dem Kiel des Schiffs hindurch. In weniger als 15 Minuten waren Wind und Meer, die vorher durchaus beherrschbar gewesen waren, richtiggehend gefährlich geworden – ein Phänomen, das man in dieser Gegend des südlichen Indischen Ozeans relativ häufig antraf. Und hier, am Rand der »Brüllenden Vierziger«, wo die Cuttyhunk jetzt quer zum Wind tapfer nach Südosten stampfte, war das Wetter besonders unberechenbar.
Schon vor zwei Tagen hatte Tug Mottram »Luken dicht« befohlen und Anweisung gegeben, daß niemand mehr das Oberdeck achterhalb der Brücke betreten durfte. Daraufhin waren alle wasserdichten Luken und Schotten geschlossen und die Belüftungsöffnungen an Deck dichtgemacht worden. Jetzt blickte der Kapitän durch den Schnee, der sich auf einmal in Graupel verwandelt hatte und vom Wind fast waagerecht durch sein Gesichtsfeld getrieben wurde, aus dem Brückenfenster, dessen Scheibenwischer gerade noch mit dem Ansturm der Elemente fertig wurden. Vorn war alles in Ordnung, aber um das Heck der Cuttyhunk machte Mottram sich Sorgen. Von achtern, aus Nordwesten, rollten immer wieder riesige Brecher heran, die eine starke Kreuzsee von querab noch gefährlicher machte. Mottram hatte den Eindruck, als hätten es die Wellenberge einzig und allein darauf abgesehen, den stählernen Rumpf des 85 Meter langen Forschungsschiffs aus Woods Hole in Massachusetts unter sich zu begraben.
»Fahrt auf zwölf Knoten reduzieren«, befahl er dem Rudergänger. »Bei diesem Seegang ist das bei dem schwachen Heck dieser Gurke eh schon fast zu viel.«
»Sind Sie jemals quergeschlagen, Sir?« fragte Kit Berens, der junge Navigationsoffizier, dessen sonnengebräuntes Gesicht einen besorgten Ausdruck angenommen hatte.
»Und ob. Bei einem ähnlichen Seegang wie jetzt. Damals hatten wir zuviel Fahrt drauf.«
»Gott im Himmel. Und sind Sie da unter eine Welle gekommen?«
»Klar doch. Sie hat das Schiff richtiggehend k. o. geschlagen. Tausende von Tonnen Wasser sind von hinten über alle Decks gestürzt und nach Steuerbord abgelaufen, so daß sich das Ruder aus dem Wasser gehoben hat und damit wirkungslos war. Das Schiff hat sich auf die Seite gedreht, und der nächste Brecher hat uns mit voller Wucht direkt mittschiffs getroffen. Ich dachte, unser letztes Stündlein hätte geschlagen.«
»Mein Gott. Und was war das für ein Schiff?«
»Ein Zerstörer der U.S. Navy, ein Spruance. Achttausend Tonnen. Und ich stand am Ruder, Kit. Ehrlich gesagt, es macht mich verdammt nervös, wenn ich überhaupt nur daran denke. Und dabei ist das jetzt zwölf Jahre her.«
»War das auch in der Antarktis, Sir?«
»Ja. Aber drüben im Pazifik. Tief unten im Süden, aber nicht so südlich, wie wir jetzt sind.«
»Wie hat das Schiff das bloß überstanden?«
»Ach, diese Zerstörer sind unglaublich stabile Pötte. Das Schiff hat sich einfach auf die Seite gelegt und ist dann wieder hochgekommen. So etwas möchte ich mit diesem Baby hier lieber nicht probieren. Wenn wir mit dem einen Fehler machen, sinkt es uns unter dem Hintern weg.«
»Mein Gott!« sagte Kit Berens noch einmal und starrte ehrfürchtig auf die riesige Wasserwand, die sich über dem besonders verwundbaren, tiefliegenden Heck der Cuttyhunk aufgebaut hatte. »Im Vergleich zu einem Zerstörer sind wir doch nur eine Nußschale. Was sollen wir tun?«
»Einfach in Bewegung bleiben, und zwar immer ein paar Knoten langsamer als die Wellen. Und ständig darauf achten, daß das Ruder im Wasser bleibt. Immer hübsch vor den größeren Brechern bleiben und möglichst bald im Windschatten der Inseln Schutz suchen.«
Draußen hatte der Sturm jetzt eine Geschwindigkeit von 70 Knoten erreicht. Das ausgedehnte Tiefdruckgebiet, das in östlicher Richtung um die Antarktis herumwanderte, ließ den vorher beständig aus Nordwesten wehenden Wind erst auf West und nun, während der letzten fünf Minuten, sogar auf Südwest drehen.
Als die Dünung, die aus Nordwesten kam, mit den vom Sturm aufgepeitschten Wogen aus Südwest kollidierte, bauten sich gefährliche, bis zu 25 Meter hohe Kreuzseen auf. Es war ein schwacher Trost für die Leute auf der Cuttyhunk, daß sich diese rauhe See nur auf ein relativ kleines Seegebiet beschränkte, denn Tug Mottram und seine Männer befanden sich genau mittendrin in dem Sturm, der sich mit aller Gewalt auf ihr Schiff stürzte.
Die Graupelschauer gingen nun wieder in Schnee über, und in Sekundenschnelle hatten sich am Steuerbord-Schandeckel kleine, weiße Schneeverwehungen gebildet, die allerdings rasch von den eisigen Wassermassen, die ständig über den Bug kamen, wieder weggespült wurden. Sobald etwas Gischt an Bord spritzte, gefror er augenblicklich zu Eis. Tug Mottram sah, wie der Wind kleine, blitzende Kristalle von der Backbordwinsch blies und daß das Thermometer an Deck auf minus fünf Grad Celsius gefallen war, was bei Windstärke zehn, die jetzt dort draußen herrschte, einer subjektiv empfundenen Temperatur von minus 15 Grad entsprechen dürfte.
Als die Cuttyhunk ihren Bug langsam in die Flanke einer ablaufenden Welle bohrte, gab Kit Berens, der an der Tür zum Funkraum stand, die momentane Position des Schiffs durch: »48 Grad Süd, 67 Grad Ost … Kurs Südost … 100 Meilen nordwestlich der Kerguelen-Inseln.«
Tug Mottram spürte, daß seinem 23jährigen Navigationsoffizier nicht allzu wohl in seiner Haut war, und murmelte leise vor sich hin: »Dieses Ding ist dafür gebaut, daß die Wellen von vorn kommen. Wenn es Probleme gibt, dann hinten am Heck …« Dann sagte er lauter, so daß es der Mann, der neben ihm am Ruder stand, besser hören konnte: »Paß auf die Wellen von querab auf, Bob. Ich möchte nicht, daß uns eine davon aus dem Kurs wirft.«
»Aye, aye, Sir!« antwortete Bob Lander, der ebenso wie Tug Mottram früher einmal Lieutenant Commander bei der Navy gewesen war. Der Unterschied zwischen ihm und dem Kapitän war der, daß Tug nach seinem vorzeitigen Abschied von der Navy im Alter von 38 Jahren der ranghöchste Seeoffizier beim Ozeanographischen Institut in Woods Hole geworden war, während der zehn Jahre ältere Bob seine Laufbahn bei der Marine ganz normal beendet hatte und nun als Erster Offizier auf der Cuttyhunk Dienst tat.
Die vierschrötigen Männer, seit frühester Jugend enge Freunde, stammten beide aus Cape Cod und waren ihr Leben lang zur See gefahren. Damit befand sich das nach der westlichsten der Elizabeth-Inseln benannte Forschungsschiff Cuttyhunk bei ihnen in besten Händen, selbst in einem so fürchterlichen antarktischen Sturm wie gerade jetzt.
»Bißchen windig da draußen, findest du nicht?« sagte Lander. »Soll ich mal nach unten gehen und den Eierköpfen ein paar beruhigende Worte sagen?«
»Gute Idee. Erzähl ihnen, daß die Cuttyhunk für solches Wetter gebaut wurde und daß wir alles voll im Griff haben. Kein Wort davon, daß wir jeden Augenblick umschlagen können, okay? So eine verdammte Kreuzsee habe ich schon lange nicht mehr erlebt … Wir können nicht einmal mehr beidrehen. Aber das darfst du bei den Eierköpfen auf keinen Fall durchblicken lassen. Erzähl denen lieber, daß wir bald in den Schutz der Inseln kommen …«
Unter Deck hatten die Wissenschaftler längst aufgehört zu arbeiten. Der schmächtige, bebrillte Professor Henry Townsend und sein Team saßen in dem geräumigen Salon, der mit voller Absicht direkt in der Mitte des Rumpfs lag: An dieser Stelle nämlich bekamen die Passagiere von dem Stampfen und Schlingern des Schiffs noch am wenigsten mit. Trotzdem fühlte sich Roger Deakins, der leitende Ozeanograph der Gruppe, alles andere als wohl, was allerdings für einen Mann, der das Meer hauptsächlich als Insasse eines tieftauchenden Forschungs-U-Boots kannte, nicht besonders erstaunlich war.
Aber nicht nur ihn hatte der plötzliche Wetterumschwung völlig unvorbereitet getroffen. Erst jetzt machte Kate Goodwin die Runde zwischen ihren Kollegen und verteilte – etwas verspätet – Tabletten gegen Seekrankheit. Die großgewachsene, blonde Wissenschaftlerin mit dem intelligenten Gesicht arbeitete auf der Cuttyhunk an ihrer Doktorarbeit, die sie am Massachusetts Institute of Technology über die Abnahme der Ozonschicht in der südlichen Hemisphäre schrieb. Das MIT forschte zusammen mit dem Ozeanographischen Institut auf diesem Gebiet.
»Ich hätte gern ein halbes Pfund von diesen Dingern«, sagte Deakins.
»Eine reicht völlig«, entgegnete Kate lachend.
»Du weißt ja gar nicht, wie ich mich fühle.«
»Gott sei Dank«, sagte Kate trocken. Ihre kleine Kabbelei mit dem Ozeanographen wurde von einem eisigen Windstoß unterbrochen, der durch die hintere Tür hereinwehte. Kurz darauf stand ein Schneemann, der Bob Landers fröhliches Gesicht trug, mitten im Salon.
»Kein Grund zur Beunruhigung, Leute«, sagte er, während er den Schnee aus seinem Mantel schüttelte. »Nur einer von diesen plötzlichen Stürmen, wie sie in diesen Breiten häufig auftreten. Gegen Abend dürften wir Schutz unter Land finden, und bis dahin ist es am besten, wenn Sie brav hier unten bleiben. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen der Geräusche, die sie von vorn hören, das sind bloß die Wellen, die gegen den Rumpf schlagen. Wir haben gerade ziemlich unruhige See, und die Brecher kommen aus allen Richtungen. Aber denken Sie einfach daran, daß dieser Pott mal ein Eisbrecher war, und so einer wird mit jedem Wetter fertig.«
»Danke, Bob«, sagte Kate. »Wollen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee?«
»Gute Idee«, sagte Lander. »Schwarz, aber mit Zucker, wenn es keine Mühe macht. Und könnte ich gleich noch mal dasselbe für den Kapitän haben?«
»Jawohl, Sir«, sagte Kate. »Wissen Sie was? Ich mache Ihnen gleich eine ganze Kanne zurecht.«
Während Bob Lander auf den Kaffee wartete, unterhielt er sich mit Professor Townsend, aber irgendwie gelang es ihm nicht, sich auf die Worte des anerkannten Spezialisten in Sachen Ozonschicht zu konzentrieren. Mit einem Ohr lauschte er ständig auf die dumpfen Schläge der großen Brecher gegen den Bug, die selbst in einem so schlimmen antarktischen Sturm wie jetzt noch einem bestimmten Rhythmus folgen sollten.
Irgend etwas an diesem Geräusch war aber nicht ganz in Ordnung. Lander kam es vor, als habe es einen hohleren Klang als zuvor, aber vielleicht lag das auch daran, daß man unter Deck alles nur gedämpft wahrnahm. Etwas anderes beunruhigte ihn viel mehr: Die Schläge kamen jetzt viel zu rasch, um allein von den Wellen herzurühren. Lander entschuldigte sich und sagte Kate, daß er gleich wiederkommen und den Kaffee holen werde. Dann trat er wieder hinaus in den Sturm und kämpfte sich den Niedergang zur Brücke hinauf.
Hier draußen konnte er den Sturm erst richtig hören, der um die Aufbauten heulte und in der Takelage kreischte. Mit einem ganz eigenen Rhythmus prallten die Wogen gegen den Bug der Cuttyhunk und ließen prasselnden Gischt auf das vordere Deck herabregnen. In die dumpfen, unheimlichen Schläge mischte sich das Geklapper einer Stahltrosse, die unablässig gegen den achterlichen Mast schlug. Bob Lander sah, daß sich an der Reling und den Abdeckungen der Winschen eine dicke Eisschicht gebildet hatte. Wäre es Winter gewesen, hätte er bald Männer mit Äxten hinausschicken müssen, um das Eis abzuhacken, denn dessen zusätzliches Gewicht hätte das Vorschiff noch tiefer unter Wasser gedrückt. In dieser Jahreszeit aber würde es rasch wieder schmelzen, spätestens dann, wenn der Sturm vorbei war.
»Und so was nennt man hier wohl einen schönen Sommertag«, murmelte Lander vor sich hin, als er die Brücke betrat und wieder auf das merkwürdige Geräusch horchte, das er vorhin unter Deck gehört hatte.
Obwohl es hier oben weniger deutlich zu hören war als unter Deck, hatte auch Tug Mottram es bereits bemerkt. Er drehte sich um, sah Bob Lander an und sagte: »Nimm dir ein paar Leute, Bob, und sieh nach, was da vorn los ist. Aber sei um Gottes willen vorsichtig.«
Lander kletterte wieder hinunter aufs stampfende Deck und holte zwei Seeleute aus dem Aufenthaltsraum der Mannschaft. Die drei Männer zogen sich dünne Neoprenanzüge und pelzgefüttertes, speziell für arktische Bedingungen ausgelegtes Ölzeug sowie Seestiefel und Sicherheitsgurte an. Mit diesen hängten sie sich an die längs über das Vorschiff gespannten Stahlseile an und kämpften sich durch den Sturm zum Bug, wo das Geräusch sehr viel deutlicher und lauter war. Jedes Mal, wenn das Schiff sich aufrichtete, krachte ein mächtiger Schlag gegen den Bug.
»Scheiße!« schrie Bob Lander durch das Heulen des Windes, »das ist wieder der Scheißanker. Er hat sich wieder losgerissen wie in dem Sturm vor Kapstadt. – Wir müssen sofort den Kettenstopper festziehen!« rief er dann Billy Wrightson und Brad Arnold zu. »Und dann gehen wir hinunter in die Farbenlast und schauen nach, ob was kaputtgegangen ist.«
In diesem Augenblick brach eine riesige Welle langsam über den Bug herein, und die drei Männer standen auf einmal bis zu den Hüften im eiskalten Wasser. Nur die Sicherheitsgurte, mit denen sie sich an dem Stahlseil festgemacht hatten, bewahrten sie davor, über Bord gespült zu werden. Die nächsten fünf Minuten zerrten und drückten sie an der Stahlspake, mit dem sich der Kettenstopper festziehen ließ, dann kämpften sie sich zum nächsten Schott und gingen unter Deck nach vorn in die Farbenlast. Auf dem Weg machte Bob Lander sich bereits insgeheim Sorgen, daß der eine halbe Tonne schwere Anker bei seinen Schlägen gegen den Rumpf stärkere Schäden verursacht haben könnte.
Schon als er die Tür zum Vorpiek öffnete, schoß ein riesiger Schwall Seewasser heraus, der die drei Männer umwarf und sich in das untere Deck ergoß. Als Lander sich wieder aufgerappelt hatte, schickte er Wrightson nach achtern zum Maschinisten, damit dieser die Pumpen einschaltete. Dann ging er mit dem anderen Matrosen nach vorn in die Farbenlast.
Ein einziger Blick auf den langen Riß, der sich einen halben Meter oberhalb des Decks in der Bordwand befand, sagte ihm alles, was er wissen mußte. Der schwere Anker hatte sich im Sturm losgerissen und mit der Zeit ein Loch in die Stahlplatten des Rumpfs geschlagen, das sich mittlerweile zu einem Riß erweitert hatte. Dabei war auch die Schweißnaht zwischen zwei Platten an einer Stelle aufgeplatzt, und niemand vermochte zu sagen, wozu das bei einem solchen Seegang noch führen konnte.
Eines allerdings wußte Bob Lander genau: Das Leck mußte so rasch wie möglich provisorisch abgedichtet werden, und dann mußte die Cuttyhunk Schutz unter Land suchen, vor Anker gehen und abwarten, bis der Sturm vorbei war und der Schaden repariert werden konnte.
Er schickte jetzt auch Brad Arnold nach hinten, damit er den Maschinisten verständigte und ihm sagte, er solle sich fünf Männer schnappen und mit ihnen das Leck im Bug abdichten und dann das Vorpiek wasserdicht verschließen.
»Der Anker ist für den Augenblick gesichert, Brad«, sagte er. »Also laufen Sie los. Ich will nicht, daß dieser Riß auch nur einen Zentimeter größer wird oder das Wasser in weitere Abteilungen eindringt. Wenn das Leck vorläufig abgedichtet ist, stellen Sie einen Matrosen als Wache vor das Schott zum Vorpiek.«
Bob Lander begab sich zur Brücke zurück und klärte Tug Mottram über das auf, was dieser ohnehin schon geahnt hatte. »War es wieder der Anker, Bob?« fragte der Kapitän.
»Genau. Wir haben den Kettenstopper wieder festgezogen und mit Draht gesichert. Trotzdem sollten wir Schutz unter Land suchen, denn im Rumpf ist ein Riß, durch den man den Himmel sehen kann. Brad dichtet das Leck gerade provisorisch ab, aber ich schätze, daß das nicht lange halten wird. Der Riß muß geschweißt werden, und das können wir nicht auf See erledigen.«
»Okay. Kit, wie weit ist es bis zu den Kerguelen?«
»Etwa 80 Meilen, Sir. Wenn wir die Geschwindigkeit beibehalten, müßten wir um vier Uhr dort sein.«
»Okay. Überprüfen Sie den Kurs.«
»Der anliegende Kurs ist in Ordnung … Auf dem kommen wir zwölf Meilen nördlich am Rendezvous Rock vorbei und können dann auf der Leeseite in die Choiseul-Bucht einlaufen, wo wir hoffentlich aus diesem Mistwetter herauskommen.«
»Ich schätze, es wird wohl noch ein, zwei Tage so weiterstürmen. Das heißt, daß wir mit schwerer Dwarssee zu rechnen haben. Im Schutz des Gebirgszugs wird es wohl ein bißchen ruhiger sein. Ich schätze, die Eierköpfe sehen es nicht allzu gern, daß sie jetzt nicht rechtzeitig in ihr ersehntes Forschungsgebiet kommen.«
»Da haben Sie recht, Sir, aber wenn uns der Bug abreißt und das Schiff sinkt, sehen die das bestimmt noch weniger gern.«
»Es besteht keine Gefahr für Leib und Leben, Kit«, sagte Bob Lander ruhig. »Wir haben bloß einen verdammt unangenehmen Schaden, den wir so schnell wie möglich beheben sollten. So, ich werde jetzt wieder unter Deck gehen und die Arbeiten im Vorpiek beaufsichtigen.«
Um 19 Uhr 57 ließ Tug Mottram einen kurzen Funkspruch an die Leitstelle in Woods Hole durchgeben: »Position 48.25 Süd, 67.25 Ost. Kurs eins-eins-sieben bei zwölf Knoten. Gehen unter Land, um kleineren Schaden am Bug zu reparieren, der bei schwerem Wetter entstanden ist.«
Um 19 Uhr 58 nahm er Kurs auf die nordwestliche Spitze der Insel Courbet, der Hauptinsel der Kerguelen. Die 300 zu Frankreich gehörenden, meist schnee- und eisbedeckten Inseln und Inselchen liegen praktisch am Ende der Welt, und sind bis auf ein paar Franzosen in der Wetterstation von Port-aux-Français weit unten im Südosten von Courbet praktisch menschenleer. Oft wird dieses gottverlassene, kahle Fleckchen Erde monatelang von keinem Schiff angelaufen. Keine Luftstraße führt darüber hinweg, und keine Militärmacht der Welt hatte bisher auch nur das geringste Interesse daran, dort einen Stützpunkt zu errichten.
So weit offiziell bekannt war, kam seit einem halben Jahrhundert kein U-Boot hier vorbei, und sogar die amerikanischen Spionagesatelliten, die sonst die ganze Welt beäugen, lassen die verlorene Inselgruppe um das 55 Meilen breite und 80 Meilen lange Haupteiland Courbet links liegen. Wären da nicht die großen Brutkolonien der Königspinguine und eine seltsame Kaninchenplage gewesen, dann hätte man sich auf den felsigen Inseln wie auf dem Mond fühlen können. So waren sie lediglich einer der einsamsten Orte auf der Erde, der fast das ganze Jahr über von Stürmen heimgesucht wurde. Mit ihren 69 Grad östlicher Länge und 49.30 Grad südlicher Breite lagen sie so sehr am unteren Rand der »Brüllenden Vierziger«, daß man schon fast von den »Brüllenden Fünfzigern« hätte sprechen können.
Genauer betrachtet sind die Kerguelen nur die Spitzen des Kerguelenrückens, einer unter Wasser liegenden Gebirgskette, die sich vom 47. Breitengrad 1 900 Meilen in südöstlicher Richtung bis an den Ostrand des Shackleton-Eisschelfs erstreckt. Westlich von diesem gigantischen Massiv ist der Ozean mehr als drei Meilen tief, auf der anderen Seite davon hat man sogar mehr als vier Meilen Wasser unter dem Kiel.
Allein der Gedanke daran ließ Tug Mottram erschaudern. Aber er verstand seinen Job, und er wußte auch, welche Bedeutung das Unterwassergebirge, das manchmal auch als Kerguelen-Gaußbergrücken bezeichnet wurde, für die Mission der Cuttyhunk hatte.
Dabei ging es den Wissenschaftlern an Bord nicht um die geologische Formation an sich, sondern um den Krill, ein winziges, krabbenartiges Lebewesen, das über diesen schroffen Unterwassergipfeln in besonders dichten Schwärmen auftritt. Der Krill dient einer ganzen Reihe von Lebewesen als Hauptnahrungsmittel – von Fischen und Tintenfischen über Seehunde bis hin zu verschiedenen Walarten, darunter auch den Buckelwalen. Killerwale wiederum ernähren sich von anderen Walen und Seehunden, und Pinguine von kleinen Fischen und Tintenfischen, die ihrerseits den Krill fressen. Damit ist er das entscheidende Glied in der antarktischen Nahrungskette, bei dessen Verschwinden das gesamte Ökosystem dieser Region kollabieren würde.
Die Wissenschaftler aus Woods Hole beschäftigten sich schon seit Jahren mit dem dramatischen Rückgang des Krills in der Antarktis, und Professor Townsend hatte mit seiner These, daß dieser durch einen Anstieg der ultravioletten Strahlen bedingt sein könnte, weltweit Aufsehen erregt. Schuld daran war seiner Meinung nach das riesige Loch in der Ozonschicht der Erde, das sich jedes Jahr im September über der Antarktis bildete. Darüber hinaus hatten Townsends Forschungen ergeben, daß das Ozonloch mit der Zeit immer größer wurde – eine Eigenschaft, die es mit dem Loch im Bug der Cuttyhunk gemeinsam hatte.
Um seine Theorien zu beweisen, hatte Professor Townsend vor, sechs Tage lang an verschiedenen Stellen des Kerguelenrückens Krill zu fangen und dann einen Monat in der Antarktischen Forschungsstation der Vereinigten Staaten im McMurdo-Sund zu verbringen. Er hoffte zu klären, ob das Phytoplankton, von dem sich der Krill ernährte, durch die UV-Strahlung in Mitleidenschaft gezogen und so eine unabsehbare Reihe von Meerseslebewesen in ihrer Existenz bedroht wurde. Sollte sich bestätigen, daß das Vorkommen des Phytoplanktons im Lauf der letzten Jahre immer weiter zurückgegangen war, so wäre das für Professor Townsend ein schlagkräftiger Beweis dafür, daß das Ozonloch tatsächlich größer wurde. Die New York Times hatte dieser Theorie kürzlich eine ganze Artikelserie gewidmet, so daß jetzt Umweltschutzorganisationen auf der ganzen Welt gespannt die Ergebnisse der Cuttyhunk-Expedition erwarteten.
Tug Mottram blickte hinaus auf die kochende See, die jetzt von Steuerbord auf das Schiff zukam. Der Sturm blies weißen Schaum von den Kämmen der Wogen, der in den Wellentälern grotesk verzweigte Netzmuster bildete.
Der Anker war für den Augenblick gesichert, aber die Männer im Vorpiek hatten immer noch alle Hände voll zu tun, um den Wassereinbruch zu stoppen. Sie hatten zwei große Matratzen über den Riß gelegt und mit kräftigen Hölzern verkeilt, die man für einen solchen Notfall bereits auf die genau passende Länge zugeschnitten hatte. Drei Matrosen, die bis zu den Hüften im Wasser standen, schlugen mit großen Vorschlaghämmern Keile unter diese Hölzer. Weil in dem eiskalten Wasser niemand lange arbeiten konnte, mußten die Matrosen alle drei Minuten abgelöst werden. Dazu kam, daß jedes Mal, wenn das Schiff nach vorn in ein Wellental tauchte, das Wasser in den Bug schwappte und den Männern fast bis an den Hals reichte. Unter diesen Bedingungen dauerte das Abdichten des Lecks, für das man bei gutem Wetter vielleicht zehn Minuten gebraucht hätte, über eine Stunde. Nach weiteren zehn Minuten hatten die Pumpen das eingedrungene Wasser wieder aus dem Rumpf gepumpt, und die durchgefrorenen Seeleute konnten in ihre Quartiere gehen und sich aufwärmen.
Um Mitternacht wechselte die Wache. Bob Lander kam auf die Brücke, und der Kapitän, der den schlimmsten Teil des Sturms abgeritten hatte, ging müde und erschlagen in seine Kabine. Mit seinen 48 Jahren fühlte er sich langsam nicht mehr ganz so belastbar wie noch mit 25, außerdem vermißte er seine umwerfend hübsche zweite Frau Jane, die in Truro, einem Hafen auf Cape Cod, auf ihn wartete. Wie so häufig in den frühen Stunden eines hellen antarktischen Sommermorgens konnte Mottram nicht auf Anhieb einschlafen. Er lag in der Koje und grübelte vor sich hin, bis ihn wieder die Schuldgefühle wegen der Scheidung von seiner ersten Frau Annie plagten. Mit Abscheu dachte er an die schrecklichen, grausamen Halbwahrheiten, die er ihr aufgetischt hatte, um von ihr loszukommen und eine erheblich jüngere Frau heiraten zu können. Als er dann aber wieder Jane vor Augen hatte, beruhigte er sich damit, daß sie das alles hundertprozentig wert gewesen war.
Draußen ließ der Sturm jetzt ein wenig nach. Zwar blies der Wind noch immer mit gut 50 Knoten, aber wenigstens fiel kein Schnee mehr, und an manchen Stellen riß die dichte Wolkendecke etwas auf. Das Schlimmste der Kaltfront hatten sie hinter sich.
Bob Lander oben auf der Brücke konnte sogar ein paarmal die Sonne sehen, die wie ein orangefarbener Feuerball dicht über dem Horizont hing. Das Schiff stampfte mit 17 Knoten Geschwindigkeit auf Kurs eins-drei-fünf in südöstlicher Richtung durch die Wellen. Bald mußte der große Granitfelsen von Îlot Rendezvous in Sicht kommen, der die nordwestliche Einfahrt zur Hauptinsel Courbet markierte. Daß der 70 Meter hohe Felsen manchmal auch »Bligh’s Cap« genannt wurde, ging auf Kapitän Cook zurück, der das Kap 1776 mit der Resolution umsegelt und ihm den Namen seines Navigators gegeben hatte – desselben William Bligh übrigens, der später Kapitän der Bounty wurde. Weil sich aber nachher herausstellte, daß die Franzosen das Kap schon vor Cook entdeckt und benannt hatten, ist Îlot Rendezvous der Name, unter dem es auf den meisten Seekarten verzeichnet ist.
Als Bob Lander es an diesem Morgen kurz vor 3 Uhr zum ersten Mal sichtete, lag es etwa eine halbe Seemeile an Steuerbord vor dem mühsam abgedichteten Bug der Cuttyhunk. Kit Berens, der um 2 Uhr wieder auf der Brücke erschienen war, hatte es bereits auf seinem Radarschirm. »Bleiben Sie noch 40 Minuten auf Kurs eins-drei-fünf, Sir, bis die Spitze von Cap d’Estaing direkt voraus liegt. Dort ist das Wasser tief genug, um die Landzunge ohne Probleme zu umrunden.«
»Danke, Kit. Wie wär’s mit einer Tasse Kaffee?«
»Gern, Sir. Ich will nur noch rasch den Kurs bis in die Choiseul-Bucht berechnen. Auf der Karte sind einige Seetangfelder eingezeichnet, um die wir lieber einen großen Bogen machen sollten. Ich hasse dieses Zeug.«
»Ich auch, Kit. Lassen Sie sich nur Zeit, und kümmern Sie sich nicht um mich. Ich bleibe einfach hier am Ruder und sterbe inzwischen vor Durst.«
Kit Berens kicherte leise vor sich hin. Ihm machte seine erste große Reise mächtig Spaß, und er war Tug Mottram unendlich dankbar dafür, daß er ihn mitgenommen hatte. Mottram erinnerte ihn an seinen Vater, und das lag nicht nur an seinem angenehm ruhigen Charakter, sondern auch daran, daß beide Männer über einen Meter neunzig groß waren und dunkle, gelockte Haare und ein sonnengegerbtes Gesicht hatten. Bei Mottram kam das von den vielen Jahren auf den Ozeanen der Welt, während Kits Vater sein Leben lang in Südtexas nach Öl gebohrt hatte. Kit kamen beide wie Männer vor, auf die man sich hundertprozentig verlassen konnte und die im Gegenzug aber auch verlangten, daß sie sich ihrerseits auf einen verlassen konnten. Ihm war das recht.
Der junge Navigator drückte die Spitzen seines Stechzirkels in die Karte und maß die Entfernung am Maßstab am Kartenrand ab. »Auf der Landzunge gibt es einen großen, flachen Berg«, rief er nach vorn zu Lander. »Hier auf der Karte ist er als Bird Table eingezeichnet. Wenn er in Sicht kommt, sollten wir ein paar Grad nach Süden abdrehen, damit wir geradewegs nach Christmas Harbour kommen. Aber dort werden wir wohl nicht genügend Schutz finden. Ich schätze, wir müssen noch etwas weiter in die Fjorde hineinfahren.«
»Wieso heißt die Bucht eigentlich Christmas Harbour?« fragte Lander. »Ich dachte, hier wäre alles französisch. Müßte sie dann nicht Baie Noël oder so ähnlich heißen?«
»Soviel ich weiß, wurde sie von Captain Cook so genannt, weil er sie am Weihnachtstag 1776 anlief. Etwa zur selben Zeit nannten die Franzosen sie Baie de l’Oiseau. Würde mich übrigens nicht wundern, wenn seitdem niemand mehr hier war. Das hier ist wohl der verlassenste Ort auf der ganzen Welt.«
Um 3 Uhr 37 steuerte Bob Lander die Cuttyhunk um die Spitze von Cap d’Estaing herum. Es war jetzt zwar heller Tag, aber der Wind aus der Antarktis fegte immer noch um die große Landzunge an der Westspitze der Insel. Als das Schiff 15 Minuten später Christmas Harbour erreichte, fand Lander das Wasser von schäumgekrönten Wellen aufgewühlt.
»Das können wir vergessen«, meinte Kit Berens. »Das ist ja der reinste Windkanal hier. Eigentlich müßte das Kap den Sturm abhalten, aber irgendwie wirbelt er um diesen verdammten Berg da drüben herum. Ich schätze, daß es hier verdammt gefährliche Fallwinde geben könnte. Ich schlage vor, wir laufen besser in einen der Fjorde ein.«
»Fjorde?« sagte Bob Lander. »Ich dachte, die gibt es nur auf der Nordhalbkugel.«
»Auf dieser Karte sieht es so aus, als hätten die Kerguelen mehr Fjorde als ganz Norwegen«, sagte Berens. »Ich vermute, daß die Inseln einmal stark vergletschert waren. Die Fjorde führen so weit ins Land hinein, daß es hier keinen Fleck gibt, der mehr als elf Meilen vom Salzwasser entfernt ist. So wie es aussieht, ist die Küstenlinie dieser Inseln länger als die von Afrika.«
Lander lachte. Er mochte den abenteuerlustigen jungen Texaner, der immer genau wußte, wo sie waren, und das nicht nur in Hinblick auf Position, Kurs und Geschwindigkeit. Es war typisch für Kit Berens, daß er erzählen konnte, was Kapitän James Cook und William Bligh vor über zweihundert Jahren in diesen Gewässern gemacht hatten.
In diesem Augenblick kam Tug Mottram zurück auf die Brücke, um seine Wache anzutreten. Wie üblich war er so pünktlich, daß man die Uhr nach ihm hätte stellen können. »Morgen, Leute«, sagte er. »Läßt denn dieser verdammte Wind niemals nach?«
»Bis jetzt noch nicht«, antwortete Lander. »Die Kaltfront hat sich noch immer nicht verzogen, aber wenigstens ist der verdammte Blizzard vorbei. Der Wind weht immer noch aus Südwest, und es ist verdammt kalt da draußen.«
»Kit, haben Sie schon einen Ankerplatz ausgesucht?« fragte der Kapitän.
»Mehr oder weniger«, antwortete der Texaner, ohne von seiner Karte aufzublicken. »Etwa acht Meilen südwestlich von hier gibt es einen Fjord, der Baie Blanche heißt und zehn Meilen lang, eine Meile breit und etwa 120 Meter tief ist. An seinem Ende teilt er sich in zwei Arme, von denen mir der linke, die Baie des Français, recht geschützt vorkommt. Aber der rechte Arm, die Baie du Repos, gefällt mir fast noch besser. Der ist acht Meilen lang, schmal und sehr tief. Dort dürfte es keine Dünung mehr geben, und auf meiner Karte ist auch kein Seetang eingezeichnet. Ich empfehle Ihnen, diesen Fjord zu nehmen, Sir.«
»Klingt gut«, sagte Mottram. »Ach Bob, bevor du in deine Kabine gehst, könntest du dem Maschinisten sagen, daß seine Leute um 8 Uhr mit den Schweißarbeiten beginnen sollen?«
»Wird gemacht. Und dann haue ich mich eine Stunde aufs Ohr, bevor ich mir ein bißchen die Gegend anschaue.«
Kit Berens blickte von der Karte auf und informierte den Kapitän, daß er jetzt über Satellit die Position der Cuttyhunk nach Woods Hole durchgeben und erklären werde, daß sie wegen kleinerer Reparaturen etwa einen halben Tag lang vor Anker gehen müsse.
Im Funkraum, der sich auf der Backbordseite der breiten Kommandobrücke befand, sprach der Funker Dick Elkins, der früher in Boston Fernsehgeräte repariert hatte, gerade mit einer Wetterstation. Kit Berens legte ihm den Funkspruch auf den Tisch. »Interkontinental – direkt nach Woods Hole.«
Jetzt lief die Cuttyhunk in die Baie Blanche ein und kam damit endlich in geschütztere Gewässer. Hier, wo die Berge an der Steuerbordseite den Wind abhielten, gab es keine großen Wellen mehr, und das Stampfen des Schiffs wurde deutlich geringer.
Zurück an seinem Platz, beugte Kit Berens sich wieder über die Karte und maß mit Stechzirkel und Stahllineal einige Entfernungen ab. »Sir, ich würde Sie gern auf drei Dinge hinweisen …«, sagte er dann zu Tug Mottram.
»Schießen Sie los, Kit«, sagte der Kapitän.
»Okay. Wenn wir von dieser Inselgruppe direkt nach Norden fahren würden, stießen wir erst nach 8 500 Meilen auf die Südküste von Pakistan. In westlicher Richtung wäre es fast ebensoweit bis zur Südküste von Argentinien, und im Osten müßten wir 6 000 Meilen fahren, um bis nach Neuseeland zu gelangen, und dann noch mal 6 500 bis Chile. Ich stelle deshalb fest, daß wir uns hier wahrhaftig am Arsch der Welt befinden.«
Tug Mottram brach in Lachen aus. »Und was ist im Süden?«
»Ein echter Albtraum, Sir. Nach 500 Meilen würden wir auf das West-Eisschelf vor der Leopold-und-Astrid-Küste stoßen, wo es noch kälter und windiger sein dürfte als hier. Aber die Kerguelen und die Antarktis haben noch etwas anderes gemeinsam.«
»So? Was denn?«
»Auf beiden wurde noch nie ein Mensch geboren.«
»Meine Güte.«
Um 6 Uhr fuhren sie in den ersten Fjord ein, die Baie Blanche, und von einer Minute auf die andere spürten sie keinen Wind mehr. Das Wasser war ruhig und ohne wahrnehmbare Strömung. Laut Karte war es 400 Fuß tief. Trotzdem ließ Tug Mottram Fahrt wegnehmen, denn in diesen kalten antarktischen Buchten kamen bisweilen die gefährlichsten Eisberge vor, die man sich vorstellen konnte: relativ kleine Blöcke aus klarem Schmelzwasser, die unterhalb der Oberfläche herumtrieben und, anders als die Berge aus weißem Gletschereis, im düsteren, fast schwarzen Wasser so gut wie nicht zu sehen waren.
Nach vier Meilen übernahm Bob Lander das Ruder, während der Skipper hinaus in die eiskalte, aber klare Luft trat und sich den zerklüfteten Fjord ansah. Direkt voraus lag die niedrige Landzunge des Pointe Bras, an der sich der Fjord in zwei Arme teilte. Dahinter ragte der 300 Meter hohe, schneebedeckte Gipfel des Mount Richards auf. Durch sein Fernglas konnte Mottram sehen, wie der immer noch heftig wehende Wind dort den Schnee in langen, weißen Fahnen wegfetzte.
Im Augenblick war die Cuttyhunk sicher vor dem Sturm, aber sollte der Wind auf Nord drehen, würde er direkt die Baie Blanche entlangfegen. Genau aus diesem Grund hatte Kit Berens auch empfohlen, für die Reparaturarbeiten die noch geschütztere Baie du Repos anzulaufen.
Um 6 Uhr 55 fuhr das Schiff mit 70 Faden Wasser unter dem Kiel eine sanfte Linkskurve und glitt in den geschützten Fjord am Fuß des Mount Richards hinein.
Bob Lander verlangsamte die Fahrt auf unter vier Knoten und suchte nach einem geeigneten Ankerplatz, als Tug Mottram zwei alte, verrostete Bojen entdeckte, die in 120 Metern Abstand voneinander 50 Meter von der felsigen Leeküste des Fjords entfernt lagen. »Die kommen ja wie gerufen«, murmelte er und dachte im selben Augenblick daran, daß die graugestrichenen Metallbojen wohl kaum von Kapitän Cook stammen konnten. Dann aber sah er durch sein Glas etwas anderes, was sowohl sein Vorstellungs- als auch sein Begriffsvermögen noch viel mehr überstieg.
Mit einer Geschwindigkeit von etwa 14 Knoten kam ein altes Landungsboot der U.S. Navy direkt auf sie zu, dessen beide 7,62-mm-Maschinengewehre am Bug direkt auf die Cuttyhunk zielten. Mottram fand diesen Anblick alles andere als beruhigend, aber was ihm wirklich zu schaffen machte, waren die großen, rot-weißen Drachenzähne, die an den niedrigen Bug des Boots gepinselt waren. Und noch schlimmer war der Anblick der zehn Besatzungsmitglieder, die allesamt in der Sonne glänzende, weiße Stahlhelme trugen.
»Wo zum Teufel kommen denn die her?« fragte sich Mottram, während er bewegungslos auf dem verlassenen Deck der Cuttyhunk stand. Er vermutete, daß es sich um Franzosen handeln mußte, aber er war sich da nicht sicher. Also rief er Berens und Lander und sagte, sie sollten sich das Boot einmal ansehen.
»Das ist ein altes Boot vom Typ 272«, sagte Lander bedächtig. »So eines habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen.«
Kit Berens, der nicht nur ein aufgeweckter Bursche, sondern auch ein typischer Texaner war, überlegte nicht lange, sondern schnappte sich die Schlüssel zum Waffenschrank. »Ich hole mir eine Knarre!« verkündete er.
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe KILO CLASS erschien bei Century Books Ltd., London
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 02/2007 Copyright © 1998 by Patrick Robinson Copyright © 1999 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration: © Matthew Williams/THE ORGANISATION Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN: 978-3-641-18405-6
www.heyne.de
www.randomhouse.de