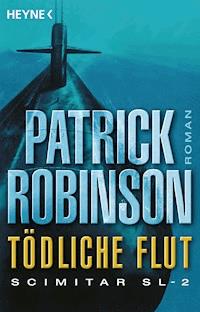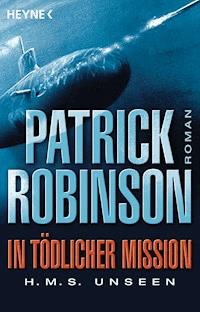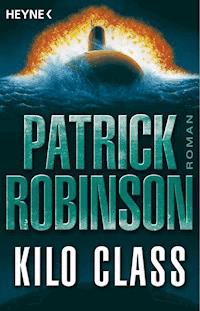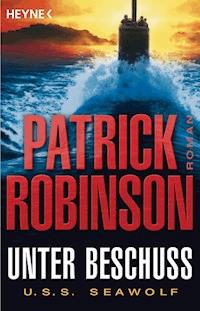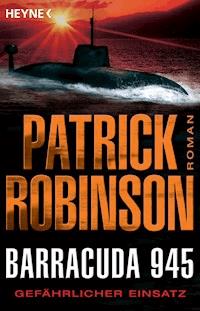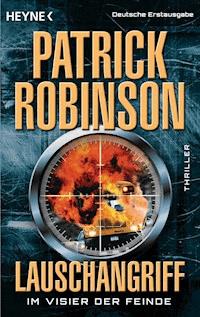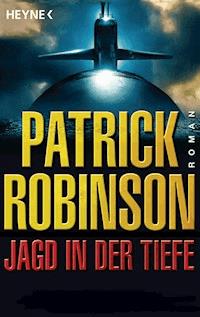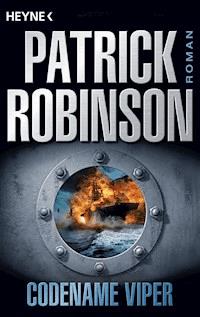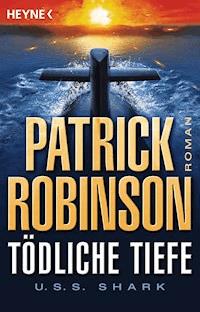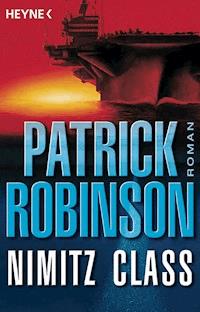
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Kriegsschiff "Thomas Jefferson" ist ein Wunder moderner High-Tech und eine eigene Stadt im Meer. Doch eines Tages geschieht das Unvorstellbare - eine atomare Explosion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Die Thomas Jefferson, ein amerikanischer Flugzeugträger der Nimitz-Klasse, ist das teuerste und aufwendigste Kriegsschiff der Welt. Mit ihren 6000 Besatzungsmitgliedern beherrscht dieses Wunder moderner High-Tech die 1000-Meilen-Zone im Arabischen Meer. Der Auftrag lautet: den Frieden und die Interessen der westlichen Alliierten in dem strategisch wichtigen Gebiet zu sichern. Nichts scheint den streng organisierten Alltag auf dem als uneinnehmbar geltenden Flugzeugträger beeinträchtigen zu können, bis das Unvorstellbare passiert: Ohne Vorwarnung, von einer Minute auf die andere, wird die Thomas Jefferson durch eine atomare Explosion ausgelöscht – und mit ihr die gesamte Besatzung. Eine ganze Nation steht fassungslos vor dieser Katastrophe, und die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer um die Welt. Wie, so fragt man sich, war es möglich, den Verteidigungsapparat der Vereinigten Staaten zu unterlaufen? Und welche Motivation steht hinter dem Attentat? Das Image der Weltmacht steht auf dem Spiel.
Commander Bill Baldridge, dessen Bruder bei dem Unglück ums Leben gekommen ist, leitet die Untersuchungen und findet heraus, dass sich zur fraglichen Zeit ein U-Boot in den Gewässern bewegte. Doch weiß man weder etwas über Herkunft und Besatzung noch über seinen Verbleib nach der Zerstörung des Flugzeugträgers. Sollte es in der Lage sein, einen weiteren Angriff zu führen? Alle Spuren führen über Umwege in den Mittleren Osten. Ein Name kristallisiert sich heraus und lässt die näheren Umstände der Katastrophe erahnen. Die Jagd auf den Provokateur beginnt.
Der Autor
Patrick Robinson, geboren in Kent/England, schrieb zahlreiche Sachbücher zum Thema Seefahrt und schaffte mit seinem Aufsehen erregenden Debüt Nimitz Class auf Anhieb den Durchbruch als Romanautor. Mit den folgenden U-Boot-Thrillern, die zu internationalen Erfolgen wurden und alle bei Heyne erschienen sind, konnte er sich im Genre Militärthriller etablieren. Patrick Robinson lebt heute in Irland und den USA.
Außerdem liegen vor: Barracuda 945/Gefährlicher Einsatz – Kilo Class - Tödliche Flut/Scimitar SL-2 – Unter Beschuss/U.S.S. Seawolf – Tödliche Tiefe/U.S.S. Shark
Inhaltsverzeichnis
Nimitz Class ist in aller Hochachtung den Offizieren und Mannschaften der US Navy und der Royal Navy gewidmet …, all jenen, die in Kriegsschiffen die Meere befahren und sich mitunter auf hoher See höchster Gefahr stellen.
VORBEMERKUNG DES AUTORS
Stellen Sie sich das New Yorker Empire State Building vor, wie es, flach auf die Seite gelegt, mit rund 55 Stundenkilometern über den Ozean kreuzt und dabei mit seinem Radioturm eine gewaltige weiße Bugwelle aufschäumt, und Sie kommen dem Anblick eines amerikanischen 100 000-Tonnen-Flugzeugträgers auf Patrouillenfahrt ziemlich nah.
Das gewaltige, vier Milliarden Dollar teure Kriegsschiff ist rund 335 Meter lang und wird von einem eigenen Atomkraftwerk mit Energie versorgt.
Bei diesem Koloß handelt es sich um einen Flugzeugträger der Nimitz-Klasse, die nach dem in Texas geborenen Admiral Chester W. Nimitz benannt ist, der im Zweiten Weltkrieg jenen Hinterhalt ersann und leitete, durch den die Seemacht der Japaner gebrochen wurde, als im Juni 1942 in der Schlacht um Midway vier von Admiral Yamamotos besten Flugzeugträgern versenkt und 332 seiner Flugzeuge zerstört wurden.
Heute durchstreifen diese modernen US-Flugzeugträger die Meere in seinem Namen und beherrschen in einem Radius von rund 800 Kilometern Luft, Meer und Festland, wo immer sie hinkommen. Aber die Giganten der Nimitz-Klasse reisen nicht allein. Sie werden normalerweise von einer kleinen Flottille von Lenkwaffenkreuzern, Zerstörern und Fregatten sowie zwei Jagd-Unterseebooten begleitet. Diese in klassischer Formation locker arrangierte Trägerkampfgruppe ist bei der Navy unter der Abkürzung CVBG (von Carrier Battle Group) bekannt.
Die Gruppe ist der unangefochtene Herr des Himmels, der Meere und der dunklen, bedrohlichen Königreiche unter den Wellen. Von der Brücke blickt der Admiral, der die Gruppe befehligt, auf das größte, schnellste, tödlichste Kriegsschiff herab, das je gebaut wurde. Er ist der Kriegsherr des 21. Jahrhunderts.
Im Zentrum seiner zehn Oberflächenschiffe umfassenden Gruppe sind 80 Jagdbomber an Deck aufgereiht, und die Lenkwaffen-Eskorten halten sich in der näheren Umgebung auf. Die Atom-Unterseeboote des Admirals bilden weit voraus die Vorhut.
Kleineren Ländern mit militärischem Etat und militärischer Erfahrung – Großbritannien, Frankreich, Deutschland – fehlen die Mittel, auch nur eine einzige vergleichbare Streitmacht aufzustellen. Nicht einmal Rußland mit seiner gigantischen, moribunden Marine kann mit der Macht der amerikanischen Trägerkampfgruppe mithalten. Die USA unterhalten zwölf davon, wobei allein der Unterhalt der Flugzeugträger 440 Millionen Dollar pro Jahr und Schiff kostet.
Fünfundfünfzig Prozent des Geldes, das jährlich von allen Ländern der Welt zusammengenommen für Verteidigungszwecke ausgegeben wird, wendet das Pentagon auf. Jeder Flugzeugträger besitzt eine riesige seefahrende Besatzung von 6000 Mann mit nahezu 600 Offizieren.
Tief in den unteren Decks des Schiffes bereiten die Köche pro Tag 18 000 Mahlzeiten zu, dazu noch den Imbiß für die Mitternachtswache. Dreimal täglich schrillt die Bootsmannspfeife, und man beginnt in einer nahezu unglaublichen Größenordnung, Lebensmittel aus Kisten und Kartons auszuladen. Mitunter werfen die Auspacker mit geübter Hand Hunderte großer, glänzender Dosen voller Ravioli oder Fleischklopse auf einmal den Küchenhelfern zu, und diese geben sie weiter an die Köche.
Ein großer Flugzeugträger ist vom Kiel bis zur Mastspitze ungefähr 24 Stockwerke hoch, besitzt ein rund 80 Meter breites Flugdeck und hat einen Tiefgang von etwa zwölf Metern. Er wird von zwei bei General Electric gebauten Druckwasser-Reaktoren angetrieben; seine Reichweite und die Zeit, die er auf See verbringen kann, ist nahezu unbegrenzt und wird allein durch die Ausdauer der Besatzung eingeschränkt. Zusätzlich gibt es vier Dampfturbinen, die rund 260 000 PS erzeugen. Vier Schraubenwellen, jede so groß wie ein hundert Jahre alter kalifornischer Redwood-Baum, treiben den Träger an.
Von seinen 6000 Besatzungsmitgliedern sind 3184 allein damit beschäftigt, das gigantische Kriegsschiff sicher durch die Meere zu bringen. Das fliegende und fliegertechnische Personal an Bord, das für die Flugoperationen und die Wartung der Maschinen verantwortlich ist, umfaßt 2800 Mann. Der Admiral, dessen Angelegenheit die Strategie und Taktik der Kampfgruppe, die Effizienz der Waffensysteme und die Überwachung eines potentiellen Feindes ist, reist mit einem Stab von 25 Offizieren und 45 Mannschaftsdienstgraden. Seine Operationszentrale ist der Ort, wo das Angriffs- und Verteidigungskonzept der US Navy greifbare Wirklichkeit wird.
Der Admiral kann nach Belieben geballte amerikanische Macht näher an die Grenzen eines Feindes heranbewegen als jeder andere Befehlshaber der Weltgeschichte. Sein Träger ist absolut mobil, autark und für jeden Gegner tödlich. Im Bauch des Schiffes lagern Raketen mit Atomsprengköpfen.
Der Träger wird von AEGIS-Raketenkreuzern flankiert, deren computergesteuerte Waffen anfliegende Angreifer mit bis zu doppelter Schallgeschwindigkeit treffen und vernichten können. Die Zerstörer der Kampfgruppe können mit jeglicher Bedrohung aus der Luft, von der Oberfläche oder aus der Meerestiefe fertig werden. Die Lenkwaffenfregatten mit ihren LAMPS-Helikoptern stellen ein Anti-Unterseeboot-Schleppnetz bereit, das sich in jeder Richtung Hunderte Kilometer weit erstrecken kann.
Die Jagd-Unterseeboote, die nötigenfalls jahrelang unter Wasser bleiben können, patrouillieren Hunderte von Seemeilen ab und machen dem Träger und seinen Begleitern den Weg frei. Ausgerüstet mit teuflisch präzisen drahtgesteuerten Torpedos und Cruise Missiles, sind sie in erster Linie darauf aus, ihre Pendants auf feindlicher Seite zu vernichten.
Ein gewaltiges Elektroniksystem hält die Gruppe in einem dichten Kommunikationsnetzwerk zusammen und meldet von Minute zu Minute, von Operationszentrale zu Operationszentrale, von Schiff zu Schiff den Einsatzzustand dieser beweglichen Zelle fast unvorstellbarer Macht. Die Trägerkampfgruppe ist ohne weiteres in der Lage, gleichzeitig Bedrohungen aus der Luft, von der Meeresoberfläche und aus der Tiefe auszuschalten.
Die Speerspitze ihres Angriffs bildet ihre Bomberflotte – 20 tödlich präzise Allwetter-Flugzeuge, die Erzfeinde jedes den Vereinigten Staaten feindlich gesonnenen Schiffes, dazu 20 überschallschnelle Jagdbomber vom Typ FA-18 Hornet. Um die Kampfgruppe zu verteidigen und/oder den Bombern Jagdschutz zu geben, stehen weitere 20 Jäger bereit – in erster Linie mit Lenkflugkörpern und einer großkalibrigen Kanone bewaffnete F-14 Tomcats und überschallschnelle F-14D Super Tomcats. In einem Notfall können mit den gewaltigen dampfbetriebenen Katapulten zwei dieser Maschinen zugleich vom zwei Hektar großen Flugdeck gestartet werden – von 0 auf 240 Stundenkilometer in zwei Sekunden.
Dazu kommen gewöhnlich vier EA-6B Prowlers, die ebenfalls empfindliche Schläge austeilen können und die einzigartige Fähigkeit besitzen, mit ihren Störimpulsen feindliches Radar vollkommen lahmzulegen und damit jeden Gegner zur leichten Beute zu machen, die somit einem amerikanischen Luftangriff hilflos ausgeliefert ist. Ein weiterer großer Elektronik-Spezialist an Deck ist die S3 Viking, ein Such- und Angriffsflugzeug, das aus der Luft die Meerestiefe sondieren und mit seinen Torpedos ein feindliches Unterseeboot Hunderte Seemeilen von der Hauptgruppe entfernt zerstören kann.
Auf Deck und in den Hangars darunter befindet sich gewöhnlich eine Flotte von acht Helikoptern – Cobra-Kampfhubschrauber, Sea Kings und üblicherweise ein schwergewichtiger CH-53-Transporter, der Angriffs- oder Rettungsteams von bis zu 55 Marineinfanteristen transportieren und absetzen kann.
Der Flugzeugträger selbst ist mit Raketen und Geschützen ausgerüstet; zudem sind die Giganten der Nimitz-Klasse die am schwersten gepanzerten Kriegsschiffe der Welt. Ihr Doppelrumpf und massiv abgeschottete Luftkammern entlang der Wasserlinie machen sie schlicht zu den überlebensfähigsten Kriegsschiffen in der Geschichte der Seefahrt.
Jede Sportmannschaft hat ihren Spielführer: In der CVBG werden die entscheidenden Spielzüge von der E2C Hawkeye angesagt, dem Frühwarn- und Feuerleitflugzeug. Mit seiner gewaltigen linsenförmigen Radarantenne, die über der computerisierten Operationszentrale der Maschine ihre elektronischen Strahlenbündel sendet und empfängt, macht es dieses schwergewichtige Marineflugzeug jeglichem Feind so gut wie unmöglich, sich unentdeckt in einem Umkreis von 1000 Meilen um den Träger zu bewegen.
Die Angriffsmaschinen des Trägers können weit und schnell fliegen; auf der Oberfläche vermag das Schiff selbst bis zu 500 Seemeilen am Tag zurückzulegen und dabei das Meer zu beherrschen, wo immer es hinfährt. Angesichts dessen, daß 40 von 42 Verbündeten der USA durch verschiedene Meere vom amerikanischen Festland getrennt sind, trifft es sich gut, daß 85 Prozent allen Landes auf diesem Planeten und 95 Prozent der Weltbevölkerung in Reichweite einer amerikanischen Trägerkampfgruppe liegen.
Und dennoch vergegenwärtigen sich nur wenige dieser Hunderte Millionen Menschen, daß sie ihr vergleichsweise friedliches und sicheres Leben der eisernen Faust und der Verteidigungskapazität der US Navy zu verdanken haben. Die meisten glauben, diese Sicherheit sei von den Vereinten Nationen geschaffen worden oder von der NATO oder von irgendeinem quasi-europäischen Verteidigungsprojekt. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es die amerikanische Trägerkampfgruppe, die schwimmende Festung, was zählt. Sie ist die Macht, die vermutlich vor den Stränden potentieller Aggressoren auftauchen wird.
Unerreichbar für Angriffe aus der Luft oder von See, mit konventionellen Unterwasser-Waffen praktisch nicht zu versenken, umgeben von einem Wall aus Kampfflugzeugen, Lenkflugkörpern und Ortungselektronik, rund um die Uhr von einem computergesteuerten Radarfeld geschützt, die Heimat seiner eigenen Bomberstreitmacht …
Kein Wort kann präzise die Unüberwindlichkeit eines Flugzeugträgers der US Navy beschreiben außer einem: unverwundbar.
Fast.
HAUPTPERSONEN DER HANDLUNG
Oberste Militärführung
Der Präsident der Vereinigten Staaten (Oberkommandierender der US-Streitkräfte)
General Josh Paul (Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs) Vizeadmiral Arnold Morgan (Direktor der National Security Agency)
Die Trägerkampfgruppe
USS Thomas Jefferson
Konteradmiral Zack Carson (Flaggoffizier)
Captain Jack Baldridge (Einsatzleiter der Gruppe)
Captain Carl Rheinegen (Kapitän der Jefferson)
Lt. William R. Howell (Pilot eines Kampfflugzeugs)
Lt. Freddie Larsen (Radarbeobachter)
Fähnrich zur See Jim Adams (Fangeinrichtungs-Offizier)
Captain Art Barry (Kommandant der USS Arkansas)
Korvettenkapitän Chuck Freeburg (Anti-U-Boot-Offizier [ASWO] auf der USS Hayler)
Lt. Joe Farell (Marinepilot)
Oberkommando der US Navy
Admiral Scott F. Dunsmore (Chef der Marineoperationen [CNO])
Vizeadmiral Freddie Roberts (Vize-CNO)
Admiral Gene Sadowski (Oberkommandierender Pazifik-Kommando)
Admiral Albie Lambert (Oberkommandierender Pazifik-Flotte)
Vizeadmiral Schnider (Leiter des Marinegeheimdienstes)
Vizeadmiral Archie Carter (Kommandant der Siebten Flotte)
Angehörige der US Navy
Korvettenkapitän Bill Baldridge (Marinegeheimdienst)
Korvettenkapitän Jay Bamberg (Adjutant des CNO)
USS Columbia
Fregattenkapitän Cale »Boomer« Dunning (Kommandant)
Korvettenkapitän Jerry Curan (Waffensystem-Offizier)
Korvettenkapitän Lee O’Brien (Ingenieur im Offiziersrang)
Korvettenkapitän Mike Krause (Leitender Offizier)
Lt. David Wingate (Navigationsoffizier)
US NavySEALs
Admiral John Bergstrom (Kommandant, Special War Command [SPECWARCOM])
Lt. Russell Bennett (Zugführer, SEAL-Team Nummer drei)
Fregattenkapitän Ray Banford (Mission Controller bei den SEALs)
Oberleutnant zur See David Mills (Tauchbootführer bei den SEALs)
Politiker und Stab des Präsidenten
Robert MacPherson (Verteidigungsminister)
Harcourt Travis (Außenminister)
Dick Stafford (Pressesprecher des Weißen Hauses)
Sam Haynes (Nationaler Sicherheitsberater)
Louis Fallon (Stabschef des Weißen Hauses)
CIA-Offiziere
Jeff Zepeda (Iran-Experte)
Major Ted Lynch (Finanzspezialist für den Mittleren Osten)
Familienangehörige
Grace Dunsmore (Frau des CNO)
Elizabeth Dunsmore (Tochter des CNO)
Emily Baldridge (Mutter von Jack und Bill)
Ray Baldridge (Bruder von Jack und Bill)
Margaret Baldridge (Jacks Frau)
Angehörige der Royal Navy
Admiral Sir Peter Elliott (Flaggoffizier der U-Boote [FOSM])
Captain Dick Greenwood (Stabschef des FOSM)
Lt. Andrew Waites (Flaggleutnant)
Admiral Sir Iain MacLean (FOSM im Ruhestand)
Korvettenkapitän Jeremy Shaw (Kommandant der HMS Unseen)
Familienmitglieder
Lady MacLean (»Annie«, Gattin von Sir Iain)
Laura Anderson (Tochter von Sir Iain und Lady MacLean)
Hochrangige ausländische Offiziere
General David Gavron (Militärattaché, Israelische Botschaft, Washington)
Vizeadmiral Witali Rankow (Leiter des russischen Marinegeheimdienstes)
Ausländische Marineangehörige
Vollmatrose Karim Aila (Dockwächter, Iranische Marine)
Lt. Juri Sapronow (Russische Marine, Sewastopol)
PROLOG
Mitten in der Ägäis, zwischen dem griechischen Festland und dem langen, westlichen Vorgebirge Kretas, liegt die rauhe und zerklüftete Insel Kithira. Sie ist ein plumper, an der breitesten Stelle über 30 Kilometer messender Felsbrocken inmitten eines leuchtenden Meeres, das wie Diamanten funkelt.
Am östlichen Rand des Mittelmeers herrscht ein klares, transparentes Licht, das selbst das Wasser zu durchfluten scheint. Für Sporttaucher handelt es sich hier um ein Urlaubsparadies, aber für die einheimischen Fischer ist das azurblaue Meer, das die Insel umgibt, ein harscher, unversöhnlicher Ort. Die Fische bleiben zunehmend aus. Und das Leben ist so schwer wie nur je.
Es war fünf Uhr früh an einem heißen Morgen Anfang Juli, und die Sonne ging gerade auf. Ein Fischerboot segelte dicht am felsigen Strand auf der Südseite entlang. Oben auf der Backbordseite des Bugs saß der 16jährige Dimitrios Morakis und ließ die Beine über das Schanzkleid baumeln. Er steckte bis zum Hals in Schwierigkeiten.
Am Nachmittag zuvor hatte er es geschafft, das einzige gute Netz zu verlieren, das seine Familie besaß, und nun hockte sein Vater, Stephanos, unrasiert und brummig an der Ruderpinne. Insgeheim war der Mann stolz auf seinen goldhäutigen Sohn. Er schaute auf die Römernase des Jungen, ein Spiegelbild seiner eigenen, und die großen Hände, die eigentlich zu kräftig waren für den schlanken, jugendlichen Körper – das genetische Erbe des Jungen aus einer langen Ahnenreihe von kithiranischen Fischern.
Nichtsdestoweniger war Stephanos noch immer gereizt. »Wir sollten es lieber finden«, sagte er überflüssigerweise. Und so glitten sie in einer leichten Morgenbrise dahin, gegen die klatschenden kleinen Wellen, während weit drüben im Osten die Landmassen für Augenblicke hinter einem durchsichtigen Schleier aus Scharlachrot und Violett aufzusteigen schienen.
Das Netz fand sich mehr oder weniger dort, wo Stephanos es erwartet hatte, von den unwandelbaren Strömungen der Ägäis gegen einen gebogenen Felsvorsprung geschwemmt. An dieser Stelle waren über die Jahrhunderte schon allerhand Netze angespült worden.
Es gab nur ein Problem: Das Netz hing fest. Obwohl er sich fast eine halbe Stunde lang im Wasser abmühte, konnte Dimitrios es nicht losbekommen. »Es hat sich ein ganzes Stück weit drunten verheddert«, rief er seinem Vater zu. »Ich komm zurück aufs Boot, und dann tauche ich mit einem Fischmesser runter.«
Drei Minuten später durchbrach der Junge mit einem Kopfsprung die Wasseroberfläche und strampelte sich nach unten. In der kristallklaren Tiefe fand er das Netz, verschlungen und in einer Spalte zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Es blieb keine andere Möglichkeit, als es loszuschneiden.
Er streckte die linke Hand aus, um festen Halt zu bekommen, und hackte mit dem Messer nach der Seite. Das Netz kam frei, und Dimitrios zerrte die verdrillte Schnur aus der V-förmigen Lücke zwischen den Felsen. Er war jetzt 24 Sekunden unter Wasser gewesen: Er mußte wieder auftauchen.
Sein Weg wurde von einem schweren Gewicht auf seinen Schultern blockiert. Er drehte sich, schob zwei große schwarze Stiefel weg und sah zu seinem Entsetzen, daß in den Stiefeln ein ausgewachsener, ziemlich toter menschlicher Leichnam steckte, der sich mit einem Arm in den uralten Felsen von Kithira verfangen hatte.
Der andere, skelettartige Arm schaukelte frei im Wasser. Er war von Fischen angefressen worden und schwankte in der Morgentide hin und her. Dimitrios schaute gebannt auf den weißen, aufgedunsenen Kopf mit den leeren Augenhöhlen: Das Fleisch der einen Gesichtshälfte war bis auf die Schädelknochen verschwunden, aber die Zähne waren noch da. Der angenagte Mund schien ihn durch das klare Wasser grotesk anzugrinsen. Es war wie eine Geistererscheinung, die sich der Teufel höchstpersönlich ausgedacht hatte.
Dimitrios würgte es vor Ekel, während er den grausigen Kadaver anstarrte, der weiter sein entsetzliches Zeitlupenballett unmittelbar unter der Wasseroberfläche vollführte: Der eine Arm und beide Beine hoben und senkten sich in der sanften Dünung, und der Körper wurde von den enggebündelten Unterwasserstrahlen des klaren ägäischen Sonnenlichts angestrahlt wie von einem Scheinwerfer.
Dann drehte Dimitrios sich um und strampelte mit der Hektik der wahrhaft Verängstigten los, panisch nach Luft verlangend, angetrieben von der lächerlichen Vorstellung, daß das Gespenst irgendwie eine Möglichkeit finden würde, ihm zu folgen. Unterwegs sah er nach unten, und dabei bemerkte er, wie die Sonne einen hellen Lichtpunkt auf dem dunkelblauen Pullover aufscheinen ließ, der den gräßlichen weißen Ballon der Wasserleiche bedeckte – der schwache Reflex auf einem winzigen, rund fünf Zentimeter langen silbernen U-Boot-Abzeichen, in das ein fünfzackiger roter Stern eingelegt war.
KAPITEL EINS
22. April 2002. Indischer Ozean.
An Bord des Flugzeugträgers USS Thomas Jefferson.
9S 92E. Fahrt 30.
Sie hatten ihn jetzt schon zweimal abgewinkt. Und jedesmal hatte Lieutenant William R. Howell behutsam den Leistungshebel seiner F-14 Tomcat nach vorn geschoben, den großen Abfangjäger nach Steuerbord wegsteigen lassen und dabei beobachtet, wie die Nadel des Fahrtmessers ohne jeden Ruck von 150 auf 280 Knoten kletterte. Die Beschleunigung war kaum zu spüren, doch binnen Sekunden sah der Lieutenant, wie sich die sechsstöckige »Insel« des Flugzeugträgers in einen zentimeterhohen Fingerhut verwandelte, der sich schwarz gegen den blauen Himmel abzeichnete.
Die tiefe Stimme des auf dem Heck des Trägers stehenden Landesignal-Offiziers mit dem schleppenden Utah-Akzent klang nach wie vor ruhig: »Tomcat zwei-null-eins, wir haben immer noch Schmutz auf dem Deck … muß Sie noch mal abwinken … bloß ausgelaufenes Öl … dies ist kein Notfall, wiederhole: kein Notfall.«
Lt. Howell sprach langsam und gelassen: »Tomcat zwei-null-eins. Roger. Ich dreh noch ’ne Runde. Neuer Anflug aus zwölf Meilen Entfernung.« Er zog sanft die Nase des Jägers hoch, nur ein bißchen, und spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Es war nie mehr als ein flüchtiges Gefühl, aber es erinnerte einen jedesmal daran, daß auf hoher See ein Flugzeug auf der schmalen, abgewinkelten, rund 230 Meter langen, stampfenden Landebahn aufzusetzen für jeden Piloten eine Geschicklichkeits- und Nervenprobe auf Leben und Tod bleibt. Die meisten Anfänger brauchen ein paar Monate, bis ihnen nicht mehr nach jeder Landung die Knie zittern. Piloten, denen es an der nötigen Geschicklichkeit oder Nervenstärke mangelt, arbeiten gewöhnlich am Boden, kutschieren Frachtflugzeuge oder sind tot. Howell wußte, daß auf amerikanischen Flugzeugträgern pro Jahr rund 20 Maschinen zu Bruch gingen.
Vom Rücksitz murmelte der Radarbeobachter, Lt. Freddie Larsen: »Scheiße. Da unten sind um die hundert Mann nun seit ’ner halben Stunde damit beschäftigt, ’nen Ölfleck wegzumachen – was zum Teufel ist da eigentlich los?« Keiner der beiden Flieger war auch nur einen Tag älter als achtundzwanzig, aber sie hatten bereits die Nonchalance des Marinefliegers angesichts des plötzlichen Todes bei Überschallgeschwindigkeit perfektioniert. Insbesondere Howell.
»Keine Ahnung«, sagte er, während er die Tomcat wie eine Gewehrkugel durch die vereinzelten, tiefhängenden Wolken jagte, die an seinem monströsen, mittlerweile rund achteinhalb Kilometer pro Minute schnellen Kampfflugzeug mit Doppelleitwerk vorbeischossen. »Haste jemals gesehen, wie ’n großer Jäger auf ’nem Trägerdeck in ’ne Öllache geraten ist?«
»Nee.«
»Kein schöner Anblick. Wenn er ins Schlittern gerät, haste ’ne echt gute Chance, ’nen Haufen Leute umzubringen. Vor allem, wenn er mit irgendwas kollidiert und in Brand gerät, was nicht ausbleiben dürfte.«
»Versuch das zu vermeiden, ja?«
Freddie spürte, wie die Tomcat an Schub verlor, nachdem Howell sie in eine Linkskurve legte. Er spürte den vertrauten Andruck schwächer werdender Triebwerke und stemmte seine Schultern gegen das Gieren der Maschine, wie er es früher beim Motorradfahren getan hatte.
Die F-14 ist ohnehin nicht viel mehr als ein Motorrad mit rund 20 Metern Flügelspannweite. Bei niedrigen Geschwindigkeiten überraschend windempfindlich, zwei steinharte Sitze, kein Komfort, aber ein Antrieb, der leistungsfähig genug ist, sie in eine Mach 2 schnelle Rakete zu verwandeln – 1400 Knoten, kein Problem, bis an die Grenze des persönlichen Leistungsprofils, von dem das Überleben des amerikanischen Jagdfliegers abhängt.
Howell, der die Geschwindigkeit noch immer bei knapp 280 Knoten hielt, ging in eine weite Kurve. Die Tomcat legte sich m nahezu 90 Grad auf die Seite, während hinter ihm die Triebwerke heulten, als versuche der Lärm ihn einzufangen und zu verschlingen. Den Träger vor sich konnte er nicht mehr ausmachen, weil die verstreuten weißen Wolken ihm die Sicht nahmen und dunkle Schatten auf das blaue Wasser warfen. Unter den beiden Fliegern lag einer der einsamsten Seewege der Welt, das rund 5500 Kilometer breite Gebiet des zentralen Indischen Ozeans, das sich zwischen der Insel Madagaskar und der felsübersäten Westküste von Sumatra erstreckt.
Der US-Flugzeugträger und seine Eskorte – zusammen bildeten sie einen kompletten, zwölf Schiffe starken Kampfverband, zu dem auch zwei Atom-Unterseeboote gehörten – liefen auf die amerikanische Marinebasis auf Diego Garcia zu, einem winzigen Atoll rund 750 Kilometer südlich des Äquators, die den einzigen sicheren anglo-amerikanischen Hafen in der gesamten Region darstellt.
Das Seegebiet war wie geschaffen für amerikanische Kampfgruppen – ein Ort, wo die kritischsten Admiräle und ihr Stab neue Raketensysteme und neue Kriegsschiffe austesteten und immer wieder ihre Spitzenpiloten vom Flugdeck katapultierten – von 0 auf 168 Knoten in 2,1 Sekunden. Die Gegend war nichts für Zartbesaitete. Es handelte sich um einen simulierten Kriegsschauplatz, der ausschließlich für die Allerbesten entworfen worden war, die das Land hervorbringen konnte – Männer, die das Zeug zum »Helden der Nation« hatten, um Tom Wolfes unsterbliche Formulierung zu verwenden. Jedermann dient dort draußen sechs endlose Monate an einem Stück.
Lt. Howell ging bis auf 1200 Fuß hinunter und sprach erneut mit dem Fluglotsen des Trägers. »Tower, hier Tomcat zwei-null-eins bei acht Meilen. Neuer Anflug.« Er faßte sich kurz, und wieder begann der Jet sachte an Höhe zu verlieren, während die Triebwerke fast jenes durchdringende, kreischende hohe C von sich gaben, das ein Regal voller Weingläser zersplittern könnte. Isoliert hinter Schutzbrille und Kopfhörern suchte Howell den Horizont nach dem 100 000-Tonnen-Flugzeugträger ab.
Seine Sprechanlage knisterte. »Roger, Tomcat zwei-null-eins. Ihr Deck ist jetzt klar zur Landung, kann Sie sehen … Fliegen Sie weiter an, achten Sie auf Kurs und Höhe. Böiger Wind um 30 Knoten aus Südwest. Wir halten immer noch genau rein. Alles bereit für Sie.«
»Roger, Tower … sechs Meilen.«
Alle Piloten der Navy und der Air Force haben eine spezielle, lässige »Was-soll’s«-Art, Nachrichten aus ihren schnellen Kampfflugzeugen zu übermitteln, eine Angewohnheit, von der gelegentlich behauptet wird, sie sei unmittelbar Amerikas berühmtestem Fliegeras abgeschaut worden – General Chuck Yeager, der 1947 als erster Testpilot mit seiner hochgeheimen Bell X-1 die Schallmauer durchbrochen hat.
Fast jeder junge Marineflieger legt sich, wenn er mit dem Tower spricht, eine Art schleppenden Dialekt wie ein Bauernbursche aus West Virginia zu – haargenau so, wie er sich vorstellt, daß General Yeager es gesagt haben könnte – gaaanz langsam, eiskalt im Angesicht der Katastrophe … »Hab ’nen kleinen Flameout im guten alten Steuerbordtriebwerk; ich stell’s dann halt ab und bring sie mit bloß einem runter. Dreht mal besser das Flugdeck ’nen Tick oder zwei, macht’s mir einfacher mit dem Seitenwind. Weiter kein Problem.«
Lieutenant William R. Howell konnte den General besser imitieren als »irgendeiner von den Jungs«. Und müheloser. Denn eigentlich war er gar nicht Lt. William R. Howell. Er war viel eher Billy-Ray Howell, dessen Vater – ein ehemaliger Bergmann und Angehöriger der Southern Methodist Church – jetzt den Krämerladen der gleichen Stadt betrieb, aus der auch Chuck Yeager stammte – Hamlin, ein Ort mit weniger als 1000 Einwohnern, der oben in den Tälern am Westrand der Appalachen lag, direkt am Mud River und nahe der Ostgrenze von Kentucky in Lincoln County. Wie Chuck Yeager redete Billy-Ray über »die Täler«, angelte im Mud River, war der Sohn eines Mannes, der in seinem Leben ein paar Bären geschossen hatte: »Kann’s kaum abwarten, heimzukommen und Daddy wiederzusehen.«
Wenn er den Steuerknüppel einer F-14 in der Hand hatte, war Billy-Ray Howell General Yeager. Er dachte wie er, sprach wie er und handelte so, wie er fest annahm, daß es der General in einem Notfall tun würde. Daß der große Chuck seinen Abschied genommen hatte und nach Kalifornien gezogen war, spielte da keine Rolle. Soweit es Billy-Ray betraf, bildeten er und Chuck Yeager in der Luft eine unausgesprochene, mystische Partnerschaft zweier Männer aus West Virginia, und er selbst, Billy-Ray, war eine Art Thronerbe. In seinen Augen verlieh das gute alte Landleben draußen zwischen den Hickory- und Walnußbäumen von Lincoln County einem Jungen einen zähen Kern. Und er war »sich verdammt sicher, daß Mr. Yeager da wohl zustimmen würde«.
Diese Strategie hatte sich auch ausgezahlt. Billy-Ray hatte seinen Schuljungentraum verwirklicht: Marineflieger zu werden. Während Jahren des Studiums, Jahren der Ausbildung hatte er immer zu den Klassenbesten gehört. In der Marinefliegerei wußte jeder, daß es der junge Billy-Ray Howell noch weit bringen würde. Man hatte es gewußt, seit er sich an der US Naval Academy sein Ingenieursdiplom verdient hatte.
Als er seine Jet-Ausbildung begann und in den alten T2 Buckeyes am Himmel über Whiting Field, östlich von Pensacola im Nordwesten Floridas, herumkurvte, hatte es niemanden überrascht, wie gut er war.
Und nun war die Stimme, die in die Flugleitzentrale drang, nahezu identisch mit der von General Yeager. Ihr ruhiger Hinterwäldlerton verriet keine Nervosität: »Tower, Tomcat zwei-null-eins, vier Meilen. Hier oben ist was nicht so ganz auf der Reihe. … Warnlicht fürs Fahrgestell flackert ’n bißchen. Konnte nicht spüren, wie die Räder einrasten. Aber vielleicht ist ja bloß was mit ’m Birnchen.«
»Tower an Tomcat zwei-null-eins, Roger. Setzen Sie den Anflug fort, und bleiben Sie etwa 50 Fuß über Deck, 200 Knoten. Dann können die Jungs sich das Fahrwerk aus der Nähe ansehen.«
»Roger, Tower … bleibe auf Kurs.«
Draußen auf dem ungeschützten und windgepeitschten Flugdeck funkte der LSO – der Landesignal-Offizier – dem Piloten Instruktionen zu. Er konnte sehen, daß Tomcat 201 noch ungefähr 45 Sekunden entfernt war, eine heulende, 20 Tonnen schwere Bestie von einem Flugzeug, die durch die unberechenbaren Böen über dem Indischen Ozean heranbockte, während der Pilot versuchte, sie auf einem Gleitpfad zwei Grad über der Horizontalen zu halten. Es herrschte hoher Seegang, und das gesamte Schiff, das 15 Knoten lief, stampfte um etwa drei Grad, je anderthalb nach jeder Seite der Waagrechten; das heißt, daß sich die Enden – Bug und Heck – alle 30 Sekunden um rund 18 Meter hoben und senkten. Jedes heimkehrende Flugzeug würde es höllisch schwer haben, in den heftigen, heißen Wind hinein anzufliegen – und im genau richtigen Moment aufzusetzen, würde das Geschick und die Tüchtigkeit eines jeden Piloten auf die Probe stellen. Und das mit Fahrgestell.
Der LSO – Lieutenant Rick Evans, ein schlaksiger Jägerpilot aus Georgia – stand nun draußen auf der ungeschützten hinteren Backbordseite des Trägers und hielt sein Fernglas auf Tomcat 201 gerichtet. Er konnte bereits sehen, daß das Fahrwerk nicht unten war, und die Landeklappen, sah er, waren es auch nicht. Ihm schwirrte der Kopf. Er wußte, daß Billy-Ray Howell in Schwierigkeiten war. Ein defektes Fahrgestell war schon immer der Alptraum jedes Fliegers, ob Zivilist oder Soldat. Aber hier draußen war es hundertmal schlimmer.
Ein Kampfflugzeug setzt nicht entlang des nahezu ebenen Gleitpfads zur Landung an, dem zivile Linienjets folgen, wenn sie einschweben und sich dann ein paar Fuß über einer kilometerlangen Rollbahn »durchsacken« lassen. Hier draußen ist dazu keine Zeit. Und auch nicht viel Platz. Navy-Piloten knallen ihre 20 Tonnen schweren Tomcats bei 160 Knoten mit gesenktem Fanghaken direkt aufs Deck und beten dabei, daß der Haken das Fangseil erwischt.
Die abwärtsgerichteten Kräfte auf das Fahrwerk sind dabei astronomisch. Es ist ein überdimensionaler Stoßdämpfer, dazu gebaut, den Ansturm der gesamten Masse des Flugzeugs zu vernichten. Wenn der Haken nicht greift, hat der Pilot eine zwanzigstel Sekunde lang die Chance, es sich anders zu überlegen und »durchzustarten« – den Nachbrenner zu zünden, über den Bug davonzuschießen und mit einem beiläufigen »Ich flieg dann noch mal an« nach Steuerbord wegzusteigen.
Das kleinste Problem mit dem hydraulischen Verriegelungsmechanismus bedeutet, daß die Landung abgebrochen wird und man das Flugzeug fast ohne Ausnahme abschreiben kann, weil die Navy eher einen 35 Millionen Dollar teuren Jet aufgibt, als zwei Flieger umzubringen, deren Ausbildung pro Kopf 2 Millionen gekostet hat. Außerdem ist es ihr weitaus lieber, das Flugzeug ins Meer stürzen zu lassen, um so das fürchterliche Risiko eines Großfeuers auf dem Flugdeck zu vermeiden, das eine Bauchlandung verursachen kann. Ganz zu schweigen vom möglichen Totalverlust weiterer 40 geparkter Maschinen und eventuell des gesamten Schiffes, falls das Feuer auf die Millionen Liter Flugtreibstoff übergreift.
Auf dem Flugdeck wußte jeder, daß Billy-Ray und Freddie nahezu mit Sicherheit den Jet ins Wasser setzen und sich selbst per Schleudersitz aus dem Cockpit katapultieren mußten – eine gefährliche und erschreckende Prozedur, die jeden Piloten Kopf und Kragen kosten kann. »Herr im Himmel«, sagte Lieutenant Evans mit unglücklicher Stimme.
Inzwischen schoben sich der LSO und sein Team allesamt auf die tiefe, dick gepolsterte »Grube« zu, in die sie springen würden, um sich in Sicherheit zu bringen, falls Billy-Ray die Kontrolle verlor und die Tomcat auf das Heck des Trägers stürzte. Sämtliche Feuerlöschmannschaften hatten höchste Alarmstufe. »Brückenwache, Ruder 4 Grad Steuerbord. Kurs zwei-eins-null. Ich möchte minimal 30 Knoten über Deck. Fahrt wie erforderlich.«
Jedermann konnte nun die Triebwerke der anfliegenden Tomcat brüllen hören, und die Buschtrommeln des Trägers liefen auf Hochtouren. Fast alle hatten Billy-Ray ins Herz geschlossen. Er war erst seit einem Jahr verheiratet, und die halbe Besatzung des Marine-Luftstützpunkts am Pax River in Maryland war auf der Hochzeit gewesen. Seine Braut, Suzie Danford, war die hochgewachsene, dunkelhaarige Tochter von Admiral Skip Danford. Sie hatte den lockenköpfigen, dunkeläugigen Billy-Ray mit seinen Bergmannsschultern und seinem verschmitzten Lächeln kennengelernt, als er in Pensacola seine Ausbildung abschloß, lange bevor er in die Pilotenelite der Navy aufgestiegen war.
Und nun saß sie allein in Maryland und wartete darauf, daß die endlosen sechs Monate seines ersten Einsatzes auf See vorübergingen. Wie alle Fliegerfrauen fürchtete sie das unerwartete Klopfen an der Tür, fürchtete den fremden Anrufer von der Air-base, jenen, der ihr erklären würde, daß ihr Billy-Ray ein gewaltiges Loch in den Indischen Ozean gestanzt hatte. Und daran war absolut nichts Melodramatisches. Ungefähr zwanzig Prozent aller Navy-Piloten sterben in den ersten neun Dienstjahren. Mit sechsundzwanzig war Suzie Danford-Howell der Tod kein Unbekannter mehr, und die Möglichkeit, daß der eigene Mann sich Jeff McCall, Charlie Rowland und Dave Redland zugesellen könnte, verfolgte sie bis in ihre Träume. Manchmal dachte sie, die ganze Sache würde sie noch in den Wahnsinn treiben. Aber sie versuchte ihre Ängste zu unterdrücken.
Sie wußte allerdings nichts von der tödlichen Gefahr, in der ihr Mann jetzt gerade schwebte. Für ein Versagen des Fahrgestells gibt es praktisch keine Routinelösungen. Der Pilot hat eigentlich keine Möglichkeiten mehr, außer die Maschine absacken zu lassen und dann wieder scharf hochzureißen, wobei das Fahrwerk im Glücksfall nach unten knallt, einrastet und die Warnlampe damit erlischt. Aber dazu ist wenig Zeit. Wenn dieser Tomcat F-14 der Sprit ausgeht, dann fällt sie vom Himmel wie ein 20 Tonnen schwerer Betonklotz und schlägt in der langen Dünung des Indischen Ozeans auf wie ein Meteorit … »Billy-Ray Howell und Freddie sind in Schwierigkeiten« – die Nachricht sprach sich in Windeseile auf dem ganzen Träger herum.
Auf der Towerseite des Flugdecks sprach Fähnrich zur See Jim Adams, ein riesiger Schwarzer aus Süd-Boston, der eine voluminöse, fluoreszierende gelbe Jacke trug, über sein Funkgerät mit den Hydraulikoperatoren auf dem Deck darunter, denen die Fangseile unterstanden, von denen eines die Tomcat erfassen, innerhalb ganzer zwei Sekunden bis auf Null abbremsen und dadurch gewaltsam zum Stehen bringen sollte.
Big Jim, der wachhabende Fangeinrichtungs-Offizier, hatte bereits angeordnet, die Anlage so einzustellen, daß sie der Wucht widerstehen würde, mit der die Tomcat bei exakt 160 Knoten aufs Deck knallte, wobei der Pilot die Hand fest auf dem Leistungshebel hatte, falls der Haken nicht griff. Aber Jim kannte das Problem … »Billy-Ray steckt da oben übel in der Klemme.«
Big Jim hatte Billy-Ray besonders ins Herz geschlossen. Sie redeten endlos über Baseball: Jim, weil er glaubte, er hätte einen nahezu legendären Ersten Schlagmann für die Boston Red Sox abgegeben, Billy-Ray, weil er auf der High-School zu Hause in Hamlin ein ziemlich guter Werfer gewesen war. Im nächsten Frühling würden sie zur gleichen Zeit Urlaub haben und wollten dann einen Ausflug nach Florida unternehmen, um den Red Sox vier Tage lang beim Frühjahrstraining zuzuschauen. Jetzt wünschte sich Big Jim allerdings nur, daß er die Fahrwerkshydraulik der Tomcat überprüfen und in Ordnung bringen könnte, und er erwischte sich dabei, das uralte Gebet aller Flugzeugträger-Decksmannschaften vor sich hin zu flüstern: »Bitte, bitte, laß ihn nicht sterben, bitte laß ihn da rauskommen.«
Oben auf der Brücke sprach Captain Carl Rheinegen mit dem leitenden LSO hinten am Deck. »Hat er einen Hydraulikdefekt? Untersagen Sie die Landung! Halten Sie ihn oben und fern von uns!«
Wieder knisterte es in dem großen, wasserdichten Funktelefon, das Lieutenant Rick Evans umklammerte, und die sich nähernde Stimme klang noch immer schleppend. »Tower, hier Tomcat zwei-null-eins. Hier oben ist immer noch irgendwas im Arsch. Hab versucht, die Mühle ein paarmal durchzuschütteln. Hat aber nicht funktioniert. Die Lampe brennt immer noch. Ich kann problemlos übers Heck reinkommen und vorbeifliegen, aber ich glaub, die Hydraulik ist nicht allzugut in Schuß. Ich will lieber auf 250 Knoten bleiben und sie direkt nach oben bringen. Bißchen Luft unter den Hintern kriegen. Kein echtes Problem. Knüppel geht ein bißchen schwer. Aber wir haben Sprit. Sagt Bescheid.«
Die F-14 donnerte jetzt auf das Heck zu, mit der doppelten Geschwindigkeit eines 150 Stundenkilometer schnellen Expreßzugs und zehnmal so ohrenbetäubend. Zu schnell, aber noch immer hoch genug. »Tower an Tomcat zwei-null-eins. Vollgas! Nachbrenner zünden und sofort hochziehen. Vergessen Sie den Überflug. Wiederhole: Vergessen Sie den Überflug.«
»Roger«, sagte Billy-Ray Howell bedächtig, und dann rammte er den Leistungshebel nach vorn und zog am Steuerknüppel. Aber es passierte nicht viel, außer daß die Maschine schneller wurde. Sie schien in die Horizontale zu gehen, und dann raste sie im Sturzflug auf das Ende des Flugdecks zu, unter den Tragflächen noch immer zwei Phoenix-Raketen. Genug, um das halbe Deck in Fetzen zu reißen. Noch immer schleppend und gelassen, sagte Billy-Ray: »Tomcat zwei-null-eins. Ich schlag bloß ’nen kleinen Haken nach links und dreh über die Backbordseite ab.« Und er beobachtete durch seine tiefliegenden Augen, wie das schwankende Flugdeck auf ihn zuzukommen schien. Er kämpfte, um in der Luft zu bleiben, aber die Tomcat hatte nun ihren eigenen Willen. Einen mörderischen Willen.
Rick Evans, der die jetzt auf die Backbordkante des Flugdecks zurasende F-14 beobachtete, bellte in sein Gerät: »Steig aus, Billy-Ray, raus!«
Für den Bruchteil einer Sekunde dachte Freddie Larsen, sein Pilot könnte es vielleicht für ein Zeichen von Schwäche oder mangelnder Coolness halten, sich aus der Maschine zu katapultieren. Und er schrie, zum ersten Mal in seiner gesamten Fliegerlaufbahn: »Hau ihn raus, Billy-Ray, um Himmels willen, hau ihn raus!«
Die Tomcat sauste am Mast des Flugzeugträgers vorbei, und genau in diesem Moment riß Lieutenant William R. Howell mit der rechten Hand am Auswurfhebel. Die verdichtete Treibladung unter seinem Sitz detonierte und katapultierte ihn mit dem Kopf voraus aus dem Cockpit. Freddie folgte eine halbe Sekunde später nach; die Gewalt der beiden Explosionen ließ sie beide für einen Augenblick ohnmächtig werden. Freddie kam als erster wieder zu sich und sah die Tomcat keine fünfzig Meter vom Backbordbug des Trägers aufschlagen, wo sie eine gut fünfzehn Meter hohe Wasserfontäne aufspritzen ließ, fast bis hoch zum Flugdeck.
Aber sie hatten es geschafft. Als Billy-Ray das Bewußtsein wiedererlangte, sah er über seinem Kopf den pendelnden Baldachin seines Fallschirms und unter sich das strudelnde, weiße Kielwasser des Trägers. Und während er und Freddie noch auf dem Wasser aufschlugen, hob ein Sea-King-Helikopter in einem tosenden Wirbelwind vom Flugdeck ab. Die Decksmannschaften kamen aus ihren Unterständen. Alle Starts und Landungen wurden verschoben. Drunten in der wogenden See hörte Billy-Ray Howell – der trotz seines wasserdichten Kälteschutzanzugs halb ertrunken war und nach Luft rang – die Stimme des Leiters der Rettungsmannschaft aus dem Lautsprecher dröhnen wie ein Geschenk des Himmels: »Ruhig, Jungs, ganz ruhig, macht die Gurte los, und haltet still, wir kommen gleich runter.«
Der riesige Hubschrauber kam näher. Ein 19jähriger Fähnrich sprang mit den Rettungsleinen direkt ins Wasser und schwamm auf die beiden angeschlagenen Flieger zu. »Alles okay, Jungs?« fragte er.
»Uns geht’s entschieden besser, als es uns jetzt in der guten alten F-14 gehn würde«, sagte Billy-Ray.
Eine halbe Minute später wurden sie hochgehievt und waren in Sicherheit; beide zitternd vom Schock, Freddie Larsen mit gebrochenem rechtem Arm, Billy-Ray mit einer aufgeplatzten Augenbraue und blutüberströmtem Gesicht, was sein Grinsen ein wenig schief wirken ließ.
Der Hubschrauber landete auf der Steuerbordseite des Decks. Dort standen bereits drei Sanitäter und einige Krankenträger. Lt. Rick Evans zitterte ebenfalls, und er sagte immer wieder: »Lieber Himmel, es tut mir ja so leid, Jungs. Es tut mir ja so leid.«
Ein kleines, betrübtes Empfangskomitee erwartete die beiden übel zugerichteten Flieger. Big Jim Adams drängte sich gegen jede Dienstvorschrift durch die Gruppe, stürzte zum Hubschrauber, hob Billy-Ray heraus und barg ihn in seinen gewaltigen Armen. »Verdammt noch mal, stirb mir nie wieder, Mann, hörste?« Jeder konnte sehen, wie Big Jim die Tränen über das Gesicht strömten.
Dann übernahmen die Sanitäter, spritzten beiden Männern ein Schmerzmittel und schnallten Billy-Ray und Freddie auf den fahrbaren Krankentragen fest. Und die gesamte, inzwischen rund vierzehnköpfige Prozession machte sich auf den Weg zu den Aufzügen, allesamt ein bißchen mitgenommen und doch verbunden durch die Kameradschaft von Männern, die zusammen dem Tod ins Gesicht geschaut haben.
Freddie sprach als erster: »Du bist ’n verrückter Hund, Billy-Ray. Du hättest 15 Sekunden früher aufs Knöpfchen drücken sollen.«
»Blödsinn, Freddie. Mein Timing war genau richtig. Wenn ich früher ausgestiegen wär, würdste jetzt wahrscheinlich da oben auf der Mastspitze hocken.«
»Ja, und ’ne Sekunde später, dann würden wir jetzt alle beide auf dem scheiß Meeresgrund sitzen.«
»Scheiße!« sagte Billy-Ray. »Du bist ’n undankbares Arschloch. Ich hab dir grad das Leben gerettet. Aber du bist noch nicht mal mein eigentliches Problem. Ist dir eigentlich klar, daß Suzie ’nen Herzanfall kriegt, wenn sie davon erfährt? Ich werd wohl dir die Schuld in die Schuhe schieben müssen.«
»Das ist doch nicht zu glauben«, sagte Freddie. Er versuchte zu lächeln und streckte den gesunden Arm aus, um seinem Piloten die noch immer zitternde Hand zu drücken. »Möcht ich irgendwann mal wieder machen!«
Der Verlust eines Tomcat-Jägers wird allgemein als Zwischenfall angesehen, der Karrieren gefährden kann. Nach einer Panne, die Uncle Sam um die 35 Millionen Dollar gekostet hat, ist es für die Navy nahezu unabdingbar, einen Sündenbock zu finden. Sowohl der Kapitän wie der Admiral würden dafür geradestehen müssen. Und es gab immer eine Menge Fragen. War es ein Pilotenfehler? Hatte die Decksmannschaft einen Fehler gemacht? Wer hatte die Maschine überprüft und gewartet, bevor sie für ihre letzte Reise an Deck kam? Hatte der für die letzten Checks unmittelbar vor dem Start verantwortliche Offizier etwas übersehen? Gab es irgendeinen Hinweis, daß der Katapultoffizier es hätte bemerken sollen?
Das Pentagon würde einen vorläufigen Bericht wünschen, so rasch er nur fertiggestellt werden konnte. Deshalb wurde sofort ein offizielles Untersuchungskomitee zusammengestellt. Als erste wurden die Hydraulikexperten vorgeladen. Im Lauf des Abends würden die Offiziere im hervorragend ausgestatteten Lazarett des Trägers routinemäßig mit Billy-Ray und Freddie sprechen, nachdem die Chirurgen den Arm des jungen Navigators gerichtet hatten.
Keiner der Flieger glaubte, daß der Pilot einen Fehler gemacht hatte, und alle wußten, daß Lieutenant William R. Howell bis zur letztmöglichen Sekunde durchgehalten hatte, um seine 200 Knoten schnelle Zeitbombe sicher über die Seite des Schiffs zu fliegen. Über ihn würden die vorgesetzten Offiziere zweifellos zu einem wohlwollenden Urteil kommen, aber die Wartungsabteilung und ihre spezialisierten Hydraulikmechaniker mußten sich auf wirklich harte Fragen gefaßt machen.
Während die Voruntersuchung des Unfalls fortgesetzt wurde, ging auch das Alltagsgeschäft der amerikanischen Kampfgruppe auf hoher See plangemäß weiter. Oben auf der Admiralsbrücke hatte normalerweise Captain Jack Baldridge, der Einsatzleiter der Kampfgruppe, in Abwesenheit des Admirals selbst das Kommando. Doch im Moment steckte er ein Deck tiefer – im Radarraum und elektronischen Nervenzentrum – in einer Konferenz mit dem Taktikoffizier und dem ASW, dem Leiter der U-Boot-Bekämpfung. Wie immer war hier der offenkundig geschäftigste Ort auf dem gigantischen Flugzeugträger. Stets im Halbdunkel, hauptsächlich von den bernsteinfarbenen Bildschirmen der Computer erhellt, bildete er eine seltsame, murmelnde Unterwelt für sich, bevölkert von ernst wirkenden jungen Technikern, die vor ihren Monitoren klebten, während die Radarsysteme das Meer und den Himmel absuchten.
Jack Baldridge war ein stämmiger, reizbarer Mann aus Kansas, der von den Great Plains des Mittelwestens stammte, aus einer Kleinstadt namens Burdett oben in Pawnee County, sechzig Kilometer nordöstlich von Dodge City. Jack kam aus einer alten Navy-Familie, die ihre Söhne zum Kämpfen auf See schickte, sie am Ende aber dann doch irgendwie zurück auf die gute alte Ranch lockte. Jacks Vater hatte während des Zweiten Weltkriegs im Nordatlantik einen Zerstörer kommandiert, sein jüngerer Bruder Bill war Korvettenkapitän und außerhalb Washingtons beim Marine-Geheimdienst stationiert; Jack fand das ein wenig mysteriös, aber der junge Bill war ein anerkannter Experte für Atomwaffen, ihre Sicherheitsaspekte, ihre Lagerung und ihren Einsatz.
Die meisten Leute gingen davon aus, daß der 40jährige Jack einmal Konteradmiral werden würde. Die maritime Kriegskunst war sein Lebensinhalt, und er war der hervorragendste Kommandant in der ganzen Kampfgruppe; als rechte Hand des Gruppenadmirals trug er bedeutende Verantwortung. Sein kleiner Bruder Bill dagegen – der aussah wie ein Cowboy, ritt wie ein Cowboy und dazu neigte, Dienstwagen der Navy zu fahren wie ein Cowboy – hatte es so weit gebracht, wie er es bringen würde. Er war kein geborener Vorgesetzter, aber seine wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Nuklearphysik und Waffentechnik waren so eindrucksvoll, daß die Marineleitung sich verpflichtet gefühlt hatte, ihm einen gehobenen Rang zu verleihen. Bill war der geborene Mann für Krisensituationen, ein besonnener, nachdenklicher Navy-Wissenschaftler, der oft auf Lösungen verfiel, an die zuvor noch niemand gedacht hatte. Es gab eine Handvoll ältlicher Admiräle, die ihn seiner unorthodoxen Methoden wegen nicht sonderlich mochten, aber Bill Baldridge hatte auch viele Gönner.
Während Jack ein solider Ehemann und nüchterner Navy-Kapitän höchstmöglicher Qualifikation war, wußte niemand so recht, wo Bill landen würde – außer in den unterschiedlichsten Betten quer durch Washington. Mit sechsunddreißig ließ er keinerlei Anzeichen erkennen, sein Junggesellenleben und das romantische Chaos aufgeben zu wollen, das sich wie eine Spur von Dodge City nach Arlington, Virginia, hinter ihm herzog. Jack betrachtete seinen Bruder mit immensem Wohlwollen.
Unten in der Elektronikzentrale bewegte sich Captain Baldridge an mehreren Fronten zugleich. Captain Rheinegen, der das seemännische Kommando über das Schiff führte, hatte eine kleinere Kursänderung angeordnet, während sie über den Östlichen Indischen Rücken dampften, der östlich vom Zentralindischen Becken von Nord nach Süd verläuft. Hier ist der Ozean nur 1828 Meter tief, aber als der Träger seinen nordwestlichen Kurs fortsetzte, fiel die Tiefe auf beinahe 6000 Meter unter dem Kiel. Captain Baldridge hatte sich bereits ausgerechnet, daß die Tomcat wahrscheinlich auf dem Meeresrücken angelangt war, nachdem sie gesunken und ungefähr 2000 Meter unter dem Meeresspiegel zur Ruhe gekommen war.
Er überprüfte die Positionen aller Schiffe der Gruppe, stimmte seinem ASW zu, daß vier Unterwasser-»Kontakte« nicht echt waren; sprach kurz mit dem Sonar-Controller und den Funkern; meldete sich bei dem Mann am Kursplotter. Er konnte hören, wie der Leiter der Waffenkontrolle mit dem Oberflächenbeobachter konferierte, und nahm auf einer verschlüsselten Leitung einen Anruf von Captain Art Barry entgegen, dem New Yorker, der den gegenwärtig rund acht Seemeilen backbord vom Bug laufenden lenkwaffenbestückten 11 000-Tonnen-Kreuzer Arkansas befehligte. Die Botschaft war kryptisch: »Kansas City Royals 2, Yankees 8. Fünf Mäuse. Art.«
»Herrgott noch mal«, sagte Baldridge. »Das findet der wohl noch witzig. Wir haben gerade ein 35 Millionen Dollar teures Flugzeug auf den Boden dieses gottverdammten Ozeans gesetzt, und er holt sich über Satellit die Baseballergebnisse.« Natürlich wäre es eine vollkommen andere Sache gewesen, wenn die Nachricht »Royals 8, Yankees 2« gelautet hätte. »Klasse Typ, dieser Art. Weiß, wo er seine Prioritäten setzen muß.«
Baldridge schaute auf seine Uhr und begann, ganz automatisch in sein Notizbuch zu schreiben; nicht für die offiziellen Akten, aber eine Angewohnheit, die das Ergebnis eines halben Lebens in der US Navy war. Er hielt das Datum und die Zeit nach Marineart als »221700APR02« fest (Tag, Uhrzeit – 17.00 Uhr in militärischer Schreibweise –, danach der Monat und das Jahr). Dann notierte er die Position des Schiffs – Mittlerer Indischer Ozean, 9S (9 Grad südlicher Breite), 91E (91 Grad östlicher Länge). Dann: »Beschissener Tag. Royals 2, Yankees 8. Tomcat verloren. Billy-Ray und Freddie verletzt, aber in Sicherheit.« Auch er hatte eine Schwäche für Billy-Ray Howell.
221709APR02. 41.30 N, 29E. Kurs 180. Fahrt 4. »Möglichkeit auf 030,10 Meilen. Sehn Sie sich das mal an, Chef. Vielleicht okay?«
»Danke … ja … plotten Sie seinen Kurs. Der heizt mit Kohlen und ist wahrscheinlich langsam genug. Wenn er weiter auf das Loch zufährt und seine Geschwindigkeit in unseren Zeitplan paßt, dann nehmen wir ihn. Hängen Sie sich dran …, aber ein gutes Stück hinter ihm, mein Lieber.«
»Dauert zwei Stunden.«
221912. »Sie beginnen, nach uns zu suchen, Zeit eine Stunde abgelaufen. Gerade erstes Signal wegen U-Boot-Unfall empfangen, Chef.«
»Gut. Was haben Sie den Jungs erzählt?«
»Was wir besprochen haben. Tarnung für spezielle Geheimübung. Wir antworten nicht. Die werden bald aufhören. Uns gibt es nicht mehr.«
»Okay. In spätestens einer Stunde ist es dunkel. Machen wir uns jetzt bereit für den Transit. Halten Sie Ausschau nach dem Leuchtfeuer auf der Rumelifeneri-Festung dort oben auf der nordwestlichen Landspitze, und gehn Sie dann direkt rein … Folgen Sie dem Ziel so dicht, wie Sie nur können.«
»Schön. Selbst wenn’s noch nie jemand getan hat, was? Oder, Chef?«
»Mein Lehrer hat mir mal gesagt, es sei machbar.«
»Ich spreche Ihre Sprache nicht, und mein Englisch ist nicht so gut wie Ihres. Aber ich weiß, daß das verdammt knifflig ist. Äußerst üble Gegenströmungen da drin. Sandbänke am rechten Ufer, in den Engpässen nahe der großen Brücke. Scheiße! Was, wenn wir auflaufen und festhängen? Wir kommen nie mehr aus dem Gefängnis raus.«
»Wenn Sie haargenau tun, was wir besprochen haben, mein Lieber, werden wir nirgendwo auflaufen.«
»Sie wollen, daß wir genau durch die Hafenmitte fahren, mit 9 Knoten und einem beschissen großen weißen Kielwasser hinter uns. Die sehen das, Chef. Zum Teufel, die können das gar nicht übersehen.«
»Muß ich es Ihnen denn noch mal sagen? Sie werden es nicht sehen, wenn Sie wirklich dicht dranbleiben, mitten im Kielwasser des Griechen. Der wird sowenig auf Grund laufen wollen wie Sie. Der wird an den seichten Stellen sein Glück schon nicht strapazieren. Also los, mein Lieber.«
»Gefällt mir immer noch nicht besonders.«
»Ich sag ja auch nicht, daß es Ihnen gefallen soll. Tun Sie’s!«
222004. »Ich möchte frühzeitig an unserem Platz sein und alles geregelt kriegen, bevor wir die Einfahrt erreichen. Wir brauchen eine gute optische Markierung, um bei Nacht die Entfernung zu ihm messen zu können. Seine Positionslampen werde reichen.«
»Schlampige Griechensau, läßt sie den ganzen Tag über brennen.«
»Hab ich bemerkt. Benutzen Sie zehn Meter Höhe für die Hecklampe.«
»Was ist mit seinem Radar, Chef?«
»Es wird uns in seiner Heckwelle nicht sehen, und wenn doch, wird er glauben, es sei sein eigenes Kielwasser. Dieser Bursche ist kein Gorstschkow. Er denkt ja noch nicht mal daran, seine Lampen abzudrehen.«
»Was ist mit den anderen Schiffen in der Fahrrinne?«
»Wer überholt, wird sich ein gutes Stück zur einen Seite halten. Entgegenkommende Schiffe werden sich auf der anderen halten. Das einzige, das mir wirklich Sorgen macht, sind die Fähren von einem Ufer zum anderen. Deswegen sollten wir die engsten Stellen auch zwischen 0200 und 0500 durchfahren, wenn wir, wie ich hoffe, keiner davon begegnen. Wär schon verdammt traurig, wenn eine am Hintern unseres griechischen Schrittmachers vorbeischlüpfen würde und wir sie rammten.«
»Wieso verstehen Sie eigentlich von allem und jedem soviel mehr als ich, Chef?«
»Hauptsächlich, weil ich mir keine Fehler leisten kann. Außerdem, weil ich einen brillanten Lehrer hatte … hochintelligent, ungeduldig, clever, arrogant … Bewahren Sie die Ruhe, mein Lieber. Und tun Sie, was ich Ihnen sage. Es ist jetzt dunkel genug. Messen wir seine Lampe an und schließen direkt hinter ihm auf.«
281400APR02. 9S, 74E. Kurs 010. Fahrt 12. 200 Seemeilen vor Diego Garcia hatte sich das Wetter verschlechtert, und heiße, wechselhafte Winde machten den Fliegern das Leben unendlich schwer. Auf dem Flugdeck der USSThomas Jefferson standen die LSOs in ihrem üblichen Grüppchen zusammen, machten sich die relative Ruhe zunutze und sprachen mit den Piloten der sieben anfliegenden Maschinen der heutigen Abfangpatrouille, von denen vier übereinander gestaffelt in 8000 Fuß Höhe und 20 Meilen Entfernung kreisten.
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe NIMITZ CLASS erschien bei Century Books Ltd., London
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 02/2007 Copyright © 1997 by Patrick Robinson Copyright © 1997 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration: © Matthew Williams Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN: 978-3-641-18404-9V003
www.heyne.de
www.randomhouse.de