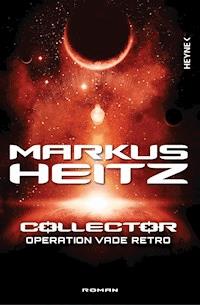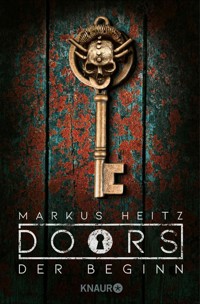6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Pakt der Dunkelheit
- Sprache: Deutsch
Ich spüre nicht nur den Tod – ich bin eine seiner Göttinnen! Leipzig 2007: Sie ist die gute Seele eines Krankenhauses. Hier steht sie denen bei, die in ihren letzten Stunden nicht allein sein sollen. Jeder, der die junge Frau am Bett eines Sterbenden wachen sieht, wird sie für einen Engel halten. Denn niemand weiß, wer sie wirklich ist. Oder was. Kinder des Judas von Markus Heitz: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Markus Heitz
Kinder des Judas
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kinder des Judas – Band 1 der Judastrilogie
»Ich spüre nicht nur den Tod – ich bin eine seiner Göttinnen!« Leipzig 2007: Sie ist die gute Seele eines Krankenhauses. Hier steht sie denen bei, die in ihren letzten Stunden nicht allein sein sollen. Jeder, der die junge Frau am Bett eines Sterbenden wachen sieht, wird sie für einen Engel halten. Denn niemand weiß, wer sie wirklich ist. Oder was.
Inhaltsübersicht
Prolog
20. November 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 23.59 Uhr
1. Buch: Das Mädchen
I. Kapitel
12. März 1670 Gruža (serbisches Gebiet), Osmanisches Reich
3. April 1670 In der Nähe von Gruža (serbisches Gebiet), Osmanisches Reich
II. Kapitel
4. April 1670 In der Nähe von Belgrad (serbisches Gebiet), Osmanisches Reich
6. April 1670 Osmanisches Tributland
III. Kapitel
21. November 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 01.18 Uhr
16. August 1670 Osmanisches Tributland
IV. Kapitel
6. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 17.01 Uhr
V. Kapitel
7. August 1672 Osmanisches Tributland
7. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 04.30 Uhr
August 1674 Osmanisches Tributland
VI. Kapitel
19. März 1675 Osmanisches Tributland
15. Mai 1675 Osmanisches Tributland
12. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 19.18 Uhr
VII. Kapitel
31. Dezember 1675 Osmanisches Tributland
23. Juli 1676 Osmanisches Tributland
15. September 1676 Osmanisches Tributland
VIII. Kapitel
15. September 1676 Osmanisches Tributland
19. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 22.09 Uhr
16. November 1676 Osmanisches Tributland
IX. Kapitel
17. Februar 1677 Osmanisches Tributland
19. September 1677 Osmanisches Tributland
20. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 00.09 Uhr
19. September 1677 Osmanisches Tributland
16. November 1677 Osmanisches Tributland
2. Buch: Aeterna
X. Kapitel
16. November 1677 Osmanisches Tributland
20. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig-Leutzsch, 02.54 Uhr
20. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 18.09 Uhr
7. September 1678 Osmanisches Tributland
20. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 21.01 Uhr
9. Juli 1679 Osmanisches Tributland
20. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 23.19 Uhr
21. November 1683 Osmanisches Tributland
XI. Kapitel
21. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 00.23 Uhr
23. Oktober 1692 Osmanisches Tributland
XII. Kapitel
21. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 03.13 Uhr
11. November 1723 Osmanisches Tributland
21. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 04.59 Uhr
3. Buch: Entdeckungen
XIII. Kapitel
12. Oktober 1731 Gut Schwarzhagen (Lausitz)
10. Dezember 1731 Belgrad, Regierungssitz der Habsburger in den eroberten osmanischen Gebieten
XIV. Kapitel
11. Dezember 1731 Parakina (serbisches Gebiet)
15. Dezember 1731 Medvegia
XV. Kapitel
23. Dezember 2007 In der Nähe von Belgrad, 18.21 Uhr
15. Dezember 1731 Medvegia
22. Dezember 1731 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
XVI. Kapitel
22. Dezember 1731 Medvegia
22. Dezember 1731 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
1. Januar 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
7. Januar 1732 Medvegia
XVII. Kapitel
9. Januar 1732 In der Nähe von Zajecar (serbisches Gebiet)
XVIII. Kapitel
10. Januar 1732 In der Nähe von Zajecar (serbisches Gebiet)
31. Januar 1732 In der Nähe von Zajecar (serbisches Gebiet)
XIX. Kapitel
Februar 1732 In der Nähe von Zajecar (serbisches Gebiet)
5. Februar 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
XX. Kapitel
5. Februar 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
28. März 1732 Belgrad
4. April 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
XXI. Kapitel
4. April 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
4. April 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
7. April 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
9. April 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
XXII. Kapitel
8. April 1732 Habsburgisches Territorium (serbisches Gebiet)
4. Buch: Tod
XXIII. Kapitel
23. Dezember 2007 In der Nähe von Belgrad, 21.59 Uhr
23. Dezember 2007 In der Nähe von Belgrad, 22.21 Uhr
XXIV. Kapitel
31. Dezember 2007 Deutschland, Sachsen, Leipzig, 21.57 Uhr
Nachwort des Autors
Bonusmaterial
Interview
Blick hinter die Kulissen
Scyllas Tagebücher
Entfallene Szene
Prolog
20. November 2007Deutschland, Sachsen, Leipzig, 23.59 Uhr
Ich kenne die Melodie des Lebens.
Es ist nicht das Vogelgezwitscher, nicht das Rauschen des Windes in den Bäumen oder das Lachen der Kinder. Sie ist viel weniger kitschig.
Die Melodie des Lebens ist sehr eintönig, elektronisch. Sie variiert selten, und wenn doch, dann ist es meistens nicht gut.
Ich kenne jeden einzelnen Ton und bin doch immer wieder überrascht, wie unterschiedlich die Melodie von Männern, Frauen und Kindern gespielt werden kann. In einer Minute erschallt dieser Ton zwischen fünfzig und achtzig Mal, ein einfaches Metronom hält den Takt mal mehr, mal weniger gut.
Es kommt vor, dass andere Instrumente in die Melodie mit einstimmen. Auch sie klingen nüchtern und leidenschaftslos, ewig gleich. Nur der Mensch bestimmt, in welchem Rhythmus sie spielen, in welcher Weise sie einen Chor bilden. Und doch hat er in den seltensten Fällen Einfluss darauf.
Ich höre diese Melodie sehr gerne, denn sie bedeutet Leben.
Mehrmals in der Woche gehe ich in das besondere Opernhaus, in dem die Melodie des Lebens von zahlreichen Interpreten zum Besten gegeben wird. Niemand käme auf die Idee, sie vom Spielplan zu nehmen. Ich sitze immer in der ersten Reihe, dichter als ich kommen nur wenige Menschen an das Orchester heran. Dargeboten wird die Melodie stets von einem einzelnen Menschen. Alt, jung, arm, reich, Mann, Frau, das macht keinerlei Unterschied. Jeder darf, auch wenn er es nicht immer möchte.
Ich sehe diesem einzelnen Musiker oft in die Augen, halte die Hand, wenn er zu aufgeregt ist, und rede ihm gut zu. Manche halten die Lider geschlossen, als würden sie selbst einem Lied lauschen; wieder andere träumen, wie ich an ihren Bewegungen erkennen kann.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Melodie zu spielen, und ich wage zu behaupten, dass ich sie alle kenne. Nein, sagen wir lieber: fast alle kenne.
Aber eines ist stets gleich – erst wenn der letzte Ton verklungen ist, gehe ich unter Tränen. Das bin ich dem Musiker schuldig.
Und die anschließende Stille weckt meinen Neid.
Heute ist der Musiker ein kleines Mädchen.
Ihr Name ist Thea. Sie ist elf Jahre alt, stammt aus Leipzig und hat sich lange geweigert, das Stück mit dem Orchester zu spielen. Gestern, vier Wochen nach ihrer Operation, ging es nicht mehr anders. Die Ärzte haben sie an die verschiedenen Monitore angehängt, um genau beobachten zu können, wie ihre Herzfrequenz ist, wie ihr Blutdruck sich verhält, was die verschiedenen Werte aussagen. Nicht, weil sie das Schlimmste befürchten, ganz im Gegenteil, sie sind voller Hoffnung. Sie haben Thea neue Medikamente gegeben, die helfen sollen. Es geht lediglich um Überwachung. Keiner sieht, was ich sehe, da helfen ihnen selbst ihre Maschinen nichts. »Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme«, haben sie den Eltern gesagt. Sie lügen nicht, sie glauben daran. Sie wissen es nicht besser – so wie ich.
Theas Gesicht ist schmal geworden, seit ich sie das erste Mal gesehen habe. Wenn man sich vorstellt, was diese arme Kreatur über sich ergehen lassen musste, ist es ein Wunder, dass sie noch immer Fleisch auf den Rippen hat. So wenig gegessen, so viel erbrochen.
Sie schläft tief und fest. Ein Zufall, dass der Krebs überhaupt festgestellt wurde, eine perverse Laune der Natur, wie schnell er gewachsen ist. Der Oberarzt sagte, dass ein so großer Tumor in einem so kleinen Köpfchen sehr selten ist. Ich bin mir nicht sicher, ob Thea und ihre Eltern einen ähnlichen Enthusiasmus beim Anblick von Befundwerten verspüren wie Professor Angerer. Er hat den Eltern nach der OP versprochen, dass alles in Ordnung kommt.
Ich sitze neben ihrem Bett, höre mit einem Ohr auf das Geräusch des elektronischen Orchesters und die Melodie des Lebens und konzentriere mich dann auf Theas Atemzüge. Sie sind ruhig und gleichmäßig. Noch.
Den Geruch nach Desinfektionsmittel und Ozon, der aus den Geräten dringt, bemerke ich schon gar nicht mehr, dafür bin ich zu oft auf solchen Stationen. Normale Besucher entwickeln schnell eine Abneigung dagegen.
Meine Hand berührt ihre zarten Züge, streichelt die bleiche Wange und schiebt die vorwitzige helle Haarlocke aus der Stirn, bevor sie auf die Nase rutscht und Thea kitzelt. Eine rot leuchtende Narbe an der Stirn ist das Andenken an den Eingriff. Sie erinnert mich unglaublich an das Gesicht eines Mädchens, das vor vielen, vielen Jahrhunderten gelebt hat und von dem ich Thea manchmal erzähle. Sie mag die Geschichten. Ich selbst bin mir da nicht so sicher.
Unter der Decke steckt rechts neben ihr Paddy, der braune Kuschelteddy, dem ich heute auch schon etwas zu essen gegeben habe. Oder jedenfalls so getan, als ob. Thea mag es, wenn ich ihr Geschichten erzähle, für sie singe und mit ihr und Paddy spiele. Danach hat sie das bisschen Brei, das sie zu sich genommen hatte, gleich wieder von sich gegeben. Waren es die Aufregung und die Freude? Habe ich sie zu sehr zum Lachen gebracht? Jetzt wird sie Nährlösung direkt ins Blut bekommen.
Als ich sie berühre, dreht sie den Kopf, klemmt dabei meine Finger fest und lächelt im Schlaf. Ich muss meine Tränen niederringen, weil ich weiß, dass ich dieses Lächeln nicht mehr oft sehen werde. Kein Mensch wird es nach dieser Nacht mehr sehen; höchstens auf einem Foto.
Es gibt dieses Märchen, in dem ein Arzt den Tod am Bett seiner Patienten stehen sieht und erkennt, ob sich der Kranke von seinem Leiden erholt oder nicht. Ich sehe den Tod zwar nicht, aber ich spüre ihn. Es ist eine Gabe, um die ich nicht gebeten habe. Vielleicht wurde sie mir verliehen, weil ich mich so oft mit dem Tod beschäftigt habe und mehr Menschen beim Sterben begleiten musste, als andere lebendigen Menschen begegnen. Bei Thea wusste ich schon am ersten Tag, dass er sie schon lange ausgesucht hatte. Es war einer jener Momente, in denen man an Gott zweifelt. Dabei ist es hochgradig unfair, ihm die Schuld zu geben. Ich meine, was würden Atheisten tun? Können sie jemanden verantwortlich machen? Wenn nicht zufällig ein Kernkraftwerk in der Nähe von Theas Wohnung liegt und es dort nachweislich ein Strahlungsleck gab, das den Tumor ausgelöst hat, dürfte es ein Atheist schwer haben, jemanden anzuklagen.
Sie sprechen von Schicksal – und meinen damit nur zu oft doch Gott. Auch wenn man an nichts glaubt, glaubt man.
In anderen Religionen heißt es sinngemäß, dass man bekommt, was man verdient. Oder die Rechnung für Dinge zahlt, die man in einem vorherigen Leben getan hat. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass ein so liebes Kind wie Thea in einem anderen Leben eine schreckliche Tat begangen haben könnte, für die sie in ihrem heutigen büßen muss; zudem wäre es wieder unfair, weil sie sich ihrer Schuld von damals nicht bewusst ist. Ebenso unfair, wie Gott die Schuld zu geben.
Ich ziehe meine Hand behutsam unter Thea heraus, streichele sie wieder und bin froh, dass ich kein Atheist bin. Mein Glaube ist stark, er verwindet auch den Tod eines unschuldigen kleinen Mädchens, ohne mit Gott zu hadern. Es gibt Dinge, die nicht geändert werden können. Wir Menschen haben alles getan, um sie zu retten. Ich habe alles getan, um sie zu retten, und das, ohne dass es jemand bemerkte. Doch die Krankheit war stärker. Die Ärzte werden von ihrem Tod überrascht werden.
Allerdings bin ich lange nicht so abgebrüht, wie das vielleicht erscheinen mag. Ich sehe die schlafende Thea an – und möchte jemandem mitten ins Gesicht schlagen. Um mich vor meiner eigenen Trauer zu schützen, werde ich wütend, werfe mich in Aggression, in Tobsucht. Es hat langer Jahre bedurft, bis ich es kontrollieren konnte. Oder besser gesagt: bis ich ein Ventil fand.
Sie hatte bisher Glück, die kleine Thea. Keine Unfälle, nicht einmal ein Beinbruch oder eine von den klassischen Verletzungen, die man als Kind hat. Sie war Klassenbeste und sollte nächstes Jahr ins Gymnasium wechseln, eine ganze Klasse überspringen. So ein cleveres Mädchen.
Thea zuckt. Die Melodie des Lebens bekommt einen kurzen, schrillen Misston.
Ich nehme ihre kühle Hand zwischen meine Finger. »Schsch, schsch, ich bin da, Thea«, flüstere ich freundlich und warm, dabei lehne ich mich nach vorne, damit mein Schatten über sie fällt und sie meine Anwesenheit unterbewusst spürt. »Sei ruhig, Liebes. Ich bin da.«
Der Klang meiner Stimme beruhigt sie, die Herzfrequenz fällt zurück auf ihr gesundes Maß, aber ich habe die Botschaft sehr wohl verstanden. Mit einer Hand drücke ich die Wechselsprechanlage.
»Schwester Doris, benachrichtigen Sie bitte Theas Eltern«, sage ich leise. »Ihre Tochter wird bald sterben.«
»Danke, Frau Sarkowitz«, kommt die Antwort. Keine Rückfragen, kein Sind Sie sicher? oder Sind Sie verrückt? Bei den tollen Werten? Das hat einen Grund. Doris kennt mich seit sieben Jahren, und sie weiß, dass jede meiner Voraussagen stimmt. Wie oft haben sie und ich uns schon gewünscht, dass ich einmal danebenliege. Nur ein einziges Mal. Leider war es uns nicht vergönnt, diesen kleinen Triumph über den Tod einmal zu erleben.
»Sie sollen sich beeilen. Es wird nicht mehr lange dauern«, füge ich hinzu und schaue zu dem Monitor, auf dem Theas Herzschläge von der Elektronik als hüpfende Punkte mit nachglühenden Linien angezeigt werden.
Plötzlich schlägt sie die dunkelbraunen Augen auf. »Ich habe Durst«, sagt sie heiser und klammert sich an meine Hand. »Mir ist so heiß, Sia.«
»Warte, ich gebe dir etwas.« Mit der Rechten schenke ich ihr von dem roten Traubensaft-Wasser-Mix ein, den sie so sehr liebt, während sie vergeblich versucht, sich aufzusetzen, und mit einem Mal kraftloser als jemals zuvor wirkt. Die Augen liegen tief in den Höhlen, sie hat Ringe darunter wie eine Fünfzigjährige. Behutsam flöße ich ihr einige Schlucke ein, dann hustet sie, und ich setze das Glas ab. »Ist es besser?«
»Ja«, antwortet sie schwach und tastet nach Paddy, den ich ihr sofort in den Arm drücke. »Danke, Sia.«
Sia ist nicht mein richtiger Name, sondern die Abkürzung für Theresia. Theresia Sarkowitz, Sitzwache, siebenunddreißig Jahre, so steht es zumindest in den Personalunterlagen des Krankenhauses. Und trotzdem würde mich kein noch so kritischer Beobachter älter als Ende zwanzig, maximal Anfang dreißig schätzen. Ich habe mich gut gehalten und bin sehr stolz auf meinen Körper, der schon viel ausgehalten hat. Prellungen, Schnittwunden von Messern und Glassplittern und vieles mehr hat meine Haut kennengelernt, ohne sich daran mit einer hässlichen Narbe zu erinnern.
»Möchtest du nicht lieber wieder schlafen?«, frage ich Thea und lege eine Hand auf ihre Stirn. Eiskalt und feucht.
Sie schüttelt den Kopf, doch ihre Bewegungen sind kraftlos. »Nein. Dann kommen wieder die Träume. Und die Monster.« Thea drückt den Bären an sich, den Beschützer und Gefährten, so gut es geht. »Ich mag sie nicht. Kann Scylla kommen und sie verjagen, Sia?«
Scylla, das Mädchen aus meinen Geschichten. »Du musst dich nicht aufregen, Kleines«, spreche ich bedächtig. »Ich schicke dir Scylla, und sie verjagt die Monster, ich verspreche es dir. Aber jetzt …«
Die Töne des Herzmonitors beschleunigen sich. Rasch schalte ich das Instrument auf stumm und verfolge die tanzenden Linien aus den Augenwinkeln. Das kleine Herz rast!
Plötzlich zuckt Thea zusammen. »Sia!« Ihr Gesicht verkrampft sich vor Schmerz und Anstrengung, nur ihre Augen bleiben groß und weit. Mir kommt es vor, als versuche sie, die Schmerzen und die Krankheit aus sich herauszupressen, sich zu reinigen. Ihr Atem beschleunigt sich.
»Ich lasse dich nicht allein, Thea«, verspreche ich ihr. »Paddy und ich passen auf, dass dir nichts geschieht.«
Da geht auch schon die Tür zum Zimmer auf, Professor Angerer und ein Notfallteam stürmen herein und schauen auf die Monitore der Geräte. Er gibt rasche Anweisungen, was die Ärzte und Pfleger tun sollen, Spritzen werden aufgezogen und in den Infusionsschlauch gejagt. Ich rücke etwas nach oben, um ihnen nicht im Weg zu sein, lasse aber die kleine Hand nicht los. Meine Augen ruhen auf Thea, alles andere interessiert mich nicht mehr. Der Tod ist bereits in sie gekrochen und sucht nach ihrer Seele, um sie mit sich zu nehmen.
Die kurzen, knappen Anweisungen des Oberarztes höre ich kaum.
Thea dreht den Kopf noch einmal zu mir, der Schleier über den Pupillen erinnert mich an beschlagene Scheiben. Sie drückt meine Finger fest, so fest, wie es auch die Erwachsenen taten, die ich beim Sterben begleitet habe. Wie kräftig Kinder sein können.
Ich lächele sie an und streichele ihr Gesicht. »Keine Angst, Thea. Keine Angst.« Auch wenn es mir unglaublich schwerfällt, summe ich ihr eines von meinen vielen Liedern vor, die vertrauten Töne werden sie beruhigen.
Theas Blick bricht.
Der Tod ist aus ihr gefahren und hat ihre Seele fortgetragen.
Dass sie an einem besseren Ort landen wird als ich, bezweifele ich nicht.
Ich schließe ihr die Augen. Neben mir steht Angerer und hält einen ehrgeizigen Assistenzarzt, der den Defibrillator einsatzbereit gemacht hat, mit einer knappen Geste zurück. Das ist ein Grund, warum ich vor diesem Oberarzt niemals den Respekt verloren habe. Bei allem Elan, den er bei einer Therapie an den Tag legt, weiß er, wann er den Kampf verloren hat und seine Patienten nicht weiter peinigen muss.
»Das verstehe ich nicht«, meint einer aus dem Pulk betroffen. »Es sah doch gut aus. Und das neue Medikament …«
Angerers Gesicht ist unbeweglich. Es ist der Ausdruck absoluter Hilflosigkeit.
Die Tränen lassen sich nicht länger zurückhalten. Ich ergebe mich der Trauer über den Verlust des jungen, unschuldigen Lebens und hoffe, dass die Wut bald zu mir zurückkehren wird.
Wer mich so an diesem Bett sieht, könnte meinen, ich sei die Mutter, die Tante, irgendeine nahe Angehörige von Thea, und so falsch ist das gar nicht. Ich fühle mich den Toten sehr eng verbunden, habe ich sie doch begleitet und bin mit ihnen ein Stück des Weges gegangen, den sie nur einmal gehen. Es ist etwas Unikales. Etwas, was uns zusammenschweißt.
Nach ein paar Minuten habe ich mich wieder gefangen und stehe auf. Erst jetzt lasse ich die Hand des Mädchens los, wische mir die Feuchtigkeit mit einem Taschentuch aus den Augen und von den Wangen, wissend, dass ich mein Make-up damit zerstöre. Einerlei.
Angerer und seine weiße Truppe sind schon wieder weitergezogen, vielleicht ein neuer Notfall oder die Routine des Sterbens im Krankenhaus: Bericht schreiben, Patientin infolge ihrer schweren Krebserkrankung verstorben, Uhrzeit nicht vergessen und keinesfalls unerwartet notieren, sonst hebt der Staatsanwalt den Kopf.
An der Tür drehe ich mich noch einmal um und betrachte Thea, wie sie daliegt, den Teddy im Arm. Ich spüre noch immer ihre Finger in meiner Hand, die Abdrücke sind auf meiner Haut zu sehen. So eine Schande.
Mein Weg führt mich ins Schwesternzimmer, in dem betroffene Stille herrscht. Die Nachtschicht weiß selbstverständlich Bescheid.
»Hier, Frau Sarkowitz«, empfängt mich Doris und reicht mir eine Tasse Tee. Es ist unser Ritual, seit sieben Jahren.
»Danke.« Ich hasse meine Stimme, wenn sie nasal klingt. Sie ist für eine Frau ungewöhnlich tief und dabei doch klar. Nur nach dem verfluchten Weinen höre ich mich an, als würde ich durch eine Gießkanne sprechen. Nach viel Zucker und Milch koste ich den Tee.
Auf dem Gang sehe ich Theas Eltern vorbeihasten.
»Ich mache das schon«, sagt Doris, steht auf und geht hinaus, um ihnen den Tod der Tochter schonend beizubringen. Das ist die Arbeitsteilung zwischen uns: Ich begleite die Menschen beim Sterben, sie die Angehörigen beim Trauern. Sie kann es besser als jeder Arzt, deswegen lässt man sie unter der Hand gewähren.
Schluck für Schluck leere ich die Tasse und versuche, meine Gedanken zu ordnen. Stattdessen habe ich Theas Gesicht vor Augen, das liebe kleine Gesicht. Es wird mich mindestens eine Woche verfolgen, das ist sicher. Der Tod von Erwachsenen geht mir lange nicht so nahe wie der von Kindern.
Meine Aufgabe in der Onkologie ist beendet. Es gibt derzeit keinen weiteren Kandidaten auf der Station, der bald aus dem Leben scheiden muss. Ich blicke zur Uhr über der Tür. 01.01 verkündet die Anzeige. Meine zweite Berufung beginnt bald.
Ich stelle die Tasse auf den Tisch zurück, erhebe mich und gehe zum Ausgang, als Doris zurückkommt. Nun hat auch sie Tränen in den Augen. Auf dem Flur höre ich das laute, verzweifelte Weinen einer Frau.
»Ich weiß gar nicht, wie Sie den Tod ertragen, Frau Sarkowitz«, sagt Doris gedrückt. »Wenn ich die Angehörigen und deren Leid sehe, könnte ich stundenlang mitheulen.« Sie greift in ihren Kittel und sucht nach einem Taschentuch.
»Sehen Sie, liebe Schwester Doris, das ist der Grund, warum ich die Sterbenden begleite, nicht die Verwandten«, erwidere ich. »Was denken Sie, wie bei mir Rotz und Wasser liefen, wenn ich bei den Eltern stehen müsste? Tröstende Worte liegen mir nicht.«
Wir reichen uns die Hand, sie berührt mich zusätzlich noch an der Schulter und geht an mir vorbei ins Zimmer.
»Haben wir noch jemanden auf den anderen Stationen?«, frage ich aus Gründen der Höflichkeit, obwohl ich es bereits weiß.
Doris schüttelt den Kopf. »Nein, Frau Sarkowitz. Auf der Intensiv der Urologie zwei liegt ein älterer Herr ohne Angehörige, aber das wissen Sie ja bereits. Der Oberarzt meinte, dass er nicht mehr viel Zeit hat, aber …«
»… aber das hat er auch schon vor einer Woche gesagt«, beende ich ihren Satz und lächle sie freundlich an. »Machen Sie sich keine Sorgen, Schwester Doris. Ihm bleiben drei Tage, vielleicht vier. Ich gehe morgen Nacht zu ihm.« Noch so ein ganz trauriger Fall: ein vergessener, einsamer alter Mensch. Gerade sie haben oft die größte Furcht vor dem Tod, auch wenn sie vorgeben, dass es eine Erlösung für sie wäre. Die meisten lügen. Ich werde ihm viel Zuwendung zukommen lassen. »Gute Nacht«, grüße ich in die Runde und warte, wie immer, nicht auf eine Antwort.
Ich gehe den Korridor hinunter zum Treppenhaus, während ich hinter mir das laute Weinen der Mutter höre, die um Thea trauert. Ganz sicher werde ich mich nicht zu ihr umdrehen. Ich mag den Anblick von verzweifelten Angehörigen nicht. Man möchte sie an den Schultern packen und sie anbrüllen, dass sie gefälligst froh sein sollen, noch ein Leben zu haben; dass sie hier sind und trauern dürfen; dass sie nicht gezwungen sind, ihre eigenen Kinder umzubringen …
Mit einem wütenden Tritt öffne ich die Tür und renne die Stufen hinab. Elf Stockwerke, lange Schritte, ein neuer Rekord zu Ehren von Thea. So schnell bin ich noch niemals im Foyer angekommen.
»Gute Nacht, Frau Sarkowitz«, ruft mir der Portier nach, ein junger Mann von höchstens achtzehn, der neue Zivi. Sie kommen und gehen so schnell, dass ich mir ihre Namen nicht merke. Ich hebe einfach die Hand und stürme hinaus.
Kann Scylla kommen und sie verjagen, Sia?
Ich habe einen Entschluss gefasst. Schon lange denke ich darüber nach, es zu tun, doch Thea hat nun den Ausschlag gegeben: Ich werde endlich all die Geschichten über das kleine Mädchen niederschreiben, die mich seit so langer Zeit verfolgen.
Eines ist sicher: Es werden erschreckende Geschichten sein. Denn ich spüre nicht nur den Tod – ich bin eine seiner Göttinnen.
I. Kapitel
12. März 1670Gruža (serbisches Gebiet), Osmanisches Reich
Kommen sie auch zu uns, Mutter?« Das kleine Mädchen blickte durch die halb blinden Fensterscheiben und ließ die Straße nicht aus den Augen, auf der die Soldaten durch den Regen von Haus zu Haus gingen. Sie gehörten, der einfachen Kleidung und Bewaffnung nach, zu den Hilfstruppen der türkischen Besatzer, vermutlich Freiwillige aus einem anderen Dorf. Der Kopf des Mädchens bewegte sich nach rechts und links, um an den undurchsichtigen Stellen im Glas vorbeizuschauen; auf dem zarten Gesicht spiegelte sich die Begeisterung wider.
»Das kann sein, Jitka.« Ihre Mutter trat hinter sie und legte die Hände auf die Schultern des Kindes. Sie teilte die Begeisterung nicht, aber es existierte auch kein Grund, weswegen sich Janja vor den Fremden fürchten sollte. Bei einer achtundzwanzigjährigen Witwe und einem acht Jahre alten Mädchen gab es nichts zu holen. Sie seufzte, richtete das einfache, dunkelbraune Kleid der Tochter und legte die zu einem Zopf gebundenen schwarzen Haare ordentlich auf den Rücken. Dabei beobachtete sie die Fenster der übrigen Fachwerkgebäude, hinter denen vereinzelte ängstliche Gesichter zu erkennen waren. Menschen, die ihre Häuser verlassen wollten, um mit den Soldaten zu sprechen, wurden mit deutlichen Gesten zurückgeschickt.
Jitka schaute nur kurz zu ihr auf, sie wollte die Männer nicht aus den Augen verlieren. »Darf ich mit ihnen gehen, Mutter?«
Janja sah sie erstaunt an und musste gegen ihren Willen sogar auflachen. Ihre Tochter wurde mit den Jahren immer unerschrockener, ihr Abenteuerhunger war inzwischen im gesamten Dorf bekannt. »Sie würden dich nicht mitnehmen, meine Blume, denn …«
Etwas erregte ihre Aufmerksamkeit. Janja sah, wie ein gepanzerter Mann heranritt und zu ihrem kleinen, frei stehenden Haus am Ende der Straße herüberblickte; dann stieg er von seinem prunkvoll geschmückten und gerüsteten Pferd. Ein Janitschar, stellte sie erstaunt fest. Man erkannte diese gefürchteten Elitekrieger an ihrer besonderen Kleidung. Eigentlich war es Janitscharen verboten zu reiten, doch weit weg von Konstantinopel und ihrem Sultan erlaubten sie sich Besonderheiten, das wusste Janja.
Der Janitschar rief einen Mann in einem orientalischen Gewand zu sich, der von einem Schirmträger flankiert wurde, und sie redeten miteinander. Dass Hilfstruppen von einem derartigen Kämpfer begleitet wurden, war mehr als ungewöhnlich und vermutlich auch nicht gut. Normalerweise war es ihnen verboten, mit der Bevölkerung in Berührung zu kommen. Sie setzten sich aber über vieles hinweg, um sich Wohlstand und Macht zu sichern.
»Und warum würden sie das nicht, Mutter?«
Janja war in Gedanken. Sie hatte einmal gehört, dass es keine Übersetzung des Wortes gab, nur eine Umschreibung, die in etwa besagte, dass ein Janitschar ein unfreier Mensch war, der allein für den Krieg lebte. Dass einer von ihnen im Dorf auftauchte, machte sie unruhig.
»Sie mögen keine Mädchen«, antwortete Janja gedankenverloren. Sie beobachtete, was sich unweit von ihnen abspielte, und das merkwürdige Unbehagen breitete sich weiter in ihr aus. Dabei sollte es dafür keinen Grund geben. Unter der Herrschaft der Türken gab es kaum Einschränkungen, und solange jeder seine Abgaben und Steuern bezahlte, ließen die Phanarioten – die griechischstämmigen Verwalter – sowie die Richter, Kadis genannt, die Dörfer in Frieden. Janja hatte ihre Abgaben bezahlt, gerade gestern erst.
Die überwiegende Mehrheit der Bewohner des Landstrichs waren Christen geblieben, die Besatzer verzichteten auf eine gewaltsame Bekehrung – wenn auch die Glocken in den Türmen nicht mehr zum Gottesdienst rufen durften. Der Klang, so lautete die Begründung, beleidige die Ohren der Muslime. Manche Kirchtürme hatten um einiges verkleinert werden müssen, damit sie nicht höher als die Minarette waren.
In ihrer kleinen Stadt gab es kein Minarett, daher erhob sich der Turm unbeeindruckt. Es gab durchaus Dörfer, die komplett zum Islam übergetreten waren, was ihnen Vorteile brachte. Sicherlich stammten diese Soldaten aus einem von ihnen.
Was natürlich immer für Unruhe sorgte, war die Devshirme, die Knabenlese, bei der die christlichen Familien ihre ältesten Söhne dem Sultan überlassen mussten, der aus ihnen Janitscharen machen ließ. War das der Grund für das Auftauchen der Soldaten?
»Aber du sagst immer, ich sei etwas Besonderes, Mutter«, widersprach Jitka leise und klatschte einmal in die Hände, als sie sah, dass der Janitschar durch die vom Wind umhergetriebenen Regenschleier auf ihr Zuhause zukam. »Vielleicht machen sie bei mir eine Ausnahme?«
»Du bist vor allem besonders neugierig. Das können sie schon gar nicht leiden. Du hast doch gesehen, wie sie die Menschen wieder in ihre Häuser gejagt haben.« Janja beugte sich zu ihrer Tochter hinunter. »Die Türken sind nicht unsere Freunde, vergiss das niemals.«
Schwere Stiefelschritte näherten sich dem Eingang, gleich danach hämmerte ein harter Gegenstand gegen die Tür. Janja warf sich ihren dunkelbraunen Umhang über, zog die weiße Haube fester über die brünetten Haare und eilte zur Tür. »Du wirst schweigen, Jitka«, befahl sie leise, doch sehr eindringlich, bevor sie öffnete.
Das Licht der Kerzen fiel auf den Mann und beleuchtete ihn golden. Jitka strahlte bei dem Anblick. Auf der Schwelle stand ein Janitschar, wie er in Geschichten beschrieben wurde und wie ihn sich das Mädchen immer erträumt hatte. Unter dem Überwurf aus gutem, schwerem Stoff glänzte ein Panzerhemd aus vernieteten Eisenringen; es war mit Broschen und Symbolen geschmückt. Als Kopfschutz diente eine schwere Sturmhaube, an der ein Ringgeflecht den Nacken-, Stirn- und Wangenschutz bildete. Auf der Sturmhaube saß wiederum eine hohe Haube aus weißem Filz, in der eine vergoldete Federhülse über der Stirn steckte. Hände und Unterarme waren von langen Panzerhandschuhen bedeckt. Das Mädchen bestaunte das Dekor, das von einem begnadeten Goldschmied angefertigt worden sein musste. Die Blumenmuster, die gravierten geometrischen Ornamente, vergoldeten Schließen und Beschlagteile glänzten im Schein der zuckenden Flämmchen.
An der Seite des Janitscharen hing der Krummsäbel, im Gürtel steckten zwei atemberaubend schön gearbeitete Pistolen. Die Griffe seiner Waffen waren mit aufwendigen Intarsien geschmückt, wie es sich üblicherweise nur Fürsten leisteten. In der Rechten hielt er einen mit Seide und Silberdraht geschmückten Rundschild. Die Beine steckten in Hosen aus blauem Stoff, die Füße in hohen Stiefeln.
Jitka traute sich kaum zu atmen, als könne sie so verhindern, dass dieses fast märchenhafte Geschöpf so schnell verschwand, wie es gekommen war. Nur das Wasser, das von der Haube rann, schien wirklich zu sein; Tropfen perlten über das Gesicht, in dem ein prächtiger brauner Schnurrbart prangte.
»Wir suchen nach einem Jungen«, sagte der Janitschar ohne einen Gruß zu Janja. Seine hellen Augen spähten in den karg eingerichteten Raum. »Wenn er hier vor uns verborgen wurde, sag es lieber gleich.« Er beugte sich vor und trat ein, die Filzhaube streifte den Türrahmen. »Falls ich ihn finden sollte, wird es dir schlecht ergehen.« Er sprach nicht nur ohne Akzent, sondern auch ohne jegliches Gefühl in der Stimme. »Er hat von den Abgaben des Dorfes gestohlen.«
»Ich habe niemanden versteckt. Ich lebe mit meiner Tochter allein«, gab Janja zurück und neigte den Kopf vor dem Janitscharen, den sie etwas älter als sich selbst schätzte. »Ich würde es niemals wagen, mich den Befehlen des Sultans zu widersetzen, das weiß der Kadi.« Sie war verunsichert, da sie nicht wusste, wie sie mit ihm sprechen durfte – und ob überhaupt. Sie kannte niemanden aus der Stadt, der das jemals zuvor getan hatte.
Vier Soldaten betraten das Haus, und auf einen Wink des Janitscharen schwärmten sie aus und begannen ihre Durchsuchung. Er selbst ging an Jitka vorbei, würdigte sie aber keines Blickes, während das Mädchen ihn anstaunte und die Augen nicht mehr abwenden wollte. Sie hatte so viele Fragen! Besonders gefiel ihr der Dolch an seiner Seite, ein wundervolles und einmaliges Stück, dessen Griff aus Holz bestand, aber mit viel Silber beschlagen war. Die Motive und Muster schimmerten, goldene Beschläge aus Blumen und Ranken liefen um die Scheide, und selbst der Griff wies Zierrat auf. Er hatte nichts mit den schartigen, abgewetzten Messern gemein, welche die Männer des Dorfes für die tägliche Arbeit bei sich trugen. Den gezischten Befehl ihrer Mutter, bei ihr zu bleiben, hörte sie nicht einmal.
Jitka folgte den Männern, während sie die drei kleinen Kammern inspizierten, Schränke öffneten, hinter den großen Kesseln und Pfannen stöberten und sogar unter das Bett schauten. Dabei blieb sie stets auf Abstand, musterte jede Bewegung des Janitscharen, die Rüstung, die Verzierungen.
Die Soldaten aber schienen sie nur als Teil des Häuschens anzusehen. Wenn sie im Weg stand, wurde sie nicht unsanft, aber achtlos wie ein Möbelstück zur Seite geschoben.
Der Janitschar gab gelegentlich kurze Anweisungen auf Türkisch an seine Begleiter. Jitka sog den Geruch des Mannes ein, der sich aus etwas Schweiß, Eisen und viel feuchtem Tuch zusammensetzte; darunter war ein würziger, angenehmer Duft verborgen. Jitka fand ihn faszinierend: eine lebendig gewordene Sagengestalt, unmittelbar von einem Schlachtfeld zu ihnen gekommen!
Schließlich hielt der Janitschar inne und wandte sich langsam zu ihr um. »Was gibt es zu sehen?«
»Euch«, sagte Jitka, ohne an die Warnung ihrer Mutter zu denken. Obwohl sie einen kleinen Schritt vor dem Mann zurückwich, nahm sie innerlich bereits Anlauf, ihm eine von vielen Fragen zu stellen.
Plötzlich stand ihre Mutter hinter ihr, packte sie an den Schultern und zwang sie aus der Schlafkammer. Der Griff war schmerzhaft. »Warte draußen!«, befahl sie ungewohnt scharf, dann sah sie den Janitscharen an. »Ich kenne dich.« Sie trat näher an ihn heran. »Du bist Branco. Sie haben dich vor fünfzehn Jahren mitgenommen, wenn ich mich richtig erinnere.«
Das Gesicht des Mannes verfinsterte sich. »Ich habe dich gleich wiedererkannt, Janja, aber ich wusste nicht, ob es sich bei dir ebenso verhielt.« Er hakte die freie Hand in den Waffengurt, neben den Griff des Damaszenerstahldolches und verbarg seine Ablehnung nicht. Man sah ihm an, dass er nicht hier sein wollte. »Jetzt bin ich mit meinem Regiment zurückgekehrt. Es ist ungewohnt, die alte Sprache zu sprechen und Gesichter zu sehen, die ich vergessen glaubte. Die meisten von ihnen schauen nicht mehr wohlgesinnt drein.«
»Wundert dich das?« Janja wusste nicht, was gerade in sie fuhr, aber die Erkenntnis, dass der Janitschar einmal einer ihrer Spielkameraden gewesen war, ließ sie alle Vorsicht vergessen. »Die Abgaben, die Devshirme …«
»Abgaben muss man immer zahlen«, wischte er ihren Einwand beiseite, »und der Sultan benötigt Janitscharen für seine Armee. Aber es wird vermutlich keine Knabenlese geben, es ist einiges im Wandel.« Die hellen Augen studierten ihr Antlitz. »Du hast geheiratet?«
»Ja.«
»Wen?«
»Du kennst ihn. Radomir.«
Branco hob die Augenbrauen. »Es ist zwar lange her, dass ich hier gelebt habe, aber wenn das seine Tochter sein soll, frage ich mich doch, warum sie ihm gar nicht ähnlich sieht. Jedenfalls nicht dem jungen Radomir.«
»Das kommt vor.« Janja verfluchte sich dafür, dass sie ihre Vorsicht vergessen und ein Gespräch begonnen hatte. Der einstige Freund hatte den größten Makel ihrer Tochter auf den ersten Blick bemerkt. Warum konnte dieses Kind nur niemals gehorchen? Janja spürte, wie Jitka sich von hinten gegen ihren Rock drückte. »Wieso haben sie dich geschickt, um den Jungen zu suchen?«, versuchte sie den Janitscharen abzulenken.
»Ich sollte die Abgaben einsammeln.« Er verzog den Mund. »Dass ich stattdessen einen gewöhnlichen Dieb jagen muss, war nicht vorgesehen.« Branco rief einem der Männer etwas zu, und der Soldat stampfte laut und prüfend auf den Dielen umher. Die Suche nach Hohlräumen begann.
»Deine Tochter ist neugierig und vorwitzig«, wandte er sich wieder an Janja. »Das hat sie von dir.«
»Sie wünscht sich, eine Janitscharin zu sein«, gab sie stolz lächelnd zurück – und erschrak, als sie sah, wie sich seine Augenbrauen zusammenzogen. Ihre Linke zuckte an ihren Hals und berührte die silberne Amuletthälfte, die dort an einem dicken Faden hing. »Sie ist gelegentlich ein schrecklicher Wirbelwind«, sagte sie schnell, »und auch, wenn sie dann und wann ihre Fäuste ballt, sind doch ihre Stärken das Tanzen und Singen. Das Kämpfen überlassen wir den Männern.«
»Dann ist sie in einigen Jahren etwas für den Harem des Sultans«, sagte Branco nachdenklich. »Sie ist jetzt schon sehr hübsch. Ich werde ein Auge auf die Kleine haben.«
Janja schluckte. Nun gab es durch ihre eigene Schuld doch etwas bei ihr zu holen!
»Was ist ein Harem?«, hörte sie ihre Tochter fragen.
»Ein Ort, an dem hübsche junge Prinzessinnen ein gutes Leben führen. Du wirst vielleicht die Frau des Sultans, des mächtigsten Mannes der Welt«, erklärte der Janitschar und bedachte sie mit einem etwas freundlicheren Blick, dann deutete er mit einer ausholenden Geste in den Raum. »Du wirst in weichen Betten aus reiner Seide schlafen, in wunderschönen Brunnen baden, deine Haut wird mit Milch und Honig gepflegt. Es gibt jede Speise, die du dir vorstellen kannst, und Konfekt, so viel du möchtest. Kein Wunsch wird dir abgeschlagen werden. Du wirst die Gebieterin in einem Palast sein und nicht wie hier«, in seine Stimme mischte sich wieder die alte Verachtung, »gefangen in einer alten, heruntergekommenen Hütte, die einmal ein Pferdestall gewesen ist.«
Jitka hing förmlich an den Lippen des Mannes. Ihre dunkelgrauen Augen leuchteten auf, und sie klatschte begeistert in die Hände; dabei rutschten die Ärmel ihres Kleides nach oben. »Das klingt wundervoll!«
Janja erstarrte. Das tropfenförmige, feuerrote Mal auf dem linken Unterarm war zum Vorschein gekommen. Jitka musste das Lederarmband, das sie normalerweise darüber trug, vergessen haben.
Branco sah es sofort, das Rot schien aus reiner Bosheit aufzuleuchten. »Was ist denn … Hat sie das von Geburt an? Dieses Zeichen?«
»Jitka, ich sagte, du sollst hinausgehen«, sprach Janja mit schneidender Stimme zu ihrer Tochter, beugte sich vor und stieß sie hinter sich. »Branco …«
Er hob die Hand, die Kettenglieder klirrten. »Mein Name ist schon lange nicht mehr Branco. Ich heiße Mohammad und folge den Gesetzen des Korans und dem Wort des Propheten«, wies er sie harsch zurecht. »Was ist mit dem Zeichen auf ihrem Arm? Das ist kein Brandfleck, sondern das, was man ein Versprechen über den Tod hinaus nennt.« Er kam drohend auf sie zu. »Ist es so? Gib es ruhig zu. Ich kenne die alten Legenden von früher.«
Janja versuchte, ihre Angst zu unterdrücken. »Dann bitte ich dich der alten Zeiten wegen: Vergiss, was du hier gesehen hast, und …«
»Deine Sorge ist unbegründet«, unterbrach er sie und stand nun direkt vor ihr. Leiser, aber mit lauerndem Unterton setzte er hinzu: »Wenn du mir sagst, wer wirklich ihr Vater ist.«
»Radomir.«
»Die Wahrheit, Weib!«
Keiner wich dem Blick des anderen aus. Für einen kurzen Moment schien die Zeit stillzustehen – bis zwischen ihnen ein Wassertropfen hindurch und zu Boden fiel. Der Janitschar hob sichtlich erstaunt die Augen und entdeckte einen nassen Fleck an der groben, von Rissen durchzogenen Decke. Die Stelle drumherum war nicht vollgesogen und aufgequollen, was bedeutete, dass sich die Feuchtigkeit noch nicht lange dort befand.
»Wie gelange ich unters Dach?«
Janja hatte das Wasser über ihrem Kopf auch eben erst bemerkt. »Ich verstehe nicht …«
Er stieß sie mit einer schnellen Bewegung aus dem Weg und riss gleich danach den Arm mit dem Schild nach oben; der Rand krachte gegen die Bohlen.
Der erschrockene Aufschrei aus dem Raum darüber wurde von allen vernommen.
Mohammad brüllte etwas auf Türkisch und zog den Krummsäbel, von draußen wurde sogleich geantwortet. Zwei seiner Soldaten packten Janja, während die anderen den Tisch unter die Stelle schoben, hinaufkletterten und mit ihren Säbeln durch die Ritzen stachen.
»Lasst mich!« Janja riss sich los und stürzte, dann kroch sie rückwärts zu Jitka hinüber. Das Kind musste in Sicherheit gebracht werden! »Lauf hinaus«, befahl sie aufgeregt. »Versteck dich dort, wo wir uns unterstellen, wenn wir Gras für die Ziegen schneiden.« Sie sah zur geöffneten Tür, auf die sich mehrere Männer zubewegten. Noch mehr Soldaten kamen in ihr Heim!
Jitka zitterte am ganzen Körper und starrte auf die türkischen Krieger, die laut rufend auf sie zukamen. »Was geschieht mit dir, Mutter?«
Sie gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Nichts, kleine Blume. Ich habe nichts getan, das wird sich herausstellen. Bis dahin bleib im Verborgenen.« Janja sprang auf, schob das Kind auf den Ausgang zu – und wurde im gleichen Moment von den Soldaten ergriffen. »Lauf, bevor sie dich erwischen! Ich komme und hole dich, wenn sich alles aufgeklärt hat.«
Jitka kämpfte die Tränen nieder – und sah zwei bewaffnete Männer auf der Schwelle stehen. Ohne lange nachzudenken, rannte sie nach links, sprang auf den Stuhl, von dort auf den Tisch und öffnete das Fenster, durch das sie gleich danach hinaus in die Gasse hüpfte.
Als sie aufkam, rutschte ihr der Fuß weg und sie fiel, aber sie rollte sich instinktiv über die Schulter ab und vermied so eine Verletzung. Es war ihr beim Spielen und den ausgedehnten Streifzügen durch die Wälder schon oft aufgefallen, dass sie eine enorme Geschicklichkeit besaß; doch nun kam es vor allem auf Geschwindigkeit an.
Jitka hetzte durch den eiskalten Regen, der ihre Kleidung binnen Lidschlägen durchweichte. Ihr Weg führte sie nicht zum Stadttor, sondern zum Haus von Milan. Er war ihr bester Spielkamerad gewesen, bis die anderen Kinder sie mehr und mehr aus ihrer Mitte ausgestoßen hatten, wegen des Mals an ihrem Unterarm und des bösen Blicks, den sie angeblich besaß. Milan hatte sich ebenfalls von ihr zurückgezogen, aber er sah sie immer noch freundlich an, wenn sie einander zufällig begegneten. Jitka wollte daher lieber bei ihm Unterschlupf suchen. Sie wusste nicht, wie lange sie in dem Versteck warten musste, und in der Nacht konnten vor den Mauern der Stadt schreckliche Kreaturen lauern.
Keuchend erreichte sie das Haus und klopfte. Milan öffnete und sah sie verwundert an. »Jitka?« Er warf einen Blick hinaus. »Allein? Um diese Zeit? Was …«
»Sie haben Mutter gefangen genommen«, erklärte sie abgehackt. »Bitte, lass mich …«
Die Tür wurde weiter geöffnet, und Milans Vater erschien. Er sah wegen des Barts, der langen dunklen Haare, seinem braunen Hemd und den braunen Hosen aus wie ein Bär. »Wer hat sie gefangen genommen?« Er schlug das Kreuz und vollführte eine Geste, die vor dem Zauber des bösen Blicks schützen sollte.
Jitka zitterte. »Die Türken!«
»Dann wird es einen Grund haben.« Der Mann stieß sie zurück in den kalten Regen; um ein Haar wäre sie gestürzt. »Scher dich weg! Sie sollen dich nicht bei uns finden und uns auch noch unglücklich machen«, befahl er und schlug die Tür zu.
Jitka verstand es nicht. Sie sah Milans Gesicht hinter dem Fenster erscheinen; er sah todunglücklich aus. Seine Lippen bewegten sich, aber das Mädchen begriff nicht, was er ihr sagen wollte.
Schritte erklangen in der Gasse, sie hörte Rufe auf Türkisch. Die Verfolger hatten nicht aufgegeben; somit blieb ihr keine andere Wahl, als den Anweisungen der Mutter zu gehorchen. Das Klappern von Pferdehufen gesellte sich hinzu, was sie als Zeichen sah, dass sie nun auch noch von dem Janitscharen gehetzt wurde. Aus ihrem Helden war ein Feind geworden, den sie für nichts mehr bewunderte.
Jitka lief wieder los, schlug Haken, verbarg sich mit klopfendem Herzen immer wieder, bis sie schließlich unbemerkt durch das Stadttor von Gruža schlüpfen konnte. Sie eilte über die Wiesen, auf denen immer wieder die Reste von Schneefeldern lagen. Die kleinen Füße hoben und senkten sich, so schnell sie es vermochten; das Mädchen wagte nicht einmal, über die Schulter nach hinten zu schauen. Zu groß war die Angst, dass sie Verfolger entdeckte: Wenn sie keine sah, das war ihre feste Überzeugung, würde sie ebenfalls nicht gesehen.
Keuchend erreichte Jitka schließlich die Felsformation, wo sich ein Überhang wie eine riesige, versteinerte Nase nach vorne schob und Schutz vor der Witterung bot.
Das Mädchen warf sich in das dort ausgelegte Stroh, das feucht war und nach Ziegen roch. Sie grub sich wie eine Maus tief in den Haufen ein und spähte aus ihrem Versteck zum ersten Mal in Richtung Stadt.
Niemand war ihr gefolgt. Doch noch wollte Jitka sich kein Aufatmen gestatten. Gebannt starrte sie auf die Wiesen, beobachtete die Straße, die von Gruža fortführte.
Die Dämmerung brach herein, Kälte kroch durch die klammen Halme in Jitkas Körper, der vor Kälte bebte. Sie betete unentwegt für ihre Mutter, für deren Wohlbefinden und für die eigene Rettung. Wer hatte sich dort oben auf dem Dachboden verborgen? Und warum ausgerechnet in ihrem Haus? Es fiel ihr keine Lösung ein.
Gedankenverloren berührte sie das Feuermal an ihrem Arm. Jitka war es gewohnt, dass man sie deswegen mied; doch mit den Fragen des Janitscharen über ihren Vater wusste sie nichts anzufangen.
Dem Halbdunkel folgte die Nacht. Der Regen prasselte noch immer auf das Land, glucksend rann er rings um das Mädchen durch Felsspalten, kleine Bäche flossen über den Stein und plätscherten in Pfützen. Trotz ihrer Müdigkeit, der Kälte und dem festen Vorhaben, entgegen der Anordnung der Mutter nach Hause zurückzukehren, schlossen sich Jitkas Augen, und sie schlief ein.
Im Traum kehrte sie zurück ins Haus, zusammen mit ihrer Mutter – und einem Mann!
Sie sah niemals sein Gesicht, etwas war immer dazwischen. Er war groß und kräftig, trug schöne Kleidung und hatte schlanke, saubere Finger; am linken Mittelfinger glänzte ein goldener Siegelring. Das Zeichen darauf konnte sie deutlich erkennen: Es waren drei gekreuzte Dolchpaare, eins oben, zwei darunter.
Sie standen in der Küche, der Ofen verbreitete angenehme Wärme, und es roch nach Kuchen. Der Mann hielt ihre Mutter im Arm. Sie lachte glücklich, gab ihm einen Kuss und beugte sich zu ihr hinab. »Sag deinem Vater guten Tag, meine Blume«, forderte sie mit einem glücklichen Lächeln.
Der Traum zerstob in dem Moment, als Jitka versuchte, mit aller Macht einen Blick auf das Gesicht des Mannes zu erhaschen. Sie vernahm ein leises Knistern und Knacken.
Jitka sah ein kleines Feuer, das im Unterstand entzündet worden war. Die Flammen hatten das Stroh und ihre Kleider bereits getrocknet. Die Wärme, die sie im Traum gespürt hatte, war demnach echt gewesen!
Sie erhob sich, die Halme fielen raschelnd von ihr herab. »Mutter?« Sie lauschte, konnte aber nichts hören. Der Regen hatte aufgehört, stattdessen hing Nebel hüfthoch wie ein weißes Meer über den Wiesen, bewegte sich und wogte sanft in einem leisen Luftzug. Sterne glänzten am Firmament. Jitkas Atem wurde als weißer Hauch sichtbar.
Sie fröstelte, sah sich im Unterstand nach Spuren um, entdeckte jedoch nichts. Irgendwo in der Nacht bellte ein Fuchs, ein zweiter stimmte ein. Jitka bekam plötzlich Angst.
»Mutter, wo bist du?«, rief sie und rückte näher ans Feuer.
Sie meinte, einen menschengroßen Schatten an der Wand hinter sich bemerkt zu haben, der sich unglaublich schnell bewegte.
Jedes Härchen in ihrem Nacken richtete sich auf, ihr Herz schlug schneller. Sie kannte die Geschichten vom Upir, dem Wesen, das in der Dunkelheit lauerte und nach dem Blut der Lebenden trachtete. Vielleicht hatte er das Feuer angezündet, damit er sein Opfer besser sah?
Ein Pferd schnaubte, dann erklangen die Rufe von zwei unterschiedlichen Männerstimmen. Metall schlug gegen Metall. Jitka erschrak, als sie im Nebel die Lichter zweier Laternen erkannte. Die Türken hatten die Suche nach ihr noch nicht aufgegeben – und das Feuer führte sie genau zu ihrem Versteck!
Sie spürte eine zärtliche Berührung an ihren Haaren, eine tiefe Männerstimme flüsterte ihren Namen. »Ich beschütze dich. Hab keine Angst und folge …«
»Nein!«
Jitka wagte nicht, sich umzuschauen, sondern rannte los, weg vom Unterstand und auf ihr Zuhause zu. Lieber geriet sie den Türken in die Hände als einem Upir!
Die Strecke bis zum Tor schien mit jedem Schritt, den sie tat, länger zu werden, als rückte eine unsichtbare Macht die Stadt immer weiter an den Horizont. Jitka lief und lief. Sie ignorierte das Stechen in ihrer Seite, den bleiernen Ring, der sich um ihre Lunge zu legen schien, und das laute Pochen des Blutes in ihren Ohren. Fast wunderte es sie, dass allein dieser Lärm ihre Verfolger nicht wieder auf ihre Spur brachte; doch auch diese schienen, wie die Stadt, von magischer Hand verschoben zu werden. Mal waren sie ganz nah, so dass Jitka sich instinktiv duckte, um Schutz zu suchen, dann wieder sah sie die Laternen der Reiter in weiter Ferne. Das Wichtigste aber war, dass die Männer sie noch nicht bemerkt hatten; verlief alles gut, konnte sie zurückkehren und nach Hause eilen, um nach ihrer Mutter zu suchen. Obwohl es gefährlich war, blieb Jitka fest entschlossen, genau zwischen den Laternen hindurchzuwischen, der Abstand erschienen ihr groß genug, um mit etwas Geschick nicht bemerkt zu werden.
Der Nebel um sie herum wirbelte auf, schien immer dichter zu werden und … lebendig! Er formte Strudel und große Wogen, aus denen sich einzelne gespenstische Arme lösten und sich ihr entgegenstreckten; in der Ferne wallte er immer höher, verschluckte die Umrisse der Stadtmauer, die Rauchfahnen aus den Schloten der Häuser – und schließlich die Sterne.
»Halt!«, befahl ein Mann, dessen Stimme sie als die des Janitscharen erkannte. Wie war er so nah an sie herangekommen? Pferdegeschirr klirrte, und das Trappeln von Hufen kam auf sie zu. »Bleib stehen, Mädchen!«
Jitka rannte schneller und schneller. Täuschte sie sich – oder wich der Nebel wirklich vor ihr zurück? Es war, als würde sie durch eine schmale Gasse zwischen hohen Mauern hindurcheilen. Und ohne, dass sie sich umschauen musste, spürte Jitka, dass das graue Meer hinter ihr wieder nahtlos zusammenfloss und ihren Verfolgern die Sicht raubte!
Ein lauter Schrei erklang irgendwo rechts von ihr. Der schwache Lichtschein einer Laterne tanzte hin und her, und sie erkannte die Silhouette eines Soldaten, der mit seinem Säbel um sich schlug. Dann erschien ein dunkler Schatten hinter ihm, eine menschliche Gestalt. Jitka sah es auf dem Kopf funkeln und glitzern, als säßen Sterne darin gefangen. Gleich darauf erlosch die Lampe, und ein zweiter Schrei gellte durch die Nacht, bis er abrupt abriss.
»Heiliger Theodor, steh mir bei«, flehte das Mädchen und rannte weiter. Milchige Gespensterfinger strichen zärtlich über ihr Gesicht, sie spürte streichelnde Hände auf ihrem Schopf und schrie entsetzt auf.
Das Pferd des Janitscharen galoppierte direkt vor ihr aus dem Nebel. Jitka warf sich erschrocken zu Boden. Mohammad achtete jedoch nicht auf sie, sondern versuchte die Stelle zu erreichen, an der seinem Soldaten Schreckliches widerfahren war.
Ein weiterer Schrei brandete auf, und Jitka sah, wie links von ihr die zweite Laterne erlosch. Das Glas zerschellte, aus dem Brüllen wurde ein Kreischen, ausgestoßen in höchster Furcht. Heilige Mutter Gottes, rief sie stumm, während sie sich wieder auf die Füße kämpfte. In diesem Nebel muss ein Upir hausen! Bitte, lass ihn seinen Hunger an meinen Verfolgern stillen und mich verschonen!
Dann, endlich, durchbrach sie die kühlen Wolken, die ihr Antlitz, die Hände und die Kleidung mit Feuchtigkeit überzogen hatten, und stand vor dem Eingang nach Gruža. Das große Tor war nur angelehnt. Eine weitere Merkwürdigkeit. Jitka zwängte sich hindurch. Keine Wache hielt sie auf, niemand sprach sie an und verlangte zu wissen, was ein kleines Mädchen um diese Zeit allein auf der Straße verloren hatte.
Sie schlich durch die einsamen Gassen und Straßen zu ihrem Haus. Um Mohammad und seine Soldaten machte sie sich keine Gedanken mehr, sie vertraute auf den Hunger des Upirs. Jitka schauderte und war froh, dass sie das Wesen nicht zu Gesicht bekommen hatte.
Hinter den Fenstern ihres Heims brannte kein Licht, und als sie vorsichtig näher heranging, sah sie, dass die Tür nicht verschlossen war. Behutsam trat sie ein, stets bereit, sich zur Flucht zu wenden.
Es hatte sich nichts verändert, sogar das Fenster war noch immer geöffnet. »Mutter, bist du da?« Jitka ging durch den Wohnraum in die Küche, kehrte zurück und betrat das Schlafzimmer. Sie sah die Bretter, die auf dem Boden lagen; Dielen waren zerbrochen worden, an den Splittern haftete dunkle Flüssigkeit. Blut! Der Janitschar und seine Leute hatten die Decke aufgebrochen und jemanden dort oben gefunden.
Aber wen? Den Jungen? Wie sollte er dorthin gelangt sein?
Jitka stellte einen Stuhl auf den Tisch, kletterte hinauf und schwang sich durch das Loch in die Dachkammer, wo die Mutter alte Kleider aufbewahrte und Schnüre zum Trocknen der Wäsche gespannt hatte. In der Mitte gab es eine enge Luke, durch die man den kleinen Raum eigentlich betrat.
Sie suchte die Dachkammer ab und fand schnell einen zweiten Zugang: Der Fremde hatte Schindeln entfernt, um hineinzuschlüpfen und sich ein Versteck einzurichten; dabei war Regen hereingelaufen, und die Tropfen an der Decke hatten ihn verraten. Der Gesuchte hatte sich ausgerechnet ihr kleines Häuschen ausgesucht, um sich zu verstecken.
Jitka kehrte zurück in die Wohnräume und suchte verzweifelt nach Hinweisen, was mit ihrer Mutter geschehen war. Die Türken hatten keine Sachen von ihr mitgenommen, es fehlte nicht ein Wäschestück. Es gab auch keine weiteren Blutspuren, also nahm sie an, dass man ihrer Mutter nichts angetan hatte.
Müdigkeit stieg in Jitka auf und machte, zusammen mit der Unsicherheit und der Verzweiflung, ihre Gliedmaßen unendlich schwer. Sie wusste, dass es niemanden in der Stadt gab, der ihr helfen würde, und es besser war, wenn sie bliebe, wo sie war. Das Mädchen mit dem bösen Blick und dem Mal, das alle hässlich fanden. Manche sagten auch noch schlimmere Dinge.
Sie ging zu dem Bett, in dem sie und ihre Mutter gemeinsam schliefen. Wie gerne hätte sie sich hineingelegt und die Decke bis über den Kopf gezogen, doch sie wagte es nicht. Stattdessen nahm sie das Laken und verkroch sich in den Schrank, auf dessen Boden sie sich zusammenrollte. Das Laken legte sie über sich, damit man sie nicht auf den ersten Blick sehen würde. Ein Versteck, falls die Türken noch einmal ins Haus kommen sollten.
Jitka schloss die Augen und betete, dass, wenn sie am nächsten Morgen erwachte, ihre Mutter neben ihr lag oder sie mit einem Kuss weckte.
Alles um sie herum war warm und sauber. Vor ihr öffnete sich eine Tür. Durch sie trat der geheimnisvolle Mann herein, dem sie schon einmal im Traum begegnet war – ihr Vater! Er streckte die Hände nach ihr aus und zog sie in seine Arme. Dankbar ließ Jitka ihren Kopf an seine Brust sinken, wollte sich in seiner tröstenden Wärme verlieren, sie spürte, wie ihr seine langen Locken in der Nase kitzelten, als er aufstand und mit ihr …
Jitka fuhr hoch. Das war kein Traum – da waren Schritte, die sich ihrem Versteck näherten! Benommen bemerkte sie, dass der Tag anbrach. Die Tür des Schranks stand offen … war sie von selbst aufgegangen?
»Jitka, steh auf«, vernahm sie die Stimme von Martin, dem Großknecht des Bauern Lubomir. Bei ihm arbeiteten sie und ihre Mutter, um sich das Geld zum Leben zu verdienen. Eine Welle der Erleichterung ließ sie für einen Moment aufatmen. Von dem netten, freundlichen Mann drohte keine Gefahr – er war aber auch nicht die geliebte Mutter.
Sie schlug das Laken zurück und sah in das bärtige Gesicht des kräftigen, untersetzten Knechts. Er trug einfache Kleidung aus derber Wolle, darüber einen abgewetzten Ledermantel, der ihn vor Kälte und Regen schützte; auf dem Kopf saß ein zerschlissener brauner Hut.
»Wo ist meine Mutter?«
Martin setzte sich neben sie vor den Schrank. »Es ist besser, wenn du die nächsten Tage bei mir bleibst«, sagte er leise und beruhigend. Er klaubte ihr ein paar Strohhalme aus dem zerzausten Haar und ließ sie zu Boden fallen. »Sie wird wiederkommen, da bin ich mir ganz sicher.«
Jitka schluckte. »War es der Janitschar? Was ist denn passiert?« Die dunkelgrauen Augen wanderten zur geborstenen Decke.
»Man sagt, der Junge hat sich da oben versteckt. Aber seine Diebesbeute fehlt«, erklärte er ihr. »Die Türken haben deine Mutter, den Jungen und dessen Familie mitgenommen. Sie werden zum Kadi gebracht, der entscheiden wird, welche Strafe über sie verhängt wird.«
»Aber wir haben …« Jitka schossen Tränen der Wut und Hilflosigkeit in die Augen. »Wir wussten nicht, dass er da oben ist.«
Martin drückte sie an sich und ließ sie in seinen Armen schluchzen. »Mein Herr hat gesagt, er wird sich für deine Mutter einsetzen, damit ihr nichts geschieht. Sie ist eine gute Frau.«
Er stand auf und trug das weinende Kind hinaus auf die Straße, wo ein Einspänner wartete. Martin setzte sie auf den Bock und legte eine dicke, kratzige Decke über Beine und Oberkörper. »Warte hier. Ich hole deine Sachen.« Er verschwand für einige Augenblicke im Haus und kehrte mit einem Korb voller Wäsche zurück, dann zog er die Tür hinter sich zu und stieg zu ihr.
Ein Peitschenknall genügte, und die Kutsche setzte sich in Bewegung, rollte die Straße entlang. Jitka sah zu den Fenstern, die rechts und links an ihr vorüberzogen, und erkannte dahinter einige mitleidige Gesichter; andere dagegen machten Zeichen zur Abwehr des bösen Zaubers, den man ihr nachsagte. Als sie am Haus von Milan vorbeikamen, stand er am Fenster und winkte. Jitka wollte den Arm heben, konnte sich aber nicht rühren. Ihre Gedanken drehten sich einzig um ihre Mutter, ihr Körper war wie gelähmt.
Rumpelnd und mit leisem Kettenklirren fuhr der Wagen zur Stadt hinaus und schlug den Weg zum Gehöft des Großbauern ein.
Am Himmel zog der Morgen herauf. Jitka suchte die Felder mit Blicken ab, um einen Hinweis auf das Geschehen der Nacht zu erhalten, aber es fanden sich keinerlei Spuren.
Der Nebel, der ihr gestern Nacht so viel Angst bereitet hatte, war bis auf eine kleine hartnäckige Bank neben dem Unterstand verschwunden.
Als sie zu den Felsen schaute, sah sie eine regungslose Männergestalt unter dem Vorsprung stehen, die ihnen nachschaute. Auf dem Kopf trug der Mann ein merkwürdiges Gebilde, das einem gewaltigen Knäuel glich, doch wegen des Schattens erkannte sie nicht, worum es sich handelte. Ein Turban? Darin funkelte es gelegentlich auf, ein dunkelblaues Schimmern nahm sie gefangen.
Jitka sah zu Martin. »Siehst du den Mann?«
»Wo denn?« Der Großknecht drehte den Kopf. »Ich sehe niemanden, Kleine.«
»Aber er ist da drüben, bei den Steinen! Er …« Jitka suchte die Umgebung mit ihren Blicken ab. Die Gestalt war verschwunden und mit ihr das geheimnisvolle Funkeln.
Sie fröstelte und richtete ihre Augen auf den holprigen Weg, in den sie abbogen. Hatte sie soeben einen Blick auf den Upir erhascht? Jitka nahm das Beten wieder auf und flehte darum, bald wieder nach Hause gehen zu dürfen. Zusammen mit ihrer Mutter.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie sich gewünscht, Abenteuer zu erleben und neue Dinge zu sehen. Was ihr der vergangene Tag und die vergangene Nacht gebracht hatten, war zu viel davon gewesen.
3. April 1670In der Nähe von Gruža (serbisches Gebiet), Osmanisches Reich
Die Öllampen in der Stube brannten mit großen Dochten und spendeten den Frauen, die beim Nähen und Sticken zusammensaßen, ein weiches, warmes Licht.
Schnee und Frost waren überraschend zurückgekehrt. Der Frühling ließ noch auf sich warten, und so verbrachten die Frauen die Tage und Abende mit Handarbeit. Alle hofften darauf, dass bald gutes Wetter über das Land kam und die Felder weiter bestellt werden konnten.
Auf einem Tisch saß Jitka, die den Frauen in der Zeit, in der sie weder Stadtneuigkeiten noch Märchen und Geschichten zu erzählen wussten, wunderschöne Lieder sang. Stets tat sie dies mit Tränen in den Augen, weil jeder Ton sie an ihre Mutter erinnerte. Janja hatte ihr nicht nur das Talent vererbt, sondern auch die Lieder beigebracht, die sie gemeinsam zu Hause gesungen hatten. So schön klangen die alten Weisen, dass die Menschen oft auf der Straße stehen geblieben waren, um zuzuhören.
Den Frauen auf dem Gehöft war dies gleich am ersten Tag aufgefallen, als Jitka beim gemeinsamen Singen ihre Stimme erhoben hatte. Keine von ihnen reichte an sie heran, keine besaß eine so warme und zugleich glasklare Stimme.
Es machte Jitka glücklich zu sehen, wie sehr sie die Herzen der Frauen rührte, denn jedes Lied sang sie zu Ehren ihrer Mutter. Es war ihre Art, die Angst um Janja auszuhalten; sie sang sich den Schmerz von der Seele.
»Kleine Nachtigall, lass uns noch einmal das Lied von den Weiden hören«, bat eine der Tagelöhnerinnen und sah von ihrem Stickbrett auf. »Ich habe es noch von keinem Menschen so schön gehört wie von dir.« Für diese Bitte erntete sie auf der Stelle zustimmendes Gemurmel.
Jitka lächelte schwach, stellte sich auf den Tisch und schloss die Augen. Dann atmete sie tief ein und erhob die Stimme, lauschte sich selbst und überwachte jeden ihrer eigenen Töne, damit sich kein Fehler einschlich, so wie es ihr Janja beigebracht hatte. Doch dann verlor sie sich zunehmend selbst in ihrem Gesang und ging vollends darin auf. Somit verlieh sie der Weise von den an gegenüberliegenden Flussufern stehenden Weiden, deren silberne Blätter sich vor Gram über ihre Trennung schwarz färbten, etwas Einmaliges.
Die Frauen hörten nicht nur das Lied, sie spürten den Schmerz der Bäume, die ihre Äste und Zweige neigten, um sich über dem Wasser zu berühren, und dabei in die Fluten stürzten. Und wenn Jitkas Vortrag damit endete, dass der Fluss Mitleid mit den Weiden hatte und sie an anderer Stelle nebeneinander neue Wurzeln schlagen ließ, hatten viele der Frauen Tränen in den Augen, die sie so unauffällig wie möglich fortwischten.
Jitka selbst fühlte sich wie eine dieser unglücklichen Weiden. Niemand konnte ihr sagen, wie es ihrer Mutter erging, wo man sie hingebracht hatte. Es machte also auch keinen Sinn, dass sie sich heimlich vom Hof stahl, um zu ihr zu gelangen. Also blieb ihr nichts anderes, als bei Martin auszuharren. Eine einsame Weide, die darauf hoffte, dass der Fluss sie endlich erfassen möge.
Nach der letzten Strophe blieb es in der Stube lange still. Die Frauen waren in der Stimmung gefangen, hier und da glitzerte es noch verräterisch feucht auf den Wangen; alle hatten mit dem Sticken und Nähen innegehalten und sich ganz auf das Lied eingelassen.
»Es ist eine Gabe, Jitka«, seufzte die Tagelöhnerin. »Eine Gabe, die du vom lieben Gott bekommen hast. Danke ihm jeden Tag für diese Stimme, kleine Nachtigall.«
Eine andere Frau fuhr ihr durch die langen schwarzen Haare, als Jitka sich hinsetzte und das Kuchenstück nahm, das ihr zum Lohn für die Darbietung gereicht wurde. Es war ein trockener, süßer Kuchen, der nach Eiern und viel Butter schmeckte; dazu trank sie einen Becher Milch. »Du tust mir so leid. Was gäbe ich darum, dir helfen zu können.«