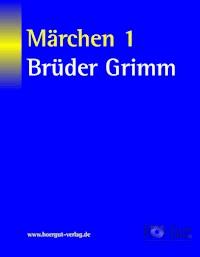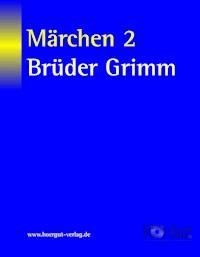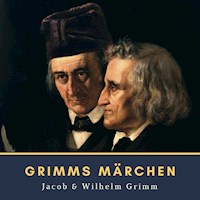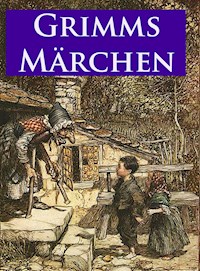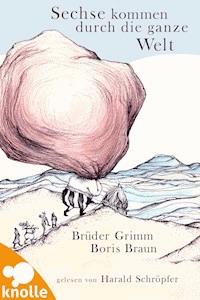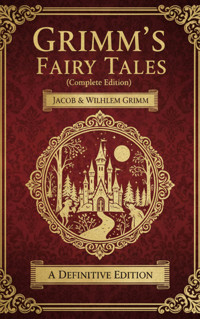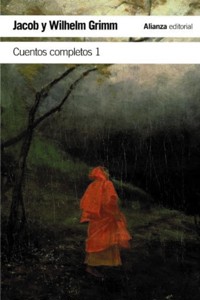Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Märchen bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ausgabe in HD Achte, neu überarbeitete Auflage - Alle Märchen auf Hochdeutsch - Mit Index und 103 vollfarbigen Bildern. Dieses Buch beinhaltet alle vollendeten Märchen der Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm der veröffentlichten Originalausgaben 1 bis 6 von 1812 bis 1850. Neben den allseits bekannten und beliebten Klassikern wie Rapunzel, Schneewittchen, Aschenputtel, Hänsel und Gretel oder Das Rotkäppchen finden sich hier auch unbekanntere und teilweise zusätzlich auf Original-Mundart vorliegende Märchen wie Das Dietmarsische Lügenmärchen, Der Bärenhäuter oder Prinzessin Mäusehaut. Alle Märchen auf Original-Mundart liegen auch auf Hochdeutsch vor. Die in Kassel aufbewahrten Handexemplare der Brüder Grimm mit wertvollen handschriftlichen Einträgen wurden 2005 von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe erklärt. Diese Märchen gehören zum größten Kulturschatz, den die deutsche Sprache aufzuweisen hat. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis von insgesamt 251 Märchen: Schneeweißchen und Rosenrot Das Waldhaus Der Vogel Greif Der Hase und der Igel Der Teufel und seine Großmutter Das singende, springende Löweneckerchen Aschenputtel Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen Der Bauer und der Teufel Brüderchen und Schwesterchen Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich Katz und Maus in Gesellschaft Tischchen-deck-dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack Rotkäppchen Die zertanzten Schuhe Sechse kommen durch die ganze Welt Schneewittchen Das Totenhemdchen König Drosselbart Die drei Federn Die goldene Gans Hans im Glück ... und viele mehr Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1622
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacob Ludwig Carl Grimm & Wilhelm Carl Grimm
Kinder- und Hausmärchen
Jacob Ludwig Carl Grimm & Wilhelm Carl Grimm
Kinder- und Hausmärchen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Ludwig Bechstein, Carl Offterdinger, Arthur Rackham, Alexander ZickHerausgeber: Jürgen Schulze 10. Auflage, ISBN 978-3-954180-31-8
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur siebten digitalen Auflage
Brüder Grimm -- Leben und Werk
Kinder- und Hausmärchen -- Bedeutung und Entstehung
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
Katz und Maus in Gesellschaft
Marienkind
Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Der Wolf und die sieben jungen Geißlein
Der getreue Johannes
Von der Nachtigall und der Blindschleiche
Der gute Handel
Der wunderliche Spielmann
Die Hand mit dem Messer
Die zwölf Brüder
Das Lumpengesindel
Brüderchen und Schwesterchen
Rapunzel
Die drei Männlein im Walde
Die drei Spinnerinnen
Hänsel und Gretel
Die drei Schlangenblätter
Herr Fix und Fertig
Die weiße Schlange
Strohhalm, Kohle und Bohne
Von den Fischer und siine Fru (Niederdeutsch)
Von dem Fischer und seiner Frau
Das tapfere Schneiderlein oder Sieben auf einen Streich
Aschenputtel
Das Rätsel
Wie Kinder Schlachtens miteinander gespielt haben
I.
II.
Von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst
Frau Holle
Die sieben Raben
Rotkäppchen
Die Bremer Stadtmusikanten
Der Tod und der Gänsehirt
Der singende Knochen
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
Läuschen und Flöhchen
Das Mädchen ohne Hände
Der gescheite Hans
Die drei Sprachen
Der gestiefelte Kater
Die kluge Else
Hansens Trine
Der Schneider im Himmel
Tischchen-deck-dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack
Daumesdick
Von der Serviette, dem Tornister, dem Kanonenhütlein und dem Horn
Die Hochzeit der Frau Füchsin
Erstes Märchen
Zweites Märchen
Die Wichtelmänner
Erstes Märchen
Zweites Märchen
Drittes Märchen
Der Räuberbräutigam
Herr Korbes
Der Herr Gevatter
Frau Trude
Die wunderliche Gasterei
Der Gevatter Tod
Däumlings Wanderschaft
Fitchers Vogel
Van den Machandel-Boom (Plattdeutsch)
Von dem Wacholderbaum
Der alte Sultan
Die sechs Schwäne
Dornröschen
Fundevogel
König Drosselbart
Schneewittchen
**Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein**
Hans Dumm
Rumpelstilzchen
Der Liebste Roland
Vom goldnen Vogel
Der Hund und der Sperling
Der Frieder und das Katherlieschen
Prinz Schwan
Die zwei Brüder
Das Goldei
Das Bürle
Von dem Schneider, der bald reich wurde
Die Bienenkönigin
Blaubart
Die drei Federn
Die goldene Gans
Die weiße Taube
Allerleirauh
Häsichen-Braut (Wendisch)
Häschenbraut
Hurleburlebutz
Die zwölf Jäger
De Gaudeif un sien Meester (Münsterisch)
Der Gaudieb und sein Meister
Von dem Sommer- und Wintergarten
Jorinde und Joringel
Die drei Glückskinder
Der Okerlo
Sechse kommen durch die ganze Welt
Prinzessin Mäusehaut
Der Wolf und der Mensch
Das Birnli will nit fallen
Der Wolf und der Fuchs
Das Mordschloss
Der Fuchs und die Frau Gevatterin
Von Johannes-Wassersprung und Caspar-Wassersprung
Der Fuchs und die Katze
Vogel Phönix
Die Nelke
Die kluge Gretel
Vom Schreiner und Drechsler
Der alte Großvater und der Enkel
Die Wassernixe
Von dem Tode des Hühnchens
Bruder Lustig
Der Schmied und der Teufel
De Spielhansl (Deutschböhmisch)
Der Spielhansl
Die drei Schwestern
Hans im Glück
Das arme Mädchen oder die Sterntaler
Hans heiratet
Die Schwiegermutter
Die Goldkinder
Der Fuchs und die Gänse
Der Arme und der Reiche
Das singende, springende Löweneckerchen
Die Gänsemagd
Der junge Riese
Dat Erdmänneken (Paderbörn)
Das Erdmännchen
Der König vom goldenen Berg
Die Rabe
Die kluge Bauerntochter
Der alte Hildebrand (Österreichisch)
Der alte Hildebrand
De drei Vügelkens (Plattdeutsch)
Die drei Vögelchen
Das Wasser des Lebens
Doktor Allwissend
Der Geist im Glas
Der Froschprinz
Des Teufels rußiger Bruder
Der Bärenhäuter
Der Zaunkönig und der Bär
Der süße Brei
Die klugen Leute
Die treuen Tiere
Märchen von der Unke
I.
II.
Der arme Müllerbursch und das Kätzchen
Die beiden Wanderer
Die Krähen
Hans mein Igel
Das Totenhemdchen
Der Jude im Dorn
Der gelernte Jäger
Der Dreschflegel vom Himmel
De beiden Künigeskinner (Paderbörn)
Die beiden Königskinder
Vom klugen Schneiderlein
Die klare Sonne bringt’s an den Tag
Das blaue Licht
Das eigensinnige Kind
Die drei Feldscherer
Die sieben Schwaben
Der Faule und der Fleißige
Die drei Handwerksburschen
Der Königssohn, der sich vor nichts fürchtet
Der Krautesel
Die lange Nase
Die Alte im Wald
Die drei Brüder
Der Teufel und seine Großmutter
Ferenand getrü un Ferenand ungetrü (Plattdeutsch)
Ferdinand getreu und Ferdinand ungetreu
Der Eisenofen
Die faule Spinnerin
Die vier kunstreichen Brüder
Der Löwe und der Frosch
Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein
Der Soldat und der Schreiner
Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie
Der Fuchs und das Pferd
Die zertanzten Schuhe
Die sechs Diener
Die weiße und die schwarze Braut
Der Eisenhans
De wilde Mann (Plattdeutsch)
Der Wilde Mann
De drei schwatten Princessinnen (Münsterländisch)
Die drei schwarzen Prinzessinnen
Knoist un sine dre Sühne (Sauerländisch)
Knoist und seine drei Söhne
Dat Mäken von Brakel (Paderbörn)
Das Mädchen von Brakel
Das Hausgesinde (Paderbörn)
Das Hausgesinde
Das Lämmchen und Fischchen
Simeliberg
Up Reisen gohn (Paderbörn)
Auf Reisen gehen
Die Kinder in Hungersnot
Das Eselein
Der undankbare Sohn
Die Rübe
Das junggeglühte Männlein
Des Herrn und des Teufels Getier
Der Hahnenbalken
Die alte Bettelfrau
Die drei Faulen
Die zwölf faulen Knechte
Das Hirtenbüblein
Die heilige Frau Kummernis
Der gestohlene Heller
Die Brautschau
Rätselmärchen
Die Schlickerlinge
Der Sperling und seine vier Kinder
Das Märchen vom Schlaraffenland
Das Dietmarsische Lügenmärchen
Schneeweißchen und Rosenrot
Der kluge Knecht
Der gläserne Sarg
Der faule Heinz
Der Vogel Greif (Alemannisch)
Der Vogel Greif
Der starke Hans
Das Bürle im Himmel (Alemannisch)
Das Bäuerlein im Himmel
Die hagere Liese
Das Waldhaus
Lieb und Leid teilen
Der Zaunkönig
Die Scholle
Rohrdommel und Wiedekopf
Die Eule
Der Mond
Das Unglück
Die Lebenszeit
Die Boten des Todes
Meister Pfriem
Die Gänsehirtin am Brunnen
Die ungleichen Kinder Evas
Die Nixe im Teich
Die Geschenke des kleinen Volkes
Die Prinzessin auf der Erbse
Der Riese und der Schneider
Der Nagel
Der arme Junge im Grab
Die wahre Braut
Der Hase und der Igel (Plattdeutsch)
Der Hase und der Igel
Spindel, Weberschiffchen und Nadel
Der Bauer und der Teufel
Die Brosamen auf dem Tisch (Schweizerdeutsch)
Die Brosamen auf dem Tisch
Das Meerhäschen
Der Räuber und seine Söhne
Der Meisterdieb
Der Trommler
Die Kornähre
Der Grabhügel
Oll Rinkrank (Niederdeutsch)
Alt Rinkrank
Die Kristallkugel
Jungfrau Maleen
Die Stiefel von Büffelleder
Der goldene Schlüssel
Der heilige Joseph im Walde
Die zwölf Apostel
Die Rose (Paderborn)
Die Rose
Armut und Demut führen zum Himmel
Gottes Speise
Die drei grünen Zweige
Muttergottesgläschen
Das alte Mütterchen
Die himmlische Hochzeit
Die Haselrute
Vorwort zur sechsten digitalen Auflage
Vorwort zur fünften digitalen Auflage
Vorwort zur vierten digitalen Auflage
Vorwort zur dritten digitalen Auflage
Vorwort zur zweiten digitalen Auflage
Vorrede zum ersten Band (Original)
Vorrede zum zweiten Band (Original)
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Märchen bei Null Papier
Andersens Märchen
Die Märchen des Wilhelm Hauff
Weihnachten
Grimms Märchen
Tausendundeine Nacht - 4 Bände - Erwachsene Märchen aus 1001 Nacht
Grimms Sagen
Bunte Märchen
Sagen des klassischen Altertums
Grimms Märchen – Illustriertes Märchenbuch
Alice hinter den Spiegeln
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort zur siebten digitalen Auflage
Und wieder ist ein Jahr vorüber. Und auch 2013 hat sich mein E-Book als das erfolgreichste Märchen-E-Book am Markt halten können.
Diesmal habe ich mich dazu entschlossen, alle (alte und neu hinzugekommene) Bilder, die ich finden konnte, in größtmöglicher Auflösung einzubinden, damit auch Besitzer eines leistungsfähigeren Tablet-Computers in einen noch »schärferen« Genuss kommen können.
Frohe Weihnachten 2013 und alles Gute für 2014 wünscht
Jürgen Schulze, Verleger
*
Brüder Grimm -- Leben und Werk
Die Brüder Grimm, jene für die deutsche Sprache und das erzählerische Gut herausragende Personen, sind namentlich Jacob Grimm und sein jüngerer Bruder Wilhelm Grimm. Jacob wurde am 4. Januar 1785 und Wilhelm am 24. Februar 1786 geboren. Als Söhne eines Amtmanns und Enkel bzw. Großenkel zweier geistlicher des reformierten Glaubenszweiges, gehörten sie einem eher wohlhabenden Hause an. Insgesamt hatten die Eltern der Brüder Grimm, Philipp Wilhelm und Dorothea Grimm, neun Kinder, von denen allerdings drei im Säuglingsalter verstarben. Ludwig Emil Grimm, ein jüngerer Bruder von Jacob und Wilhelm, wurde später als Maler bekannt.
Damit Jacob und Wilhelm ihrem Vater als Juristen folgen konnten, wurden sie 1798 nach Kassel geschickt, um dort bei ihrer Tante zu wohnen und das Friedrichsgymnasium zu besuchen. Später gingen beide auf die Marburger Universität und studierten Rechtswissenschaften. Friedrich Carl von Savigny, ein Lehrer der beiden, erkannte ihr Potenzial und ihre Wissbegierde, woraufhin er sie einlud, seine Privatbibliothek zu nutzen. Mit Schiller und Goethe waren Jacob und Wilhelm zu dieser Zeit bereits vertraut, doch von Savignys Sammlung führte sie in die Bereiche des Minnesangs und der Romantik. Genau so stark, wenn nicht noch ein bisschen mehr, beeinflusste die beiden das Wirken Johann Gottfried Herders, dessen Werke Jacob und Wilhelm auf den Weg der Sprachwissenschaften führten.
In Herders Manier betrachteten sie die Sprache und die Zustände, die zu ihren Verwendungsformen führten, nicht in einer romantisch-verklärten, sondern in einer rationalen und realistischen Art. Sie fingen an, zahlreiche Schriften zu studieren, zu denen nicht nur Dichtung gehörte, sondern auch Urkunden und andere geschichtliche Aufzeichnungen. Auch beschränkten sie sich nicht auf deutsche Quellen -- sie nutzten Dokumente aus Großbritannien und Irland sowie später auch skandinavische, niederländische, spanische und serbische Aufzeichnungen. Nach ihrem Studienabschluss im Jahre 1806 begannen sie mit jenem Werk, das den Namen der Brüder Grimm heute noch in den Köpfen der Menschen hält -- mit der Sammlung von Märchen. Im Auftrag von Achim von Arnim und Clemens Brentano, zwei Hauptvertreter der Heidelberger Romantik, trugen Jacob und Wilhelm die bis dahin überwiegend mündlich überlieferten Geschichten, Märchen und Sagen zusammen, überarbeiteten sie und glätteten ihre Sprache auf die bekannte Form.
Im Jahr 1811 veröffentlichten sowohl Jacob als auch Wilhelm jeweils ein Buch. Jacob Grimms »Über den Altdeutschen Meistergesang« ist seine erste und einzige umfangreiche literaturhistorische Studie. Sie fasst nahezu alle damals für Jacob Grimm zugänglichen Informationen zusammen und legte zugleich den Grundstein für weitere neuzeitliche Forschungen rund um den Meistersang. Wilhelm Grimm veröffentlichte in diesem Jahr sein Werk »Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen«. Dem Namen entsprechend präsentiert er in diesem Werk altdänische Volkspoesie in den benannten Formen. Zu diesen von ihm selbst übersetzten Werken fügte er eine eigene Schrift hinzu, in der er sich leidenschaftlich für die Auseinandersetzung mit den alten Schriften einsetzt.
1812, also nur ein Jahr später, agierten die Brüder Grimm zusammen als Herausgeber des Bandes »Hildebrandslied und Wessobrunner Gebet«. Die beiden Titel stellen die ältesten bis dahin und bis heute erhaltenen poetischen Texte in deutscher Sprache dar. Sie stammen beide aus dem 9. Jahrhundert und wurden von Jacob und Wilhelm erstmals wissenschaftlich aufbereitet. Der bis heute gebräuchliche Name für das Heldenlied »Hildebrandslied« wurde von den Brüdern Grimm vergeben. Zuvor hatte diese Dichtung keinen Namen gehabt.
Die erste Ausgabe des heute bekanntesten Titels der Brüder Grimm, die »Kinder- und Hausmärchen«, wurde ebenfalls 1812 veröffentlicht. Drei Jahre später erschien der zweite Band und nach sieben Jahren, im Jahr 1819, erschien der erste Band nochmals in einer stark überarbeiteten Form. Der dritte Band der Serie wurde 1822 veröffentlicht und enthält Anmerkungen zu den jeweiligen Märchen des ersten und zweiten Bandes. Die 1825 erschienene »Kleine Ausgabe«, für die der Bruder Emil Grimm die Illustration übernahm, führte dann zu jenem weltweiten Erfolg, den die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm bis heute erfahren.
Zwischen den Veröffentlichungen der »Kinder- und Hausmärchen«-Bände veröffentlichten die Brüder Grimm auch weitere Werke. So zum Beispiel zwei Bände mit dem Namen »Deutsche Sagen«, die 1816 und 1818 veröffentlicht wurden und knapp 600 aus dem deutschsprachigen Raum stammende Sagen in Buchform darbieten. Zudem die »Deutsche Grammatik«, welche Jacob Grimm 1819 veröffentlichte. Es handelt sich bei diesem Band jedoch nicht um ein Lehrbuch, das den Satzbau und die korrekte Wortbeugung aufzeigt. Vielmehr ist es eine Studie, welche die Zusammenhänge zwischen sämtlichen germanischen Sprachen und ihre historischen Entwicklungen aufzeigt. 1821 erschien Wilhelm Grimms »Über deutsche Runen«, in dem er die Runen der Sachsen sowie ihre Rolle bei der Verbreitung der Runenschrift aufzeigt.
Bis zu ihrem gemeinsamen großen Werk mit dem Namen »Deutsches Wörterbuch« veröffentlichten die Brüder Grimm noch weitere Bücher, die zu ihrem Hauptwerk gezählt werden und die späteren Generationen als Wissensfundus dienten und dienen. Darunter Jacob Grimms »Deutsche Rechtsaltertümer« aus dem Jahre 1828, in dem er die mittelalterliche Rechtspraxis darlegt. Dabei profitierte er unter anderem von Aufzeichnungen, die er schon während des Studiums einsah und sammelte. 1829 veröffentlichte Wilhelm Grimm »Die deutsche Heldensage«, welches er selbst als sein Hauptwerk bezeichnete. Neben Sagen, die vom 6. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert datiert sind, enthält der Band auch Kommentare und geschichtliche Hintergründe. In den Jahren 1832 und 1834 erschienen Jacob Grimms Werke »Deutsche Mythologie« und »Reinhart Fuchs«, in denen er sich zum einen vorchristlichen Religionsvorstellungen deutscher Stämme und zum anderen der Erforschung sowie der Interpretation des mittelalterlichen Tierepos hingibt.
1854 erschien dann der erste Band des Gemeinschaftswerks »Deutsches Wörterbuch«, das Wilhelm Grimm schon 1846 auf dem in Frankfurt stattfindenden Germanistentag ankündigte. Jacob Grimm schrieb dafür ein umfangreiches Vorwort, in dem er wichtige und richtungsweisende Hinweise zu Lexikographie, Orthographie, Sprachpflege und -geschichte gab. Das »Deutsche Wörterbuch« ist kein Lexikon im herkömmlichen Sinne und die Wörter werden nicht (nur) auf ihre Definition hin beschrieben, sondern vielmehr hinsichtlich ihrer sprachwissenschaftlichen Herkunft. Dazu werden griechische, lateinische sowie auch indogermanische Quellen bedient, um die Wurzeln der Sprache freizulegen und aufzuzeigen. Die Brüder Grimm hatten den Arbeitsaufwand bis zur Fertigstellung des Gesamtwerks auf sechs bis zehn Jahre geschätzt. Jedoch verstarb Wilhelm Grimm bereits im Jahr 1859 und stellte bis dahin lediglich das Verzeichnis bis zum Buchstaben »D« fertig. Jacob Grimm, der nur vier Jahre später -- 1863 -- verstarb, editierte als letztes das Wort »Frucht«. Erst im Jahr 1961 war das bis dahin auf 33 Bände angewachsene Werk vervollständigt worden.
Kinder- und Hausmärchen -- Bedeutung und Entstehung
Die »Kinder- und Hausmärchen«, volkstümlich »Grimms Märchen«, genannt, sind eine berühmte deutsche Anthologie von Märchen, die Jacob Ludwig Carl Grimm und sein Bruder Wilhelm Carl Grimm, bekannt als die »Brüder Grimm«, herausgegeben haben.
1803 hatten die beiden Brüder in der Marburger Universität die Romantiker Clemens Brentano und Achim von Arnim kennengelernt, die bei ihnen das Interesse für alte Hausmärchen weckten.
Jacob und Wilhelm Grimm begannen in Kassel in ihrem bürgerlichen Umfeld, das vielfach hugenottisch geprägt war, mündlich überlieferte Märchen zu sammeln und zu bearbeiten. Viele der gesammelten Märchen stammen von der ortsansässigen Märchenerzählerin Dorothea Viehmann, die keineswegs die alte Bäuerin war, als die die Grimms sie darstellten, sondern eine gebildete Frau, sowie aus der Feder des französischen Kulturstaatssekretärs Charles Perrault, der seine Märchen ebenfalls nicht nur aus mündlicher Überlieferung, sondern auch von französischen und italienischen Märchensammlern, wie Straparola und vor allem Basile, übernahm. Bei anderen Märchen wird vermutet, dass sie aus der Feder der Grimms selbst stammten. Nach Ansicht vieler Forscher war die Pose der sorgfältigen Sammler alter Traditionen, die die Brüder einnahmen, weitgehend eine der Zeitstimmung der Romantik geschuldete Fiktion: Die Märchensammlung stellt vielmehr eine Mischung aus neuen Texten, Kunstmärchen und teils stark bearbeiteten und veränderten Volksmärchen dar. Einige der teils sehr erheblichen grimmschen Bearbeitungen erkennt man durch eine Gegenüberstellung bestimmter Märchen in der ersten Ausgabe von 1812/15 und in der Ausgabe letzter Hand von 1857.
Die Texte wurden von Auflage zu Auflage weiter überarbeitet, teilweise verniedlicht und mit christlicher Moral unterfüttert. Die Grimms reagierten damit auch auf Kritik, die Märchen seien nicht kindgerecht. Um dem zeitgemäßen Geschmack des vorwiegend bürgerlichen Publikums entgegenzukommen, wurden auch wichtige Details geändert. So wurde aus der Mutter in Hänsel und Gretel eine Stiefmutter, denn ihr Verhalten, die Kinder zu verstoßen, war mit dem Mutterbild des Bürgertums nicht zu vereinbaren. Auch direkte sexuelle Anspielungen und Bezüge wurden verändert oder weggelassen. In ihrer Vorrede zu der Ausgabe der Märchen von 1815 erwähnen sie explizit, dass es sich bei ihrer Sammlung von Märchen um ein Erziehungsbuch handelt. Wilhelm Grimm, der die Märchen seit der zweiten Auflage 1819 fast ausschließlich allein bearbeitete, ergänzte die Texte auch durch zahlreiche Redensarten und bildhafte Formeln.
Durch Perrault und durch die hugenottische Herkunft Dorothea Viehmanns und der Kasseler Familien Hassenpflug und Wild (sie verkehrten im Hause Grimm; eine Tochter der Familie Wild wurde später die Frau Wilhelms) flossen auch viele ursprünglich französische Kunstmärchen und Märchenvarianten in die Sammlung ein. Um ein Märchenbuch mit »rein deutschen« Märchen zu haben, wurden einige Märchen, die aus Frankreich in den deutschen Sprachraum gelangten, wie etwa Der gestiefelte Kater oder Blaubart, nach der ersten Ausgabe wieder entfernt. Dies geschah allerdings nicht konsequent, denn den Grimms war durchaus bekannt, dass zum Beispiel für Rotkäppchen auch eine französische Version mit tragischem Ende existierte. Eine nationale Eingrenzung war auch deshalb fragwürdig, weil einige Märchen wie etwa Aschenputtel eine umfangreiche europäische und sogar internationale Herkunfts- und Verbreitungsgeschichte haben. In ihrer Vorrede zu den Märchen versichern die Grimms immer wieder, dass es sich bei den gesammelten Märchen um »echt hessische Märchen« handele, welche ihren Ursprung in altnordischen und urdeutschen Mythen hätten. Dass es sich bei ihrer Hauptquelle, der Viehmännin, nicht um eine hessische Bäuerin, sondern um eine gebildete Schneiderin mit französischen Wurzeln handelt, verschweigen sie hingegen. In den Handschriften der Märchen, die 1927 in einer Abtei im Elsass gefunden worden sind, finden sich jedoch Vermerke über die französische Herkunft und die Parallelen zu Perraults Märchensammlung.
Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich
In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwerk.
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu: »Was hast du vor, Königstochter, du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte.«
Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist es, alter Wasserpatscher«, sagte sie, »ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.«
»Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch, »ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?«
»Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie; »meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.«
Der Frosch antwortete: »Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich lieb haben willst, und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen.«
»Ach ja«, sagte sie, »ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wieder bringst.«
Sie dachte aber: Was der einfältige Frosch schwätzt! Der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein.
Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab, und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. »Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du!«
Aber was half es ihm, dass er ihr sein Quak, Quak so laut nachschrie, als er konnte! Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste.
Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen, und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: »Königstochter, jüngste, mach mir auf!«
Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und es war ihr ganz angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte, und sprach: »Mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?«
»Ach nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.«
»Was will der Frosch von dir?«
»Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden; ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser herauskönnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.«
Und schon klopfte es zum zweiten Mal und rief:
»Königstochter, jüngste, Mach mir auf, weißt du nicht, was gestern Du zu mir gesagt Bei dem kühlen Wasserbrunnen? Königstochter, jüngste, Mach mir auf!«
Da sagte der König: »Was du versprochen hast, das musst du auch halten; geh nur und mach ihm auf.«
Sie ging und öffnete die Türe, da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: »Heb mich herauf zu dir.«
Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er: »Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.«
Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie’s nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich’s gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse. Endlich sprach er: »Ich habe mich satt gegessen und bin müde; nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.«
Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber ward zornig und sprach: »Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.«
Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach: »Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sag’s deinem Vater.«
Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand: »Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch.«
Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein, und am anderen Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, dass er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen; der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung.
Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief:
»Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht, Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als Du in dem Brunnen saßt, als Du ein Frosch gewesen warst.«
Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.
Katz und Maus in Gesellschaft
Eine Katze und eine Maus wollten zusammenleben und eine Wirtschaft zusammen haben; sie sorgten auch für den Winter und kauften ein Töpfchen mit Fett, und weil sie keinen besseren und sichereren Ort wussten, stellten sie es unter den Altar in der Kirche, da sollte es stehen, bis sie sein bedürftig wären.
Einstmals aber trug die Katze Gelüste danach und ging zur Maus: »Hör’ Mäuschen, ich bin von meiner Base1 zu Gevatter2 gebeten, sie hat ein Söhnchen geboren, weiß und braun gefleckt, das soll ich über die Taufe halten, lass mich ausgehen und halt heut allein Haus.« -- »Ja, ja«, sagte die Maus, »geh hin, und wenn du was Gutes isst, denk an mich, von dem süßen roten Wein zur Feier tränk ich auch gern ein Tröpfchen.«
Die Katze aber ging geradeswegs in die Kirche und leckte die fette Haut ab, spazierte danach um die Stadt herum und kam erst am Abend nach Haus. »Du wirst dich recht verlustiert haben«, sagte die Maus, »wie hat denn das Kind geheißen?« -- »Hautab«, antwortete die Katze. -- »Hautab? Das ist ein seltsamer Name, den hab’ ich noch nicht gehört.«
Bald danach hatte die Katze wieder ein Gelüsten, ging zur Maus und sprach: »Ich bin aufs Neue zu Gevatter gebeten, das Kind hat einen weißen Ring um den Leib, da kann ich’s nicht abschlagen, du musst mir den Gefallen tun und allein die Wirtschaft betreiben.«
Die Maus sagte ja, die Katze aber ging hin und fraß den Fetttopf bis zur Hälfte leer. Als sie heimkam, fragte die Maus: »Wie ist denn dieser Pate getauft worden?« -- »Halbaus« -- »Halbaus? Was du sagst! Den Namen hab’ ich gar noch nicht gehört, der steht gewiss nicht im Kalender.«
Die Katze aber konnte den Fetttopf nicht vergessen: »Ich bin zum dritten Mal zu Gevatter gebeten, das Kind ist schwarz und hat bloß weiße Pfoten, sonst kein weißes Haar am ganzen Leib, das trifft sich alle paar Jahr nur einmal, du lässt mich doch ausgehen?« -- »Hautab, Halbaus«, sagte die Maus, »es sind so kuriose Namen, die machen mich so nachdenklich, doch geh nur hin.«
Die Maus hielt alles in Ordnung und räumte auf, dieweil fraß die Katze den Fetttopf ganz aus und kam satt und dick erst in der Nacht wieder. »Wie heißt denn das dritte Kind?« -- »Ganzaus« -- »Ganzaus! Ei! Ei! Das ist der allerbedenklichste Namen«, sagte die Maus; »Ganzaus? Was soll der bedeuten? Gedruckt ist er mir noch nicht vorgekommen!«
Damit schüttelte sie den Kopf und legte sich schlafen.
Zum vierten Mal wollte niemand die Katze zu Gevatter bitten; der Winter aber kam bald herbei. Wie nun draußen nichts mehr zu finden war, sagte die Maus zur Katze: »Komm wir wollen zum Vorrat gehen, den wir in der Kirche unter dem Altar versteckt haben.«
Wie sie aber hinkamen, war alles leer -- »Ach!«, sagte die Maus, »nun kommt’s an den Tag, du hast alles gefressen, wie du zu Gevatter ausgegangen bist, erst Haut ab, dann halb aus, dann« -- »Schweig still«, sagte die Katze, »oder ich fress’ dich, wenn du noch ein Wort sprichst« -- »Ganz aus«, hatte die arme Maus im Mund, und hatte es kaum gesprochen, so sprang die Katze auf sie zu und schluckte sie hinunter.
Cousine <<<
Taufe <<<
Marienkind
Vor einem großen Walde lebte ein Holzhacker mit seiner Frau, der hatte nur ein einziges Kind, das war ein Mädchen von drei Jahren. Sie waren aber so arm, dass sie nicht mehr das tägliche Brot hatten und nicht wussten, was sie ihm sollten zu essen geben. Eines Morgens ging der Holzhacker voller Sorgen hinaus in den Wald an seine Arbeit, und wie er da Holz hackte, stand auf einmal eine schöne große Frau vor ihm, die hatte eine Krone von leuchtenden Sternen auf dem Haupt und sprach zu ihm: »Ich bin die Jungfrau Maria, die Mutter des Christkindleins. Du bist arm und dürftig, bring mir dein Kind, ich will es mit mir nehmen, seine Mutter sein und für es sorgen.«
Der Holzhacker gehorchte, holte sein Kind und übergab es der Jungfrau Maria, die nahm es mit sich hinauf in den Himmel. Da ging es ihm wohl, es aß Zuckerbrot und trank süße Milch, und seine Kleider waren von Gold, und die Englein spielten mit ihm. Als es nun vierzehn Jahr alt geworden war, rief es einmal die Jungfrau Maria zu sich und sprach: »Liebes Kind, ich habe eine große Reise vor, da nimm die Schlüssel zu den dreizehn Türen des Himmelreichs in Verwahrung. Zwölf davon darfst du aufschließen und die Herrlichkeiten darin betrachten, aber die Dreizehnte, wozu dieser kleine Schlüssel gehört, die ist dir verboten. Hüte dich, dass du sie nicht aufschließest, sonst wirst du unglücklich.«
Das Mädchen versprach, gehorsam zu sein, und als nun die Jungfrau Maria weg war, fing sie an und besah die Wohnungen des Himmelreichs. Jeden Tag schloss es eine auf, bis die zwölfe herum waren. In jeder aber saß ein Apostel und war von großem Glanz umgeben, und es freute sich über all die Pracht und Herrlichkeit, und die Englein, die es immer begleiteten, freuten sich mit ihm.
Nun war die verbotene Tür allein noch übrig, da empfand es eine große Lust zu wissen, was dahinter verborgen wäre, und sprach zu den Englein: »Ganz aufmachen will ich sie nicht und will auch nicht hineingehen, aber ich will sie aufschließen, damit wir ein wenig durch den Ritz sehen.«
»Ach nein«, sagten die Englein, »das wäre Sünde, die Jungfrau Maria hat’s verboten, und es könnte leicht dein Unglück werden.«
Da schwieg es still, aber die Begierde in seinem Herzen schwieg nicht still, sondern nagte und pickte ordentlich daran und ließ ihm keine Ruhe. Und als die Englein einmal alle hinausgegangen waren, dachte es: »Nun bin ich ganz allein und könnte hineingucken, es weiß es ja niemand, wenn ich’s tue.«
Es suchte den Schlüssel heraus, und als es ihn in der Hand hielt, steckte es ihn auch in das Schloss, und als es ihn hineingesteckt hatte, drehte es auch um. Da sprang die Türe auf, und es sah da die Dreieinigkeit im Feuer und Glanz sitzen. Es blieb ein Weilchen stehen und betrachtete alles mit Erstaunen, dann rührte es ein wenig mit dem Finger an dem Glanz, da ward der Finger ganz golden. Alsbald empfand es eine gewaltige Angst, schlug die Türe heftig zu und lief fort. Die Angst wollte auch nicht wieder weichen, es mochte anfangen, was es wollte, und das Herz klopfte in einem fort und wollte nicht ruhig werden, auch das Gold blieb an dem Finger und ging nicht ab, es mochte waschen und reiben, soviel es wollte.
Gar nicht lange, so kam die Jungfrau Maria von ihrer Reise zurück. Sie rief das Mädchen zu sich und forderte ihm die Himmelsschlüssel wieder ab. Als es den Bund hinreichte, blickte ihm die Jungfrau in die Augen und sprach: »Hast du auch nicht die dreizehnte Tür geöffnet?«
»Nein«, antwortete es. Da legte sie ihre Hand auf sein Herz, fühlte, wie es klopfte und klopfte, und merkte wohl, dass es ihr Gebot übertreten und die Türe aufgeschlossen hatte. Da sprach sie noch einmal: »Hast du es gewiss nicht getan?«
»Nein«, sagte das Mädchen zum zweiten Mal. Da erblickte sie den Finger, der von der Berührung des himmlischen Feuers golden geworden war, sah wohl, dass es gesündigt hatte, und sprach zum dritten Mal: »Hast du es nicht getan?«
»Nein«, sagte das Mädchen zum dritten Mal. Da sprach die Jungfrau Maria: »Du hast mir nicht gehorcht, und hast noch dazu gelogen, du bist nicht mehr würdig, im Himmel zu sein.«
Da versank das Mädchen in einen tiefen Schlaf, und als es erwachte, lag es unten auf der Erde, mitten in einer Wildnis. Es wollte rufen, aber es konnte keinen Laut hervorbringen. Es sprang auf und wollte fortlaufen, aber wo es sich hinwendete, immer ward es von dichten Dornhecken zurückgehalten, die es nicht durchbrechen konnte. In der Einöde, in welche es eingeschlossen war, stand ein alter hohler Baum, das musste seine Wohnung sein.
Da kroch es hinein, wenn die Nacht kam, und schlief darin, und wenn es stürmte und regnete, fand es darin Schutz, aber es war ein jämmerliches Leben, und wenn es daran dachte, wie es im Himmel so schön gewesen war, und die Engel mit ihm gespielt hatten, so weinte es bitterlich. Wurzeln und Waldbeeren waren seine einzige Nahrung, die suchte es sich, so weit es kommen konnte. Im Herbst sammelte es die herabgefallenen Nüsse und Blätter und trug sie in die Höhle, die Nüsse waren im Winter seine Speise, und wenn Schnee und Eis kam, so kroch es wie ein armes Tierchen in die Blätter, dass es nicht fror. Nicht lange, so zerrissen seine Kleider und fiel ein Stück nach dem andern vom Leibe herab. Sobald dann die Sonne wieder warm schien, ging es heraus und setzte sich vor den Baum, und seine langen Haare bedeckten es von allen Seiten wie ein Mantel. So saß es ein Jahr nach dem andern und fühlte den Jammer und das Elend der Welt.
Einmal, als die Bäume wieder in frischem Grün standen, jagte der König des Landes in dem Wald und verfolgte ein Reh, und weil es in das Gebüsch geflohen war, das den Waldplatz einschloss, stieg er vom Pferd, riss das Gestrüpp auseinander und hieb sich mit seinem Schwert einen Weg. Als er endlich hindurchgedrungen war, sah er unter dem Baum ein wunderschönes Mädchen sitzen, das saß da und war von seinem goldenen Haar bis zu den Fußzehen bedeckt. Er stand still und betrachtete es voll Erstaunen, dann redete er es an und sprach: »Wer bist du? Warum sitzest du hier in der Einöde?«
Es gab aber keine Antwort, denn es konnte seinen Mund nicht auftun. Der König sprach weiter: »Willst du mit mir auf mein Schloss gehen?«
Da nickte es nur ein wenig mit dem Kopf. Der König nahm es auf seinen Arm, trug es auf sein Pferd und ritt mit ihm heim, und als er auf das königliche Schloss kam, ließ er ihm schöne Kleider anziehen und gab ihm alles im Überfluss. Und ob es gleich nicht sprechen konnte, so war es doch schön und holdselig, dass er es von Herzen lieb gewann, und es dauerte nicht lange, da vermählte er sich mit ihm.
Als etwa ein Jahr verflossen war, brachte die Königin einen Sohn zur Welt. Darauf in der Nacht, wo sie allein in ihrem Bette lag, erschien ihr die Jungfrau Maria und sprach: »Willst du die Wahrheit sagen und gestehen, dass du die verbotene Tür aufgeschlossen hast, so will ich deinen Mund öffnen und dir die Sprache wiedergeben. Verharrst du aber in der Sünde und leugnest hartnäckig, so nehme ich dein neugeborenes Kind mit mir.«
Da war der Königin verliehen zu antworten, sie blieb aber verstockt und sprach: »Nein, ich habe die verbotene Tür nicht aufgemacht.«
Und die Jungfrau Maria nahm das neugeborene Kind ihr aus den Armen und verschwand damit. Am andern Morgen, als das Kind nicht zu finden war, ging ein Gemurmel unter den Leuten, die Königin wäre eine Menschenfresserin und hätte ihr eigenes Kind umgebracht. Sie hörte alles und konnte nichts dagegen sagen, der König aber wollte es nicht glauben, weil er sie so lieb hatte.
Nach einem Jahr gebar die Königin wieder einen Sohn. In der Nacht trat auch wieder die Jungfrau Maria zu ihr herein und sprach: »Willst du gestehen, dass du die verbotene Türe geöffnet hast, so will ich dir dein Kind wiedergeben und deine Zunge lösen. Verharrst du aber in der Sünde und leugnest, so nehme ich auch dieses neugeborene mit mir.«
Da sprach die Königin wiederum: »Nein, ich habe die verbotene Tür nicht geöffnet.«
Und die Jungfrau nahm ihr das Kind aus den Armen weg und mit sich in den Himmel. Am Morgen, als das Kind abermals verschwunden war, sagten die Leute ganz laut, die Königin hätte es verschlungen, und des Königs Räte verlangten, dass sie sollte gerichtet werden. Der König aber hatte sie so lieb, dass er es nicht glauben wollte, und befahl den Räten bei Leibes- und Lebensstrafe, nicht mehr darüber zu sprechen.
Im nächsten Jahr gebar die Königin ein schönes Töchterlein, da erschien ihr zum dritten Mal nachts die Jungfrau Maria und sprach: »Folge mir.«
Sie nahm sie bei der Hand und führte sie in den Himmel, und zeigte ihr da ihre beiden ältesten Kinder, die lachten sie an und spielten mit der Weltkugel. Als sich die Königin darüber freute, sprach die Jungfrau Maria: »Ist dein Herz noch nicht erweicht? Wenn du eingestehst, dass du die verbotene Tür geöffnet hast, so will ich dir deine beiden Söhnlein zurückgeben.«
Aber die Königin antwortete zum dritten Mal: »Nein, ich habe die verbotene Tür nicht geöffnet.«
Da ließ sie die Jungfrau wieder zur Erde hinabsinken und nahm ihr auch das dritte Kind.
Am andern Morgen, als es ruchbar ward, riefen alle Leute laut: »Die Königin ist eine Menschenfresserin, sie muss verurteilt werden.«
Und der König konnte seine Räte nicht mehr zurückweisen. Es ward ein Gericht über sie gehalten, und weil sie nicht antworten und sich nicht verteidigen konnte, ward sie verurteilt, auf dem Scheiterhaufen zu sterben. Das Holz wurde zusammengetragen, und als sie an einen Pfahl festgebunden war und das Feuer ringsumher zu brennen anfing, da schmolz das harte Eis des Stolzes und ihr Herz ward von Reue bewegt, und sie dachte: »Könnt ich nur noch vor meinem Tode gestehen, dass ich die Tür geöffnet habe.«
Da kam ihr die Stimme, dass sie laut ausrief: »Ja, Maria, ich habe es getan!«
Und alsbald fing der Himmel an zu regnen und löschte die Feuerflammen, und über ihr brach ein Licht hervor, und die Jungfrau Maria kam herab und hatte die beiden Söhnlein zu ihren Seiten und das neugeborene Töchterlein auf dem Arm. Sie sprach freundlich zu ihr: »Wer seine Sünde bereut und eingesteht, dem ist sie vergeben.«
Und reichte ihr die drei Kinder, löste ihr die Zunge und gab ihr Glück für das ganze Leben.
Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
Ein Vater hatte zwei Söhne, davon war der älteste klug und gescheit, und wusste sich in alles wohl zu schicken. Der jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen, und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie: »Mit dem wird der Vater noch seine Last haben!«
Wenn nun etwas zu tun war, so musste es der älteste allzeit ausrichten; hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl: »Ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir!«
Denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal: »Ach, es gruselt mir!«
Der jüngste saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. »Immer sagen sie, es gruselt mir, es gruselt mir! Mir gruselt es nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe.«
Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach: »Hör, du in der Ecke dort, du wirst groß und stark, du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt, aber an dir ist Hopfen und Malz verloren.«
»Ei, Vater«, antwortete er, »ich will gerne was lernen; ja, wenn es anginge, so möchte ich lernen, dass mir es gruselte; davon verstehe ich noch gar nichts.«
Der älteste lachte, als er das hörte und dachte bei sich: Du lieber Gott, was ist mein Bruder für ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts. Was ein Häkchen werden will, muss sich beizeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm: »Das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.«
Bald danach kam der Küster zu Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre, er wüsste nichts und lernte nichts. »Denkt Euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen.«
»Wenn es weiter nichts ist«, antwortete der Küster, »das kann er bei mir lernen; tut ihn nur zu mir, ich werde ihn schon abhobeln.«
Der Vater war es zufrieden, weil er dachte: Der Junge wird doch ein wenig zugestutzt. Der Küster nahm ihn also ins Haus, und er musste die Glocken läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. Du sollst schon lernen, was Gruseln ist, dachte er, ging heimlich voraus, und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah er auf der Treppe eine weiße Gestalt stehen. »Wer da?«, rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht.
»Gib Antwort«, rief der Junge, »oder mache, dass du fortkommst, du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen!«
Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal: »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die Treppe hinab.«
Der Küster dachte: Das wird so schlimm nicht gemeint sein, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er von Stein wäre.
Da rief ihn der Junge zum dritten Mal an, und als das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocke, ging heim, legte sich ohne ein Wort zu sagen ins Bett und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich angst, sie weckte den Jungen und fragte: »Weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen.«
»Nein«, antwortete der Junge, »aber da hat einer auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet Ihr sehen, ob er es gewesen ist, es sollte mir leidtun.«
Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte.
Sie trug ihn herab und eilte mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. »Euer Junge«, rief sie, »hat ein großes Unglück angerichtet, meinen Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft den Taugenichts aus unserm Hause!«
Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. »Was sind das für gottlose Streiche, die muss dir der Böse eingegeben haben.«
»Vater«, antwortete er, »hört nur an, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht wie einer, der Böses im Sinne hat. Ich wusste nicht, wer es war, und habe ihn dreimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen.«
»Ach«, sprach der Vater, »mit dir erleb ich nur Unglück, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.«
»Ja, Vater, recht gerne, wartet nur bis Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen, so versteh ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann.«
»Lerne, was du willst«, sprach der Vater, »mir ist alles einerlei. Da hast du fünfzig Taler, damit geh in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muss mich deiner schämen.«
»Ja, Vater, wie Ihr es haben wollt, wenn Ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leichttun.«
Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine fünfzig Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin: »Wenn mir es nur gruselte! Wenn mir es nur gruselte!«
Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, dass man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm: »Siehst du, dort ist der Baum, wo sieben mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen: setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon noch das Gruseln lernen.«
»Wenn weiter nichts dazu gehört«, antwortete der Junge, »das ist leicht getan; lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine fünfzig Taler haben; komm nur morgen früh wieder zu mir.«
Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich ein Feuer an. Aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass er trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehenkten gegeneinanderstieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er: Du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln. Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab.
Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er: »Nehmt euch in acht, sonst häng ich euch wieder hinauf.«
Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er bös und sprach: »Wenn ihr nicht achtgeben wollt, so kann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit euch verbrennen.« und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein, und am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Taler haben und sprach: »Nun, weißt du, was Gruseln ist?«
»Nein«, antwortete er, »woher sollte ich es wissen? Die da droben haben das Maul nicht auf getan und waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.« Da sah der Mann, dass er die fünfzig Taler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach: »So einer ist mir noch nicht vorgekommen.«
Der Junge ging auch seines Wegs und fing wieder an, vor sich hin zu reden: »Ach, wenn mir es nur gruselte! Ach, wenn mir es nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm her schritt, und fragte: »Wer bist du?«
»Ich weiß nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter: »Wo bist du her?«
»Ich weiß nicht.«
»Wer ist dein Vater?«
»Das darf ich nicht sagen.«
»Was brummst du beständig in den Bart hinein?«
»Ei«, antwortete der Junge, »ich wollte, dass mir es gruselte, aber niemand kann mich es lehren.«
»Lass dein dummes Geschwätz«, sprach der Fuhrmann. »Komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich unterbringe.« Der Junge ging mit dem Fuhrmann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut: »Wenn mir es nur gruselte! Wenn mir es nur gruselte!« Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach: »Wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein.«
»Ach, schweig stille«, sprach die Wirtsfrau, »so mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt, es wäre Jammer und Schade um die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wieder sehen sollten.« Der Junge aber sagte: »Wenn es noch so schwer wäre, ich will es einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen.«
Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was Gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der es wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien; in dem Schlosse steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht, die würden dann frei und könnten einen Armen sehr reich machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder herausgekommen.
Da ging der Junge am anderen Morgen vor den König und sprach: »Wenn es erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen.« Der König sah ihn an und weil er ihm gefiel, sprach er: »Du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und das darfst du mit ins Schloss nehmen.« Da antwortete er: »So bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer.«
Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn mir es nur gruselte«, sprach er, »aber hier werde ich es auch nicht lernen.« Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschüren, wie er so hineinblies, da schrie es plötzlich aus einer Ecke: »Au, miau! Was uns friert!«
»Ihr Narren«, rief er, »was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch.« Und wie er das gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie: »Kamerad, wollen wir eins in der Karte spielen?«
»Warum nicht?«, antwortete er, »aber zeigt einmal eure Pfoten her.« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei«, sagte er, »was habt ihr lange Nägel! Wartet, die muss ich euch erst abschneiden.« Damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger gesehen«, sprach er, »da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel«, schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser.
Als er aber die zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten, immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das sah er ein Weilchen ruhig mit an, als es ihm aber zu arg ward, fasste er sein Schnitzmesser und rief: »Fort mit dir, du Gesindel« und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich.
Als er wiedergekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. »Das ist mir eben recht«, sprach er, und legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. »Recht so«, sprach er, »nur besser zu.« Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab: auf einmal, hopp hopp! Warf es um, das Unterste zuoberst, dass es wie ein Berg auf ihm lag.
Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte: »Nun mag fahren, wer Lust hat«, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König, und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er: »Es ist doch schade um den schönen Menschen.« Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach: »So weit ist es noch nicht!« Da Verwunderte sich der König, freute sich aber, und fragte, wie es ihm gegangen wäre. »Recht gut«, antwortete er, »eine Nacht wäre herum, die zwei anderen werden auch herumgehen.« Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen. »Ich dachte nicht«, sprach er, »dass ich dich wieder lebendig sehen würde; hast du nun gelernt, was Gruseln ist?«
»Nein«, sagte er, »es ist alles vergeblich. Wenn mir es nur einer sagen könnte!«
Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an: »Wenn mir es nur gruselte!« Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören; erst sachte dann immer stärker, dann war es ein bisschen still, endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihn hin. »Heda!«, rief er, »noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig.« Da ging der Lärm von frischem an, es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. »Wart«, sprach er, »ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen.«
Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren und saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. »So haben wir nicht gewettet«, sprach der Junge, »die Bank ist mein.« Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ es sich nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen, die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte: »Hört ihr, kann ich mit sein?«
»Ja, wenn du Geld hast.«
»Geld genug«, antwortete er, »aber eure Kugeln sind nicht recht rund.« Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So, jetzt werden sie besser schüppeln«, sprach er, »heida! Nun geht es lustig!« Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld, als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am anderen Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. »Wie ist dir es diesmal gegangen?«, fragte er. »Ich habe gekegelt«, antwortete er, »und ein paar Heller verloren.«
»Hat dir denn nicht gegruselt?«
»Ei was«, sprach er, »lustig hab ich mich gemacht. Wenn ich nur wüsste, was Gruseln wäre!«
In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich: »Wenn es mir nur gruselte!« Als es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er: »Ha, ha, das ist gewiss mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist«, winkte mit dem Finger und rief, »komm, Vetterchen, komm!« Sie stellten den Sarg auf die Erde, er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab: da lag ein toter Mann darin.
Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. »Wart«, sprach er, »ich will dich ein bisschen wärmen«, ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer, legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein, »wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich«, brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Über ein Weilchen ward der Tote warm und fing an sich zu regen. Da sprach der Junge: »Siehst du, Vetterchen, hätte ich dich nicht gewärmt!« Der Tote aber hub an und rief: »Jetzt will ich dich erwürgen.«
»Was«, sagte er, »ist das mein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg«, hub ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu; da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. »Es will mir nicht gruseln«, sagte er, »hier lerne ich es mein Lebtag nicht.«
Da trat ein Mann herein, der war größer als. Alle anderen, und sah fürchterlich aus; er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. »O du Wicht«, rief er, »nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben.«
»Nicht so schnell«, antwortete der Junge, »soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein.«
»Dich will ich schon packen«, sprach der Unhold.
»Sachte, sachte, mach dich nicht so breit; so stark wie du bin ich auch, und wohl noch stärker.«
»Das wollen wir sehn«, sprach der Alte, »bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen; komm, wir wollen es versuchen.« Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde. »Das kann ich noch besser«, sprach der Junge, und ging zu dem anderen Amboss. Der Alte stellte sich nebenhin und wollte zusehen, und sein weißer Bart hing herab.
Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. »Nun hab ich dich«, sprach der Junge, »jetzt ist das Sterben an dir.« Dann fasste er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören, er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. »Davon«, sprach er, »ist ein Teil den Armen, der andere dem König, der dritte dein.« Indem schlug es zwölfe, und der Geist verschwand, also dass der Junge im Finstern stand. »Ich werde mir doch heraushelfen können«, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte: »Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist?«
»Nein«, antwortete er, »was ist es nur? Mein toter Vetter war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.« Da sprach der König: »Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten.«
»Das ist alles recht gut«, antwortete er, »aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist.«
Da ward das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer: »Wenn mir es nur gruselte! Wenn mir es nur gruselte!« Das verdross sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach: »Ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen.« Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, dass die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief: »Ach, was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist.«
Der Wolf und die sieben jungen Geißlein
E