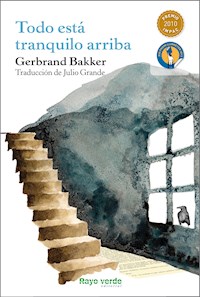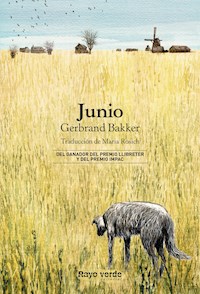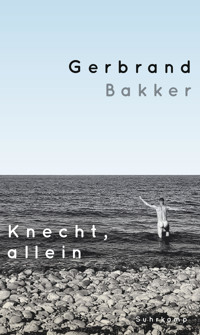
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller Gerbrand Bakker leidet an Depressionen und wegen der verschriebenen Antidepressiva an Libidoverlust. Eine Sexologin rät ihm, eine love map zu erstellen. Er folgt ihrem Rat und verzeichnet in Knecht, allein, seiner persönlichen Liebeskarte, alle im weitesten Sinne zur Geschichte seines Liebens gehörenden Erinnerungen. Er schreibt von einem Roadtrip nach Griechenland, einer Wanderung in Wales, von Gesprächen mit Freunden und den Nachbarn in der Eifel – und sucht in diesen Erinnerungen nach einem möglichen Auslöser seines depressiven Weltverlusts.
Knecht, allein liefert psychologische Einsichten in das Leben und Lieben eines Depressiven, wie man sie in dieser Ehrlichkeit und Klarheit selten liest. Der »Sprachhandwerker« Gerbrand Bakker umkreist sein Selbstverhältnis zu seiner Krankheit, sucht fast fiebrig nach den geeigneten Worten, um die Leere zu greifen, und begegnet ihr zugleich mit einer besonderen Lakonie, mit Humor und Freimut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Gerbrand Bakker
Knecht, allein
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Suhrkamp Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Knecht, alleen bei De Arbeiderspers, Amsterdam.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© 2020 Gerbrand Bakker
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln
Umschlagfoto: Jens Roep
eISBN 978-3-518-77215-7
www.suhrkamp.de
Knecht, allein
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
–
1
–
–
2
–
–
3
–
–
4
–
–
5
–
–
6
–
–
7
–
–
8
–
–
9
–
–
10
–
DACHDECKER RUDI
–
11
–
–
12
–
–
13
–
–
14
–
EINE EWIGE PLAUDEREI
–
15
–
–
16
–
–
17
–
–
18
–
–
19
–
M.
–
20
–
–
21
–
–
22
–
–
23
–
–
24
–
–
25
–
–
26
–
–
27
–
–
28
–
–
29
–
DER PORTUGIESE
–
30
–
–
31
–
–
32
–
–
33
–
DER KINDERBUCHAUTOR
–
34
–
–
35
–
–
36
–
–
37
–
–
38
–
–
39
–
–
40
–
DIE LERCHE
UMSCHLAGENDES SELBSTBILD
–
41
–
–
42
–
–
43
–
–
44
–
–
45
–
DAS ORAKEL VON DELPHI
WRITING RETREAT
AUGENZEUGENBERICHT ÜBER
»
ZORBAS
«
–
46
–
–
47
–
–
48
–
–
49
–
–
50
–
–
51
–
–
52
–
–
53
–
–
54
–
–
55
–
–
56
–
–
57
–
–
58
–
ICH
,
SELBST
–
59
–
–
60
–
DER WWOOFER
VII
.
DU SOLLST NICHT EHEBRECHEN
–
61
–
–
62
–
–
63
–
KLAAS
–
64
–
DER USBEKE
–
65
–
DIE WETTERFAHNE
–
66
–
–
67
–
–
68
–
–
69
–
–
70
–
–
71
–
–
72
–
–
73
–
–
74
–
–
75
–
–
76
–
–
77
–
–
78
–
–
79
–
–
80
–
–
81
–
–
82
–
–
83
–
HUBERT
–
84
–
–
85
–
–
86
–
–
87
–
QUELLEN
Fußnoten
Informationen zum Buch
– 1 –
Auf dem Weg zum ersten Termin bei der Sexologin in der Universitätsklinik Amsterdam kam ich am Bastion Hotel vorbei, das in der Nähe des ehemaligen Bijlmer-Gefängnisses steht. Ich sah es von der Metro aus. Es regnete, was der Grund dafür war, dass ich in der Metro und nicht auf dem Fahrrad saß. Im Bastion Hotel war einmal ein Amerikaner aus Portland, Oregon, zu Gast gewesen. In dem Hotel war ich mit ihm zusammen. 1998 war das. Ein gläubiger Amerikaner. Irgendwann fragte er: »And what shall I do with this penis?« Er sprach nicht von seinem eigenen Penis, sondern von meinem. Ich habe nicht geantwortet. Ich dachte: Mach, was du willst. Ich fand seine Frage seltsam. Später landeten wir sogar beide noch auf dem Boden, weil die Doppelbetten in Bastion Hotels zusammengeschobene Einzelbetten waren.
Die Sexologin war noch jung, und offenbar betrachtete sie die Sitzung als Erstgespräch. Wir plauderten über dies und das, aber schließlich musste sie doch unbedingt ein paar Fragen auf ihrer Liste abhaken. Unter anderem, wann ich meine ersten sexuellen Erlebnisse gehabt habe und wann es zur ersten Penetration gekommen sei. Ich dachte kurz darüber nach. »Ich mache es mit Männern«, sagte ich und schaute sie an. »Bei uns ist manches ein bisschen anders. Vielleicht brauchen Sie eine andere Fragenliste?« Nach einer Stunde war das Erstgespräch vorbei, und wir vereinbarten einen Folgetermin.
Ich war an diesem Tag zur Uniklinik gefahren, weil meine Freundin Annelore Kodde vor Monaten »So eine Riesengemeinheit!« ausgerufen hatte. Damals hatte ich mein Antidepressivum abgesetzt, weil ich mich gut fühlte und weil ich eine der ärgerlichsten Nebenwirkungen von Antidepressiva leid war: Verminderung der Libido. Betrüblicherweise verschwand meine Libido in den Monaten nach dem Absetzen so gut wie vollständig. Das war nicht der Sinn der Sache, und als ich Annelore davon erzählte, hatte sie natürlich recht mit der Riesengemeinheit. Aber eine Riesengemeinheit von wem oder was? Das wollte ich herausfinden, zusammen mit der Sexologin in der Uniklinik, zu der mich mein Hausarzt überwiesen hatte.
– 2 –
Zu einem weiteren Gespräch mit der Sexologin ist es noch nicht gekommen. Zwei- oder dreimal habe ich abgesagt. Ich hatte anderes im Kopf, als darüber zu reden, warum ich keinen Orgasmus bekommen kann oder will, oder über eine verflüchtigte Libido oder meine Art, Sex zu haben.
Als ich am 1. Januar 2018 im Haus von Dolf Verroen und Gerard Hemmes am Ankleidezimmer vorbeiging, sah ich dort eine Waage. Schon eine Weile hatte ich das unbestimmte Gefühl, dass mein Körper sich veränderte, und das bestätigte sich, als ich mich auf die Waage stellte. Sechsundachtzig Kilo. Sechsundachtzig! Noch am selben Tag setzte ich sämtliche Süßigkeiten ab. Keine Pralinen, keine Apfeltaschen, keine Zimtschnecken. Nach ein paar Monaten wog ich noch einundachtzig Kilo. Während der Sommer in den Herbst überging, nahm ich weitere sieben Kilo ab. Weil ich nicht essen konnte.
In dieser Zeit unternahm ich mit Pauline Slot und Freund Henk, das ist der mit Hündchen Bas, eine Reise nach Griechenland und zurück. Einen Monat im Auto unterwegs. In mir war alles hohl. Was hohl ist, kann gefüllt werden, nur galt das nicht für mich. Ich fühlte mich hohl vor lauter Angst, Stress, manchmal Panik. Ich kämpfte. Wenigstens schlief ich gut, das war besser als nichts: Am Ende jedes Tages war ich so geschafft, dass Schlaf willkommen war. Neben dem Antidepressivum, mit dem ich wieder angefangen und das mich in diesen Daseinszustand versetzt hatte, nahm ich anderthalb Monate lang Alprazolam; dank meines Therapeuten hatte ich es in einer Apotheke im slowenischen Kranj kaufen können. Der erste Nachmittag mit Alprazolam war schön. Ich stieg mit Freund Henk einen Berg hinauf, es war herrliches Wetter, unterwegs begegneten wir Leuten, mit denen ich mich ganz normal unterhielt, ich hatte das Gefühl, wieder da zu sein. Es war das erste Mal, dass ich dachte: Ich bin wieder da. Das habe ich danach noch sehr oft gedacht, vor allem abends. Dann hatte ich zwei oder drei Gläser Weißwein getrunken und konnte mir nicht vorstellen, dass ich mich am nächsten Tag wieder ganz und gar verloren fühlen würde und gegen die Leere und Bedeutungslosigkeit kämpfen müsste, von denen man nicht genau weiß, woran man sie festmachen soll, und gegen die man mit Gedanken (»Du darfst nicht so viel grübeln!«) nicht ankommt.
Ich saß praktisch immer hinten im Wagen. Ich kann nicht Auto fahren, besitze nicht einmal einen Führerschein. Wir fuhren durch einen langen Tunnel. Ich versuchte mir vorzustellen, dass dieser Tunnel ein Symbol war, dass am Ende nicht nur das Auto samt materiellem Inhalt herauskommen würde, sondern auch ich. Wenn nicht gleich, dann eben morgen oder vielleicht übermorgen. Ich versuchte, das Schlucken der rosafarbenen Tablette möglichst lange aufzuschieben, ich versuchte, mit einer einzigen pro Tag auszukommen. Und wir fuhren und fuhren, durch Albanien, durch Bosnien und Herzegowina, durch Länder, von denen ich nicht das Geringste mitbekam. Bedrohliche Länder, fern von zu Hause, Länder, in denen Krieg gewütet hatte, in denen die Menschen nicht friedliebend waren. Ich merkte, dass ich unwillkürlich darüber nachdachte, ob die Städte, deren Namen auf den Schildern standen, einen Flughafen hatten. Skopje, las ich. Ja, dachte ich, da gibt es einen Flughafen. Da hätte ich mal hinfliegen sollen. Aber ich gab mir Mühe. Hin und wieder fragte ich Pauline und Henk, ob es mit mir auszuhalten sei. »Ja«, sagten sie. Nach einiger Zeit nimmt die Wirkung von Mitteln wie Alprazolam drastisch ab, und nach etwa ein oder zwei Wochen ist man süchtig danach. Man möchte eigentlich immer mehr davon nehmen, aber ich hütete mich, das zu tun. »Heldenhaft«, sagte der Therapeut, als ich ihm ein paar Wochen nach meiner Rückkehr erzählte, dass ich es von einem Tag auf den anderen abgesetzt hatte. Ich hatte Entzugserscheinungen. Immerhin, wenn ich das merkte, war vielleicht eine neue Phase in diesem Kampf erreicht.
– 3 –
Ein paar Wochen nach meiner Rückkehr. Zweieinhalb Wochen lang suchte ich den Therapeuten täglich auf, auch samstags und sonntags. Zusammen versuchten wir, diese Zeit durchzustehen. Er schickte mich zum Krisendienst, weil mein Zustand ihn so erschreckte – er kennt mich schon einige Jahre –, dass er das Schlimmste befürchtete. Und weil ich ihm sagte, dass ich nicht mehr konnte. Dass ich eine Grenze erreicht hatte. Irgendwann in dieser Zeit erinnerte ich mich an einen Vorfall im Zug von Norwich nach Bangor, Wales. Es war Sommeranfang. Sehr viele Mitreisende. Unter anderem eine Gruppe typisch britischer junger Frauen, die irgendetwas feierten, sie hatten Ballons bei sich. Es war warm im Zug und viel zu voll. Ich bekam einen altmodischen Panikanfall. Den ich zunächst noch distanziert beobachten konnte, mit einer Spur von Vergnügen sogar, weil ich ihn wiedererkannte und glaubte, ihn allein schon dadurch im Keim ersticken zu können. Doch allmählich wuchs er zu etwas heran, das sich in gewisser Weise außerhalb des eigenen Selbst abspielte. Ich stand auf und ging zur Toilette. Um irgendetwas zu tun. Doch nach der Rückkehr an meinen Platz war diese Fluchtroute schon abgehakt, ich konnte nicht noch einmal zur Toilette. Und es wurde immer schlimmer, bald hatte die Panik mich fest im Griff, sie steigerte sich immer weiter, bis zu einem Punkt, an dem man sich fragt, was danach noch kommen kann. Ich saß auf meinem Platz, ich atmete, ich versuchte, aus dem Fenster zu schauen, vor dem die wunderschöne britische Landschaft vorüberglitt, und ganz allmählich spürte ich, wie in meinem Inneren etwas absackte. Ich erzählte meinem Therapeuten davon. Das sollte ich festhalten, sagte er. Diese Erinnerung festhalten. Die Grenze, von der ich sagte, dass ich sie erreicht hätte, was für eine Grenze ist das eigentlich? Existiert sie überhaupt?
Jemand hat mir gesagt, dass es bei ihm noch schlimmer war, dass er nur noch im Bett liegen konnte. Schlimmer?!, dachte ich. Könnte ich doch bloß im Bett liegen, bei geschlossenen Vorhängen! Ich musste mich mit höchster Konzentration von einem Tag zum nächsten schleppen. Ich durfte mich nicht gehen lassen. Ich musste abgelenkt werden. Aber das konnte nur ich selbst. Mein Telefon schaltete ich auf stumm. Alles, was von außen kam, war bedrohlich und störend. Ich las und spielte stundenlang Spiele. Ich sah fern, ebenfalls stundenlang. Ich las, konnte aber nicht lesen. Ich sah fern, konnte aber nichts aufnehmen. Und die ganze Zeit schluckte ich dieses verdammte Medikament einfach weiter, irgendwann musste es doch wirken. Absetzen kommt eigentlich nicht infrage; das dauert lange, weil es nur allmählich geht, und wer konnte garantieren, dass ein anderes Mittel, zum Beispiel mein altvertrautes Citalopram, wirksamer sein würde? Das neue Medikament war Escitalopram, eine verbesserte Version von Citalopram. Das habe ich mir einmal von meinem Apotheker erklären lassen. Pharmazeuten ist es gelungen, die nichtwirksame Hälfte des Citalopram herauszufiltern. Escitalopram enthält also die Hälfte des Wirkstoffs von Citalopram. Den guten, wirksamen Teil. Das beruhigte mich, weil die wirksame Substanz genau die gleiche ist wie in Citalopram. Der Vorteil von Escitalopram soll sein, dass es weniger Nebenwirkungen hat. In meinem Fall kam das nicht so ganz hin.
Als verlorenes Häuflein Mensch tagaus, tagein hinten in einem Auto zu sitzen, das durch fremde Länder rauscht, ist nicht das Wahre für jemanden, der schwer depressiv und voller Ängste ist. Die zwölf Tage, die wir in Griechenland verbrachten – an einem Ort, den ich gut kenne, weil ich im Vorjahr schon dort war und einen Teil von Echte Bäume weinen nicht geschrieben hatte –, ließen sich prima aushalten. Vermutlich, weil ich auf Anraten des Therapeuten eine Vierteltablette Escitalopram 10 Milligramm und eine ganze Alprazolam schluckte. Zugegeben, ich fühlte mich »seltsam«, aber ich funktionierte, ich schrieb Kolumnen, ich arbeitete ein bisschen im Garten. All das war vertraut. Ich konnte mich normal gegenüber den anderen Gästen verhalten, darunter eine außerordentlich nette Frau. Romi Jones, aus England, Northumberland. Mit ihr tausche ich bis heute fast täglich WhatsApp-Nachrichten aus. »Heute« ist übrigens der 28. November 2018, aber aus irgendeinem Grund ist das kaum von Bedeutung.
Während der Rückreise war bald Schluss mit dem Funktionieren, ich wurde wieder zu dem verlorenen Häuflein Mensch auf der Rückbank, eine Flasche Wasser und die rosa Pillen in Reichweite, außerdem Kaugummi, weil Kaugummikauen die einzige Möglichkeit war, bohrende Zahnschmerzen zu dämpfen. Nach unserer Rückkehr – zwei Tage früher als geplant, weil ich in Kroatien, in Skradin, verkündete, es »leid« zu sein, und fragte, ob wir nicht bitte einfach in die Eifel zurückfahren könnten – wurde es noch schlimmer. Vor lauter Elend nahm ich sieben Kilo ab. »Es wird schon werden«, meinte der Therapeut.
Irgendwann in den vergangenen Wochen war ich tapfer oder klar genug, um den Zahnarzt anzurufen. Ob er bitte einmal meine Brücke kontrollieren könne. Wie konnte ich dort Schmerzen haben? Der eine Backenzahn war gezogen, und hatte der dahinter nicht eine gründliche Wurzelkanalbehandlung bekommen? Dirk, so heißt mein Zahnarzt, machte eine Röntgenaufnahme und stocherte ein wenig im Zahnfleisch herum. »Da ist eine riesige Tasche«, sagte er. »Und auf dem Foto sieht alles tadellos aus.« Ich war erleichtert. Zumindest eine Sorge weniger. Ich hatte mir schon eine aufwändige Operation vorgestellt; Brücke raus, wieder eine Wurzelkanalbehandlung, dieses scheußliche Gummiläppchen auf dem Mund, schlucken, bis es nichts mehr zu schlucken gibt. Übers Internet bestellte ich dicke Zahnseide, die man in keinem Laden mehr bekommt, fuhrwerkte damit jeden Abend in der Tasche herum (Das tut weh!), und die Zahnschmerzen, die in all diesen Ländern, in denen ich gar nicht sein wollte, so lange gebohrt hatten, ließen nach und verschwanden. Ich schilderte Dirk meinen Zustand. »Beschissen«, sagte er. »Unerfreulich«, schreiben andere. Oder »zum Kotzen«.
– 4 –
Beschissen, unerfreulich oder zum Kotzen sind verdammt unzulängliche Ausdrücke. Die mich auch wütend machen. Was fängt man damit an, wenn jemand sagt, dass er den geschilderten Zustand »unerfreulich« findet? Soll man »Danke schön« sagen? Es ist unerfreulich, wenn man sich in den Finger schneidet oder Zahnschmerzen hat. Es ist zum Kotzen, wenn einem der Zug vor der Nase wegfährt. Es ist beschissen, wenn die Eisschnellläuferin, die man bewundert, bei den Olympischen Spielen auf der 500-Meter-Strecke stürzt. Die Wut verflüchtigt sich auch schnell wieder, denn immerhin drückt sich auf diese Weise Mitempfinden aus, so ungeschickt und unzulänglich es auch artikuliert sein mag. »Versuch doch, es trotzdem zu genießen«, schrieb jemand per SMS, als ich in Griechenland war. Ich starrte auf die Buchstaben und schüttelte den Kopf. Es zeigte mir wieder einmal, wie schlimm es ist, wenn man anderen Menschen nicht begreiflich machen kann – nicht einmal seinen besten Freunden oder der eigenen Mutter –, was mit einem los ist. Wo man sich befindet. Es ist kein Krebs, keine gebrochene Elle. Es ist unsichtbar und unsagbar. Und es ist schwer, sich in diesen Zustand hineinzuversetzen, wie es sogar für mich selbst wahrscheinlich unmöglich ist, mich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen, der an einer Depression leidet. »Ich muss dann immer ganz furchtbar weinen«, sagt Anton Dautzenberg. »Was?!«, erwidere ich. »Aber dann bist du ja gar nicht depressiv! Du weinst, das ist Ausdruck eines Gefühls!« Genauso habe ich reagiert, als ich von einem DJ hörte, der während einer Radio-Livesendung in Tränen ausbrach und bekannte, depressiv zu sein. Er erhielt sehr viel Beifall und Bestätigung. Doch ich dachte im Stillen: Der ist überhaupt nicht depressiv, das ist ausgeschlossen, sonst hätte er nicht geweint, als er auf Sendung war! Schließlich schrieb ich in meinem Blog darüber, wobei ich sofort zugab, eigentlich nichts dazu sagen zu können und zu dürfen, weil ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, dass in dieser Hinsicht jeder Mensch anders ist. Gut, in manchen Fällen darf man schon etwas sagen. Wenn zum Beispiel jemand behauptet, er sei depressiv, weil ein bestimmter Mensch gestorben sei. Dann ist man nämlich nicht depressiv, sondern man trauert. Trauer ist ein Gefühl, trauern ist verarbeiten, und natürlich fühlt man sich dann beschissen – um dieses Wort selbst einmal zu gebrauchen –, aber depressiv ist man nicht. Vielleicht ist es ein Seinszustand, auf den das Wort »beschissen« wirklich passt.
Es gab Momente der Erleichterung. In Albanien machten wir in Kruja Station, einer Kleinstadt am Fuß der Berge. Unser Hotel lag hoch oben auf einem Felsen, und wir schliefen in kleinen Chalets. Der Abend und die Nacht waren erträglich gewesen: rosa Pille und Alkohol. Ein unsympathisches schwules Paar aus den Niederlanden ignorierte uns demonstrativ, wahrscheinlich, weil wir als Landsleute ihre Vorstellung von einem einmaligen und authentischen Urlaubserlebnis brutal infrage stellten. Dabei war es dort gar nicht besonders authentisch, in der schmalen Straße unterhalb unseres Felsens gab es nichts als Souvenirläden und Restaurants. Freund Henk stolperte über eine Stufe vor einem der Läden, sodass er eine Tafel mit touristischem Magnetklimbim zum Umfallen brachte. Fassungslosigkeit. Am Ende gab sich die Inhaberin mit fünf Euro Schadenersatz zufrieden. »Die braucht eine ganze Woche nicht mehr zu arbeiten«, meinte Pauline. Die beiden angestoßenen Keramik-Magnete nahm Henk mit. Eins der hässlichen Dinger hängt jetzt an meinem Backofen. Das andere, noch hässlichere (ein Schühchen mit Bommel) habe ich Gartenkumpel Han gegeben, der es nach ein paar Tagen weggeworfen hat. Wir zurück ins Auto. Fast sofort war ich wieder das willenlose Stück Fleisch, von Angst verzehrt. Draußen zog eine unansehnliche Landschaft vorüber, ich vermute, dass ich es kaum erwarten konnte, zur Grenze zu kommen. Albaner fahren tatsächlich so wie in Reiseführern geschildert: wie Irre. Dazu ziehen sie grimmige, finstere Visagen. Ich glaube mich zu erinnern, dass nur die Hälfte der Straßen asphaltiert ist. Wir machten an einer Tankstelle halt. Ich aß eine Banane. Im Grunde bekam ich nichts anderes als Bananen herunter. Weiter. Allmählich veränderte sich die Landschaft, wurde flacher, weniger dicht bewaldet, auf einem niedrigen Hügel stand eine wunderschöne Kirche. »Es gefällt mir hier«, meldete die Rückbank dem Fahrer- und Beifahrersitz. Ich dachte: Ich bin wieder da. Dieser Zustand hielt nicht an.
Ganz ähnlich: die Verleihung des Jan-Wolkers-Preises im Museum Boerhaave in Leiden. Am 21. Oktober. Live in der Radiosendung Vroege Vogels. Ich hatte absagen wollen, eigentlich blieb mir fast nichts anderes übrig. Um halb sechs musste ich aufstehen. Eine unerwartet befriedigende Erfahrung. Weil ich roh aus tiefem Schlaf geweckt wurde, lag ich nicht wie gewöhnlich mit einem hohlen Gefühl und einem Puls von hundert im Bett; ein Körper, der sich voller Angst darauf vorbereitet, wieder einen Tag zu überstehen. Ich würgte etwas Brot herunter, schluckte eine rosa Pille und stieg zu Freund Henk ins Auto. Wir holten Gartenkumpel Han in Haarlem ab und kamen schon vor acht in Leiden an. Ich sollte mich live im Radio äußern, Menno Bentveld sollte mich interviewen. Ich hielt mich aufrecht, ich plauderte mit diesem und jener, unter anderem mit Karina Wolkers, Jan Wolkers’ Witwe. Jemand anders gewann den Preis. Ich war mit allem einverstanden. Ich bekam ein Glas Sekt angeboten und trank es aus. Wir fuhren zurück, tranken bei Gartenkumpel Han noch eine Tasse Kaffee, und wenig später lag ich zu Hause auf dem Sofa. Ich döste ein bisschen ein. Ich dachte: Ich bin wieder da. Dieses Gefühl hielt den Rest des Tages und den Abend an.
Eine Fahrt von der Eifel nach Amsterdam. Das war am 25. Oktober. Ich weiß das, weil ich es auf einem Zettel notiert habe. Gartenkumpel Han fuhr. Als Kind haben mich Autofahrten negativ geprägt. Nicht verwunderlich, das war mir klar. Jede Rückfahrt im Auto am Ende der Ferien war eine Katastrophe. Aber jetzt – nach dem Einnehmen einer rosa Tablette – sah ich Dinge außerhalb des Autos. Ich sah Hügel und Bäume und Häuser. Ich versuchte, nicht nachzudenken, und ich spürte ein inzwischen fast schon unbekanntes Etwas in der Magengegend. Hatte ich tatsächlich Hunger? Wie gewöhnlich machten wir beim La Place – früher AC Restaurant – in der Nähe von Nederweert Pause. Wir nahmen beide ein Würstchen im Schlafrock. Noch nie hatte mir Würstchen im Schlafrock so gut geschmeckt. Ein wunderbar triefend fettes, lauwarmes Hackfleischwürstchen in Blätterteig. Ich hätte noch eins essen können und wollen. Ich gab Hündchen Jet etwas von meinem Würstchen im Schlafrock ab. Ich glücklich, Jet glücklich, Han glücklich. Ich versuchte, nicht nachzudenken, ich starrte aus dem Fenster auf die A2 und die vorbeirasenden Autos, und ich spürte: Ich bin wieder da. Dieses Gefühl hielt den Rest des Tages und den Abend an.
Morgen, dachte ich jeden Abend. Morgen bin ich wieder da. Nach ein paar Gläsern Alkohol konnte ich mir nicht vorstellen, dass dieses Gefühl am nächsten Morgen weg sein könnte. Jeden Tag aufs Neue. Ich begann, über die Wirkung von Alkohol nachzudenken. War es denn so einfach? Ein paar Gläser Rutte-Genever oder Weißwein und, zack, mein Empfinden verwandelt sich wie durch Zauberhand? Während ich schon seit Monaten ein Medikament nehme, das dafür sorgen sollte?
»Bist du auch ein bisschen vorsichtig mit Alkohol?«, fragte der Therapeut. »Du hast leicht reden«, antwortete ich. »Wenn er mir doch hilft?«
Und immer wieder gab mir die Uniklinik einen neuen Termin für die Folgewoche. Die kennen da nichts, es ist nicht möglich, selbst einen Termin auszumachen, der einem gut passt. Es wurde Zeit, die Tatsachen offenzulegen. Ich mailte, dass ich depressiv sei und dass es deshalb aus meiner Sicht im Moment keinen Sinn habe, die Untersuchung fortzusetzen. Dafür hatte die Sexologin Verständnis. Und ich bekam einen Termin für die nächste Woche. Später fragte sie, ob sie mit meinem Therapeuten Kontakt aufnehmen dürfe. Das ärgerte mich, ich fand es völlig unnötig. Ich schrieb ihr das, und außerdem, dass ich mich erst einmal auf »meine Genesung« konzentrieren wolle und keine Lust auf Kompliziertes habe. Sie antwortete, es sei auch nicht nötig, sie habe nur wissen wollen, ob man sich gut um mich kümmere. Daraufhin konnte ich ihr wiederum mailen, dass ich sie sehr freundlich und anteilnehmend finde und mich zu gegebener Zeit wieder bei ihr melden werde.
Diese Mails zu schreiben war schrecklich. Ich hatte es benannt. Ich hatte es benannt, also war es real. Der Therapeut drängte mich auch immer wieder einmal zum Schreiben. »Du bist doch Schriftsteller, oder?«, scherzte er. »Bring es doch zu Papier.« Aber das konnte und wagte ich nicht. Wochenlang habe ich meinen Laptop nicht angerührt, ich wollte und konnte nichts damit zu tun haben. Irgendwann in den vergangenen Wochen habe ich Songschreiber und Sänger Boudewijn de Groot auf die Frage eines Fernsehmoderators, warum er keine Musik mehr schreibe, antworten hören: »Ich komme da nicht ran.« Texten klappte noch, komponieren nicht. Er hatte das schön ausgedrückt, fand ich. Ich komme da nicht ran. Meistens will man auch nicht rankommen. Traut man sich nicht. Weil ich es benannt hatte, wurde das Absagen von allerlei Verpflichtungen ein bisschen einfacher. Ich sagte eine Lesung in Wormerveer ab, ich sagte vier Lesungen in Karlsruhe und Stuttgart ab, ich sagte das festliche Wochenende in Harlingen ab, an dem der Anton-Wachter-Preis verliehen werden sollte. Ich war Mitglied der Jury. Jurykollegin Joke Linders mailte: »Komm doch, wir werden dich schon aufmuntern.« Lieb gemeint, aber es machte mich wieder wütend. Aufmuntern?! Kapiert denn wirklich niemand, was es heißt, depressiv zu sein? Da muss man nicht aufgemuntert werden. Ich bin nicht schwermütig.
Nicht schwermütig. Ich glaube, die Vorstellung, die das Wort Depression im Allgemeinen hervorruft, ist die von »Schwermut«. Das ist irreführend. Ich bin überhaupt nicht schwermütig. Ich meine, ich habe keine schwermütige Veranlagung. Ich bin, soweit man so etwas selbst beurteilen kann, ein Macher, jemand, der etwas tut. Ich habe Disziplin. Hätte ich keine Disziplin gehabt, hätte ich natürlich schon beim Aufstehen zur Flasche gegriffen. Wenn Alkohol so einfach wirkt, warum sollte man dann nicht den ganzen Tag trinken? Was das Wesen der Depression besser charakterisiert, ist das Wort nichts. Niemandsland. Da ist nichts, man selbst ist nichts. Man hat keinen Kontakt zu sich selbst, nicht zu seinem Denken, nicht zu seinem Fühlen, nicht zu seinem Körper, nicht zu anderen. Alle meine Gespräche in den zurückliegenden Monaten habe ich gespielt. Ich habe jemanden gespielt, der sich mit anderen unterhielt. Denn es sagte mir nichts, es interessierte mich nicht. Wenn mich jemand in den Arm nahm – Freund Henk, Pauline Slot –, hatte das keine Bedeutung über das Umarmen hinaus. Ich fühlte nichts. Es tröstete nicht.
Eine Depression ist nichts. Man ist nichts. Nichts ist ein Niemandsland. Ein Niemandsland ist eine Welt, in der nichts mehr von Bedeutung ist. Und darin kann man nicht leben.
Entfremdung. Von sich selbst, von anderen, von der Umgebung. Als würde man in einer anderen Welt leben. Das eigene Zuhause fühlt sich nicht wie ein Zuhause an, der Garten in der Eifel wurde zu einem fremden Ort, an dem es unmöglich wurde zu arbeiten. Man ist heimatlos. Man kann nicht nichts sein und doch gleichzeitig physisch da sein. Das ist der Knackpunkt. Daher die Notwendigkeit, mich zu konzentrieren. Jede Sekunde etwas tun, etwas lesen – irgendetwas, aber lieber keine scheußlichen Dinge, und in fast allem, was man liest, stehen scheußliche Dinge –, etwas sehen, so tun, als würde man Leuten zuhören, und auf möglichst adäquate Weise darauf eingehen. Einfach auf dem Sofa zu sitzen und vor mich hin zu starren, war vollkommen unmöglich, denn dann hätte ich diesem Etwas Raum gegeben. Dem Ort in einem selbst, der dafür sorgt, dass man sich in diesem Moment so fühlt, und von dem man sich nicht wegdenken kann. Der Leere, dem Nichts, dem, was kein Ende kennt. The Black Dog, wie manche Briten sagen. Nicht einmal ein Therapeut, also auch nicht meiner, kommt da heran, sodass er einem nicht oder kaum helfen kann. Denn es ist in mir und in mir allein, und egal wie viel Mühe ich mir gebe, wie sorgfältig ich meine Worte zu wählen versuche, auch ihm kann ich es nicht genau erklären.
Ich versuchte, The Power of Now von Eckhart Tolle in der niederländischen Übersetzung zu lesen. Ein Tipp von meinem Therapeuten. Was ich las, sollte jetzt und sofort auf mich überspringen. Ich bin bis zum Anfang eines Kapitels mit dem Titel »Das innere Ziel deiner Lebensreise« gekommen. Da ahnte ich schon, dass nichts davon geschehen würde, dass man Tolles Lehren nur mit Meditation befolgen konnte, wochenlang, monatelang. Aber ich wollte alles jetzt. Ich wollte jetzt die Kraft der Gegenwart. Trotzdem hat es mir etwas gebracht. Schlicht und einfach das Wort »jetzt«. Die Einsicht, dass das »ich« jetzt einmal keine Verpflichtungen hat, weil ich krank bin. Ich wurde tatsächlich krank, mehr oder weniger. Mein Körper vertrug das ganze Elend nicht gut. Ich bekam Darmbeschwerden, Schmerzen, eine schwere Erkältung. Mein Puls war zu schnell. Ich schwitzte. Ich wurde müder und müder. Manchmal, auf dem Fahrrad unterwegs zum Jordaan-Viertel, wo mein Therapeut wohnt, spürte ich, dass ich an einem noch tieferen Punkt angelangt war, dann wurden der Kreuzfahrtterminal oder das Musikgebäude am IJ oder der Hauptbahnhof zu fremdartigen Gebäuden aus einer anderen, fremdartigen Welt, und ich dachte noch ein bisschen weiter: Wenn es so ist, wenn ich noch tiefer unten bin, als ich je für möglich gehalten hätte, müsste dann jetzt nicht ein Weg nach oben kommen? Bei meinem Therapeuten sprach ich dann auch die uralte Weisheit aus: Bevor man den Weg aufwärts gehen kann, muss man ganz unten angekommen sein. Er nickte und brummte zustimmend. Ja, das ist möglich. Bei diesen Fahrradfahrten hatte ich übrigens nie einen Unfall, ich war immer noch so weit bei mir, dass ich entgegenkommende Fahrzeuge wahrnahm, nach links und rechts blickte, nie wie ein aufgescheuchtes Huhn die Haarlemmerstraat überquerte.
– 5 –
Und immer war da auch das Wissen um das Warum meines Zustands. Als ich vergangene Woche mit einem Freund vier Tage in der Eifel verbrachte, sagte ich zu Christa – der Frau von Dachdecker Rudi, der inzwischen verstorben ist –, der Tag der Geburtstagsfeier ihres Sohnes Johannes, der 9. September, sei so ungefähr der letzte »normale« Tag für mich gewesen. Es war ein Sonntag, Johannes feierte seinen Geburtstag im ehemaligen Rathaus von Nimshuscheid. Es gab Getränke und Essen, es waren viele Leute da, die ich kannte. Ich bin früh nach Hause gegangen, ich hatte das Gefühl, da nicht hinzugehören, ich war unruhig. Jetzt erinnere ich mich sehr deutlich an diesen Abend. Ich weiß noch, wer damals dort war, mit wem ich gesprochen habe, zum Beispiel bin ich Jenny begegnet, die im Friseursalon in Lasel gearbeitet, dort aber aufgehört hatte, wonach ich sie aus den Augen verlor, und bei der Feier war sie eine der Kellnerinnen. Ich weiß noch, was ich gegessen habe, die Gespräche mit den Brüdern von Johannes habe ich fast wörtlich in Erinnerung, ich sehe noch, mit wem ich draußen geraucht habe. Ich habe die Bäume und Sträucher rings um das ehemalige Rathaus gesehen, ich habe den frischen Septembergeruch geschnuppert, ich sehe mich selbst auf dem Weg nach Nimshuscheider Mühle und schließlich nach Schwarzbach, ich schnalzte mit der Zunge den Pferden zu, dunklen Flecken auf der Weide. Ich atmete ein und aus, ich ging weiter bergab.
An den darauffolgenden Tagen fing das Elend an. Ich glaube, mir war klar, dass ich nicht gut auf das Antidepressivum reagierte, das ich nun wieder nahm. Für mich selbst bezeichnete ich es als Panik, obwohl ich verstandesmäßig nicht in Panik geriet; ich wusste ja, dass dergleichen passieren konnte. Es kommt regelmäßig vor, dass Menschen, die ein abgesetztes Antidepressivum erneut einnehmen, erst einmal – kurze Zeit – weiter abrutschen, bevor das Medikament anschlägt. Ich jätete Unkraut in der Einfahrt und sagte zu mir: Mach einfach weiter, das geht vorbei, dieses schreckliche Gefühl wird verschwinden. Mitte September fuhren Henk, Pauline und ich zum Gästehaus St. Gregor in Plankstetten. In der Hoffnung, dass alles gutgehen würde.
Ich hatte kurz vor Johannes’ Geburtstag wieder mit der Einnahme angefangen, weil ich mich nicht so besonders fühlte, um es der Einfachheit halber so auszudrücken. Bei einem Besuch beim Therapeuten – den ich auch manchmal monatelang nicht sehe oder spreche – waren wir zu dem Schluss gelangt, dass bei mir wieder Symptome einer Depression erkennbar waren. Im Juli war etwas passiert, das mich ziemlich fertiggemacht hatte. Ich bekam in der Eifel Besuch von einer manischen Freundin. Sie blieb sechs Tage. Es war nicht auszuhalten. Sie war derart manisch, dass sie vollkommen selbstsüchtig war. Ich versuchte, sie wegzuschicken, ihr klarzumachen, dass sie in ihrem Zustand unmöglich bei einer anderen Person sein konnte, weil das für diese andere Person schlicht unzumutbar war. Das gelang mir natürlich nicht, sie reagierte mit Weinen und Wut auf mich. Sie meinte, ich kapiere einfach gar nichts, und sie fühlte sich unendlich weit über mich erhaben. Mich, ihren Gastgeber.
Gleichzeitig war die Deutsche Dogge Elvis bei mir zu Gast. Das fand ich immer schön. Elvis ist ein unglaublich lieber, anhänglicher Hund, der keiner Fliege etwas zuleide tut und den man außerdem sehr gut ohne Leine laufen lassen kann, weil er immer hört, wenn man ihn ruft. Bis zu dieser Woche. Er schnappte sich ein Schaf. Und zwar nicht irgendwie, sondern so, als wüsste auch ein Hund, der noch nie einen Menschen oder ein anderes Tier gebissen hat, ganz genau, wie man es machen muss, mit einem Biss in den Hals. Um zu töten. Das Schaf hat letztlich überlebt, was aber erst nach Wochen und etlichen hundert Euro an Tierarztkosten feststand. Da hatte ich also diese unmögliche Freundin am Hals, die mir alle Energie raubte, ohne es zu merken, denn sie selbst fühlte sich ja großartig, und wie es mir ging, interessierte sie nicht einen Moment, und außerdem einen Schafkiller, an dessen Fang langsam das Blut trocknete. Der Hund musste weg, ich konnte ihn nicht mehr sehen. Das kostete noch einiges an Nerven. Elvis’ Herrchen dachte nicht daran, seinen Italienurlaub abzubrechen, um mich zu erlösen. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann weinend mit meiner Mutter telefoniert habe. »Er weint deswegen!«, rief sie meinem Vater zu, der wahrscheinlich gerade auf seinem Stuhl am Fenster De Telegraaf las. Schließlich verschwanden sowohl die Freundin als auch der Hund (ein Neffe aus den Niederlanden holte ihn ab, an einem Tag mit 35 Grad Hitze, in einem Kleinbus ohne Klimaanlage), und ich blieb reichlich mitgenommen zurück.
Wenn ich aber daran zurückdenke, wer ich im vergangenen Sommer war, wie ich mich bis Anfang September fühlte, dann verfluche ich den Tag, an dem ich die erste Vierteltablette Escitalopram eingenommen habe. Das habe ich gemeint, als ich weiter oben von dem Wissen um das Warum meines Zustands geschrieben habe.
»Es ist kein Paracetamol«, sagte einer der drei Männer, denen ich gegenübersaß, als ich beim Krisendienst gelandet war. Ich weiß nicht mehr, wann genau das war, irgendwann im Oktober.
»Das ist mir bewusst«, antwortete ich ganz ruhig. »Ich habe schon öfter wieder mit einem Antidepressivum angefangen.«
Die Leute vom Krisendienst machen übrigens ihre Sache gut, muss ich sagen. Drei Männer, die einen aufmerksam beobachten, jeder auf seine Weise, dem jeweils eigenen Fachgebiet entsprechend, während man selbst mutterseelenallein auf der anderen Seite des Tisches sitzt und redet. Es war in der Eerste Constantijn Huygensstraat, und offiziell heißt es Psychiatrischer Notdienst Amsterdam. Ich war ruhig; am Vortag – als der Therapeut morgens, noch bevor ich zum zweiten Mal zu ihm fuhr, alarmiert von meinem ersten Besuch unmittelbar nach dem Urlaub, den Termin für mich ausmachte – hatte ich einen guten Tag gehabt, und am Morgen vor meiner Fahrt zum Krisendienst hatte ich natürlich ein Alprazolam eingenommen. Das Gespräch verlief deshalb ausgesprochen ruhig und rational, und die drei Männer kamen zu dem Schluss, dass »keine Gefahr« bestand. Als ich nach Hause radelte, dachte ich: Ich bin wieder da. Dieses Gefühl hielt sich nicht den ganzen Tag. Vor allem nicht, nachdem einer der drei Männer sich später noch telefonisch bei mir meldete und erklärte, dass ich falls nötig jederzeit, Tag und Nacht, anrufen könne.
(Monate später bekam ich eine Rechnung von meiner Krankenversicherung, aus der hervorging, dass ich mit dem Besuch beim Krisendienst auf einen Schlag die Grenze für nicht unbedingt notwendige Leistungen überschritten hatte. Die Viertelstunde in dem kleinen Zimmer – plus einer Dreiviertelstunde, die ich in einem großen, offenen Raum zwischen anderen, ebenfalls unmittelbar Hilfsbedürftigen gewartet hatte – kostete insgesamt 1350 Euro.)
Dass man durch die Einnahme eines Antidepressivums eine lähmende Depression bekommen kann. Das ist schrecklich, andererseits aber auch etwas, woran man sich festhalten kann. Man kann sich sagen: Ich bin oder tue das nicht selbst, es wird durch eine chemische Substanz verursacht. Es ist etwas außerhalb meiner selbst. Das wäre vergleichbar mit dem, was Matt Haig einmal getwittert hat, vermutlich aus dem Buch über seine Depression, Reasons to stay alive: »Always, [depression] is smaller than you, even when it feels vast. It operates within you, you do not operate within it. It may be a dark cloud passing across the sky, but – if that is the metaphore – you are the sky. You were there before it. And the cloud can’t exist without the sky, but the sky can exist without the cloud.« Er fühlt sich gezwungen, auf Metaphern zurückzugreifen.
Es gab noch einen vierten Moment der Erleichterung. Nachdem ich die Lesungen in Deutschland abgesagt hatte und mit aller Macht versuchte, das Schuldgefühl deswegen zu unterdrücken (»Ich muss überhaupt nichts«), meldete sich irgendeine Deutsche auf Twitter zu Wort. Auf Twitter kann einem jeder folgen und kann und darf jeder alle Arten von Ansichten über einen äußern. Sie verfasste gleich zwei Tweets mit dem Verweis @gerbrandbakker, damit ich sie nur ja zu Gesicht bekam. Der erste: »Ich habe mich auf nichts so gefreut wie auf die Lesung in Karlsruhe am 16.11. Mein Ticket nach Karlsruhe ist seit 3 Wochen gekauft, ich habe eine Übernachtung gemietet, und jetzt fällt Ihre Lesung aus. Ich bin so enttäuscht.« Und der zweite: »Ich habe mich auf nichts so gefreut wie auf die Lesung am 16.11. in Karlsruhe. Frei genommen, Zugticket, Übernachtung gebucht. Jetzt fällt sie aus. Das gibt es doch echt nicht. WARUM?« Ich habe die Tweets an einem Abend nach ein paar Gläsern Wein entdeckt. Abends, also dachte ich: morgen. Morgen ist alles wieder gut, ich kann mich doch nicht jetzt so fühlen und morgen nicht mehr. Zum Glück habe ich nicht geantwortet, zum Glück habe ich mich zurückgehalten. Ich hoffe, dass sie diese Zeilen liest. Ich hoffe, dass sie sich schämt. Andererseits: Für sie war es ja beschissen, unerfreulich oder zum Kotzen, dass sie die Fahrkarte schon gekauft hatte. Die »Erleichterung« verdankte sich der Wut, die ich empfand. Etwas fühlen, egal was.
– 6 –
Am Dienstag, dem 7. Juli 2016, habe ich bei Freunden in Haarlem zu Abend gegessen. Wir aßen spät, das bin ich von diesem Haushalt gewöhnt, und es macht auch nichts, weil die Zeit bis zum Essen mit Chips und Dauerwurst und Whisky gefüllt wird. Sjoerd kochte, es gab Chili con carne. Mariska mag das nicht, ebendeshalb kochte Sjoerd. Es war gemütlich, es war angenehm, es war vertraut. Mariska machte ein Foto von mir, ein schönes Foto, ich sehe entspannt aus, und ich hatte – das habe ich später auch selbst gesehen – schöne Sachen an. Sie postete das Foto auf Facebook, ohne mich zu fragen.
Um ein Uhr in der Nacht bekam ich Bauchschmerzen. Erst schlief ich wieder ein, später musste ich raus. Ich kotzte wie ein Reiher. Danach legte ich mich wieder hin. Um fünf Uhr konnte ich nicht mehr. Es hatte sich in eine Art von Schmerz verwandelt, für den das Wort »krepieren« erfunden worden ist. (Übers Italienische vom lateinischen crepāre, »klappern, knattern, knallen«. Wahrscheinlich nach dem Aufplatzen von verwesenden Leichen.) Ich weckte meinen Neffen Casper, der in Amsterdam studiert und bei mir wohnt, und bat ihn, Hilfe zu rufen, egal wo und von wem. Das hat er ganz toll gemacht. Ich stützte mich gekrümmt mit den Händen auf die Arbeitsplatte in der Küche. Als um halb sechs Rettungssanitäter eintrafen, wälzte ich mich in meiner beschmutzten Unterhose – ich hatte nicht nur gekotzt, sondern auch mehr oder weniger unkontrolliert Darminhalt von mir gegeben – auf dem Teppichboden im Wohnzimmer. Plötzlich stand ein Eimer vor meiner Nase, ich übergab mich erneut und sagte: »Geht schon wieder.« Darüber haben Casper und ich später noch herzlich gelacht. Ich wollte, dass die Sanitäter wieder gingen. Als ich auf der Fahrtrage lag und auf die Galerie gerollt wurde, kam gerade meine Nachbarin aus ihrer Wohnung. Sie ist Straßenbahnfahrerin und hat manchmal eine sehr frühe Schicht. Prompt lief sie gegen die Trage. »Hab ich mich erschrocken!«, rief sie. Ich sagte nichts, ich hatte mich ganz in die Hände der Sanitäter gegeben.
Man brachte mich zur Notaufnahme des Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Da habe ich den lieben langen Tag gelegen. Eine Notaufnahme ist nicht der allerschönste Ort dafür. Man liegt da vor aller Augen, es herrscht Unruhe, alles und jeder kommt vorbei. Manchmal habe ich übrigens nicht gelegen, dann hatte ich so schreckliche Schmerzen, dass ich aufstehen und mich zusammenfalten musste. Und immer wieder musste ich mich übergeben. Eine Reihe von Untersuchungen wurde vorgenommen, ich wurde geröntgt und was weiß ich noch, man schmierte mir Gel auf den Bauch und bewegte darauf ein Gerät hin und her wie bei einer Schwangeren, und wenn ich mich recht erinnere, hat man mich auch durch ein MRT-Gerät geschoben, nachdem ich einen Liter von einer fiesen Flüssigkeit hatte trinken müssen. Nur, wo soll man einen Liter fiese Flüssigkeit unterbringen, wenn vom Magen an alles verschlossen ist (was zu dem Zeitpunkt allerdings noch niemand wusste)? Irgendwann kam auch Casper und brachte eine Jogginghose, mein Telefon und noch alles mögliche andere. Ich war geistesgegenwärtig genug, meinem Verlag Bescheid zu sagen, dass ich am nächsten Tag höchstwahrscheinlich nicht nach Skopje würde fliegen können, um dort bei der Vorstellung der mazedonischen Ausgabe von Oben ist es still anwesend zu sein.
Gegen Ende des Tages sagte mir jemand mit ernster Miene, dass ich sofort operiert werden müsse, man habe andere Operationen dafür verschoben. »Sie werden höchstwahrscheinlich mit einem Stoma aufwachen«, sagte er. Ich glaube nicht, dass ich etwas erwidert habe, ich stand gerade wieder zusammengefaltet neben der Liege. Vorher hatte ich schon eine Krankenpflegerin gebeten, mir endlich etwas gegen die Schmerzen zu geben. »Aber Sie haben schon ganz viel bekommen«, antwortete sie. »Davon merke ich nichts«, sagte ich. Ich war vollkommen mürbe. Man rollte mich zu einem OP, wo man mich auf den Operationstisch hob. Der war angenehm warm. Ich gab dem Chirurgen und noch einigen anderen die Hand und schluckte ohne Murren einen Schlauch. Ich sah meine beschmutzte Unterhose. Ohne dass jemand irgendetwas zu mir gesagt hätte, war ich weg. Ich meine, ohne so etwas wie Runterzählen. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie im Krankenhaus gelegen, ganz zu schweigen von Operationen. Ich hatte angenommen, dass zum Narkotisiertwerden etwas mehr Zuwendung gehörte. Ungefähr zwei Stunden später kam ich im Aufwachraum wieder zu mir. Ich lag auf der Seite. Eine unglaublich liebe Krankenpflegerin sagte, ich müsse jetzt wach bleiben. Ich begriff nicht, warum die Frau nicht Deutsch sprach. Außerdem dachte ich, dass die Operation noch bevorstand. Eine halbe Stunde später lag ich in einem Zimmer mit drei anderen Leuten, darunter eine Frau aus Flandern, die sich die Brust hatte verkleinern lassen. Später habe ich mich noch manchmal gefragt, warum sie in der Gastroenterologie lag. Durch vorsichtiges Tasten stellte ich fest, dass ich kein Stoma hatte.
Ich lag vollkommen zufrieden in diesem Zimmer. Auf die Idee, jemanden anzurufen, kam ich gar nicht erst. Aus unerfindlichen Gründen hat auch Casper, der am Donnerstag wiederkam und mir noch mehr Sachen brachte – ein Buch, mein Portemonnaie, frische Unterhosen –, niemanden angerufen. Ich aß sehr leckere Frikadellen, während die drei anderen im Zimmer nichts aßen und sich immer wieder übergaben. Ich sah Mauersegler am Fenster vorbeisausen, draußen war richtig schönes Wetter. Sommer. Ich schlief, wenn ich schlafen wollte, lag die halbe Nacht wach, und ich war so unglaublich zufrieden. Keine Schmerzen mehr. Man brachte die Morphinpumpe, die neben meinem Bett stand, wieder weg, weil ich sie nicht benutzte. »Sie müssen sie auch benutzen«, hatte eine Krankenpflegerin gesagt. »Sonst nehme ich sie mit.« Und ich war so zufrieden und glücklich. Schläuche wurden aus meiner Nase und aus meinem Schwanz entfernt. Es tat nicht weh. Ich sah Berichte von der Tour de France in dem kleinen Fernseher. Ich bekam mein Citalopram, offenbar hatte jemand darauf hingewiesen, dass ich das einnahm. Ich setze es ab, dachte ich. Ich bin jetzt doch so zufrieden. Hin und wieder schlurfte ich durch den Gang zum Aufzug, setzte mich in den Innenhof, rauchte und sprach mit anderen Rauchern, alle mit schlimmeren und noch viel schlimmeren Krankheiten. Und dann bekam ich doch noch Besuch. Erst am Donnerstagabend oder Freitag rief ich meine Mutter an. Und fragte, ob ich mich bei ihnen von der Operation erholen könnte. Ich hatte eine lange Operationsnarbe am Bauch, das Gehen fiel mir schwer, die Genesung würde noch Wochen dauern, Bauchoperationen sind schwere Operationen. »Ha, das wird schön«, sagte meine Mutter.
In Wieringerwaard schrieb ich eine Kolumne für De Groene Amsterdammer, der ich den Titel »Schamloser Verarbeitungstext« gab:
Montag, 11. Juli 2016. Wieringerwaard. Ich liege im Garten. Auf einem sehr schweren, hölzernen Liegestuhl, den mir mein Bruder hingestellt hat. Ich darf nämlich keine schweren Gegenstände heben oder schleifen. Es weht ein heftiger Wind. Mir fallen allerhand Dinge auf. Zum Beispiel: Wenn man unter einer Blutbuche liegt, sieht man nicht, dass die Blätter rötlich sind. Es könnte genauso gut eine Rotbuche sein. Ich höre die leisen Laute der Zwerghühner meines Vaters in ihrem Auslauf weit hinten im Garten. Da, wo es immer dunkel ist, wegen der viel zu stark gewucherten Linden. Linden, über die vor Kurzem jemand zu meinem Vater gesagt hat, dass sie eigentlich auf die Liste der Naturdenkmäler gehören. Das halte ich für reichlich übertrieben, diese Linden sind mindestens fünf Jahre jünger als ich, vielleicht sogar zehn. Ich frage meine Mutter, ob Zwerghühner keine Sonne mögen. »Ich glaube doch«, antwortet sie. »Tja, die kriegen sie nie zu sehen.« Sie legen gut, auch wenn die Eier klein sind. Zwei von diesen Eiern habe ich schon gegessen. Es ist also nicht mein eigener Garten, in dem ich liege. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt jemals in meinem eigenen Garten gelegen hätte. Außerdem liege ich in diesem Garten – hinterm Haus, geschützt vor dem unbarmherzigen Westwind –, weil es sein muss oder zumindest im Moment empfehlenswert ist.
Gestern Abend, nach dem Essen, habe ich auch hier gelegen. Auch da stürmte es, noch heftiger als heute, und es war deutlich kälter. Ich hatte mich mit einer kleinen Bettdecke zugedeckt. Und ich dachte, wie verdammt angenehm es doch ist, einfach so unter einer warmen Bettdecke in einem kühlen, von wildem Zweiggepeitsche überkuppelten Garten zu liegen. Ansonsten tat ich nichts. Ich glaube, ich wollte ein bisschen dösen, aber daraus wurde nichts. Ich blickte mich um und vor allem nach oben. Dort taumelten Möwen durch die Luft, Tauben fegten wie Kanonenkugeln vorbei, Mauersegler wurden vom Wind gepackt und zurückgeworfen. Der einsame Nadelbaum fing über das Haus hinweg noch etwas Sonne ein, die Lindenblätter hinten im Garten wechselten blitzschnell von hellgrün zu grau und zurück. Und ich dachte nach. Ich dachte, dass das Wort »sinnieren« eine bessere Umschreibung sei. Ich sinnierte über die neue Küche, die ich in der Eifel haben will. Jetzt endgültig. Wenn einem etwas Unerwartetes widerfahren ist, vor allem wenn es mit Krankenhäusern und gefährlichen Operationen und Man-kann-nie-sicher-sein-dass-man-aus-der-Narkose-erwacht zu tun hat – so sinnierte ich –, dann macht man sich nicht so große Gedanken darüber, ob eine neue Küche fünftausend oder zehntausend Euro kostet. Ich beschloss auf der Stelle – der Wind packte sich gerade den Hängekorb mit fröhlich bunten Sommerblumen –, bei der Anschaffung der Küche nicht knauserig oder ängstlich zu sein. Mir wurde schwer ums Herz, weil ich plötzlich an Dachdecker Rudi denken musste, in seinem kalten Grab in Lasel, von dem die Blumensträuße jetzt wohl entfernt sein werden, und anschließend an Jasper und an Lure, das Hündchen von Gartenkumpel Han und seiner Frau Trijntje, das gestern die Spritze bekommen hat, und in einer Sinnierpause schickte ich Freund Henk eine Nachricht: Wie viel doch in einem Menschenleben geschieht! Etwas später, ich sinnierte schon wieder, antwortete Henk – der gerade von einer schrecklichen Beerdigung zurückgekommen war –, er könne mir nur zustimmen.
Ich sinniere sonst nie. Ich kann es nicht, oder erlaube es mir nicht. Es gefiel mir. Ein Vogel schiss mir auf den Kopf, eine Meise vermutlich, es war nur ein winziges Häuflein. Durch Gesten versuchte ich meinem Vater hinter der verglasten Schiebewand mitzuteilen, dass ein Vogel mir auf den Kopf gemacht hatte, aber er verstand mich nicht. Es ist ziemlich schwierig, jemandem ohne Worte deutlich zu machen, dass einem ein Vogel auf den Kopf gemacht hat. Darüber sinnierte ich. Vielleicht ist Sinnieren genau das: Sehr wichtige Dinge werden verweht wie die Blütenblätter einer verblühten Rose von einem für die Jahreszeit ungewöhnlich heftigen Wind, während kleine, unbedeutende Dinge so viel Gewicht bekommen, wie man es nie für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel, dass es schreckliche und weniger schreckliche und nicht schreckliche Beerdigungen gibt. Abhängig vom Alter des Verstorbenen, dem Grad der Zuneigung und Nähe, der manchmal fragwürdigen Notwendigkeit, gewisse Beerdigungen zu besuchen, und wahrscheinlich noch ein paar anderen Faktoren. Darüber hatte ich nie nachgedacht. Ein dicker Ast brach von einer Pappel ab, glücklicherweise wurde er nicht zu mir hin geweht. Dass man vom Grundstück meines Bruders aus die mächtige Blutbuche hinterm Haus meiner Eltern sieht, während ich jetzt, direkt unter dem Baum, beim besten Willen keine Blutbuche darin erkennen kann.
Meine Mutter bringt mir einen Becher Tee. Gerade heute muss ich sehr aufpassen, wie viel ich trinke, denn ich habe Durchfall. Das sollte nicht sein, aber ich kann es erklären. Heute Morgen habe ich allzu gierig zwei Magnesiumtabletten geschluckt, obwohl das gar nicht nötig war, und plötzlich fällt mir ein, was eine Krankenpflegerin mir gesagt hat: »Nehmen Sie diese Magnesiumtabletten, solange Sie noch Morphin nehmen, aber passen Sie auf, dass Sie keinen Durchfall bekommen.« Ich habe kein Morphin mehr, und meine Verdauung war gut, warum also trotzdem die Magnesiumtabletten? Selber schuld. Eine andere Krankenpflegerin sagte, meine Sauerstoffsättigung sei für einen Raucher erstaunlich gut. Aha, dachte ich, stur weiterrauchen. So sinniere ich vom einen zum anderen und habe alle eingespielten Abläufe in diesem Haus durcheinandergebracht, was aber niemandem etwas auszumachen scheint. Drinnen läuft schon wieder der Fernseher, die Tour-Fahrer verlassen heute die Pyrenäen. Niemals werde ich die engelhafte Frau im Aufwachraum des OLVG vergessen. Niemals. Ich sinne viel über sie nach (natürlich ist Sinnieren auch dafür gut, Erlebtes zu verarbeiten und einzuordnen), vielleicht auch, weil ich versuche, etwas zurückzuholen, vielleicht, um den Chirurgen, der mein Gedärm aus der Bauchhöhle hervorgeholt hat, meinen Erinnerungen hinzufügen zu können, besonders, nachdem meine Schwester heute Morgen zu mir gesagt hat, es sei eine Schande, dass ich nie mehr mit diesem Chirurgen gesprochen habe, und ich Mitleid mit ihm bekam, weil ich ihn vielleicht einfach vergessen hatte. Sinnieren. Der Engel im Aufwachraum sprach Niederländisch mit mir. Warum spricht diese Frau nicht Deutsch?, dachte ich immer wieder. Sprich doch einfach Deutsch! Außerdem dachte ich: So ist es also, wenn man operiert wird? Zuerst die Hölle, dann wird man von einem Moment auf den nächsten ausgelöscht und kommt in einer Art Limbus wieder zu sich, einem unbeschreiblich schönen Limbus, wo alles piept und singt und seltsamerweise niemand Deutsch spricht. Ich habe mich an das Gewand dieses Engels geklammert, bis jemand anders mich zur Station rollte. »Loslassen, Herr Bakker«, sagte jemand, ich weiß nicht, wer. Sinnieren. Loslassen. Neue Küche. Vogelkacke und ein abgebrochener Pappelast. Wie unglaublich viel doch in einem Menschenleben geschehen kann.