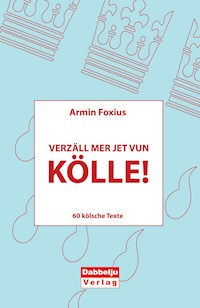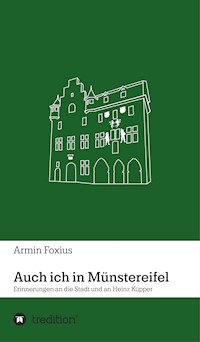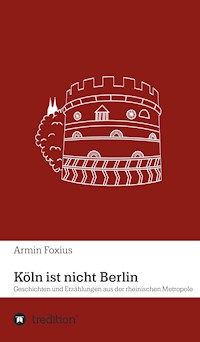
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurze Texte über das Köln unserer Tage. Zupackend und pointiert. Die rheinische Metropole in ihrer Vielfalt, mit ihrem Charme, aber auch in ihrer Widersprüchlichkeit. So etwas wie Heimat. "Glücklich die Stadt, die einen Chronisten wie Armin Foxius hat." (Heinz Küpper, Schriftsteller)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Armin Foxius
Köln ist nicht Berlin
Geschichten und Erzählungen aus der rheinischen Metropole
© 2018 Armin Foxius
Verlag & Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:978-3-7469-5362-5
Hardcover:978-3-7469-5363-2
e-Book:978-3-7469-5364-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Zwei Studentinnen in einer Berliner S-Bahn.Die eine: Kommst du aus Neu-Kölln?Die andere: Nä! Aus Richtig-Köln.
Vorbemerkung
Berlin ist nicht Köln. Das wäre ja noch schöner.
Wir wollen uns die Menschen, die mit dieser Stadt hier zu tun haben, einmal anschauen. Wie sie so daher kommen und sich geben. Ich habe das mal aufgeschrieben.
Köln ist eine deutsche Millionenstadt. Sie war im Mittelalter die größte Stadt nördlich der Alpen. Sie ist die einzige deutsche Stadt, die über 2000 Jahre, seit den Römern, bedeutend und eine Großstadt ist.
Sie war nie auf Dauer Hauptstadt von irgendwas. Warum auch? Im Selbstbewusstsein ihrer Bürger hatte sie das gar nicht nötig. So ist das bis heute. Man war und ist eben: KÖLN.
„Bei Durchsicht meiner Bücher“. So nannte der große deutsche Schriftsteller Erich Kästner 1946 einen Auswahlband seiner bisherigen lyrischen Werke. Der war nötig geworden, weil auch seine Bücher 1933 von den Goebbels-Schergen in Berlin auf dem damaligen Opernplatz gegenüber der Universität verbrannt worden waren.
Mir gefiel der Titel schon immer gut. Ich will mich natürlich nicht mit Kästner und seinem Hintergrund vergleichen. Aber ich mache, was das Auswählen angeht, Ähnliches.
Ich habe meine Bücher durchgesehen, wie es auch ein bilanzierender Kaufmann tut. Ich bin meine bisherigen Bücher durchgegangen, und weitere Publikationen, hier und da und dort, in Zeitschriften, Anthologien, Gelegenheits- und Auftragsarbeiten. Alles Texte, die sich mit Köln und dem Rheinland befassen oder damit in Beziehung stehen. Einige Texte spielen im Gebiet der ehemaligen preußischen Rheinprovinz; dies ist wiederum eine Verbindung zu Berlin.
Es ist ein Sammelsurium geworden, eine Ansammlung von hochdeutschen Texten; was ich betonen muss, da ich ja auch im kölschen und rheinischen Dialekt schreibe.
Die Texte sind nicht chronologisch nach Erscheinungsdatum geordnet oder in Themengruppen zusammengefasst, nein, ich habe sie, wie schon in meinem Bändchen mit rheinischer Lyrik geschehen, alphabetisch sortiert, wie die Überschriften eben anfangen. So entstehen reizvolle und teilweise wunderliche Nachbarschaften.
Am Ende jeden Textes steht das Jahr der Erstveröffentlichung oder der Verfertigung (in Klammern).
Dieses Buch ist ein Loblied auf diese Metropole am Rhein. Aber es kann sein, dass sie es nicht merkt.
Einige kurze Anmerkungen zu einzelnen Texten:
Die Kölner Ringe ist ein erläuternder geschichtlicher Abriss als Anhang zu einem Fotokalender von Schülern der Ursula Kuhr-Schule in Köln-Heimersdorf.
Gestapo-Keller im EL-DE-Haus – Dies ist die Collage einer Auswahl von Wandinschriften in diesem Kölner Gestapo-Keller im Herzen der Stadt. Ich habe die Inschriften thematisch sortiert. Sie sind unkommentiert.
Kölnische Anekdoteaus den Zeiten römischer Besetzung lehnt sich parodierend an Heinrich von Kleists berühmten Text „Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege“ an.
Quasi ein Nachwort– Als solches fungiert hier eine Rede des Schriftstellers, meines ehemaligen Deutschlehrers und Freundes Heinz Küpper, die er anlässlich der Vorstellung meines Buches „Dom mit Balkon“ 2003 in Kölner studio dumont hielt.
Quirinus von Malmedy– Dieser Text ist einer der ersten, der von mir veröffentlicht wurde. Eine Übung in ironischem Umgang mit Frommem.
Malmedy im heutigen Ostbelgien ist eine Klostergründung durch den Kölner Bischof Kunibert. Jahrhundertelang gehörte Malmedy zur Erzdiözese Köln, politisch von 1815 bis 1918 zu Preußen.
Der Text ist eine Hommage an „Der Erwählte“ von Thomas Mann. Und eine Erinnerung an den Deutschunterricht bei Heinz Küpper, in dem wir den „Gregorius“ des Hartmann von der Aue behandelten.
Ursula Kuhr– Zwei Texte sind dieser vorbildlichen Kölner Lehrerin gewidmet, die sich als Schutzschild vor die ihr anvertrauten Schüler stellte und von einem Amokläufer getötet wurde. – Der erste Text wurde für den offiziellen Internet-Auftritt der nach ihr benannten Hauptschule im Kölner Norden geschrieben. Der zweite gibt den vom Autor verfassten Text der Gedenkplakette am Attentatsort am Gebäude der ehemaligen Volksschule in Köln-Volkhoven wieder. Der Text wird erläutert und begründet.
Besonders zu danken habe ich
–der Journalistin und Autorin Monika Salchert für ihr Vorwort,
–meinem Sohn Alexander für die Cover-Gestaltung (nicht nur dieses Buchs) und seine wertvollen Hinweise,
–Frau Christine Kolb und ihrem Schreibbüro für Textgestaltung, Layout und viele Hilfen.
Köln, im August 2018
Armin Foxius
Vorwort
„Schreib das auf, Foxius!“ – Ja, ich weiß, der Satz gehört zu Egon Erwin Kisch. Der „rasende Reporter“ war und ist Vorbild, Vordenker und Vorschreiber für Generationen von Journalistinnen und Journalisten. Seine Arbeit folgte einer ebenso einfachen wie genialen Formel. Er konnte zuhören, beobachten und einordnen.
Genau das zeichnet Armin Foxius aus. Auch er verschmilzt mit seiner Umgebung, wird eins mit der Handlung, saugt und klaubt alles auf, was der Alltag ihm serviert. Seine Momentaufnahmen präsentiert er uns in seinem Buch „Köln ist nicht Berlin.“
Seine Sprache ist glasklar, schnörkellos und immer wieder überraschend. Kaum eine Geschichte endet so, wie es zu Beginn scheinen mag. Mein Favorit ist der Drehorgelspieler auf der Schildergasse. Hier zeigt sich eine weitere Stärke des Autors. Er liebt Menschen. Vor allem die mit den Ecken und Kanten. Die mit den schrägen Lebensläufen. Die, die an der Kante der gesellschaftlichen Normen balancieren und bei denen niemand sagen kann, ob und wann es kippt.
Armin Foxius ist zwar anders als sein Vater kein Journalist, sondern Lehrer. Aber er ist Kisch näher als manch einer, der diese Berufsbezeichnung via Visitenkarte ungefragt verbreitet. Ach ja, noch eins: Foxius fängt seine Leser mit klugem und feinsinnigem Humor, er verzichtet auf brachiale Auswüchse mit Schenkelbrecher-Qualität.
Danke dafür. Und für die „Drei Musketiere“.
Monika Salchert
Die Texte
Also: Eigentlich
Das „Garmisch-Partenkirchner Tagblatt“ vom 6. August 2003 meldet im Teil „Lokales München“: „Kaufingerstraße gut besucht“. Eigentlich. Stellt dann fest: „Die Kaufingerstraße liegt unter den am häufigsten besuchten Einkaufsmeilen Deutschlands auf Platz zwei.“
Und muss dann zugeben: „Die Innenstadtstraße muss nur der Schildergasse in Köln den Vorrang geben.“
In eben dieser Straße steht eines Nachmittags, nein, „steht“ ist falsch, tanzt, hampelt, beugt sich vor und zurück, wirft den Kopf nach hinten, fuchtelt mit dem rechten Arm, mit dieser Hand, die einen Bogen führt, einen selbstgemachten Geigenbogen, mit faseriger Kordel bespannt, sticht damit zu, haut in die Luft, wedelt, weist, nimmt ihn als Florett, Brechstange und Baseballschläger, und führt ihn dann über die Saiten seiner Geige, lauscht in deren Korpus, in sich hinein, er schreit und bellt Worte, Liedfetzen, lacht, kölscht, schaut die Leute wie lieb an, schaut zwischendurch in eine aufgeschlagene dicke Kladde, mit handgeschriebenen Texten, auf der Schildergasse also tobt ein Irrwisch mit lichten Locken, einem Bart, einer Brille mit runden Gläsern, einer verspeckten Weste, kurz: Klaus der Geiger spielt auf.
Er ist der bekannteste Straßenmusiker, nicht nur hier und in der Region. Kein alternatives Ereignis ohne ihn, und das seit zwanzig, dreißig Jahren. Er hat den größten Zulauf, seine Zuhörer und Zuschauer blockieren die Schildergasse in ganzer Breite, sie sind, wie bei der Altersangabe bei „Mensch ärgere Dich nicht“, zwischen drei und neunundneunzig.
Seine Texte sind die der Aufmüpfigkeit und der Rebellion gegen die schreienden Ungerechtigkeiten in dieser Welt, die ekligen Nickligkeiten der kleinen Drecksäcke in der Nähe. Bei Jüngeren kommt das direkt an, Ältere und Alte zucken zurück, bleiben aber doch stehen, weil sie Klaus der Geiger kennen, weil sie fasziniert sind von diesem Rumpelstilzchen.
Ja, und dann kommt der Auftritt der älteren Damen aus dem Kölner Bürgerturm, die eigentlich abgestoßen vorbeieilen müssten. Tun sie aber nicht. Ihr Auftritt beginnt, wenn andere sich über den Straßenmusiker mokieren. Dann heben sie an und beginnen so, mit Leuchten in den Augen:
Also: Eigentlich heißt der Mann Klaus von Wrochem, und er ist ein richtiger Geiger, mit Examen, der hat Konzerte gespielt, der kennt die Podien der Alten Welt!
Und dieses Wissen und dieses Preisgeben lässt die Damen triumphieren: Das, was so proletarisch und plebejisch, ja, ordinär daherkommt, ist gar nicht das Eigentliche, nein, nein, das ist nur sowas, das anderes, wohl das Richtige verbergen soll.
Klaus der Geiger hat Fans, die er vielleicht eigentlich nicht will.
Also: Eigentlich wissen wir auch das nicht.
(2003)
Auf großer Fahrt
Mit der Vorgebirgsbahn unterwegs
Es ist eine Fahrt durchs Herz in einem jetzt fast unbekannten Land, vor nicht allzu langer Zeit, also in der alten Bundesrepublik.
Man wusste vom Ruhrgebiet, dessen Kohle man herausbrach und wo man Stahl kochte, dann von der evangelischen Tiefebene im Norden und dem schwarzen Block im Süden, und dann vom Osten; na ja, dem stellte man Kerzen ins Fenster.
Hier aber war die rheinische katholische Republik zu Hause.
km 0,0 Köln, Barbarossaplatz
Hier war der Kopfbahnhof der Köln-Bonner Eisenbahn durch Ville und Vorgebirge. Mit der KBE von der ehemals freien Reichsstadt in die ehemalige Residenz der Kurfürsten, Bonn. Der große Turm mit dem segelartigen Schwalbendach steht noch, Landmarke in der Stadt. Die Schalterhalle mit Warteraum und Gaststätte ist jetzt McDonald’s. Die Linie 18 rauscht zweigleisig vorbei und hat die Aufgabe der Vorgebirgsbahn übernommen. Ein totes Gleis liegt überwuchert. Über eine Weiche ist es aber mit dem Schienenstrang verbunden. Bei Mäckes hängt eine Nährwerttabelle in Form eines Fahrplans.
Hier kamen die Bäuerinnen aus der Ville mit Kiep und Körben an, voll Kappes und Schavur. Hier kam in der Ubier- und Römerzeit das frische Quellwasser aus der Eifel an, hergeführt in einer gemauerten Leitung mit ständigem Gefälle von 1 %.
km 3,0 Köln-Klettenberg
Als die Läden noch um halb Sieben schlossen, und samstags um Zwei, konnten die Klettenberger und Sülzer im KBE-Bahnhof noch einkaufen. Das sah man als nah an und nicht weit weg wie den Hauptbahnhof.
km 4,7 Efferen
Ein Bahnhofsgebäude mit Gaststätte, kein Bahnhof mehr, ein Haltepunkt noch. Reiche römische Bürger hatten hier ihre Kammergräber, im Mittelalter unterhielt man am Duffesbach Mühlen und Schleifkotten. Bis vor Kurzem hatte RTL in der Nähe Studios.
km 6,3 Hürth-Hermülheim
Unsere Gleise sind vom Bahnhof weggerückt, dazwischen hat die DB ihre Trasse. Die große Bahn hält hier nicht.
km 8,2 Fischenich
In sichtbarer Ferne sieht man in feiner Linienführung die sich aus der Ebene entwickelnde Ville.
km 10,6 Vochem
Auf einem Nebengleis stehen vermodernde Güterwagen und ein alter Triebwagen der KBE.
km 11,7 Brühl-Nord
Ein kleiner Bahnhofsbau aus Backsteinen, verrammelt. Daneben ein Büdchen mit dem, was man hier so braucht, als Wartender, als Aussteigender. Auch Coffee to go.
km 12,3 Brühl-Mitte
Ein großer Klinkerbahnhof, mit Schalter noch und großer Gaststätte. Hier kann man Strongbow-Cider aus England trinken. Pendelbusse fahren zum Phantasialand hin und retour. Und alle wollen in der Gaststätte pinkeln. Es gibt keine öffentliche Toilette; die versiffe, wenn es sie denn gäbe; sagt man, vermutet man.
km 14,0 Badorf
Ein gemauerter Warteraum, ein Kiosk.
km 15,7 Schwadorf
An einem Haus weht eine große Fahne des
1. FC Köln. Hier ist FC-Land. Das Vorgebirge steigt an. Kirchturmspitzen davor und da drauf.
Ein leerer Bahnhof, daneben eine kleine Halle mit nicht genutzter Laderampe, Gras und Kraut sind schon dran.
km 16,6 Walberberg
Ein Haltepunkt. Hier war bis vor Kurzem ein sehr berühmtes und bedeutendes Dominikanerkloster. Seine Mönche waren gefragte Berater Konrad Adenauers und Helmut Kohls, ein Braintrust der alten Bundesrepublik. War das nicht nach Jahrhunderten wieder ein fast katholischer Staat auf deutschem Boden? Böll mochte sie nicht, die alten Inquisitoren. Aber milde waren sie geworden, Intellektuelle. Es gab Tagungen für Manager, Politiker und Schüler. Sie kennen sich aus in dieser Welt, setzen hier und da Akzente, Gedankenstützen.
Sie haben ein Netzwerk. Ein Klassenkamerad, der hier einen Onkel hatte, wurde Priester. In den Neunzigern starb er an Aids.
km 18,5 Merten
Ein Bahnhof mit Güterschuppen, Klinker, teilweise umgewidmet, teilweise ungenutzt.
Hier ist Heinrich Böll begraben, nach katholischem Ritus. Er war sowas von r.k., da konnte er schreiben, was er wollte, und aus der Kirche austreten, so oft er wollte.
km 20,3 Waldorf
Ein umgewidmeter Bahnhof, Wohnungen.
km 21,6 Dersdorf
Ein Haltepunkt, dahinter Spalierobst (Äpfel, Birnen), weiter hinten Spargelfelder.
km 23,2 Bornheim
Ein umgewidmeter Bahnhof. Eine Gaststätte, die ab achtzehn Uhr öffnet, eine kleine Karte anbietet. Sie heißt „Das Wunder von Bernd“. Schranken regeln den Verkehr.
Die Kirche aus dem neunzehnten Jahrhundert nebenan ist dem Eisheiligen Servatius gewidmet, dazu noch als Verstärkung dem Wetterpatron Donatus; zu sehr war man von der Landwirtschaft abhängig. Jetzt ist die Kirche am helllichten Tag geschlossen.
In den Fünfzigern wohnte hier der Onkel einer Bekannten, der befummelte das Kind, belästigte es. Sie erzählte das ihrer Mutter. Die sagte nichts, machte nichts und ließ ihren Bruder einen guten Mann sein.
km 24,7 Roisdorf-West
Ein umgewidmeter Bahnhof. Die Sprudelabfüllanlage und der Obst- und Gemüsegroßmarkt werden von Lkws angefahren und bedient.
km 26,1 Alfter
Die Bahn ist ein kleiner Orientexpress, mehr Muslime sitzen drin als bei den heutigen Museumsfahrten des richtigen.
km 28,5 Dransdorf
Ein kleines, umgewidmetes Bahnhäuschen. Ein Haltepunkt, hier pendelt man nach Bonn ein.
km 30,1 Brühler Straße
An der Straße neben dem Haltepunkt steht eine Moschee, sie wird noch erweitert.
km 32,0 Bonn Hbf.
Unterirdisch hält unsere Bahn. Neben anderen Straßenbahnen eingegliedert in das Netz des öffentlichen Nahverkehrs. Früher gab es einen eigenen Kopfbahnhof an der Ecke zur Thomas-Mann-Straße, ähnlich dem Kölner am Barbarossaplatz. Mit Gaststätte. 1976 kostete ein Glas Kölsch hier fünfzig Pfennig.
Die Bahnhöfe sind weg. Das Kloster ist weg. Der Güterverkehr ist weg. Der Name KBE ist weg.
(2012)
Aus deutscher Geschichte
Als St. Petersburg mal Leningrad hieß, als Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen noch DDR waren, die Welt sich im Kalten Krieg befand, dessen Hauptfront durch Deutschland verlief, fuhr man gern mit Schulklassen nach Berlin.
Diese Fahrten wurden vom Staat subventioniert, galten als pädagogisch wertvoll und führten in eine Stadt preußisch-deutscher Geschichte, des Ost-West-Gegensatzes, der Mauer und des Fehlens einer Sperrstunde. Eine Kölner Abschlussklasse nun, eine Zehn, machte 1982 die Reise mit der Bundesbahn, die es damals auch noch gab. In Marienborn waren die DDR-Grenzer und Reichsbahnkontrolleure zugestiegen und walteten ihrer Ämter.
Die Erwachsenen im Zug saßen in angespannter Aufmerksamkeit bei schon offenen Türen und mit großen Ohren zu den Nachbarwaggons hinhorchend: Reisedokumente und Personalpapiere hielt man schon seit den Lautsprecherdurchsagen an der Demarkationslinie, einseitig als Grenze bezeichnet, in Händen. Man war nervös. – Warum eigentlich? War nicht alles vertraglich geregelt, durch ministerielle Paraphen und Unterschriften fixiert?
Waren dies nicht – trotz beanspruchter eigener Staatsangehörigkeit – Menschen deutscher Zunge, teilte man nicht die Muttersprache mit ihnen, entstammte man nicht gemeinsamem Vaterland? Und: Hier war doch Mitteleuropa, also doch terra cognita.
Viele waren ängstlich, alle unruhig. Nur die Schüler ließen sich nicht anstecken. Die liefen durch den Gang, scherzten, lachten, bandelten an. In mehreren Abteilen hatten sie – wie vorgesehen, also auch erlaubt – die gegenüberliegenden Sitzflächen zusammengeschoben, man konnte so liegen. Die Türen hatte man zugeschoben, das Licht gedämpft, die Vorhänge zugezogen.
Da wird mit einem Male energisch, laut knallend die Tür aufgerissen, zwei Graue stehen da, DDRler in grauer Uniform, einer hat ein Kästchen wie ein kleiner Bauchladen mit Stempelkissen, Stempel und Schreibgerät in Brusthöhe vorgebunden und herrscht die Jugendlichen an: „Sitze zusammen!“, „Gerade sitzen!“, „Visa!“
Die Schüler, Höflichkeit gewohnt, jetzt angeschnauzt, zu Selbstbewusstsein angeleitet, jetzt zusammengeschissen, wollen’s nicht glauben. Einige haben es noch gar nicht realisiert, verwundert schauen sie auf. Zwei lachen. Und einer steht auf, baut sich seinerseits vor diesen staatstragenden Uniformen auf, groß ist er auf den Polstern stehend, großgeworden im Westen der alten Bundesrepublik, verankert im rheinischen Selbstbewusstsein, und er wedelt mit der Hand vor Stirn und Gesicht und sagt im breitesten kölschen Singsang: „Bes do eijentlich lala?“
(1998)
B.
Ja! Ja, ja. Na klar, das war B. Mein alter Freund und Schulkamerad B. Im Halbprofil hatte man ihn aufgenommen, ein ganzes Drittel der Zeitungsseite nahm sein Foto ein, wie er so da saß mit geöffnetem Mantel an einem Bistrotisch, wie hingehockt, ein Weinglas vor sich.
Wie oft hatten wir zusammen gespielt und gelacht, jetzt hockte er da, ein Schal hing ihm um den Hals, und er stierte vor sich hin. Jede Tageszeitung hält auf sich und Traditionen des Gewerbes und der regionalen, nationalen Kultur. So gibt es wohl keine Tageszeitung, die nicht zu Weihnachten und zu Ostern eine spezielle Beilage, besonders gestaltete Seiten ihrem Presseorgan zufügt. Also auch zu Weihnachten. Also auch unsere große Kölner Tageszeitung. Der Tenor war: Alle feiern in Familie, wenige – aber es werden immer mehr – sind allein. Mehrere wurden in diesem längeren Text vorgestellt, eine alleingelassene Frau, ein Mann, der schon immer allein war, ein älteres Ehepaar, das erstmals allein war, ohne Kinder.
Das einzige Bild auf dieser Seite zu diesem Aufsatz zeigte meinen Freund B., wie er da allein saß, an kargem Tisch, im Mantel noch, ein kleines Glas Weißwein vor sich.
Als das Foto in der Weihnachtsausgabe auf meinem Frühstückstisch erschien, war es Vormittag des Heiligen Abends. Dünn war der Sportteil, auch die Politik ging auf gemächlicheres Feiertagstempo zu, und beim weiteren Durchblättern sah ich es denn. Erstaunen, genaueres Nachsehen. Einsicht in den Kontext dieser Weihnachtsseite, und man müsste doch und jetzt direkt.
Aber der Heilige Abend war nur noch wenige Stunden entfernt, Besorgungen mussten noch erledigt, Aufräumarbeiten noch getan, die Gänge des Festmenüs mussten schon vorbereitet, und das Kind sollte doch noch gebadet werden.
So ging B.s Bild in diesen hektischen Tagen voller Termine, Besuche und organisierter Besinnlichkeit verloren.
Als ich einen Tag vor Silvester das Altpapier bündelte, hatte ich das Blatt wieder in der Hand.
Ich rief B. sofort an. Ja, zehn Jahre habe man sich bestimmt nicht mehr gesehen, und ich sei wohl der zwanzigste Anrufer wegen des Bildes. Und er lachte laut auf, wie ich es von ihm immer noch im Ohr hatte, und vielleicht hatte er schon zwanzigmal aufgelacht bei den Anrufen wegen seines ernsten Bildes. Ach, das Foto sei voriges Jahr gemacht. worden. Denn dieses Jahr ginge ja nicht, die Zeitung könne ja nicht ein Ereignis am Morgen dokumentieren, was erst am selben Abend passiere, lachte er. Ob ich denn den Tisch nicht erkannt habe, das sei das „Alkazar“, und eine Bekannte habe das Foto gemacht, sie jobbe bei der Zeitung. Ja, es sei der Nachmittag des 24. gewesen, nur eben der des Vorjahres. Und er sei so in Eile gewesen, schon im Mantel, um zu seiner Mutter in die Eifel zu fahren, die ihn mit seinen Brüdern und deren Familie am Heiligabend erwartete. „Das ist bei uns immer noch so, Du kennst es ja“, rief er durchs Telefon.
Dann fragte er noch nach mir und meiner Familie und was man die Tage so gemacht habe. „Auch in Familie? Was willste machen? Aber da kann man ja mit leben.“
Wir verabredeten uns dann für „mal im Januar, wir telefonieren noch“. Er wollte noch ein paar Tage Skifahren. Ich brachte die alten Zeitungen zum Papiercontainer.
(1994)
Das Narbengesicht
Ein Mann steht auf der Schildergasse und spielt eine Drehorgel. Doch die überhört man sofort, sieht man sein Gesicht: von Narben verzerrt, über und über entstellt, wie von schlimmsten Säuren und Brand. – Ein Schild lehnt an der Drehorgel, die er – groß gewachsen, von beeindruckender Statur, aber dieses Gesicht! – mit Schwung dreht.
Auf dem Schild nennt er einen schweren Unfall und dass er für ein „neues Gesicht“ sammle. – Viele Menschen durchbrechen ihre Fassungslosigkeit und spenden ihm in eine Mütze; es gibt auch Scheine.
Als er pausiert, eine Zigarette in den Restmund steckt, spreche ich ihn an: ob denn keine Versicherung, keine Kasse ihm helfen könne. Nein, sagt er.
Und wir kommen ins Gespräch, sogar über dies und das und jenes, wie zwei Passanten auf der Schildergasse, die nun mal ein paar Worte wechseln. Und dann erzählt er, vom schweren, selbst verschuldeten Unfall, von Frau und Kindern, die sich abgewandt hätten, als die Verbände gelöst wurden.
Und er verbringe seine Tage jetzt in billigsten Hotels und in den Einkaufspassagen des Rheinlands, aber auch der norddeutschen Großstädte. Und das erorgelte Geld reiche natürlich nicht für die großen und sehr, sehr teuren Operationen, die er auch gar nicht mehr erdulden wolle, aber es reiche sehr gut für allabendliche Bordellbesuche, die er sich mit allem Drum und Dran und großer Befriedigung leisten könne. – Die Zigarette war geraucht, er nahm den Orgelschwengel in die Hand, man grüßt. – Ich gehe weiter.
(2003)
Der Bluthund
Von fern, für den flüchtigen Passanten, war es fast eine Idylle.