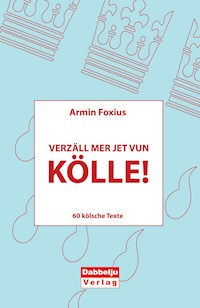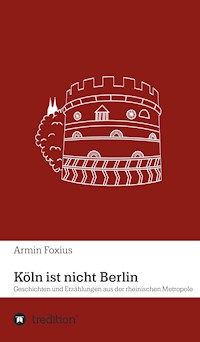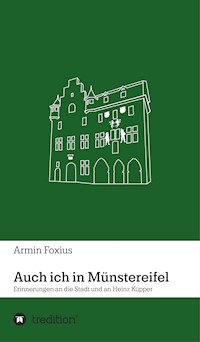
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses kleine Buch versammelt die meisten Texte, die Armin Foxius in den letzten Jahrzehnten über Münstereifel und Heinz Küpper geschrieben und veröffentlicht hat. Nur das Kapitel "Petitessen" wurde für diese Publikation verfasst. Das Bändchen gliedert sich in zwei Teile: zum Ort, der heute Bad Münstereifel heißt, und zu Heinz Küpper, der sein Lehrer war und Freund wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Armin Foxius
Auch ich in Münstereifel
Erinnerungen an die Stadt und an Heinz Küpper
© 2018 Armin Foxius
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7469-2361-1
(Paperback)
978-3-7469-2362-8
(Hardcover)
978-3-7469-2363-5
(e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
1. Teil: Münstereifel
Zum Geleit
Münstereifel – Gedächtnissplitter
Schulzeit/Lebenszeit
Gespräch mit Bernhard Kräling
Vorwort zur Guddorf-Festschrift
Zinnober in Münstereifel
Münstereifel vor fünfzig Jahren
Eine Untat
Kleine Welt/Großes Kino
Langenhecke 4 und ich
Armin Foxius: Jugendaustausch 1966
Erlebt beim Jugendaustausch in Ashford
St. Michael: Ein Achtundsechziger?
2. Teil: Heinz Küpper
Vorwort
Rede zu Heinz Küppers Sechzigstem
Hein Küpper zum Siebzigsten
Trauerrede Heinz Küpper 28.11.2005
Küpper-Brücke
Heinz-Küpper-Weg
Petitessen
Arbeit an „Zeit in Münstereifel“
Das verpasste Interview
Du und Sie
Ein Gruß aus dem Ilm-Tal
Ein Zweikampf um Hirn und Seele
Förderungspreis 1965
Gänge
Goethe – Stieler – Küpper
Hubertuswege
Im Goethe zu Hause
Letzter Besuch
Museumsgänge
Neuanfang
Rheinisch un Standarddeutsch
Tod, Trauerfeier, „Grab“
Wie hast du’s mit der Religion? (Faust: V.3415)
Wohnungen
Zaungast Goethe
Zum Schluss
Vorbemerkung
Dieses kleine Buch versammelt die meisten Texte, die ich in den letzten Jahrzehnten über Münstereifel und Heinz Küpper geschrieben und veröffentlicht habe. Nur das Kapitel „Petitessen“ wurde für diese Publikation verfasst. Das Bändchen gliedert sich in zwei Teile: zum Ort, der heute Bad Münstereifel heißt, und zu Heinz Küpper, der mein Lehrer war und Freund wurde.
Ich wohnte mit meiner Familie von 1959 bis 1968 in Münstereifel und besuchte als Städter das damals staatliche St.-Michael-Gymnasium. Die ersten drei Texte über die Stadt, die Schulzeit, das Gespräch mit meinem Klassenlehrer Kräling stammen aus dem zusammen mit Heinz Küpper herausgegebenen Buch „Zeit in Münstereifel“ von 1988, zur Erinnerung an das Abitur 1968.
Zum Vorwort für eine Sammlung von Arbeiten unseres Direktors August Guddorf wurde ich von Harald Bongart gebeten. Die dann folgenden Texte wurden im Nachrichtenblatt des Vereins Alter Münstereifeler (VAMÜ) gebracht: Erinnerungssplitter.
Die Artikel über die England-Fahrt von 1966 für die Kölnische Rundschau und den Kölner Stadt-Anzeiger wurden im Auftrag des Jugendaustauschleiters und Studienrats Ferdinand Lethert geschrieben: „Dein Vater war doch Journalist.“
Den Münstereifel-Teil schließt eine Betrachtung über das tolle Jahr 1968 ab, Text für einen Erinnerungsband über den 66er-Jahrgang von 2016.
Der zweite Teil befasst sich mit Heinz Küpper, dem großen Schriftsteller, der bis zu seinem Tod hier wohnte.
Der sechzigste Geburtstag wurde 1990 bei dem so gastfreundlichen Ehepaar Fischer in Groß-Vernich gefeiert. Ich sollte im Auftrag Küppers die einzige Rede halten: „Bevor ein anderer Quatsch erzählt“.
Der siebzigste Geburtstag wurde in noch größeren Rahmen auf der Burg begangen. Es sprachen Berufenere; lang, teilweise sehr lang. Was ich zu sagen hatte, kannte Küpper ja schon; deswegen bat er mich um ein kölsches Gedicht.
Die Trauerfeier und Beerdigung an einem trüben Novembertag hatte eine Collage von Küpper-Texten und eine kleine Ansprache der Erinnerung.
Die Ansprachen zur Benennung der Heinz-Küpper-Brücke in Bad Münstereifel und des Heinz-Küpper-Wegs in Euskirchen waren Teil der Bemühungen, das Andenken dieses Lehrers und Schriftstellers wachzuhalten.
Den Abschluss bilden Petitessen, Kleinigkeiten: Hier und da was, aus dem Gedächtnis, mithilfe von Notizen und Tagebucheintragungen.
Besonderer Dank gilt den Autoren der Vorworte zu den einzelnen Teilen im Buch:
– Herrn Professor Dr. Horst A. Wessel, Dozent für Wirtschaftsgeschichte an der Heinrich-Heine-Universität zu Düsseldorf, Ehrenvorsitzender des Vereins Alter Altmünstereifeler (VAMÜ),
– Herrn Helmut Mörchen, Literaturwissenschaftler und Publizist aus Köln.
Köln, im April 2018 Armin Foxius
1. Teil: Münstereifel
Zum Geleit
Die drei Texte des ersten Teils der Veröffentlichung betreffen die Zeit, die Armin Foxius als Volksschüler und Gymnasiast in Münstereifel gelebt hat. Es waren Jahre, die ihn in besonderer Weise und nachhaltig geprägt haben. Zwar sind auch andere Menschen „Kinder ihrer Zeit“, aber das, was der Autor über seine Jugend- und Schulzeit zu erzählen weiß, zeigt die Ausprägung eines nicht nur individuellen, sondern auch früh sehr selbstständigen Charakters. Die Texte sind vor dreißig Jahren entstanden; dürfen also zu Recht als Zeitzeugnisse angesehen werden – zumal der Verfasser bewusst davon Abstand genommen hat zu glätten, geschweige denn inhaltlich zu verändern. Sogar auf das, was er damals als weniger wichtig angesehen hat oder was er seinerzeit nicht wusste, jedoch im Nachhinein an Interesse gewonnen hat, ist nicht ergänzt worden.
Armin Foxius war bereits damals ein exzellenter Erzähler, der genau beobachtete, interessant und humorvoll zu erzählen wusste, dabei jedoch den gebotenen Abstand zu den Geschehnissen wahrte und sie und sich distanziert und manchmal auch ironisch bewertete. Aufbau, Duktus und Sprache zeigen die Schule des Schriftstellers Heinz Küpper, der sein Deutschlehrer war und mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbunden hat. Bemerkenswert sind die den einzelnen Kapiteln vorangestellten, sehr passend ausgewählten Zitate aus dem epischen Theaterstück „Unsere kleine Stadt“ von Thornton Wilder, das der Verfasser als Schüler im zum Theater umgebauten Stadtkino gesehen hat. Das Münstereifel seiner Schülerzeit ist augenzwinkernd diese kleine Stadt, diese angeblich heile Welt, in der alle Kinder gut erzogen sind, in der auch die Banalitäten des Alltags so wichtig genommen werden. Armin Foxius nimmt sich davon nicht aus; im Gegenteil: Im Unterschied zum Spielleiter des Theaterstücks steht er nicht außerhalb der Handlung, sondern ist selbst Teil davon. Das unterscheidet diese Erinnerungen so wohltuend von den üblichen Schülermemoiren.
Armin Foxius war nicht wie zwei Drittel seiner Sexta des St.-Michael-Gymnasiums Konviktorist, sondern gehörte zu der kleinen Gruppe, die aus der Stadt selbst kamen. Zwar war er nicht in Münstereifel geboren, aber er war, weil der Vater als Journalist einer regionalen Tageszeitung hier arbeitete, in jungen Jahren mit der Familie zugezogen. Das führte zu einer Betrachtung der kleinstädtischen Verhältnisse und der damals einzigen weiterführenden Schule am Ort aus einer neuen, höchst ungewöhnlichen Perspektive. Denn wenn über die Schülerzeit, insbesondere im Nachrichtenblatt des Vereins Alter Münstereifeler, berichtet wurde, dann waren es die Erinnerungen von Internatsschülern. Und das war, wie ich bei der Lektüre überrascht feststellte, eine ganz andere Welt. Aufmerksam wird man schon in Anbetracht der Tatsache, dass von dem Drittel der Sextaner aus der Stadt oder ihrer Umgebung nur ein Einziger, nämlich der Verfasser, bis zur erfolgreichen Abiturprüfung nicht auf der Strecke geblieben ist. Allerdings wird die Frage, was denn aus den anderen geworden ist und warum diese scheiterten, zwar wiederholt gestellt, bleibt aber – auch in dem ausführlichen und gedanklich tief gehenden Gespräch mit dem ehemaligen Klassenlehrer (durchgehend von Sexta bis zum Abitur) – unbeantwortet.
Armin Foxius kam vor dreißig Jahren, als er über seine Zeit als Schüler nachdachte und seine Gedanken niederschrieb, zu dem Ergebnis, dass es eine „glückliche Zeit“ gewesen war. Und er lässt uns daran auf eine nachdenkliche, jedoch stets vergnügliche Art teilhaben. Außerdem erfahren wir, warum dies so gewesen ist. Nicht von ungefähr hat er sich später schließlich für den Beruf des Lehrers, und zwar ganz bewusst an der Hauptschule, entschieden. Selbst ich, der ich nur wenige Jahre früher, allerdings als Konviktorist, das St.-Michael-Gymnasium besucht und diese Zeit intensiv erlebt und in geringem Umfang auch mitgestaltet habe, konnte viel Neues erfahren über die Stadt und das Gymnasium sowie deren Akteure. Beispielsweise war uns der damalige Oberpfarrer Dr. Rothkranz zwar ein Begriff, aber vor allem wegen seiner Ansage bei der Fronleichnamsprozession: „Zum Schluss singen wir ‚Großer Gott wir loben Dich’ mit Blechmusik“. Dass er ein gebildeter Verehrer der hellenistischen Kultur war und den jungen Schüler mit Fachliteratur versorgte, das habe ich erst jetzt erfahren und lässt diesen Mann in einem anderen Licht erscheinen. In Erinnerung war auch, dass unser Latein- und Griechischlehrer Kräling an Feiertagen die Konviktsorgel spielte, nicht jedoch, dass er das an Weihnachten und bei anderer Gelegenheit auch in der evangelischen Kirche tat – und dass Armin Foxius ihm dabei assistierte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass damals zwischen den Konfessionen noch scheinbar unüberbrückbare Gegensätze bestanden. Ich erinnere mich noch gut daran, dass bei meiner Vorstellung in Münstereifel Präses Otto Keppeler bekannte, dass im Lehrerkollegium des St.-Michael-Gymnasiums zwar auch evangelische Lehrer tätig, aber diese vollkommen integer und außerdem sehr tüchtig seien.
Die Bürgermeister der Stadt traten bei uns im „Kasten“ bei verschiedenen Anlässen auf, beispielsweise beim Besuch des Erzbischofs oder bei der Ernennung von Präses Keppeler zum Prälaten. Sie waren uns nach einigen Jahren in der Stadt durchaus bekannt. Aber das, was hier und vor allem auch wie über sie berichtet wird, setzt ein Wissen voraus, das in unmittelbarer Nähe erworben und in seiner Bedeutung auch richtig eingeordnet wurde. Der bereits erwähnten Weigerung des Verfassers, die Texte nachträglich zu ändern oder zu ergänzen, dürfte es zuzuschreiben sein, dass einer, der damals hinsichtlich seiner körperlichen Statur und auch seiner Aufgabe und Funktion zu den gewichtigsten Akteuren in der Stadt zählte, nicht in Erscheinung tritt. Von mir darauf aufmerksam gemacht, bedauerte Armin Foxius diese Lücke, verwies auf das Zeitzeugnis und schlug vor, ich solle diese Episode im Geleitwort erwähnen. Das will ich tun. Genannter Akteur war der damalige Leiter der Polizeiwache Münster. Dieser sah sich in der „rebellischen Zeit“ Ende der 1960er-Jahre einer unangemeldeten und daher nicht rechtmäßigen Vietnam-Demonstration gegenüber. Es gelang ihm, den Zug zu stoppen, allerdings nur kurzfristig; denn die Demonstranten drängten und drohten, ihn, der die Obrigkeit verkörperte, einfach auf die Seite zu schieben. Gerade rechtzeitig fand er einen typisch Münstereifeler Kompromiss, der beiden Seiten unter Wahrung des Gesichts und der Obrigkeit auch der Autorität aus der Klemme half: „Die Straße bleibt frei! Was Ihr auf dem Bürgersteig veranstaltet, das geht mich nichts an.“
Auch Lehrer, die wir nicht mehr aktiv im Schuldienst erlebt haben, werden aufgrund ihrer besonderen Verdienst gewürdigt. Beispielsweise Studienrat Backes, der in den 1950/60er-Jahren erfolgreich mehrere Initiativen ergriff, um das kaum vorhandene öffentliche Kulturleben in der Stadt auf eine tragfähige Grundlage zu stellen. Er engagierte Gastspieltheater, die auf dem oberen Schulhof des Gymnasiums und regelmäßig im Kino auftraten, u.a. mit dem bereits erwähnten Stück von Thornton Wilder. Er rief einen Filmklub ins Leben und führte Oberstufenschüler an die Aufgabe heran, die nach der Vorführung angesetzte Diskussionsleitung zu übernehmen. Mir ist noch in guter Erinnerung, dass ich beim ersten derartigen Einsatz den Edelwestern „12 Uhr mittags“ mit Gary Cooper zu behandeln hatte. Bei den Ausführungen zu den Sportveranstaltungen im Wallgraben fiel mir ein Foto in meinem Schüleralbum ein, das ein besonderes Engagement unseres Oberstudiendirektors August Guddorf dokumentiert: Dieser sprintete anlässlich der Bundesjugendspiele als buchstäblicher Kugelblitz die 100-Meter-Bahn hinab, an seiner Seite Studienrat Gier („Passivi“). Dieses Ereignis dürfte jedoch bereits vor der Gymnasialzeit von Armin Foxius stattgefunden haben.
Breiten Raum nimmt das Interview ein, das Armin Foxius vor dreißig Jahren mit seinem ehemaligen Klassenlehrer geführt hat. Es ist nicht nur Zeitzeugnis, sondern erweist sich noch heute als hochaktuell. Zwar sind die Probleme, die während der Schulzeit des Verfassers durch die Auflösung der Klassenverbände im Zusammenhang mit der Oberstufenreform entstanden sind, längst in Vergessenheit geraten, aber die Folgen sind noch heute empfindlich spürbar. Ob es gut war, den Klassenlehrer von Sexta bis Oberprima zu behalten, statt ihn wie üblich alle drei Jahre zu wechseln, das ist wohl nur individuell zu beantworten. Lehrer wie Schüler kamen jedenfalls vor dreißig Jahren zu dem Ergebnis, dass es sich gelohnt hat. Nachdenklich stimmen die Vergleiche zwischen den Verhältnissen in den 1950/60er- und den 1970/80er-Jahren, auch das betrübliche Schicksal der Hauptschule. Die Entwicklung ist keineswegs zum Guten fortgeschritten. Angesprochen wurde der Verlust der Allgemeinbildung bzw. die Züchtung von „Fachidioten“, der Sinn des Vokabellernens bzw. der Irrsinn zu glauben, Vokabeln seien bei Bedarf nachschlagbar oder elektronisch abrufbar. Sicherlich nicht selbstverständlich ist in diesem Zusammenhang die Erörterung des Verhältnisses von Katholisch und Heidnisch-Klassisch, Katholisch und Evangelisch bzw. die Bedeutung der Ökumene für einen Lehrer, der neben seinen ursprünglichen Fächern Latein und Griechisch mangels Nachfrage nun auch Unterricht in katholischer Religionslehre erteilte. Der Primat des Papstes wird in dieser Tour d’Horizon ebenso behandelt wie der Zölibat und die Clyniazensische Reform.
Nachdenklich stimmt vor allem das Fazit des langjährigen Gymnasiallehrers: „Lehrer sind sonderbare Menschen. Normale Menschen haben Kinder, die ziehen sie groß; die Kinder gehen aus dem Haus. Der Lehrer fängt immer wieder mit kleinen Kindern neu an. Und das dreißig Jahre lang.“ Der Verfasser setzte dagegen: „Dieser Beruf gibt Freiheiten, die man in anderen Berufen nicht findet.“ Und diese Freiheiten hat der Hauptschullehrer Armin Foxius zum Wohl seiner immer wieder neuen Schüler sowie nicht zuletzt dafür genutzt, um Prosatexte und vor allem Gedichte zu schreiben, die erfreuen und zum Nachdenken anregen. Dafür liefern die hier veröffentlichten Texte treffende Beispiele.
Horst A. Wessel
Münstereifel – Gedächtnissplitter
Wenige hundert Meter fuhr der Zug von Bahnhof Euskirchen noch in Richtung Köln, doch dann bog er in einer Rechtskurve ab, und wenn man am Haltepunkt „Kuchenheim – Zuckerfabrik“ und an den beiden großen Silos vorbei war, wusste man: Jetzt konnte es nur noch nach Münstereifel gehen.
In Stotzheim, Kreuzweingarten, Arloff, Iversheim gab es noch kleine Bahnhöfe, natürlich mit Gaststätte. Man sah in der Höhe von Arloff zur Rechten wie einen feinen grünen Strich das so irdische Kalkarer Moor, und wenn man sich weit aus dem Fenster hinauslehnte, das Ohr und Auge ins Weltall, die Radiosternwarte Stockert. Jetzt war es nicht mehr weit, nach Iversheim kam schnell Münstereifel selbst, Endstation einer Reise.
Als ich 1959 nach Münstereifel kam, fuhr noch die Dampflok, für uns Kinder Einstieg in Technik – und ins 19. Jahrhundert. Am Endpunkt Münstereifel wurde die Lok umgesetzt: Sie wurde von den Waggons abgekuppelt, fuhr ein wenig vor, eine Weiche wurde von Hand umgestellt, die Lok dampfte rückwärts, rechts an den Waggons vorbei, überquerte noch die Straße zur Otterbach bis etwa in Höhe des Omnibusdepots der Bundespost, fuhr dann wieder retour in die Bahnhofsanlage und wurde ans andere Zugende angekuppelt, jetzt wieder in Richtung Euskirchen.
Die Lok konnte hier auch mit Wasser versorgt werden, und zur Straße hin war noch ein separater Gleisanschluss zu einem großen Holzlagerplatz. Das Bahnhofsgebäude war ähnlich denen des Ahrtals, von der Reichsbahn Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin entworfen. Auf der ersten Etage wohnte der Bahnhofsvorsteher, und zusammen mit einer seiner Töchter besuchte ich das vierte Schuljahr.
1959 zogen wir nach Münstereifel, und am ersten Morgen wurde ich einkaufen geschickt; im Café Kreuzberg gab es Brötchen, bei Frau Esser im „Spar“ (Ecke Unnau-/Orchheimer Str.) Büchsenmilch und Nescafé im Probiertübchen.
Als ich 1959 nach Münstereifel kam, war die Stiftskirche gerade wegen Baufälligkeit geschlossen worden.
Ich habe zehn Jahre hier gelebt, es war eine glückliche Zeit.
CHRYSANTHUS UND DARIA
„Dies alles geschah, und wir bemerkten es nicht.“ (Thornton Wilder: Unsere kleine Stadt)
Evangelische gab es auch. Aber ansonsten war es eine zutiefst katholische Kleinstadt. Und da die Stiftskirche „Chrysanthus und Daria“ geschlossen worden war, stand das Pfarrhaus am falschen Platz. Das war dann für den gehbehinderten Oberpfarrer Rothkranz ein langer Weg bis zur Jesuitenkirche, die für viele Jahre als Pfarrkirche aushelfen musste. Dr. Rothkranz passte eigentlich nicht nach Münstereifel, er saß zwischen seinen vielen Büchern, hatte die Leutseligkeit eines Pius’ XII. und schenkte einem wissensdurstigen Zwölfjährigen „Die hellenische Kultur“ von Fritz Baumgarten in einer wunderschönen Ausgabe von 1913. Unbefragte Kirche und private Intellektualität. Diese lange Epoche im Klerus bestand auch im Kleinen, und endete dann auch dort, wie auch im Großen.
Geistliche Lehrer, auch Bürgermeister und Stadtdirektor waren Anfang der 60er-Jahre noch klare, wichtige Größen und Kristallisationspunkte.
Rothkranz’ Nachfolger organisierte Jugend. Und im Zeltlager hatten wir unsere festen Abläufe, hielten Gottesdienste unter freiem Himmel, waren selbstverständlich katholisch wie jung. In der KJG waren Volksschüler, Lehrlinge und Gymnasiasten in den gleichen Gruppen. Alte Beziehungen von der Volksschule her blieben trotz unterschiedlicher Bildungs- und Berufsgänge erhalten. Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ausgewählte fuhr Oberpfarrer Schäper durch die Erzdiözese zu den Kirchenneubauten der Architekten Böhm, Vater und Sohn.
Der evangelische Pfarrer, natürlich in einem Neubau angesiedelt, hart an der Stadtmauer, hatte eine ganz andere Klientel. Nichtrheinisch, intellektueller, offensiv fröhlich und – schon damals – mit handgearbeiteten Textilien bekleidet. Als das alte Pfarrhaus Ecke Heisterbacherstraße abgerissen werden musste, nachdem sich dort wegen der Enge schwere Unfälle und gar der Tod eines jungen Mädchens ereignet hatten, durfte ich zentnerweise Briketts aus den alten Kellern herausholen und zu uns nach Hause bringen. An Feiertagen registrierte ich meinem Klassenlehrer Kräling in der evangelischen Kirche die Orgel, bei den musikalischen Aktivitäten von Pfarrer Sassenscheidt uns beiden Katholiken ganz selbstverständlich.
Und als ich genaue Informationen über die Vorgänge in Vietnam suchte, bekam ich Texte und Dokumente, die in der Zeitschrift „Stimme der Gemeinde“ abgedruckt waren, aus dem evangelischen Pfarrhaus. Klütten und Literatur.
In der gesperrten Stiftskirche machte ein junger Archäologe vom Bonner Landesmuseum, mit Baskenmütze und Fliege auffällig gekennzeichnet, Untersuchungen, der junge Hugo Borger versuchte, das gefährdete Baudenkmal in den Griff zu bekommen. Wir krabbelten durch ein offenes Fenster in die Krypta und spielten hier Verstecken.
Von unserer Volksschule, der Marienschule, hatten wir einen weiten Blick auf die Stadt. Und als das Wohnhaus und das kleine Café (mit Ziege davor) von Peter Schumacher abbrannten, hatten wir Schüler einen Logenplatz. – Bei Schulfeiern spielte Rektor Beilenhoff auf der Geige, und wir sangen, so begleitet, Marien- und andere Volkslieder. In der früheren Lehrerausbildung waren die Kandidaten angehalten, ein Instrument zu beherrschen. Heute können einige wenige Klavier spielen, aber das tun sie dann privat. Alle Schüler und Lehrer der Schule nahmen am zentralen Martinsumzug teil. Vorneweg wurde ein erleuchtetes Schulmodell getragen. Die ganze Stadt war eine Gemeinde.
Wir haben viel auf den Straßen gespielt, die ganze Stadt und ihr Weichbild war unser Aktionsraum.
1960 spielten wir „Olympische Spiele“. Wir liefen die Fibergasse hoch, durch den Rathausbogen, rechts runter, an „Schultes Eck“ mit der Buchhandlung zwängten wir uns an den Menschen vorbei, und zurück zur Fibergasse. Und obwohl die meisten von uns älter waren, gewann immer Fredy Kirchner. Aber dessen Vater war ja auch beim Dresdner SC gewesen und kannte von daher noch Helmut Schön. Und wenn ich heute im Fernsehen in irgendeiner Aids-Diskussionsrunde Prof. Manfred Steinbach contra Gauweiler höre, fällt mir ein, wie wir auf einem Sandhaufen vor dem Schuhhaus Kammering seinen Acht-Meter-Weitsprung von Rom kopierten (vierter Platz).
In manchen Wintern war die Erft zugefroren. Wir liefen über die Straße bis zum Sportplatz, kletterten dann die Böschung runter auf das Eis und gingen und rutschten die Erft rauf bis Eicherscheid.
Das schwierigste Stück war die Partie „an der Rauschen“. Wir hangelten uns die gefrorene Schräge hoch, hielten uns an Steinvorsprüngen und größeren Eisgebilden fest. Wir hörten das Wasser unter uns gurgeln; und war es uns nicht trotz der Eisschicht so nah, dass wir die Luftblasen und die reißende Geschwindigkeit des Ozeans Erft durch das papierdünne Eis sahen? So schien es uns, und wir hatten schreckliche Angst. Wir krabbelten weiter, auf allen Vieren, und am Wehr oben angekommen, hatte keiner mehr Angst gehabt, und wir gingen weiter. Langsamer, das Eis und jeden unserer Schritte genau beobachtend.
Im September 1960 gab es eine Trinkwasserkatastrophe. Aus der Hauptquelle floss verseuchtes Wasser. Auf dem Klosterplatz stand eine Wasseraufbereitungsanlage, Trinkwasser lagerte in riesigen durchsichtigen Plastikbehältern auf erhöhten Gestellen. Der Stadtdirektor wurde auf dem Platz von einem Fernsehteam interviewt. Man stand im Kreis herum, man hörte, wie einer fragte, und sah, wie sich ein anderer um Antwort bemühte. So was wie ein Fernsehinterview hatten wir alle noch nicht gesehen und gehört. Nach mehreren Anläufen klappte es dann. Am Abend saß die ganze Stadt vor dem Fernseher: Münstereifel war in „Hier und Heute“.
FRINGSE LÖR, HEUELS PAD
„Eine sehr durchschnittliche Stadt, wenn Sie mich fragen. Ein wenig gesitteter als die anderen, dafür aber auch bedeutend weniger aufregend.“ (Thornton Wilder: Unsere kleine Stadt)
Politik fand auch statt, und sie war so übersichtlich angeordnet und wurde so gradlinig exekutiert, dass ein Kind es verstehen konnte. Es gab einen Stadtrat mit einer eindeutigen CDU-Mehrheit, einer starken FDP und SPD-Leuten. Wichtig aber war die Trias an der Spitze: Bürgermeister Laurenz Frings, Stadtdirektor Derkum und Stadtinspektor Schmidt. Fringse Lör sah man überall in der Stadt. Wenn mehrmals am Tage aus dem Café Frohn von der Bedienung Kännchen Kaffee über die Straße ins Rathaus getragen wurden, kannte man den Adressaten: Heinrich Derkum. Punkt 12 Uhr verließ Herr Schmidt sein Büro und ging kerzengerade die wenigen Schritte in seine Privatwohnung, Mittagszeit.
Waren wichtige Dinge der Bevölkerung mitzuteilen, ging dies auf schnellstem Wege, nur noch der Geschwindigkeit des heutigen Bildschirmtextes vergleichbar: Der städtische Angestellte Ritzdorf wurde losgeschickt, an bestimmten Stellen der Stadt blieb er stehen, bimmelte kräftig mit einer Glocke, wartete ab, dass Fenster und Ohren geöffnet wurden, und meldete derart: „Der Oberstadtdirektor gibt bekannt! Wegen der Ostertage ändern sich die Müllabfuhrzeiten, etc.“ Das war ja auch wichtig, und aus dem nachgeordneten Mund der Verwaltungsspitze klang es dringlicher als in dürren, wenigen Worten auf irgendeiner Seite im Lokalteil der Zeitung. Und, wer hatte überhaupt eine Zeitung abonniert? – Die alte „Münstereifeler Zeitung“ gab es ja schon lange nicht mehr, und „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ waren überregionale Blätter, die mit Münstereifel zunächst einmal wenig im Sinn hatten. – Die Meldungen von Herrn Ritzdorf bekam jeder mit, denn die Frauen waren auf jeden Fall zu Hause. So war das damals.
Als ich nach Münstereifel kam, gab es hier viele Flüchtlinge. Sie waren häufig nur notdürftig untergebracht, darunter mehrere Familien auf engstem Raum in einem heruntergekommenen Gebäude am Anfang der Langenhecke. Heute ist es das „Romanische Haus“, einer der ältesten Profanbauten des Rheinlandes.
Der Nachfolger von Fringse Lör war ein Herr Heuel, wie ersterer ein richtiger Münstereifeler. Was anderes kam gar nicht infrage, auch nicht eine andere Parteimitgliedschaft als die der CDU.
Der neue Bürgermeister war wohlbeleibt, der Spitzname war gerechtfertigt, und nie sah ich eine Amtskette am Träger so dekorativ auf dem Präsentierteller. Das war auch sehr wichtig, denn Verschwisterungen mit anderen europäischen Gemeinden standen auf der Tagesordnung und sollten zelebriert werden. Man war Europäer geworden. Mochten die Planungen zur Restaurierung von Stadtmauer und Burg auch konkrete Züge annehmen, im geistigen Bereich hatte man die Engen der Kleinstadt und Westdeutschlands längst verlassen und bemühte sich um polyglotte Weltläufigkeit. Die Mädchen und Jungen der Stadt und der Umgebung lernten in den Schulen Hochdeutsch und dann ganz schnell Englisch, um möglichst bald nach Ashford/Kent fahren zu können. Die Erwachsenen fuhren mit Vereinen und Clubs über den Kanal in einer neuen und ganz anderen Weise „gen Engeland“, als sie es noch als Kinder gelernt hatten. Münstereifel war eine behäbige Stadt, die zusehends prosperierte und sich ausdehnte. Die Bebauung quoll aus dem engen Tal heraus, belegte die umgebenden Hänge, und aus dem mittelalterlichen Städtchen wurde eine moderne Gemeinde mit historischem Kern.
Diese Explosion fand im Wesentlichen in den 60er-Jahren statt. Und ich habe es erlebt.
Die Politik wurde zu Beginn dieser Etappe noch von den Einheimischen, und bei denen von den kleinbürgerlichen Säulen Handwerk, Handel und mittlerer Beamtenschicht bestimmt. Der enorme Zuzug von „Fremden“ und die landespolitischen Vorgaben zur Kommunalpolitik aus Düsseldorf veränderten alles. Nur in wenigen Bereichen, vor allem auf Grund von ökonomischer Macht, konnten sich die „alten“ Münstereifeler Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.