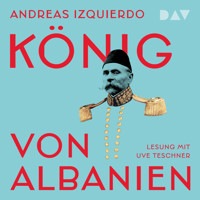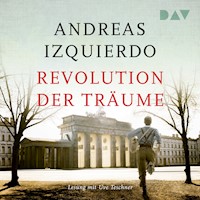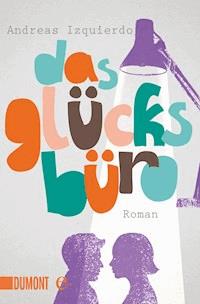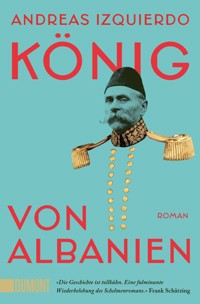
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Salzburg, März 1913. Der Schausteller Otto Witte wird in eine Irrenanstalt eingewiesen, weil er steif und fest behauptet, König von Albanien gewesen zu sein. Der junge Doktorand Alois Schilchegger ist von diesem Mann fasziniert und nimmt sich seiner an. Ottos Geschichte beginnt im Oktober 1912 in Konstantinopel. Das Osmanische Reich droht auseinanderzubrechen. Albanien nutzt die Gunst der Stunde, erklärt sich unabhängig und sucht einen König. Otto und sein Kumpan, der Schwertschlucker Max Hoffmann, riskieren einen Coup: Albanien sucht einen König? Albanien bekommt einen König! Nämlich Otto, der einem möglichen Kandidaten auf den Thron zum Verwechseln ähnlich sieht. Otto und Max treten im Kostüm als Prinz und dessen Sekretär auf. Niemand stellt auch nur eine Frage. Fünf Tage geht es drunter und drüber in Albanien. Otto hält Paraden ab, lässt sich vom Volk bejubeln, gründet einen Harem und macht gegen Serbien und Montenegro mobil. Der Schwindel bleibt freilich nicht unbemerkt und fliegt am Ende auf. Dieser Roman um Albaniens angeblichen Kurzzeitkönig ist eine höchst vergnügliche Hommage an die Kunst des Hochstapelns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Salzburg, März 1913. Der Schausteller Otto Witte wird in eine Irrenanstalt eingewiesen, weil er steif und fest behauptet, König von Albanien gewesen zu sein. Der junge Doktorand Alois Schilchegger ist von diesem Mann fasziniert und nimmt sich seiner an.
Ottos Version der Weltgeschichte beginnt im Oktober 1912 in Konstantinopel. Das Osmanische Reich droht auseinanderzubrechen. Albanien nutzt die Gunst der Stunde, erklärt sich unabhängig und sucht einen König. Otto und sein Kumpan, der Schwertschlucker Max Hoffmann, riskieren einen waghalsigen Coup: Albanien sucht einen König? Albanien bekommt einen König! Doch der Schwindel bleibt freilich nicht unbemerkt …
Autorenfoto: © Niklas Berg
Andreas Izquierdo ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, unter anderem ›Das Glücksbüro‹ (2013), den SPIEGEL-Bestseller ›Der Club der Traumtänzer‹ (2014) und ›Fräulein Hedy träumt vom Fliegen‹ (2018). Für seine historische ›Wege der Zeit‹-Reihe um die drei Freunde Carl, Artur und Isi, bestehend aus ›Schatten der Welt‹ (2020), ›Revolution der Träume‹ (2021) und ›Labyrinth der Freiheit‹ (2022), wurde er mit dem bronzenen Homer ausgezeichnet. Zuletzt erschien ›Kein guter Mann‹ (2023). Andreas Izquierdo lebt in Köln.
Andreas Izquierdo
König von Albanien
Roman
Von Andreas Izquierdo sind bei DuMont außerdem erschienen: Das Glücksbüro Der Club der Traumtänzer Schatten der Welt Revolution der Träume Labyrinth der Freiheit Kein guter Mann
E-Book 2024 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten © 2024 DuMont Buchverlag, Köln ›König von Albanien‹ erschien erstmals 2007 bei Rotbuch Verlag, Berlin. Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © Keystone/GettyImages, © Heritage Images/Kontributor/GettyImages Gestaltung der Karten: Katharina Fuchs Satz: Angelika Kudella, Köln E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck ISBN E-Book 978-3-7558-1032-2
Für Luis und in memoriam Otto Witte & Max Hoffmann
SALZBURG, 2. MÄRZ 1913
1
Am Tag ihrer Einlieferung war Majestät so wütend, dass sie drohte, alle und jeden sofort verhaften zu lassen, wenn man sie nicht auf der Stelle freiließe. Dabei machte sie einen solchen Aufstand, dass eine der Barmherzigen Schwestern in ihrer weißen Tracht mit dem gestärkten, an den Seiten hochgebogenen Häubchen davoneilte, um nach Skopolamin zu suchen. Währenddessen stand ich dem Neuen gegenüber, ließ ihn toben, bis er – was immer er auch in meinem Gesicht gelesen haben mochte – plötzlich schwieg, sich umdrehte und erhobenen Hauptes an mir vorbeischritt, hinaus auf den Flur.
Bis heute ist es mir ein Rätsel, warum sich dort plötzlich Melancholiker in ihren Betten aufsetzten, Degenerierte ihre Wahnreden unterbrachen, Idioten ihre starre Haltung lösten und sie alle zusammen ein Spalier bildeten, durch das Seine Majestät Otto I. in stolzer Haltung hindurchschritt. Es war so still, dass man geradezu das Einsetzen einer Militärkapelle erwartete, die den Staatsgast mit einem Marsch begrüßte. Und doch lief hier nicht ein Edelmann den Flur hinab, sondern nur ein neuer Patient im städtischen Irrenhaus, das leider nur wir Ärzte Heilanstalt für Gemütskranke nannten. Die Kranken schien das alles nicht zu stören, sie neigten in demütiger Ehrerbietung die Häupter, was Otto mit einem rätselhaften Lächeln oder mit einer wohlwollenden Handbewegung belohnte. Am Ende des Flurs angelangt, öffnete er mit großer Selbstverständlichkeit eine Tür, durchschritt sie ohne Hast und schloss sie hinter sich.
Schwester Philomena starrte den Flur hinab, umklammerte dabei das Fläschchen Skopolamin, als hätte es ihr der Herrgott persönlich zur Aufbewahrung anvertraut, drehte sich dann zu mir und sah mich fragend an.
Ich sagte: »Ich denke, wir brauchen kein Skopolamin. Es sei denn, Seine Majestät weigert sich, wieder aus der Abstellkammer herauszukommen.«
Eine Weile hielt die Stille, dann flackerte die Nervosität der Unruhigen auf der Unruhigenstation im ersten Stock wieder auf. Das Spalier zerfiel unter dem Schlurfen der Pantoffeln, die Melancholischen sanken zurück in ihre Nebel, idiotisches Lachen sprang von Wand zu Wand – der Moment hatte sich im Nichts aufgelöst. Es herrschte wieder der übliche Betrieb, den Otto mit dem Paradieren der Paranoiden unterbrochen hatte, und ich fragte mich, wie lange Ottos Stolz ihm verbieten würde, die Kammer als Trottel zu verlassen, die er als König betreten hatte. Damals war Otto für mich einer von viel zu vielen, die aufgrund mangelnder Heilungsaussicht hier ihr neues Zuhause fanden. Und so übertrug ich die Daten der Gendarmerie, die ihn an der Grenze aufgegriffen hatte, auf ein Krankenblatt: Otto Witte, geboren 16. Oktober 1871, Magdeburg, Deutsches Reich. Tatsächlich sah ich ihn an jenem Tag nicht mehr, und wann immer er aus der Kammer geschlichen war, die Barmherzigen Schwestern hatten für seine Einkleidung gesorgt und ihm ein Bett in einem der Schlafsäle zugewiesen.
Am nächsten Morgen stellte ich Otto meinem Doktorvater, Professor Theodor Meyring, vor, dessen medizinisches Talent ich sehr achtete, und das nicht nur, weil er in mir ebenfalls ein großes medizinisches Talent sah, welches er nach Kräften fördern wollte. Für mich stand er Neuroanatomen wie Flechsig oder Hitzig in nichts nach, und es erfüllte mich mit Stolz, dass ich ihm am Mikroskop assistieren durfte.
»Ein neues Gesicht«, bemerkte Professor Meyring, während er seine kleine runde Brille abnahm und begann, sie abwesend mit einem Taschentuch zu putzen. »Nun, lieber Schilchegger, wie lautet der Befund?«
Meyring fragte nicht nach Ottos Namen, er fragte niemals nach Namen, nur nach Befunden. In der Wissenschaft gab es Namen nur dann, wenn ein Arzt einen Befund dechiffrierte oder einen Heilungsweg aufzeigte. Dann gab er der Krankheit seinen Namen.
»Wahnvorstellungen. Der Patient glaubt, König von Albanien zu sein.«
Professor Meyring putzte weiterhin seine Brille und antwortete knapp: »Wie originell.« Ohne aufzusehen fragte er mich: »Wie lautet Ihre Diagnose?«
»Neurosyphilis.«
»Hm, hm.«
Meyring putzte seine Brille, schien in seine Gedanken versunken und verunsicherte mich, weil es mich immer verunsicherte, wenn er sich mit der Antwort Zeit ließ. Endlich steckte er das Taschentuch ein, setzte sich die Brille vorsichtig auf und sah mich ruhig an. »Bergersches Zeichen?«
Ich räusperte mich, dann trat ich ans Bett, beugte mich zu Otto hinab und starrte in seine Augen … eigenartig, wie blau sie waren. Selten bei jemandem, der dunkles Haar hatte. Auch schienen sie weder verängstigt noch leer zu sein, was meine Nervosität vor meinem Doktorvater nur noch steigerte, da ich damit beschäftigt war, seinem neugierigen Blick auszuweichen, statt nach Anhaltspunkten für eine Dilatation zu suchen.
»Nun, lieber Schilchegger?«
»Ich … ähm, bin nicht sicher, Professor …«
Professor Meyring trat nur einen Schritt näher heran und beugte sich ein bisschen herab, immer darauf bedacht, den nötigen Abstand zwischen sich und dem Patienten zu wahren. Otto behielt mich im Blick, und dass mir das so viel ausmachte, ärgerte mich immens. Das war unwissenschaftlich.
»Nun, ich sehe nichts, Schilchegger.«
Otto schien die Antwort zu amüsieren, mich nicht. Mein Ärger auf den Patienten wuchs im selben Maß wie der auf mich selbst, da ich nicht Herr meiner Emotionen war. Wie sollte ich ein Mediziner von Rang werden, wenn mich bereits ein Taugenichts wie Otto Witte aus der Bahn warf?
Ich sagte: »Möglicherweise D. P.«
»Hm, hm.«
Einen Moment blieben wir schweigend vor Ottos Bett stehen, dann drehte sich Professor Meyring zu mir und antwortete: »Ausgezeichnet. Konsultieren Sie mich bitte gleich, sollte er verscheiden. Wer ist der Nächste?«
Ich deutete mit einer Handbewegung nach draußen, folgte Meyring aus dem Schlafsaal, froh, dass meine zweite Diagnose offenbar getroffen hatte, auch wenn ich spürte, dass ich Otto mit der niederschmetterndsten aller Diagnosen Unrecht getan hatte. Patienten mit unheilbarer Dementia Praecox waren Meyring die liebsten, denn hier ersehnte er sich den Durchbruch seiner Theorie, dass sich ausnahmslos alle Geisteskrankheiten als histologische Befunde im Gehirn nachweisen ließen. Es hatte in den letzten Jahren bereits Erfolge auf dem Gebiet gegeben, und Meyring hoffte, auch seinen Namen ins Scheinwerferlicht der Wissenschaft rücken zu können, und – ich gestehe – bei mir gab es ebenfalls Hoffnungen, dass in diesem Fall auch meine Karriere unter einem günstigen Stern stehen würde. Für diesen Nachweis brauchten wir Gehirne. Und da die sich unglücklicherweise erst nach dem Ableben der Kranken untersuchen ließen, bestand unser Tagwerk aus Warten und Verwalten, denn unsere Klinik war eine der modernsten im ganzen Land, und das wiederum reduzierte die Sterblichkeitsrate enorm. Wir saßen an der Quelle, aber sie sprudelte nicht, ein Umstand, der Professor Meyring bekümmerte, ebenso wie mich, seinen ersten Schüler.
Aber es gab Hoffnung.
In einem weiteren Schlafsaal führte ich Meyring zu einem Patienten, der – von paranoiden Schüben gequält – dem Personal unterstellte, dass es sein Essen vergifte. Selbst den Ordensfrauen der Barmherzigen Schwestern gegenüber war sein Benehmen unsäglich, und die Flüche, die er ihnen entgegenschleuderte, waren so beschämend, dass nur noch den ungebildetsten Pflegern seine Versorgung zugemutet werden konnte. Er hatte seit drei Tagen nichts mehr gegessen und war trotzdem immer noch kräftig genug, sich gegen jeden Versuch einer Zwangsernährung zu wehren. Ich schilderte den Fall Professor Meyring, der mir interessiert zuhörte.
»Wie lange, denken Sie, lieber Schilchegger, kann er das noch durchstehen?«
»Ich weiß es nicht. Zuweilen entwickeln die Patienten erstaunliche Kräfte.«
»Hm, hm.«
Professor Meyring sah die arme Seele, die vor uns in ihrem Bett lag, abschätzend an. »Es scheint doch, dass er sich beruhigt hat.« Er winkte einem der Pfleger zu, dass er etwas zu essen holen solle. Bald kehrte der Pfleger zurück mit einem Teller Brei, den er dem Patienten anbot. Und tatsächlich probierte der Patient den Brei, nahm den Löffel, führte ihn zum Mund, leer wieder zurück in den Teller, wieder zum Mund, zunächst zurückhaltend, dann zunehmend gieriger.
»Er isst.«
Ein Hauch Enttäuschung schwang in Meyrings Stimme mit.
Zu spät bemerkte ich, dass der Mann zwar Brei in sich hineinstopfte, ihn aber nicht herunterschluckte: Seine Wangen wölbten sich bereits wie prall gefüllte Ballons. Dann schoss er ruckartig vor und spuckte den Brei im hohen Bogen aus.
Im Gegensatz zu mir und dem Pfleger trug der Professor keine weiße Schürze, sondern nur einen tadellosen schwarzen Anzug, ein hochschließendes weißes Hemd und eine elegante Fliege. Jetzt war davon nicht mehr viel zu sehen. Grauer Brei tropfte an ihm herab, vom Scheitel bis zur Sohle. Professor Meyring reagierte bewundernswert gelassen, setzte die verschmierte Brille ab, als ihm postwendend der Breiteller gegen den Kopf flog. Aber auch das brachte ihn nicht aus der Fassung, und ich muss zugeben, ich war voll Bewunderung über die Selbstbeherrschung, die er aufbrachte.
»Es scheint, als sei der Mann etwas erregt …« Nichts an seiner Stimme verriet Ärger. »Mischen Sie bitte Hyoszin und Apomorphin. Das wird ihn beruhigen.«
»Ich kann kaum sagen, wie leid mir der Vorfall tut, Professor Meyring.«
Er winkte großzügig ab. »Nicht Ihre Schuld, Schilchegger. Ich stand einfach etwas zu nahe am Subjekt. Lassen Sie sich das eine Lehre sein. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen?«
»Aber natürlich!«
Mit großer Würde verschwand Professor Meyring, blieb am Eingang des Schlafsaales noch einmal stehen und sagte: »Ein interessanter Fall, Schilchegger. Konsultieren Sie mich bitte gleich, sollte er verscheiden.«
Augenblicklich rief ich zwei weitere Pfleger herbei, kräftige Bauernburschen. Zu dritt packten sie den Kranken, der sich wild aufbäumte, schlimmste Flüche ausstieß, spuckte, kratzte, sich ganz und gar wie ein wildes Tier benahm. Trotzdem war seine Gegenwehr nur von kurzer Dauer, die Pfleger fixierten ihn mit Gewalt auf dem Boden, sodass er aufgab und sich ruhig verhielt. Unter seinem Schlafanzug war er nur noch Haut und Knochen, wirkte wie jemand, den die Pfleger ohne größere Mühe in der Mitte hätten durchbrechen können. Ich kehrte mit einem Glas voll Beruhigungsmittel in der einen Hand, einem Schlauch und einem Trichter in der anderen zurück.
Augenblicklich begann der Mann zu betteln, zu heulen, versuchte, sich aus dem Griff der Pfleger zu winden, ohne jede Hoffnung, sich dem, was ihn erwartete, entziehen zu können. Zwei der Pfleger knieten sich auf Beine und Brust, während der Dritte seinen Kopf festhielt und mit einem Beißholz die Kiefer aufbog. Daraufhin führte ich den Schlauch in seinen Mund, schob ihn die Speiseröhre herab, setzte den Trichter auf den Schlauch und kippte das Hyoszin-Apomorphin-Gemisch hinein. Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten. Man beeilte sich, den Mann auf die Toilette zu schleppen, wo er förmlich grün anlief, während sich sein Brustkorb konvulsivisch zusammenzog, um vornehmlich Flüssigkeit, schließlich Galle zu erbrechen. Fast eine Stunde war der Mann dem Beruhigungsmittel ausgeliefert, das vor allem deswegen beruhigend wirkte, da das Erbrechen die Patienten völlig erschöpfte. Halb bewusstlos wurde der Patient zu seinem Bett geschleppt, wo er in einen unruhigen Schlaf fiel.
Er war ein Bild des Jammers, wie er dort lag in seinem Bett, dürr und verletzlich, das Gesicht mittlerweile weiß wie die Wände des Saals, sich von einer Seite auf die andere werfend. Es war, als hätte ich ein Kind bestraft, das sein Tun nicht richtig einschätzen konnte und dennoch nach den Regeln der Erwachsenen zur Rechenschaft gezogen wurde. Und obwohl die bestehende Ordnung wichtig war und unbedingt eingehalten werden musste, verspürte ich großes Mitgefühl mit dieser Kreatur. Aber das würde mit den Jahren, in denen ich zu einem Wissenschaftler heranwuchs, sicher vergehen. Ich war im Begriff, den Saal zu verlassen, als er im Schlaf leise nach seiner Mutter rief: Es stach mir tief ins Herz.
2
Der nächste Tag verschluckte jeden schönen Gedanken; es regnete aus schwarzgrauen kalten Wolken. Die Unruhigen des ersten Stocks taten alles, um uns das Leben zur Hölle zu machen. Die, die aufstehen konnten, wanderten rastlos umher, rückten Stühle oder Betten, stritten sich, entzündeten die Deckenbeleuchtung der Tagesräume oder Schlafsäle nur, um sie gleich wieder abzudrehen, hingen den Barmherzigen Schwestern wie kleine Kinder an den Kitteln oder verlangten Essen zur Unzeit. Das Licht in jedem der einzelnen Räume war trotz der großen Fenster und hohen Decken allenfalls schmutziggrau und trug zur fahrigen Weinerlichkeit der Melancholischen in einem Maße bei, dass ihr Jammern wie dauerndes Summen die Gänge erfüllte und einen bis in den letzten Winkel der Station verfolgte.
Nur zwei Patienten verhielten sich völlig ruhig. Otto war der eine. Er saß am Fußende des Bettes des Paranoikers mit der starken Abneigung gegen Brei. Der andere war der Paranoiker selbst. Und während um sie herum die Schwestern und Pfleger die fiebrig Nervösen vergebens in ihren Betten zu halten versuchten, saß Otto ruhig da, schälte einen runzeligen Apfel, gab ihn dem Paranoiker, der ihn mit großem Appetit aß. Für einen Moment dachte ich, ich hätte dieselben Halluzinationen wie einige meiner Patienten, aber es gab keinen Zweifel: Der Mann verschlang den Apfel mit Stumpf und Stiel, leckte sich die Finger sauber, wischte sie an der Bettdecke ab und gab Otto lächelnd die Hand. Der stand auf, verabschiedete sich.
»Otto?«, rief ihm der Paranoiker nach.
»Was denn?«
»Wie geht die Geschichte aus?« Otto versprach: »Morgen …«
Damit kam er auf mich zu, während seine Augen blitzeblau funkelten und sich unter seinem gewaltigen Schnauzer ein breites Lächeln abzeichnete. »Ah, Herr Schilchegger, schön, dass Sie vorbeischauen. Alfred hat Hunger.«
»Alfred?«
»Ihr Patient!«, antwortete Otto verwundert. Ich war sicher, ich hörte Ironie aus seiner Stimme, aber sein Gesicht blieb ganz Ausdruck unschuldiger Verwunderung. »Alfred. Jetzt sagen Sie nicht, Sie kennen seinen Namen nicht?« Wieder dieses Sticheln.
»Natürlich kenne ich seinen Namen!«, empörte ich mich, doch ich hielt seinem frechen Blick nicht stand: Heißes Erröten verriet meine Lüge. Der Mann, der Alfred hieß, war für mich der Paranoiker im Hungerstreik. Diagnose: hoffnungslos. Ein Fall fürs Mikroskop.
Otto lächelte immer noch: »Wie gesagt: Er hat Hunger.«
»Wie haben Sie das gemacht?«, fragte ich.
Otto zuckte mit den Schultern: »Ich weiß nicht, was Sie meinen. Er hat schon die ganze Zeit Hunger. Sie müssen ihm nur etwas geben.«
Damit ging er zurück in seinen Schlafsaal und ließ mich unschlüssig zurück. Da saß er nun, der Paranoide, der Alfred hieß, völlig ruhig in seinem Bett und sah mich neugierig an. Er hatte Hunger? Nicht zu fassen. Gestern noch rief er nach seiner Mutter, so geschwächt, dass ich glaubte, er würde keine zwei Tage mehr leben, und heute hatte er Hunger. Ich rief nach einem Pfleger, ließ mir einen Teller Milch mit darin eingeweichtem Brot und einen Löffel bringen, setzte mich an Alfreds Bett und bot ihm das Essen an.
Er nahm es und warf es mir an den Kopf.
Wutentbrannt sprang ich auf, unterdrückte den Reflex, Alfreds dürren Hals mit meinen Händen zu umschließen, verließ energischen Schrittes den Schlafsaal und fand Otto eine Tür weiter in seinem Bett, die Hände bequem hinter dem Kopf verschränkt, scheinbar gedankenverloren aus dem Fenster blickend. Erst als ich vor seinem Bett stand, die Haare milchverklebt, mit Brotbröckchen auf meiner besten Anzugjacke und dem unangenehmen Gefühl von Flüssigkeit, die in meiner Hose versickerte, drehte sich Otto mir zu. Seinem Gesichtsausdruck war nichts zu entnehmen. Meinem schon. Ich zischte: »Sagten Sie nicht, Alfred habe Hunger?!«
»Ja.«
»Möglicherweise fällt Ihnen an mir etwas auf?!«
Otto schwieg.
»Nicht?! Dann will ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen: Sie haben mich angelogen!«
Otto nahm seine Hände hinter dem Kopf hervor und richtete sich auf. Instinktiv wich ich einen halben Schritt zurück.
Er sagte ruhig: »Alfred hat Hunger. Großen Hunger sogar. Er hat seit Tagen nichts mehr gegessen. Wie können Sie als Mediziner behaupten, dass er keinen Hunger habe?«
Otto brachte mich aus dem Konzept, immerhin so gründlich, dass ich meinen Ärger über Alfred vergaß. »Aber das behaupte ich doch gar nicht!«
»Und warum nennen Sie mich dann einen Lügner?«
»Ich …«
Schlagfertigkeit war noch nie meine Stärke. Ich musste auf Diskussionen vorbereitet sein, sie gedanklich durchgespielt haben und darauf hoffen, dass sie einen gewissen Themenkorridor nicht verließen. Der freie Lauf der Gedanken war mir unheimlich, da ich dieser Dynamik nichts entgegenzusetzen hatte. Ich liebte die Ordentlichkeit der Wissenschaft, das Katalogisieren der Erkenntnisse, die Wiederholbarkeit der Experimente, den beruhigenden wissenschaftlichen Boden, den man unter den Füßen spürte, wenn man sich nur einer Sache widmete. Hier stand ich nun und wusste keine Antwort, und mit jeder Sekunde, die verstrich, verpasste ich die Möglichkeit, ohne einen gewissen Gesichtsverlust einfach zu gehen. Erwartete er eine Entschuldigung von mir? Ein Arzt, der sich bei seinem Patienten entschuldigte? Das schien absurd.
»Und warum hat er bei Ihnen gegessen?«, fragte ich.
»Weil er Hunger hatte.«
»Und bei mir hatte er keinen Hunger?«
»Doch.«
Das Gespräch lief nicht zu meiner Zufriedenheit, und mich überkam das Gefühl, mich zum Narren zu machen. Ich fragte einen Mann, der sich für den König von Albanien hielt, warum ein anderer, der sich von allem verfolgt fühlte, nicht auf medizinische Betreuung ansprach. Einmal mehr wurde mir bewusst, wie weit ich noch davon entfernt war, ein guter Wissenschaftler zu sein.
Otto lächelte. »Jetzt fragen Sie sich sicher, warum er Ihnen den Brei an den Kopf geworfen hat und mir nicht?!«
»Nein, das tue ich nicht!«
Ich drehte mich um und ging erhobenen Hauptes.
3
Wie zur Strafe auf die nicht eben intelligente Replik blieb das Wetter in den folgenden Tagen miserabel, was die Stimmung im ersten Stock der Unruhigen zu einer echten Geduldsprobe machte. Die in schmucklos dunkle Arbeitsanzüge gekleideten Patienten geisterten durch die Flure, verfolgt von weiß gestärkten Barmherzigen Schwestern, die ihnen nachschwebten und sie zurückführten in die Tages- oder Aufenthaltsräume. Pfleger gingen in solchen Zeiten ruppiger mit Querulanten um als sonst, und es waren üblicherweise Tage wie diese, die sie zur Kündigung ihrer ohnehin schlecht bezahlten Stellung reizten, sodass wir kurzfristig in Personalnotstand gerieten und selbst bei den Barmherzigen Schwestern unchristlich schlechte Laune aufzog. Mir blieb keine Wahl, als in dieser Situation die Notbremse zu ziehen, und so beruhigte ich die schlimmsten Quengler großzügig mit Chloralhydrat, sodass auch schon bald ein unangenehmer Geruch die Luft der Abteilung schwängerte. Das erfreute niemanden, aber endlich kehrte Ruhe ein; Zeit, die ich zu nutzen wusste. Der chloralhydrierte Schlaf erlaubte mir, mich meinen Studien zu widmen: oben im zweiten Stock, in den Studierzimmern, die Professor Meyring eigens dort hatte einrichten lassen, um in Ruhe nach den Zeichen für Schwachsinn Ausschau zu halten, die sich unter dem Mikroskop vor uns verbargen. Dort traf ich auch meinen Doktorvater, und wir arbeiteten stundenlang, ohne ein Wort zu verlieren. Viel später fragte Meyring mich nach Alfred und seinem Gesundheitszustand, und ich berichtete ihm, dass sich der Mann erholt habe, nachdem der Patient, der sich für den König von Albanien halte, ihn dazu gebracht habe, wieder Essen zu sich zu nehmen.
»Interessant«, murmelte Meyring und äugte angestrengt durch das Mikroskop. »Und beide erfreuen sich bester Gesundheit?«
»Ja«, antwortete ich.
»Hm, hm …«
Professor Meyring betrat so gut wie nie den ersten Stock, es sei denn, es gab einen interessanten Neuzugang oder einen interessanten Abgang. Und nach Alfreds unmöglichem Benehmen konnte ich gut verstehen, dass ein Mann seines Formats die Station mied. Der Professor war ein Berufener der Wissenschaft, es stand außer Frage, dass man ihm den kleinlichen klinischen Alltag vom Hals hielt. Die Aufgabe war größer als wir beide zusammen, ihr zu dienen vornehmstes Ziel. Ich genoss die stillen Stunden der Forschung und liebte es, assistierend akribische Tabellen zu erstellen, die unseren Weg durch die Wissenschaft markierten.
Ein schwarzgrauer Tag war bereits einer mondlosen Nacht gewichen, als wir unsere Studien beendeten und uns verabschiedeten. Draußen riss ein starker Wind die Wolken auseinander, und die Vorstellung, jetzt noch mit dem Fahrrad nach Salzburg zu fahren, in mein kleines Zimmer, in dem niemand auf mich wartete, bereitete mir wenig Behagen. Und so zog ich es vor, in meinem Bereitschaftsraum zu schlafen, welcher ebenfalls im zweiten Stock lag. Die Schwestern und Pfleger hatten hier ebenfalls ihre Zimmer, aber als ich auf den Flur trat, schimmerte unter keiner der Türen Licht hindurch. Eine gespenstische Ruhe schien das ganze Haus zu umarmen, ohne jedes Zeichen von Leben. Stirnrunzelnd stieg ich hinab in den ersten Stock, schloss die Tür zur Station auf – und auch hier umfing mich misstrauisch machende Ruhe in einem ansonsten dunklen Flur. In einem der Schlafsäle brannte Licht, hinter der angelehnten Tür glaubte ich, eine Stimme zu hören. Unwillkürlich schlich ich auf Zehenspitzen durch den Flur, der Stimme entgegen, die Schritt für Schritt deutlicher als die Ottos erkennbar wurde.
Vorsichtig spinkste ich durch den Türspalt in den Schlafsaal. Mir klappte das Kinn herunter: Alle waren dort versammelt. Die Schwestern saßen auf Stühlen, die Pfleger auf dem Boden, zusammen mit den Kranken, die keinen Platz mehr in den Betten der anderen gefunden hatten. Irgendwer hatte eine Birne aus der Deckenbeleuchtung herausgedreht, sodass es ein dramatisches Licht gab, in dem Otto stand und offenbar eine Geschichte erzählte. Einen Moment war ich versucht, die Versammlung aufzulösen, aber ich begann, ihm zuzuhören, genauso wie es alle anderen taten, schnappte nach einem Wort, und es riss mich mühelos fort in eines seiner Abenteuer.
Offenbar waren er und sein bester Freund Max in Gefahr geraten, und Max befand sich jetzt in einer ausweglosen Situation, die ihm nichts als den Tod einbringen würde. Gebannt lauschte ich Ottos Stimme, die mich in einen geheimnisvollen Orient entführte, in ein Schloss, in dessen Kerker Max saß, einige Stunden vor Tagesanbruch. Dort sah ich ihn stehen, die Finger um die Fenstergitter geklammert. Draußen – geschützt von der Dunkelheit – versteckte sich Otto, der seinem Freund Wasser und Essen durch das Gitter reichen wollte, aber Posten entdeckten ihn und eröffneten sogleich das Feuer.
Ich konnte die Büchsen donnern hören, hörte Ottos rasche Schritte durch ein dichtes Unterholz, verfolgt von Männern in luftigen weißen Gewändern, mit dunklen Gesichtern, bewaffnet mit Krummsäbeln und Gewehren. Ich hörte Max schreien: »Lauf, Otto, lauf!«, dann wieder Schüsse und Stimmen in einer fremden Sprache. Ich spürte förmlich, wie mir Äste ins Gesicht schlugen, wie die Häscher mir immer näher kamen, wie ich in panischer Flucht in einen wilden Fluss sprang, um von der Strömung augenblicklich mitgerissen zu werden. Wirbel zogen mich unter Wasser, Kugeln peitschten durchs Nass und zogen einen hellen Schweif hinter sich her. Dann trug mich der Strom aus dem Schussfeld meiner Feinde, und es gelang mir, mit letzter Kraft das Ufer zu erreichen.
Dann – das schien unglaublich –, kaum der Gefahr entkommen, stürzte ich ihr ohne zu zögern wieder entgegen, denn mein bester Freund Max saß immer noch in seinem Kerker, und das, was ihn jetzt erwartete, war zu schrecklich. Ursprünglich hatte der böse Schlossherr versucht, Max in seinem Kerker verhungern zu lassen, doch jetzt ging ihm sein schändlicher Plan nicht schnell genug. Nun befahl er seinen Schergen, Max jede Nacht um ein Uhr einen Dolchstich zuzufügen, beginnend mit dieser Nacht.
Wieder stand ich vor den Mauern des Schlosses, die sich uneinnehmbar vor mir aufbäumten, an ihren Zinnen bewacht von verschlagenen Wächtern, die nur darauf warteten, mir den Garaus zu machen. Erfreut stellte ich fest, dass die Mauern nur schlecht verfugt waren, und so begann ich – leise wie ein Insekt – den gefährlichen Aufstieg, bis ich den oberen Mauerrand erreichte und in einem günstigen Augenblick – von den Wachen unbemerkt – die Zinnen überwand und in das Schloss eindrang. Dort sah ich allerlei Reichtum: Gold, Silber und wertvolle Gemälde. Ich suchte eine Waffe, um damit Max aus seiner misslichen Lage zu befreien. Aber die Situation war wie verhext – es gab nichts, was ich für einen Angriff hätte nutzen können, und schon waren Schritte auf den weitläufigen Gängen zu hören. Hinter mir gab es keinen Ausweg, nur eine Tür zu meiner Linken. Dort sprang ich hinein und verriegelte das Schloss.
Doch man hatte mich entdeckt. Sie versuchten, die Tür mit Gewalt zu öffnen – rasch sah ich mich in dem Zimmer nach einer Fluchtmöglichkeit um, aber der Raum war fensterlos, hatte nur eine einzige Tür, und vor der standen meine Häscher. Nichts konnte mir als Waffe dienen, denn hier standen nur ein weiß gedeckter Tisch, ein paar Stühle und Teppiche, die man an die Wände gehängt hatte. Was war jetzt zu tun? Was konnte ich machen? Schon brachen die Scharniere aus dem Mauerwerk, die Tür würde nur noch wenige Momente halten, als ich den rettenden Einfall hatte!
Ein donnerndes Husten ließ den ganzen Schlafsaal zusammenzucken, amüsiertes wie erschrecktes Gemurmel huschte durch die Reihen, weil einer der Melancholischen sich vor lauter Aufregung verschluckt hatte und rotgesichtig nach Luft rang, während man ihm wohlwollend auf den Rücken schlug. Auch ich war zusammengefahren, fühlte Ärger in mir aufsteigen, von dem ich nicht wusste, ob er der Unterbrechung der Geschichte galt oder mir selbst, der ich wie ein dummer Schulbub an der Tür stand und lauschte. Jedenfalls nutzte ich den Moment, stieß die Tür auf und stand mit zwei Schritten im Raum.
»Darf ich fragen, was hier vor sich geht?«
Selten hatte ich so autoritär geklungen, und meine Stimme verfehlte nicht ihre Wirkung: Die Barmherzigen Schwestern standen schnell auf, die Kranken verkrochen sich ängstlich unter ihre Decken.
»Es ist Bettzeit! Ich darf also bitten!«
Die Versammlung löste sich in Windeseile auf, die fehlende Birne wurde flugs wieder in die Fassung gedreht. Otto schien weder missmutig noch amüsiert über meinen Auftritt, sondern ging ohne weiteres Aufheben ins Bett. Ich löschte das Licht – die Ordnung war wiederhergestellt.
Erst in meinem Zimmer, als ich den Anzug ablegte und mich für die Nacht fertig machte, fragte ich mich, welchen rettenden Einfall Otto wohl gehabt haben mochte, eingesperrt in einem Zimmer ohne Ausweg und Waffen, nur Sekunden, bevor man ihn schnappen würde. Es fiel mir keiner ein.
Eine ganze schlaflose Nacht lang nicht.
4
Eigentlich war ich kein sonderlich launischer Mensch, da ich wie Meyring die Meinung vertrat, dass Launen die Arbeit eines Wissenschaftlers sabotierten. Alle Emotionen waren hinderlich, da sie die Ordnung wie Schnee in einer Glaskugel durcheinanderschüttelten und stringente Lösungen niemals aus einem Chaos geboren wurden. Unterwarf man übermäßige Regungen jedoch dem ordnenden Willen, besiegte man auf diese Art ausschweifende Gedanken, die vom Ziel seiner Anstrengung fortführten. Oder wie es Professor Meyring ausdrückte: Ein Feuer löscht man nur, wenn man Wasser zu einem Strahl kanalisiert.
Es war wohl meiner Unerfahrenheit zuzuschreiben, dass mir dies dann und wann nicht in dem Maße gelang, wie ich es für mich selbst gewünscht hätte, aber was mich an diesem regnerischen Morgen am Wickel hatte, sprengte doch meine begehrte innere Ordnung in Stücke. Ich brannte lichterloh vor schlechter Laune, und ich gab mir keinerlei Mühe, das zu verbergen. Ich wichste nicht meinen Schnauzbart, den ich mir nach der Mode des deutschen Kaisers stehen ließ, verzichtete auf meine morgendlichen Kniebeugen, stieß mir den Zeh an einem Stuhl, was zu einem Wutanfall führte, den ich sonst nur von den Rebellischen unter den Unruhigen kannte, zog mir kein frisches Hemd an und vergaß, mir eine Fliege umzubinden.
So stapfte ich blass und übernächtigt über die Flure des ersten Stocks, darauf lauernd, dass es jemand darauf anlegte, einen Becher Apomorphin-Hyoszin zu schlucken. Ich machte meine morgendliche Runde, aber niemand jammerte, niemand schlich ruhelos umher, niemand drehte am Lichtschalter herum, geradeso als hätte ich Chloralhydrat ausgegeben. Genau genommen beachtete man mich nicht, weder die Patienten noch die Pfleger, selbst die Schwestern nicht, allen voran Schwester Philomena, die vorgab, mich nicht zu sehen, und dementsprechend nicht grüßte, bis ich so nahe bei ihr stand, dass selbst sie mich zur Kenntnis nehmen musste.
Ihr Gesicht blieb jedoch ausdruckslos, der Blick flog wässrig blau durch mich hindurch, und wahrte sie sonst den Anstand, wenigstens so zu tun, als würde sie mich als Arzt und Vorgesetzten respektieren, schien sie jetzt in ihre Rolle als Herrin der Station vollends hineingefunden zu haben. Möglicherweise war es meine Position als Assistenzarzt ohne Titel, der sie sich nicht unterwerfen wollte, möglicherweise fühlte sie sich mir durch viele Jahre Berufserfahrung überlegen. Möglicherweise konnte sie mir einfach nur den Buckel runterrutschen. Wer brauchte schon eine sture Schwester, deren Ignoranz einen aggressiv machte. So beschloss ich, mit gleichen Waffen zurückzuschlagen, hielt mich nicht weiter mit ihr auf und inspizierte die Räume.
Einen Moment blieb ich an Ottos Bett stehen und fragte Belangloses. Was mich jedoch wirklich interessierte, war, wie er seinen Verfolgern entkommen konnte. Und genau das konnte ich ihn schlecht fragen, würde ich mich damit doch als heimlicher Lauscher verraten und vor allem meine Autorität als angehender Arzt und Wissenschaftler untergraben. Die ganze Nacht hatte ich darüber gerätselt, aber es fehlte mir eindeutig an Fantasie, um dafür eine Lösung zu finden. Wie konnte ich es anstellen, dass er mir die Geschichte zu Ende erzählte, ohne darum zu bitten? Es musste doch möglich sein, einen Kranken, der sich für den König von Albanien hielt, zu überlisten, ohne dass er sich dessen gewahr wurde. Schließlich war er – vertraute man den Akten der Gendarmerie – nur ein einfacher Mann, ein Rumtreiber, der nicht lesen und, bis auf seinen Namen, nicht schreiben konnte. Ich war ihm intellektuell weit überlegen, sodass es nicht allzu schwer sein konnte, ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Und schon hörte ich mich beiläufig fragen: »Was war denn das für eine Versammlung gestern?«
Otto zuckte mit den Schultern. »Nichts Besonderes.«
»Ach so. Nichts Besonderes … na dann …«
Obwohl ich mein unschuldigstes Gesicht aufsetzte und konzentriert in Ottos Krankenblatt kritzelte, schien Otto meine Neugier zu spüren. Er sagte lockend: »Nur eine Geschichte. Ein Abenteuer.«
»Hm, hm …«, machte ich, kritzelnd, darauf hoffend, Otto würde von sich aus weiterreden, um das Rätsel seines rettenden Einfalls zu lüften. Aber er schwieg. Ich fragte beiläufig: »Worum ging’s denn?«
Er antwortete abwinkend: »Ach, das würde Sie nur langweilen.«
Dann machte er es sich in seinem Bett gemütlich, und ich glaubte, ein boshaftes Lächeln über sein Gesicht huschen zu sehen, bevor er demonstrativ gähnte und meinte, dass ihm nach einem Nickerchen sei. Damit drehte er sich zur Seite und ließ mich kritzelnd stehen. Wütend verließ ich den Schlafsaal, gab Schwester Philomena zu verstehen, dass ich bei meinen Studien nicht gestört werden wollte. Sie nickte knapp und verzog sich in den Tagesraum. Sie schien wütend zu sein, war aber viel zu beherrscht, um das in Worte zu fassen. Ich hatte das Gefühl, dass hier und heute jeder machte, was er wollte.
Unglücklicherweise war der Tag damit noch nicht beendet, denn Meyring bemerkte mein unordentliches Äußeres sogleich und rügte es wohlwollend. Beschämt eilte ich in mein Zimmer, band mir eine Fliege um, wichste den Bart und frischte die Pomade in meinem Haar auf. Jedoch übertrug sich meine physische Ordnung nicht auf meine psychische, ich machte so ungewöhnlich viele Fehler beim Aufstellen meiner Tabellen, dass Meyring auch dieser Umstand nicht verborgen blieb und er mich freiheraus fragte, was denn in mich gefahren sei. Ich wusste keine Antwort, und die einzige, die ich ihm hätte nennen können, nämlich, dass mich der fehlende Ausgang einer Geschichte nicht hatte schlafen lassen, war zu peinlich, um sie auch nur andeutungsweise zu erwähnen.
»Sie wissen, lieber Schilchegger, dass ich für einige Wochen nach Wien abberufen wurde?«
»Natürlich, Herr Professor.«
»Und dass ich große Hoffnung habe, dass Sie hier meine … unsere Arbeit fortführen?«
»Ich werde Sie nicht enttäuschen.«
Ich musste ob der Rüge wohl sehr mitleiderregend ausgesehen haben, denn Meyring musterte mich, lächelte dann und klopfte mir wohlwollend auf die Schulter: »Na, kommen Sie, lieber Schilchegger. Grämen Sie sich nicht. Das ist die Jugend. Wie alt sind Sie noch?«
»Fast sechsundzwanzig.«
»Na, da haben wir es doch. Sie sind ein prächtiger Schüler, lieber Schilchegger, gewissenhaft und akkurat, Ihren Altersgenossen an Ernsthaftigkeit weit voraus. Natürlich gibt es in Ihrem Alter noch Rückschläge. Aber Sie sehen, wie wichtig die innere Ordnung für einen Wissenschaftler ist. Wie sage ich immer? Wer ein Feuer löschen will, muss das Wasser zu einem Strahl kanalisieren.«
»Natürlich, Herr Professor.«
»Machen Sie einen Spaziergang, ordnen Sie Ihre Gedanken, Schilchegger. Sie werden sehen, das wirkt Wunder.«
Es schüttete wie aus Kübeln, aber ich wagte nicht zu widersprechen, und so zog ich einen Mantel an, nahm einen Schirm und machte einen Spaziergang über das Gelände. Ich ließ das zweistöckige Haus der Unruhigen Männer hinter mir, zu meiner Linken die Kirche mit dem schlanken, sehr spitzen Kirchturm, vor mir die offene Frauenabteilung, die Abteilung für Ruhige Männer, das Wirtschaftsgebäude, der Wasserturm und das Verwaltungsgebäude, allesamt weiß gestrichen und locker platziert in freundlich grüner Natur, weit entfernt von jedem Wohnhaus in der wirklichen Welt. Ein autarker Kosmos, den die Gesellschaft in unsere Hände befohlen hatte, wie eine weiß getünchte Arche, die niemals einen Hafen anlief. So weit draußen, dass kein Gitter und kein Zaun den freien Blick hinderten, aber frei waren wir nicht. Die Kranken nicht, und wir waren es auch nicht. Dieser Gedanke erstaunte mich so, dass ich mich umdrehte und für den Moment das Gefühl hatte, das Haus der Unruhigen zum ersten Mal zu sehen, ebenso wie die anderen Gebäude. Ich lächelte: Was für ein schöner Tag heute doch war! Vorerst kehrte ich bester Laune zurück ins Haus der Unruhigen, assistierte Meyring zu seiner und meiner Freude ohne jeden Fehler.
Am Ende des Tages empfahl ich mich Meyring, um noch in meiner Station nach dem Rechten zu sehen, und insgeheim erwartete ich, dass sich alle wieder in Ottos Schlafsaal versammelt hatten, um sich seine Geschichten zu Ende anzuhören. Aber nichts dergleichen fand ich vor. Im ersten Schlafsaal lagen alle in ihren Betten, grüßten freundlich und verhielten sich geradezu vorbildlich, obwohl noch ein halbe Stunde Zeit bis zur Bettruhe war.
Ich traf Schwester Philomena auf dem Flur, die mit auffallendem Interesse und einem bei ihr nie gesehenen sympathischen Lächeln nach meinen Studien und ihren Ergebnissen fragte. Nach kurzem aufgeräumtem Plausch schwebte sie davon. Jetzt war ich richtiggehend misstrauisch geworden. Ich warf einen Blick in Ottos Schlafsaal: alles ruhig. Der ganze Raum lag im Dämmerlicht der herannahenden Nacht, die Patienten schienen zu schlafen. Erst als ich das Licht kurz andrehte und entdeckte, dass wie gestern nur eine Lampe in ihrer Fassung schien, wurde mir klar, was zu so guter Laune geführt hatte: Otto hatte seine Geschichte während meiner Abwesenheit zu Ende erzählt. Und das hatte ganz offensichtlich zu allgemeiner Heiterkeit geführt. Jetzt wussten alle, wie er seinen Verfolgern entkommen war.
Alle – außer mir.
5
Zu meiner Freude erwachte ich am nächsten Morgen bester Laune und voller Tatendrang. Ich absolvierte meine morgendlichen Übungen mit großem Schwung, eilte tadellos herausgeputzt auf meine Station und begann, die Akten der örtlichen Gendarmerie zu studieren. Es war das erste Mal, dass ich ein solches Interesse an einem Patienten entwickelte. Viel verrieten mir die Aufzeichnungen nicht, außer dass man Otto an der Grenze aufgegriffen hatte, ohne Passformular, dafür aber mit allerlei wertvollem Schmuck, von dem man glaubte, dass er ihn gestohlen habe. Otto hingegen behauptete, diesen habe man ihm zu seiner Krönung geschenkt. Ein Kabel des Gendarmeriehauptmanns nach Tirana brachte Aufklärung: Einen Otto Witte kannte man dort nicht. Demzufolge war er auch nicht König von Albanien. So folgte die Überstellung in die städtische Heilanstalt, um Otto Wittes Geisteszustand prüfen zu lassen. Ich klappte das schmale Heft zusammen und runzelte die Stirn: nicht eben viel. Aber das musste nicht so bleiben.
Ich fand Otto an Alfreds Bett: Die beiden frühstückten zusammen. Die Barmherzigen Schwestern mussten Otto und Alfred diese Extravaganz erlaubt haben, da es Patienten ansonsten verboten war, im Bett zu frühstücken. Muße führte zu Übermut, und der wiederum löste die Strukturen der täglichen Routine auf. Ganz offensichtlich hatte Otto ein subversives Talent, bestehende Ordnungen zu unterwandern.
Eine Weile blieb ich in der Tür des Schlafsaales von beiden unbemerkt stehen und beobachtete sie, wie sie sich in rechter Vertrautheit Brot und Milchsuppe teilten. Dann und wann lachte Alfred amüsiert, was mich noch mehr erstaunte, da ich ihn noch nie hatte lachen sehen. Als ich näher kam, verfinsterte sich seine Miene. Otto drehte sich zu mir um und grüßte freundlich. Ich hielt genügend Abstand zu Alfred, der schon wieder verdächtig an seinem Teller herumnestelte und – wie mir schien – die Entfernung für einen weiteren Wurf abschätzte.
Ich fragte Otto: »Darf ich Sie einen Moment sprechen?«
»Selbstverständlich.«
Mit einer Geste deutete ich ihm an, dass er mir folgen solle, und führte ihn zu seinem Bett. Dieser Schlafsaal war leer, die meisten hielten sich im Tagesraum auf und wurden von den Barmherzigen Schwestern mit einfachen Arbeiten wie Bürstenmachen beschäftigt. Otto machte es sich in seinem Bett bequem und sah mich neugierig an.
»Was gibt’s, Herr Doktor?«
»Wie geht es Ihnen heute?«
»Ausgezeichnet. Wann komme ich hier raus?«
»Das hängt ganz von Ihnen ab.«
Otto lehnte sich in sein Kissen zurück. Sein dichter Schnauzbart überdeckte seine Lippen, sodass ihm eine Gefühlsregung, egal ob verärgert oder erfreut, meist an seinen Augen und den hochstehenden Wangenknochen anzusehen war. Er sagte ruhig: »Ich weiß nicht einmal, warum ich hier drin bin. Da fällt es schwer herauszufinden, was mich hier wieder rausbringt.«
»Sie sind jetzt schon ein paar Tage hier und haben wahrscheinlich auch ein paar unserer Kranken kennengelernt. Ist Ihnen im ersten Schlafsaal ein kleiner, dicker Mann aufgefallen, mit schütterem Haar und seltsam staksigem Gang?«
»Der Mann heißt Emil, Herr Doktor.«
»Gut, meinetwegen. Emil. Er hält sich für Gott.«
»Emil ist verrückt.«
»Allerdings.«
Einen Moment kehrte Pause ein. Dann fragte Otto: »Und ich halte mich für den König von Albanien, richtig?«
Ich nickte.
»Und deswegen bin ich auch verrückt?«
»Sie sind hier zur Beobachtung, Herr Witte. Wir müssen sicher sein, dass Sie weder für sich noch für andere eine Gefahr darstellen. Und wir müssen sicher sein, dass Sie sich in der Welt draußen zurechtfinden.«
Otto lachte. »Mich zurechtfinden? Seit meinem achten Lebensjahr finde ich mich zurecht.«
»Sie können weder lesen noch schreiben.«
Otto sah mich lauernd an: »Sprechen Sie Türkisch, Herr Doktor?«
»Nein.«
»Oder Rumänisch?«
»Nein, bedaure.«
»Wie steht’s mit Serbisch? Bulgarisch?«
»Nein.«
»Ich schon. Was also glauben Sie, wer sich von uns beiden in der Welt da draußen besser zurechtfindet?«
Ich hasste es, wenn Gespräche nicht so verliefen, wie ich sie mir gedanklich zurechtgelegt hatte. Und dass Otto Herr über fünf Sprachen war, die Muttersprache miteingerechnet, schockte mich geradezu.
»Es ist leicht, so etwas zu behaupten«, antwortete ich lahm.
Otto sah mich herausfordernd an. »Warum testen Sie mich nicht?«
Ich deutete ihm an, in seinem Bett auf mich zu warten, und suchte im Tagesraum nach Schwester Philomena, die – wie sie mir mal in einem ihrer äußerst seltenen menschelnden Momente anvertraut hatte – eine rumänische Großmutter hatte und Rumänisch zwar nur leidlich sprach, aber sehr gut verstand. Mit ihr kehrte ich in Ottos Zimmer zurück und ließ sie ihn etwas Einfaches fragen. Otto sprudelte nur so drauflos, sodass Schwester Philomena Schwierigkeiten hatte, mit der Übersetzung nachzukommen, und es irgendwann aufgab. Im Hinausgehen versicherte sie mir, dass Otto ausgezeichnet Rumänisch sprach und obendrein Fluchworte kannte, die sie nicht zu wiederholen gedachte. Ich war sicher gewesen, dass Otto mich angelogen hatte, da aber der Test diesbezüglich ein Fiasko war, setzte ich mich kleinlaut neben ihn und suchte verzweifelt nach einer neuen Strategie.
»Wieso glauben Sie, dass Sie König von Albanien sind?«
»Weil ich gekrönt wurde.«
»Vom albanischen Volk?«
»Natürlich vom Volk. Und von den albanischen Adligen. Ich war Otto der I. von Albanien.«
Ich seufzte: »Eines Ihrer Abenteuer?«
»So ist es.«
»Eines, das Sie mit Ihrem Freund Max erlebt haben?«
Zu meiner großen Überraschung sah ich einen tiefen Riss in Ottos Selbstsicherheit, plötzlich schien er – wenn auch nur für einen Moment – aus dem Konzept gebracht. Er verschränkte seine Arme vor der Brust, sein Blick wich meinem aus. Aber er fing sich wieder und antwortete bestimmt: »Jawohl. Mit meinem Freund Max. Max Hoffmann.«
Zum ersten Mal, seit ich Otto begegnet war, fühlte ich Oberwasser. Es gab offensichtlich einen wunden Punkt, den der unbesiegbare Otto Witte nur schwer überspielen konnte.
»Dann kann dieser Max Hoffmann Ihre Krönung bezeugen?« Otto schwieg.
»Wo ist er? Ich werde ihn gern für Sie kontaktieren, und wenn er uns Ihre Geschichte glaubhaft bezeugt, dann bin ich sicher, dass wir Sie wieder entlassen können. Also, sagen Sie mir einfach, wo ich diesen Max Hoffmann finden kann?«
Otto schwieg, aber sein Blick wirkte defensiv, verletzt.
»Ach?! Sie wissen nicht, wo Ihr Freund ist? Ihr bester Freund Max?!«
Otto antwortete nicht, und ich war zu sehr in Fahrt, um noch zu stoppen. »Ich will Ihnen mal was sagen: Es gibt keinen Max Hoffmann, ebenso wenig wie es einen König Otto gibt! Die Gendarmerie hat sich in Tirana nach Ihnen erkundigt: Niemand kennt Sie dort. Und niemand weiß etwas von einer Krönung!«
Otto drehte sich zur Seite und zog sein Laken über die Schulter: Das Gespräch war beendet. Erst jetzt bemerkte ich, wie wenig ich Herr meiner Emotionen war. Es schadete meiner Forschung, und es schadete meinen Patienten. Ich hatte einen schwachen Moment benutzt, um mich zu profilieren, und alles, was dabei herausgekommen war, war, dass ich mich niederträchtig und gemein fühlte.
Auf dem Flur flammte plötzlich Geschrei auf, sodass ich schnell aufsprang, um nachzusehen, was dort vor sich ging.
Es war ein Neuzugang.
Ein riesiger Kerl, der sich wie ein wildes Tier benahm. Nur mit Mühe und Not gelang es uns, ihn mit Skopolamin ruhigzustellen. Aber kaum ließ die Wirkung nach, begann er erneut, wild um sich zu schlagen, zu schreien und zu fluchen, sodass wir ihn wieder betäubten und anschließend auf seinem Bett fixierten.
Am Abend erwachte er ausgeruht und – wie mir schien – wiederhergestellt. Jedenfalls gaben seine Antworten auf die üblichen Fragen zur Person Sinn. Nichts deutete darauf hin, dass er erneut Opfer eines Wutanfalls werden würde, so gab ich Anweisung, seine Fesseln zu lösen. Und auch hier verhielt er sich ruhig. Bis ihm Schwester Philomena begegnete. Was auch immer er in ihr gesehen hatte, es ließ ihn völlig die Fassung verlieren, sodass er sich auf sie stürzte und mit ihr zu Boden ging. Er schrie und schüttelte sie an den Schultern, als sich die Pfleger auf ihn warfen und wüst auf ihn einschlugen.
Er bezog die Tracht Prügel seines Lebens, die Nase wurde ihm gebrochen, und er verlor vier Zähne. Dann erst gelang es mir, die Pfleger fortzuschieben und ihm in Kochsalzlösung aufgelöstes Morphium subkutan zu injizieren. Etwa zehn Minuten hielten ihn die Pfleger auf dem Boden, dann wurde seine Gegenwehr immer schwächer, bis er schließlich einschlief. Erst da fiel mir auf, dass ich die Dosis in der Hektik viel zu hoch bemessen hatte.
Nur ein Wunder würde ihn das überleben lassen.
6
Drei Tage versuchte ich, die Fassade zu wahren, aber der tiefe Schlaf des Patienten und die Sorge, ihn zu Tode gespritzt zu haben, fraßen mich von innen auf. Ich suchte Rat bei Professor Meyring, der mir mit väterlicher Fürsorge versprach, dass die Wahrheit über den Vorfall, sollte er sich zu seinem Schlimmsten kehren, nicht die Mauern der Anstalt verlassen würde. Auch tröstete er mich, dass es sich bei allem Schrecken über die Tat nur um eine unglückliche Seele handeln würde, die möglicherweise vor ihrer Zeit von ihrem schrecklichen Schicksal erlöst werden würde. So würde sie eben früher den Frieden finden, der ihr auf Erden nie vergönnt gewesen war. Als gläubiger Katholik sog ich Stärkung aus Meyrings Worten, doch befreiten sie mich nicht von einem nagenden Gefühl der Schuld. Zur wissenschaftlichen Arbeit taugte ich in dieser Zeit nicht, sodass ich auf der Station schweigend meinen Dienst tat und dabei ruhelos wie ein Wolf über die Flure und Zimmer strich. Den Patienten verlegten wir auf ein Einzelzimmer. Unzählige Male kontrollierte ich seinen Puls, unzählige Male atmete ich erleichtert durch, wenn ich ihn zu fassen bekam.
Ich richtete seine Nase, desinfizierte die frischen Zahnlücken. Und wenn ich sicher war, dass niemand in der Nähe war, sprach ich ihm gut zu. Drei Tage schlief der Mann durch, ehe er just in dem Moment erwachte, als ich einmal mehr seinen Puls kontrollierte.
Ich lächelte: »Wie geht es Ihnen?«
Er antwortete: »Gut.«
»Sie haben lange geschlafen.«
Er wirkte desorientiert, sah sich fragend um, als wüsste er nicht, wo er sich befände. Und dass seine Hände ans Bett fixiert waren, schien ihn vollends zu verwirren. Er rüttelte an seinen Fesseln und sah mich fragend an.
»Sie können sich nicht erinnern?«
»Nein.«
»Nun, Sie waren sehr erregt, um nicht zu sagen: außer sich! Wir mussten Sie zu unserem Schutz anbinden.«
Er nickte knapp. »Ich habe Hunger.«
»Ich lasse Ihnen was bringen.«
»Nein. Bitte, bringen Sie mir etwas zu essen. Bitte!«
Ich nickte verwundert, eilte hinaus und kehrte mit Brot, Käse und Milch zurück. Er versuchte sich aufzurichten, was nicht gelingen konnte, solange er am Bett gefesselt war. Einen Moment sahen wir uns an, und was immer mich bewogen haben mochte, die Fesseln zu lösen, ich hatte keinen Zweifel daran, dass er die Situation ausnutzen würde. Und so war es auch.
Er verhielt sich vorbildlich, aß vorsichtig, nachdem ich ihm erklärt hatte, was mit seinen Zähnen geschehen war. Zufrieden beobachtete ich ihn und fand, dass er aussah wie ein Kind im Körper eines fast zwei Meter großen Mannes, der mir binnen Sekunden das Genick hätte brechen können. Aber er tat es nicht. Doch warum tat er es nicht? Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr fand ich in mir die Antwort: Er vertraute mir. Und was ich noch erstaunlicher fand: Ich vertraute ihm. Dabei gab es keinen Grund für diese Basis, und doch war sie da.
Ich fragte: »Wie heißen Sie?« Er antwortete: »Joseph.«
Wir gaben uns die Hände.
Auch das hatte ich vorher nie getan. Warum eigentlich nicht? Ich stand auf und verließ sein Zimmer, wissend, dass er sich ruhig verhalten würde, solange ich in der Nähe war.
Ich fand Otto im Tagesraum beim Bürstenmachen, einer Arbeit, die er augenscheinlich hasste. Als er mich sah, huschte ein Lächeln über sein Gesicht, nur kurz, bevor er sich wieder auf seine Arbeit konzentrierte. Mir schien, dass er nicht mehr wütend auf mich war, und so tippte ich ihm an die Schulter und fragte, ob er einen Moment Zeit für mich habe. Ich führte ihn in das Arztzimmer, verschloss die Tür und bot ihm einen Schnaps an, den er begeistert annahm. Wir tranken ein Glas, die Flasche verschloss ich nicht wieder im Schrank.
»Was gibt’s, Herr Doktor?«, fragte Otto.
Ich setzte mich an den Tisch und antwortete: »Ich wollte mich für mein Verhalten entschuldigen …«
»Für was genau wollen Sie sich entschuldigen, Herr Doktor?«
»Ich verstehe nicht?«
Otto hob die Schnapsflasche an, während ich mit einem Nicken ein weiteres Glas genehmigte. Er sagte: »Sie wollen sich entschuldigen, Herr Doktor. Aber für was? Dafür, dass Sie wütend waren?«
»Ähm, ja, ich denke schon.«
»Ich nehme die Entschuldigung nicht an!«
»Nicht? Aber …«
Otto winkte ab. »Nein, denn es gibt nichts zu entschuldigen.
Wofür wollen Sie sich entschuldigen? Dafür, dass Sie Ihr Herz entdeckt haben?«
Ich war so überrascht, dass ich schnell den Schnaps an meine Lippen hob und herunterkippte, um Zeit zu gewinnen. Wieso verliefen die Gespräche mit Otto nie so, wie ich mir das vornahm?
Ich fragte: »Was meinen Sie?«
Otto sah mich spitzbübisch an. »Ich habe Sie die letzten Tage beobachtet!«
»Sie mich?«
»Aber natürlich.«
»Was haben Sie beobachtet?«
Wieder hob Otto die Flasche an, wieder erlaubte ich mit einem Nicken, dass er nachgoss. Dann sagte er: »Sie sind keine Maschine, lieber Doktor. Ich meine, Sie versuchen, eine zu sein. Wie dieser Professor. Sie sind aber nicht so. Und Sie werden es auch nie sein.«
»Ich glaube nicht, dass Sie das beurteilen können.«
»Oh, doch. Ich kann. Sie sind ein guter Mensch, Herr Schilchegger. Aus Ihnen wird nie eine Maschine.«
Mir fehlten die Worte – wie so oft leider. Und weil mir partout nicht einfallen wollte, was ich zu meiner Verteidigung hätte erwidern können, wertete Otto mein erstauntes Schweigen offensichtlich als Zustimmung und fuhr munter fort: »Irgendjemand hat Ihnen gesagt, Sie müssten Patienten wie Dinge behandeln. Wahrscheinlich dieser Idiot von Professor. Und jetzt versuchen Sie, uns wie Dinge zu sehen, aber das kriegen Sie nicht hin.«
Alles, was ich rausbrachte, war: »Professor Meyring … ein Idiot …« Ich schnellte hoch und zischte: »Das reicht jetzt! Gehen Sie zurück zu den anderen!«
Otto lächelte: »Sie sind ja schon wieder wütend! Glauben Sie, dass Professor Meyring wütend wäre, wenn ich ihm sagen würde, dass Sie, Herr Schilchegger, ein Idiot sind?«
Ich öffnete stumm die Türe, durch die Otto hindurchschritt und zurück in den Tagesraum ging. Dann schloss ich die Tür, schüttete mir einen Schnaps ein, trank ihn im Stehen und setzte mich. Ich war wütend – wie Otto gesagt hatte. Und ich war verwirrt, weil er mich auf etwas gestoßen hatte, über das ich mir nie Gedanken gemacht hatte: Würde Professor Meyring mich vor einem der Patienten verteidigen? Würde er mich vor irgendjemandem verteidigen? Und wenn es so war, dass ich mir darüber nie Gedanken gemacht hatte, warum kannte ich dann die Antwort? Gab es etwas an mir, das zu verteidigen sich lohnte?
Heute, da ich dies hier alles niederschreibe, frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn ich an einer anderen Heilanstalt Dienst getan hätte. Ohne Otto. Ohne Professor Meyring. Ohne die Barmherzigen Schwestern und die Patienten der Abteilung der Unruhigen Männer. Hätte eine andere Konstellation zu demselben Ergebnis geführt? Oder musste man im Leben auf das Glück hoffen, diese eine perfekte Konstellation zu erwischen, die einen dazu bewegt, den Vorhang zur Seite zu reißen, um zu sehen, was es noch alles gibt? Oder gab es diese Fügungen zwangsweise, da man nicht dauerhaft gegen sein Innerstes ankämpfen konnte?
Ich fand keine Antwort darauf.
7
Aber die Antwort hatte mich gefunden.
Über Nacht. So leise, so heimlich, dass ich sie zunächst nur als Unruhe empfand, als Vorfreude auf eine neue Aufgabe, als Befreiung von einer Last. Und bezeichnenderweise beherrschte mich dieses Gefühl am stärksten, als ich Professor Meyrings Koffer zu seinem Automobil trug, ihn verstaute und ihm eine gute Reise wünschte. Er war für ein paar Wochen an die Universität nach Wien berufen worden, um dort seiner Lehrtätigkeit nachzukommen, was er nur mit großem Widerwillen tat.
Meyring hatte mir den ganzen Vormittag lang die Aufgaben erklärt, die ich in seiner Abwesenheit zu erfüllen hatte, und ich hatte eifrig genickt und versprochen, allem nachzukommen, was ihm wichtig für seine Forschung erschien. Ich blickte ihm nach, als er in sein Automobil stieg und davonfuhr. Dann meldete ich mich ab und verbrachte den Tag in Salzburg, genauer in der Bibliothek der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt, einem Überbleibsel der Salzburger Universität, die vor vielen Jahrzehnten nach München umgezogen war.
Schwester Philomena nahm es mit einem Kopfnicken zur Kenntnis, denn es spielte für sie keine Rolle, ob ich da war oder nicht. Sie war die wahre Herrscherin der Abteilung der Unruhigen Männer, hart und selbstbewusst, aber doch zu gewieft, um sich mit einem Arzt anzulegen.
Natürlich war die Bibliothek beileibe nicht so gut sortiert wie die in Wien, wo ich in Rekordzeit Medizin studiert hatte, wo ich Meyrings Adlatus wurde, sein bester Schüler, dessen Noten nicht seiner Genialität, sondern seines unbändigen Fleißes wegen herausragten und, wie ich vermutete, durch Meyring obendrein wohlwollend zensiert wurden. Er war überall – nur mich gab es nicht.
Erst jetzt wurde mir bewusst, wie einseitig mein Studium verlaufen war, wie sehr ich in vorauseilendem Gehorsam die Vielfältigkeit meines Faches ignoriert hatte, nur um Meyring zu gefallen. Es war mir gleichsam Ansporn und Lebensinhalt, immer das Richtige zu tun, geringste seiner Zeichen zu deuten, bevor er sie artikulieren konnte, ja, es ging sogar so weit, dass ich seine Gesichtsausdrücke zu imitieren wusste, sodass wir uns auch ohne Worte verstanden.
Erwähnte beispielsweise ein Student die Bedeutung Pinels oder Esquirols, so schloss ich meine Lider ein wenig, und mein Mund verzog sich kaum merklich zu einem süffisanten Lächeln, gleich so, als ob man Nachsicht mit einem Mann haben musste, der einfach nicht wusste, wovon er redete. Blickte Meyring in dieser Sekunde zu mir herüber, so sah er sich selbst in mir und belohnte mich mit einem wohlwollenden Lächeln. Einen Kommilitonen hingegen, der sich für Flechsig oder Hitzig begeisterte, ermutigte ich mit offenem Blick und anhaltendem Nicken weiterzusprechen, genau wie es Meyring tat. Trafen sich jetzt unsere Blicke, so verrieten winzige Gesten der Zustimmung, dass es sich bei dem jungen Mann um ein hoffnungsvolles Talent auf dem Gebiet der Psychiatrie handelte.
Ich war sein bester Schüler, der beste, den er je gehabt hatte, und ich war vor allem ein selbst dressierter Zirkusaffe. Es ist nicht leicht, sich das einzugestehen, aber jetzt, da ich das nachholte, was ich während des Studiums hätte lernen sollen, wurde mir bewusst, dass meine Kenntnisse außerhalb der Neuroanatomie faktisch bei null lagen.
Ich fand viele Werke, die mich interessierten, und lieh alle aus: mehr Bücher, als ich tragen konnte, sodass mir der Bibliothekar und sein Gehilfe mit Bänden bis unter das Kinn vollgepackt nach draußen folgten und mir halfen, alles in eine Kutsche zu legen, mit der ich zurück zur Anstalt fuhr. Dort ließ ich die Pfleger die Bücher in mein Zimmer tragen.
Am Abend bat ich Otto Witte in mein Zimmer im zweiten Stock. Zu seiner Freude hatte ich Schnaps bereitstehen, und so saßen wir uns im Dämmerlicht der herannahenden Nacht an einem Tisch gegenüber.
»Sie fragen sich sicher, warum ich Sie eingeladen habe?«
Otto trank genießerisch den Schnaps und stellte das leere Glas auf den Tisch: »Nein.«
»Ich möchte, dass Sie mir erzählen, wer Sie sind.«
»Warum sollte ich das tun?«
»Weil es Sie hier rausbringen könnte.«
Otto lehnte sich zurück und taxierte mich. Diesmal hielt ich seinem Blick mühelos stand.
Er lächelte: »Ich würde alles tun, um hier rauszukommen.«
Ich nickte: »Ich weiß. Deswegen gibt es eine Bedingung!«
»Welche?«
»Die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Sie fügen nichts zu, lassen nichts weg.«
Otto zögerte keinen Moment: »Einverstanden.« Ich reichte ihm die Hand: »Ehrenwort!«
Otto schüttelte sie. »Ich werde Sie nicht belügen.«
»Warum glauben Sie, dass Sie König von Albanien sind?«
Otto zögerte einen Moment, dann antwortete er: »Die Wahrheit ist: Ich bin nicht König von Albanien …«
Ich fühlte Enttäuschung und auch Erleichterung. Ein verwirrendes Gefühl, denn ich hatte erwartet, dass Otto auf seinem Status beharrte.
»Aber ich war es. Für fünf Tage.«
Aufmerksam suchte ich in seinem Gesicht nach Zeichen von Arglist, fand aber nichts außer aufmerksamen blauen Augen, die mich anzulächeln schienen. Ein paar Momente gab es nichts als Stille zwischen uns, dann beschloss ich, ihm zu glauben. Vorerst. Ich stand auf, holte eine Petroleumlampe aus einem Schrank und entzündete sie. Jetzt hatten wir Licht nach Ottos Geschmack.
Ich sagte: »Wir haben viel Zeit. Ich will alles hören. Die ganze Geschichte. Und wehe, Sie lügen mich an.«
Otto schüttelte den Kopf: »Ich werde Sie nicht belügen.«
»Gut. Wie wird man König von Albanien?« Otto lachte.
Und dann begann er, eine ganz und gar unglaubliche Geschichte zu erzählen.
KONSTANTINOPEL, 8. OKTOBER 1912
8
Lichtfinger tasteten über einen friedlichen Bosporus mit seinem klaren, nach Salz riechenden Wasser, entfachten ihn zu dem flammenden Spektakel, das der lieblichen Enge zwischen Stambul mit seinen mächtigen Moscheen, dem Topkapi-Palast und den steil ansteigenden Ufern von Galata vor langer Zeit seinen Namen gegeben hatte: das Goldene Horn. Das Feuer der aufgehenden Sonne schwappte über den Hafen von Galata, in dem ein solcher Betrieb herrschte, als ob es zuvor weder eine Nacht noch Schlaf gegeben hätte. Nahe am Ufer kreuzten unzählige Kaiks der Händler und Fischer, weiter draußen Panzerfregatten und Handelsschiffe aus aller Welt.
An Land, auf schmutzigen, schlecht gepflasterten Straßen: offene Kaufläden, Lastenträger, Verkäufer, Tagelöhner und einfache zweispännige Kutschen, in denen mal ein Efendi mit seinen Dienern vor-, mal eine zart verschleierte Dame davonfuhr. Hier pulsierte das Leben in einem scheinbar unkontrollierten Chaos, Stimmen und Geschrei irrten wie von Wind hochgepeitschter Staub durch die winklig bergauf und bergab laufenden Gässchen mit den dicht an dicht gedrängten Holzhäusern, die die Moscheen und Paläste wegen ihrer schrägen Baufälligkeit umso prächtiger aussehen ließen. Und dort – inmitten fiebriger Betriebsamkeit – gleich am Ufer, zwischen abgespannten Anhängern in einem Berg alter Säcke, lagen Otto und Max und schliefen. Und sie hätten es trotz des ruhestörenden Lärms der Arbeitenden wohl auch noch eine Weile getan, wenn Max nicht ein leises, aber sehr verbindliches Geräusch geweckt hätte: das Knurren seines Magens. Mürrisch warf er ein paar Säcke von sich, richtete sich blinzelnd auf, streckte sich und stieß schließlich Otto so lange an, bis der sich geschlagen gab und sich ebenfalls aufsetzte.
»So geht’s nicht weiter, Otto.«
»Ich weiß.«
»Ich bin heute Nacht fast erfroren. Und wir können von Glück sagen, dass das Wetter hält.«
»Ich weiß.«
»Schön, dann weißt du auch, dass wir völlig abgebrannt sind und ich Hunger habe. Kurzum: Die Situation ist eine Katastrophe. Ich fürchte, es ist so weit: Es kommt zum Äußersten …«
»Arbeiten? Kommt nicht infrage!«
»Bitte. Dann schlag was anderes vor.«
Otto erhob sich und klopfte sich den Staub von seinem zerknitterten Anzug. Max blinzelte zu ihm auf und sagte: »Wenn wir Geld hätten, könnten wir einen Satz Schwerter für die große Schwertschluckernummer kaufen …«
Otto seufzte und antwortete: »Das reicht nicht, Max. Sieh uns an: Wir sehen aus wie Bettler. Eine Schande, so was.«
Max stand ebenfalls auf, zog sein geflicktes Jackett aus, schüttelte es, dass Staub in wilden Wolken aufstob und Otto zwei Schritte zurücktrat. Die beiden sahen sich einen Moment an, und es schien, als würden sie in dieser Sekunde das Gleiche denken, nämlich, dass sie in all den Jahren niemals so abgerissen gewesen waren wie jetzt. Max’ Vollbart wirkte struppig, von der gedrungenen Bulligkeit war dank der unfreiwilligen Diät der letzten Wochen nur wenig geblieben. Es fehlte nicht viel zur schlanken Knochigkeit Ottos, und seinem ansonsten gutmütigen Blick nach zu urteilen, missfiel ihm dieser Umstand am meisten.
»Also, Otto, was sollen wir tun?«
»Mir fällt schon etwas ein. Mir fällt immer was ein.«
»Gut, ich sag dir was: Bis heute Abend hast du eine Lösung, oder wir heuern im Hafen an.«
Otto blinzelte gegen das Licht hinüber zur Galatabrücke, auf der Menschen wie Ameisen hin und her wuselten, einige zum Flanieren, die meisten jedoch ihrer Arbeit nachgehend, darunter auch die Tätigkeit ausübend, die am leichtesten zu haben und am schlechtesten bezahlt war: Lastenträger. Einen Traghöcker auf dem Rücken, ein Tragband um die Stirn gewunden, schleppten sie das, was man ihnen aufband. Und das war in den seltensten Fällen ein Korb voller Schnittblumen. Otto schüttelte sich vor Abscheu: Es musste einen anderen Weg geben.
»Wie viel haben wir noch?«
Max kramte in seiner Hosentasche und zählte Münzen. »Keine zwei Piaster«, antwortete er seufzend. »Und die eiserne Reserve. Die hast du.«
»Fabelhaft. Wir frühstücken erst mal, dann sehen wir weiter.«
Nach ein paar Schritten mischten sie sich in die wuselige Betriebsamkeit, ließen die Brücke hinter sich, schlenderten einer Treppe entgegen, die Galata mit dem höher gelegenen Pera verband, fanden ein kleines Café, vor dem ein paar Türken schweigend Mokka tranken und Wasserpfeife rauchten, und setzten sich an einen freien Tisch. Von hier aus hatten sie einen wunderbaren Blick auf das Hafenviertel und auf die Treppe, auf der dann und wann Edelmänner aus dem eleganten Pera nach Galata herabstiegen, um über die Brücke nach Stambul zu spazieren. Otto bestellte Mokka und behielt die Treppe im Blick: Er wartete auf jemanden, der ihre bescheidenen finanziellen Möglichkeiten verbessern sollte.
»Max?«
Max lehnte bequem in seinem Stuhl und genoss die wärmende Herbstsonne. »Hm?«
»Tu mir einen Gefallen und frag Mehmet, ob wir uns seinen Köter ausleihen dürfen?«
»Was willst du mit dem faulen Vieh?«
»Frag ihn bitte.«