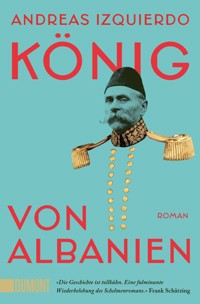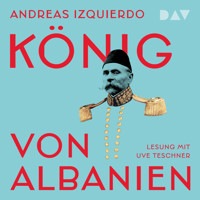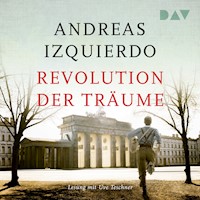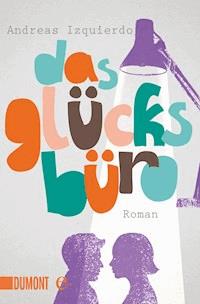11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Walter ist Postbote und ziemlich gut darin, sich unbeliebt zu machen. Mit knapp sechzig wird er schließlich in die Abteilung für unzustellbare Briefe strafversetzt: in die Christkindfiliale der Post in Engelskirchen. Natürlich ist niemand schlechter für den Job geeignet als er. Eines Tages erreicht ihn ein Schreiben an den lieben Gott. Es stammt vom zehnjährigen Ben. Er will weder Handy noch Playstation, sondern nur wissen, wie man einen Klempner ruft. Walter antwortet vage und bekommt einen zweiten Brief, in dem Ben den lieben Gott ganz schön zusammenfaltet: Warum hilft er ihm nicht? Walter beginnt einen Briefwechsel mit Ben, selbstverständlich als Gott. Er erfährt immer mehr über das Leben des Jungen, der allein mit seiner depressiven Mutter lebt. Mehr als alles andere wünscht Ben sich einen Freund. Unterdessen naht Weihnachten, und Walter ist mit seinem eigenen Familiendrama beschäftigt: Die Beziehung zu seinen Kindern ist kompliziert, geschieden ist er schon lange, und da ist diese schwere Schuld aus seiner Vergangenheit, die ihm einfach keine Ruhe lässt. Vielleicht kann Walter ja Ben helfen und Ben Walter?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Walter ist Postbote und ziemlich gut darin, sich unbeliebt zu machen. Mit knapp sechzig wird er schließlich in die Abteilung für unzustellbare Briefe strafversetzt: in die Christkindfiliale der Post in Engelskirchen. Natürlich ist niemand schlechter für den Job geeignet als er.
Eines Tages erreicht ihn ein Schreiben an den lieben Gott. Es stammt vom zehnjährigen Ben. Er will weder Handy noch Playstation, sondern nur wissen, wie man einen Klempner ruft. Walter antwortet vage und bekommt einen zweiten Brief, in dem Ben den lieben Gott ganz schön zusammenfaltet: Warum hilft er ihm nicht?
Walter beginnt einen Briefwechsel mit Ben – selbstverständlich als Gott. Er erfährt immer mehr über das Leben des Jungen, der allein mit seiner depressiven Mutter lebt. Mehr als alles andere wünscht Ben sich einen Freund. Unterdessen naht Weihnachten, und Walter ist mit seinem eigenen Familiendrama beschäftigt: Die Beziehungen zu seinen Kindern sind kompliziert, geschieden ist er lange schon, und da ist diese schwere Schuld aus seiner Vergangenheit, die ihm einfach keine Ruhe lässt. Vielleicht kann Walter ja Ben helfen – und Ben Walter?
Autorenfoto: © Niklas Berg
Andreas Izquierdo ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, unter anderem ›Das Glücksbüro‹ (2013), den SPIEGEL-Bestseller ›Der Club der Traumtänzer‹ (2014) und ›Fräulein Hedy träumt vom Fliegen‹ (2018). Zuletzt erschienen die historischen Romane ›Schatten der Welt‹ (2020), ausgezeichnet mit dem bronzenen Homer, ›Revolution der Träume‹ (2021) und ›Labyrinth der Freiheit‹ (2022).
Andreas Izquierdo
KEIN GUTER MANN
Roman
Von Andreas Izquierdo sind bei DuMont außerdem erschienen:Das GlücksbüroDer Club der TraumtänzerSchatten der WeltRevolution der TräumeLabyrinth der Freiheit
E-Book 2023© 2023 DuMont Buchverlag, KölnAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagillustration: © Andrea VenturaSatz: Angelika Kudella, KölnE-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN E-Book 978-3-8321-6080-7
www.dumont-buchverlag.de
Für Pilar
EINE FRAGE DER SCHULD
1
Lange bevor Walter aus Versehen Gott wurde, suchte seine Chefin bereits nach Wegen, ihn loszuwerden. Nicht nur, weil er ein gewisses Alter erreicht hatte und den Anforderungen seines Berufes als Postbote kaum mehr gewachsen war, sondern vor allem, weil sich die Liste der Beschwerden über ihn zu einer Fahne ausgewachsen hatte, die man, auf den höchsten Hügeln des idyllischen Ründeroths aufgestellt, im gut vierzig Kilometer entfernten Köln ebenso hätte sehen, wie man den Weg dorthin mit ihren vielen mahnenden, zuweilen auch weiß glühenden Worten hätte asphaltieren können.
Allein es half nicht.
Jeder Versuch, ihn zu entlassen, war zum Scheitern verurteilt, denn Walter war formell unkündbar und hielt sich zudem an die Regeln. Mehr noch: Er sorgte dafür, dass sich alle anderen ebenfalls an die Regeln hielten, was ständig neue Konflikte heraufbeschwor, deren Eskalation er mit den stets gleichen Worten an sich abperlen ließ: »Nicht meine Schuld!«
Eigentlich war nichts seine Schuld, weil er lediglich darauf bestand, dass sich jeder so verhielt, wie es einer Gemeinschaft zum allseitigen Vorteil gereichte. Und wenn eine Situation aus dem Ruder zu laufen drohte, fühlte er sich schon aus rein pädagogischen Gründen berufen einzugreifen, um Ordnung und Anstand wiederherzustellen.
Doch wie hieß es so schön? Dinge geschahen aus Gründen!
Auch wenn die nicht immer gleich erkannt wurden.
Die Causa Leyendecker war jedenfalls mehr als die bloße Ausweitung eines an und für sich lächerlichen Streits.
Alles begann an einem völlig verregneten Novembertag.
Frau Witzke, Zeugin jener schicksalhaften Begebenheit, konnte zu Walters Ehrenrettung bestätigen, dass ihn am Ausbruch der Feindseligkeiten keine Schuld traf, was ihn aber nicht von dem Vorwurf freisprach, eine Gedankenlosigkeit zu einer eichenharten Fehde eskaliert zu haben. Walter hätte die Sache großzügig auf sich beruhen lassen, wie Herr Leyendecker sich kleinlaut hätte entschuldigen können, aber weil der eine für den anderen in etwa so viel Verständnis aufbrachte wie ein brunftiger Widder für ein rivalisierendes Männchen, trat nichts von beidem ein.
Es pladderte an diesem Tag ohne Unterlass, kaltes, unwirtliches Wetter, zu scheußlich, um auch nur eine Sekunde vor die Tür zu gehen, es sei denn, man hatte wie Walter gar keine andere Wahl. Die Kanalisation war vollgelaufen, die Agger über die Ufer getreten, Wasser lief in Strömen von den Flanken des Tals die Straßen hinab und sammelte sich in Senken zu riesigen Pfützen.
Bis zum Mittag hatte Frau Witzke gehofft, dass die Schauer nachlassen würden, es dann aber aufgegeben und sich für den Einkauf warm und wasserfest angezogen. Sie trat just auf den Bürgersteig, als Walter vor einem der grauen, unscheinbaren Kästen am Wegesrand sein elektrisches Fahrrad anhielt, um dort seine leeren Packtaschen mit frischem Postgut aufzufüllen.
Kaum aber hatte er den Kasten geöffnet, da jagte auch schon Herr Leyendecker in seinem silbernen Golf von hinten heran und fegte dabei durch eine besonders tiefe Pfütze. Für einen Wimpernschlag wölbte sich eine schlammig braune Springflut in die Höhe, um im nächsten Moment über Walter zusammenzubrechen und ihn unter sich zu begraben.
Frau Witzke, die sich auf der anderen Straßenseite befunden hatte, wusste später zu berichten, dass der arme Walter hinter dieser Wasserwand vollständig verschwunden war, bevor er eine Sekunde später nach Luft schnappend aus ihr wieder auftauchte, nass bis auf die Unterhosen, die Post in seinen Händen nur mehr ein feuchter Klumpen. Das alles war, fand auch Frau Witzke, eine große Gemeinheit, zumal es höchstens sechs Grad Außentemperatur hatte und das Wasser sicher kein Grad wärmer war.
Walter sah empört den roten Rücklichtern des Golfs nach, der eine Straße weiter links in den Wilhelmsweg abbog, eine Sackgasse, an deren Ende Herr Leyendecker in einem kleinen, ungepflegten Bungalow wohnte. Ohne sich um die restliche Post zu kümmern, marschierte Walter ihm nach, um kurze Zeit später an seiner Haustür zu klingeln.
Herr Leyendecker öffnete und starrte Walter erstaunt an, der vor Nässe triefend und mit schlierigem Gesicht vor ihm stand und ihn mit wütenden Blicken in feine Scheiben laserte.
»Sie sind aber früh dran!«, rief Herr Leyendecker und rückte seine dicke Hornbrille zurecht.
»Was sollte das?«, zischte Walter wütend.
»Was sollte was?«, fragte Herr Leyendecker interessiert zurück.
Walter deutete mit dem Finger an sich hoch und runter. »Das!«
Herr Leyendecker schien ehrlich überfordert mit der Frage und kratzte sich an seinem ebenso spärlichen wie widerborstigen grauen Haarkranz.
»Neue Uniform?«
»Sie haben mich eingesaut!«
»Ich?«
»Ja, Sie! Gerade. Mit dem Auto!«
Herr Leyendecker schüttelte den Kopf. »Kann nicht sein!«
»Ich war dabei!«, knurrte Walter.
Sekundenlang starrte Herr Leyendecker Walter an, dann antwortete er: »Quatsch.«
»Sie leugnen es?«, fragte Walter scharf.
Herr Leyendecker kniff ein wenig die Augen zusammen. »Ich leugne gar nichts, weil es nichts zu leugnen gibt. Ich glaube, Sie nehmen sich ein bisschen zu wichtig, kann das sein?«
Ein paar Atemzüge standen sich die beiden gegenüber.
Regen prasselte aus dunklen Wolken herab und beschwor ein erstaunlich passendes Endzeitszenario herauf.
Dann aber nickte Walter.
Nicht als Antwort auf Herrn Leyendeckers Behauptung, sondern eher als Bestätigung, dass hiermit ein Krieg erklärt und die Front gezogen worden war. Er drehte sich unheilvoll schweigend um und stapfte davon. Die Gelegenheit, sich für das an ihm begangene Unrecht zu revanchieren, würde kommen.
Ganze vier Monate später.
2
Vielleicht wäre diese unglückselige Begegnung in einer richtigen Stadt mit nervös flackernden Lichtern, pulsierendem Leben und lockenden Abwechslungen von Walter wenn nicht vergessen, so doch verdrängt worden. Aber Ründeroth war nun mal Ründeroth, ein entzückender kleiner Ortsteil im Bergischen Land mit Fachwerkhäusern und Schieferwerk, zwei Kirchen – für jede Konfession eine –, mit Pflastersteinen im Zentrum und einem Kurpark samt künstlichem Teich in der Mitte und ein paar Parkbänken zum Verweilen drum herum. Eine friedliche Agger wälzte sich träge durch den Ort, um erst nach einem kleinen Wasserfall ein wenig mehr Fahrt aufzunehmen, nicht zu viel natürlich, was man durchaus als eine hübsche Allegorie für Ründerother Dramatik werten durfte. Immerhin sorgten die nahen Aggertalhöhlen im Sommer für touristische Neugierde und das bewaldete Tal wusste mit romantischer Natur zu überzeugen.
Zum Winter hin aber trudelte das Leben aus und an verregneten November-, nasskalten Dezember- oder gefrorenen Januartagen schlief es ganz ein. Selbst der Weg ins nahe Engelskirchen, dem der Ort offiziell angehörte, kam einem weiter vor als die ausgewiesenen fünf Kilometer, da man sich hier von einem Tal ins nächste schlängeln musste und außer der Agger nicht viel zu sehen bekam.
Walter mochte Ründeroth.
Er lebte in einem kleinen Häuschen am Ende einer ruhigen Gasse, hatte wenig Kontakt zu seinen Nachbarn und noch weniger zu seiner Familie, mit Ausnahme seiner Tochter Sandra. Anders als ihre Mutter und ihr Bruder, die Walters Schroffheit schon lange überhatten, besuchte sie ihn dann und wann, so wie sie es just an jenem regnerischen Tag tat, als Herr Leyendecker seine Missetat an Walter so unverschämt bestritten hatte.
An diesem Tag aber traf sie Walter noch viel übellauniger als sonst an, was sie, nachdem sie sonnenbebrillt eingetreten war, mit breitem Lächeln und übertriebener Freundlichkeit aufzufangen versuchte, ohne zu ahnen, dass Walters Tag bereits unrettbar verloren war und ihm weder der Sinn nach Konversation noch nach Nettigkeit stand.
Er saß in seinem Wohnzimmersessel, während Sandra durch das Zimmer huschte und feststellte, dass hier mal wieder Ordnung gemacht werden musste. Dann begann sie aufzuräumen, obwohl es gar nicht unordentlich war, Staub zu wischen, obwohl sich kaum welcher gelegt hatte, und über alles Mögliche zu plaudern, die Tatsache ignorierend, dass ihr Vater gar nicht antwortete. Sie redete, weil sie sein Schweigen nicht ertrug, aber nichts von dem, was sie Walter mitteilte, war für den von Belang. Weder wer gestorben war, noch wer geheiratet oder eine Affäre hatte, wessen Kinder bei einer Schulaufführung geglänzt hatten und wessen Essen auf einer Party versalzen gewesen war.
Sie wischte und räumte um Walter herum, immer auf der Suche nach dem einen Thema, auf das er reagieren würde. Bis sie endlich auf das zu sprechen kam, weswegen sie eigentlich aufgetaucht war: Weihnachten.
»Wir feiern bei Christian. Möchtest du nicht auch kommen?«
»Bin nicht eingeladen«, gab Walter murrend zurück.
»Ich lade dich ein!«
»Es ist Christians Haus, er lädt ein.«
»Er hat sicher nichts dagegen«, entgegnete Sandra defensiv.
»Warum hat er mich dann noch nie eingeladen?«, fragte Walter.
Sandra mied seinen Blick und putzte eine Stelle im Wohnzimmerschrank, auf der sich kein einziges Staubkorn mehr befand.
Nach einer kurzen Stille antwortete sie leise: »Vielleicht sollten wir die Vergangenheit ruhen lassen und wieder eine Familie sein.«
Daraufhin schwieg Walter.
Eine gute Minute hoffte sie auf eine Antwort, dann gab sie auf, verschwand in der Küche und begann, mit Töpfen und Tellern zu klappern. Er ging ihr nach und stellte sich schweigend hinter sie.
Sandra drehte sich um. »Hast du einen bestimmten Wunsch? Soll ich vielleicht noch etwas einkaufen?«
Walter schüttelte den Kopf und fragte stattdessen: »Warum trägst du eine Sonnenbrille?«
Unwillkürlich kontrollierte sie mit den Fingerspitzen deren Sitz und antwortete dann: »Winterlicht. Ich habe empfindliche Augen. Das weißt du doch!«
»Auch hier drinnen?«
Sie lächelte unsicher. »Ich lass sie lieber auf. Wenn ich sie ablege, dann vergesse ich sie später nur.«
Walter sah sie nur stumm an. Trotz der schützenden Sonnenbrille hielt sie seinem Blick nicht stand und senkte den Kopf. Da nahm er ihr die Gläser vorsichtig ab, und als sie ihren Kopf wieder anhob, konnte er ein fast schwarzes Veilchen sehen.
»Es ist nicht das, was du denkst!«, sagte sie schnell.
»Was denke ich denn?«, fragte Walter.
»Du denkst, dass das Uwe war!«
»Und? War er es?«
Sie hob an zu antworten, wagte dann aber nicht, ihren Vater anzulügen.
Walter sagte: »Er hat keinen Job und will auch keinen. Er hat keine Bildung und will auch keine. Er ist zwanzig Jahre älter als du, er treibt sich rum, säuft und bezahlt alles von deinem Geld. Und er schlägt dich, wann immer er denkt, dass du schuld bist an seinem Elend!«
»Das ist nicht wahr!« In ihren Augen schimmerten Tränen. »Er hat auch seine guten Seiten. Die Leute kennen ihn nur nicht!«
»Die Leute?«, fragte Walter.
»Du!«, zischte Sandra. »Du kennst ihn nicht! Das Einzige, was du kannst, ist, ihm die Schuld für alles zu geben!«
Walter schüttelte den Kopf. »Ich gebe ihm nicht die Schuld. Ich gebe sie dir!«
»Mir?«, würgte sie förmlich hervor.
»Du hast diesen Versager in dein Leben gelassen!«
»Er ist kein Versager!«
»Ich kenne solche Typen, Sandra. Seine Stärke ist deine Schwäche. Er lebt von dir, bis er dich zerstört hat. Dann zieht er weiter. Schneid ihn von dir ab, Sandra. Schneid ihn ab oder ….«
Tränen liefen ihr die Wangen herab. »Oder was?«
»Oder du bist tatsächlich selbst schuld.«
Sie brach in Tränen aus. »Wie kannst du nur so …, so …«
Der Satz versank in Rotz und Wasser. Ein kleines Mädchen, das sich in ihrer Hilflosigkeit nichts mehr wünschte, als dass ihr Vater sie tröstete. Sie in den Arm nahm und ihr sagte, dass alles wieder gut werden würde.
Walter aber war wütend: auf sich, auf Sandra, auf diese Made, die sich bei ihr eingenistet hatte, auf Herrn Leyendecker und im Grunde genommen auf die ganze Welt.
Er war wütend und wusste nicht, wie er daran etwas ändern konnte.
Es gab so viel Ausgesprochenes und Unausgesprochenes, das ihn daran hinderte, für seine Tochter, seinen Sohn, seinen Enkel oder seine Ex-Frau da zu sein – oder sie für ihn. Die Kluft, die sie trennte, war zu tief, als dass er sie hätte überbrücken können.
So kehrte er ins Wohnzimmer zurück.
Hörte, wie Sandra leise seine Wohnung verließ.
Sah sie, am Fenster stehend, davoneilen und wusste, dass sie für lange Zeit nicht mehr zurückkehren würde.
Er war wieder allein in seinem verwitterten Fachwerkheim, das ihm mehr Burg als Zuhause war, und blickte auf eine Welt, die ihn verlassen hatte.
Oder besser: er sie.
Was nicht einer gewissen Ironie entbehrte, denn schließlich war er doch einer von denen, die täglich diese Welt in jedes Heim brachten und dabei mehr über ihre Mitmenschen erfuhren, als diese ahnten. Postboten verwandelten nicht nur leere Briefkästen in volle, sondern konnten auch anhand der Form und des Absenders einer Sendung erraten, was in ihr enthalten war. Sie durchschauten Vorlieben und Fetische, wussten, ob man gern zu schnell fuhr oder falsch parkte, seine Familie liebte oder seinen Nachbarn hasste. Ob man ordentlich war oder schlampig, überfordert oder sorglos, seine Frau schlug, seine Kinder wusch, seinen Garten pflegte oder sein Auto anbetete: Postboten sahen es. Und was sie nicht sahen, konnten sie sich zusammenreimen.
Sie waren wie Geister, deren Namen sich niemand merkte, deren Schicksale die anderen nicht interessierten, die eigenartig vertraut und gleichzeitig vollkommen fremd waren. Dienstleute, die als selbstverständlich hingenommen wurden, täglich aufs Neue erwartet und gleich wieder vergessen.
Die Tage nach dem Streit verliefen für Walter jedenfalls wieder in altvertrautem Gleichklang. Morgens um halb sechs stand er auf, duschte, versorgte seinen schmerzenden Fuß, sprang in seine Dienstkleidung, schmierte sich für seine Tour ein paar Stullen, braute Kaffee, verschloss ihn in einer Thermoskanne und stieg dann auf ein kleines Moped, um damit zum Zustellstützpunkt in die Gerberstraße nach Lindlar zu fahren, von wo er seine tägliche Route in Angriff nahm.
Jeder Tag gleich.
Jede Woche gleich.
Jeder Monat gleich.
Walter wehte wie ein Herbstblatt durch den November und den Dezember, verbrachte ein freudloses Weihnachten ohne Familie, hörte, wie sich eine kleine Gruppe draußen an Silvester Frohes neues Jahr! zurief, und dachte nur, dass nichts an diesem Jahr neu sein würde und schon gar nicht froh.
Januarzeit war Urlaubszeit.
Ausschlafen zu Hause.
Die Welt durch ein Fenster betrachten.
In der Stille verharren.
Im Februar dann posaunte der Karneval.
Und im März endlich kehrte der Frühling zurück.
Ründeroth erwachte, reckte sich, streckte sich und blinzelte verschlafen in einen ersten blauen Himmel. Genau wie Walter, dem war, als erfüllte ein neuer Duft die Morgen.
Vier Monate waren vergangen und doch war manches wie stehen geblieben. Sandra war nicht zurückgekehrt und er verspürte deswegen erst eine große Trauer, dann eine große Wut.
Alles hätte so anders sein können.
Alles.
3
Für Herrn Leyendecker schlich sich das Unheil in Form einer geradezu grotesk wirkenden Kleinigkeit in sein Leben: Er wechselte den Mobilfunkbetreiber und bestellte eine neue SIM-Karte. Das war schon alles – und doch Auftakt eines ziemlich beeindruckenden Idiotenrennens.
Nachdem Walter ihm monatelang nur Standardpost geliefert und der Versuchung widerstanden hatte, sie in eine Pfütze zu tunken oder Schlimmeres damit anzustellen – was ganz eindeutig gegen die Regeln verstoßen hätte –, klingelte er an diesem Tag mit einem kleinen Päckchen in der Hand an der Tür des Bungalows im Wilhelmsweg und wartete, dass der Hausherr ihm öffnete.
»Ah!«, rief Herr Leyendecker erfreut. »Da ist sie ja endlich!« Er kniepte Walter vertraulich zu. »Bin schon seit zwei Tagen ohne Handy!«
Walter antwortete unbewegt: »Den Personalausweis, bitte.«
»Den Personalausweis?«, fragte Herr Leyendecker überrascht.
»Wertzustellung.«
»Aber Sie kennen mich doch?«
»Ist Vorschrift!«, antwortete Walter ungerührt.
Herr Leyendecker sah erst Walter, dann das Päckchen mit der SIM-Karte, dann wieder Walter an und wusste, dass es nur einen Weg gab, an das zu kommen, was er bestellt hatte.
»Moment!«, rief er und verschwand wieder in der Wohnung.
Er war nicht der Ordentlichste und seinen Personalausweis hatte er nicht wie die meisten im Portemonnaie, sondern irgendwo zwischen seinen Unterlagen verstaut, sodass er hektisch danach suchte, um ihn dann nach einer gefühlten Ewigkeit aus einer Schublade zu fischen. Beglückt eilte er zur Haustür, wo er feststellte, dass Walter seine Tour fortgesetzt hatte.
Am nächsten Tag stand Walter erneut mit dem Päckchen vor der Tür.
»Sie hätten ruhig warten können!«, maulte Herr Leyendecker, als er Walter geöffnet hatte.
»Können Sie sich jetzt ausweisen?«, fragte Walter kühl.
Herr Leyendecker konnte.
Walter besah sich den Personalausweis und gab ihn Herrn Leyendecker zurück. »Abgelaufen.«
Herr Leyendecker blickte überrascht auf seinen Ausweis und sah, dass er tatsächlich zwei Monate über der Zeit war.
»Na ja«, entgegnete er. »Ein Ausweis ist ein Ausweis. Und am Bild sehen Sie ja, dass ich ich bin!«
Er hielt fordernd die Hand hin, aber Walter machte keine Anstalten, ihm die SIM-Karte zu überreichen.
»Die Vorschriften sind da ganz eindeutig, Herr Leyendecker: Aushändigung nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments«, antwortete Walter ruhig.
»Aber das bin doch ich!«, rief Herr Leyendecker beinahe schon verzweifelt. »Das ist mein Haus! Und das da ist meine SIM-Karte!«
Walter blickte auf das Paket und sagte: »Noch ist es das Eigentum der Mobilfunkfirma – bis Sie mir ein gültiges Dokument zeigen!«
»Ich bitte Sie«, beschwor ihn Herr Leyendecker hilflos.
»Die Regeln sind für alle gleich, Herr Leyendecker!«, sagte Walter.
»Muss ich jetzt Ihretwegen etwa einen neuen Personalausweis beantragen?«, empörte sich Herr Leyendecker.
»Meinetwegen?«, wunderte sich Walter. »Also bitte, so wichtig bin ich wirklich nicht.«
Das schien bei Herrn Leyendecker eine Erinnerung auszulösen, denn plötzlich funkelte er Walter wütend an. »Ist es etwa wegen dieser Sache im November?«
»Welcher Sache im November?«, fragte Walter unschuldig zurück.
Herr Leyendecker antwortete nicht, möglicherweise, weil er ansonsten hätte zugeben müssen, dass er Walter übel mitgespielt hatte.
Stattdessen bat er beinahe flehentlich: »Jetzt kommen Sie schon: Ich brauche diese SIM-Karte!«
»Und ich ein gültiges Ausweisdokument.«
So standen sie sich wieder ein paar Atemzüge lang still gegenüber. Diesmal jedoch bei strahlendem Frühlingswetter und fröhlich zwitschernden Vögeln.
Schließlich fragte Herr Leyendecker ratlos: »Und jetzt?«
»Nehme ich das Päckchen wieder mit. Es bleibt sieben Tage in der Filiale, danach geht es wieder zurück.«
Herr Leyendecker schnaubte.
Dann aber hellte sich seine Miene auf. »Also ist es heute am späten Nachmittag dort?«
Walter nickte.
Ohne ein weiteres Wort warf Herr Leyendecker die Tür zu, und da Walter wusste, was er vorhatte, beendete er an diesem Tag gut gelaunt seine Runde, lieferte die Post, die er nicht hatte zustellen können, wieder in der Filiale ab und wartete draußen auf Herrn Leyendecker, der auch prompt auftauchte und hineineilte.
Normalerweise hätte man über den Umstand, dass der Ausweis abgelaufen war, hinweggesehen – wenn es denn überhaupt aufgefallen wäre –, diesmal aber waren die Kollegen vorgewarnt, und während Herr Leyendecker drinnen diskutierte, machte Walter draußen ein paar schöne Fotos von dessen silbernem Golf und schickte die dem Ordnungsamt. Denn vor der Filiale galt ein eingeschränktes Halteverbot und Herr Leyendecker hatte angenommen, er würde nur schnell mal rein- und wieder raushuschen können.
Ganz schön naiv, wie Walter fand.
Jedenfalls verließ Herr Leyendecker die Post ohne SIM-Karte, dafür aber mit einem Bußgeldbescheid über achtundsiebzig Euro und fünfzig Cent: fünfzig fürs falsche Parken, fünfundzwanzig für die Zustellurkunde und drei Euro fünfzig Cent für die Auslagen eines Schreibens, das ihm Walter ein paar Tage später recht zufrieden dreinschauend überreichte.
Sauer öffnete Herr Leyendecker den Brief und las nicht nur ordentlich eingerahmt Tag, Ort und Zeit seines Vergehens, sondern vor allem auch die Bemerkung darunter.
Beweismittel: Fotos.
Zeugen: Zusteller.
Damit waren auch für Herrn Leyendecker die Spiele eröffnet.
4
Betrachtete man Herrn Leyendeckers nächsten Zug unvoreingenommen, so kam man nicht umhin zuzugeben, dass sich darin eine boshafte Eleganz verbarg.
Herr Leyendecker pflanzte Rosen an.
Nicht nur, weil man das bei einem Mann, der seit ein paar Monaten die Frührente genoss und offenbar viel zu viel Tagesfreizeit hatte, erwartete, sondern vor allem, weil ihm über Nacht eingefallen war, wie er sich für Walters Ruchlosigkeit erkenntlich zeigen konnte.
So pflanzte er mannshohe Sträucher, aber nicht in seinem Garten oder auf seiner Terrasse, sondern rund um seinen Briefkasten. Er machte sich sogar die Mühe, Pflastersteine zu lösen, Boden auszuheben und die Löcher mit Rosenerde zu füllen, um das ausgewachsene, herrlich duftende dornige Gewächs zu pflanzen.
Kurz darauf sah Walter sich mit dem neuen Pflanzenarrangement konfrontiert. Er stand auf dem Bürgersteig und visierte skeptisch den Briefkasten an, der gut zwei Meter tief in den Rosen steckte. Die Haustür erlaubte ihm nicht, die Post darunter durchzuschieben, und sie einfach auf der Fußmatte abzulegen war verboten, denn Post musste ordentlich zugestellt werden, eine unumgängliche Vorschrift, an die Walter sich hielt.
Seufzend zupfte Walter an seinem Dienst-Kurzarmshirt, presste sich dann ganz eng an die Hauswand und schob sich langsam über den kratzigen Rauputz Richtung Briefkasten.
Etwa auf halber Strecke verfingen sich die ersten biegsamen Äste mit nadelspitzigen Stacheln in Haar und Kleidung. Mit einer Hand versuchte er, die Briefkastenklappe zu öffnen, aber auch hier griffen gemeine grüne Kraken nach ihm und wickelten sich kratzend und stechend um seine nackten Unterarme. Ohne blutige Striemen würde er nicht weiterkommen, ganz gleich, in welche Richtung er sich noch bewegte. Wieder schob sich Walter ein Stückchen vor, erreichte unter Stöhnen und Fluchen den Briefkastendeckel, nur um festzustellen, dass der sich nicht anheben ließ, weil er offenbar zugeklebt worden war.
Er mühte sich wieder aus den gewaltigen Rosenbüschen heraus, während sich überall die Dornen in ihn hineinbohrten. Schließlich aber schaffte er es doch. Er pflückte noch die mitgerissenen Stängel und Äste von sich herunter, als Herr Leyendecker voller Genugtuung die Haustür öffnete. »Hach, diese Rosen! So schön, nicht?«
Walter wahrte Haltung und überreichte ihm schweigend den Packen Post.
»Einen Augenblick, bitte!«, rief Herr Leyendecker, als Walter bereits im Begriff war, sich umzudrehen, und reichte ihm den Großteil zurück.
Walter sah ihn irritiert an.
Da grinste Herr Leyendecker und sagte: »Annahme verweigert!«
Und bevor Walter etwas erwidern konnte, fiel auch schon die Haustür zurück ins Schloss. Erst jetzt sah Walter, dass es sich bei den großen Umschlägen um Werbung handelte, die Herr Leyendecker wohl nur angefordert hatte, um sie abzulehnen. Die ganze schmerzhafte Zustellung war damit nicht nur umsonst gewesen, er durfte den ganzen Mist auch wieder mit zurücknehmen. Zähneknirschend musste Walter zugeben, dass der Tag an Herrn Leyendecker gegangen war.
Am nächsten Morgen kehrte Walter mit einer Rosenschere zurück.
Die Pflanzen erhielten einen nicht gerade fachmännischen Rückschnitt, der Deckel des Briefkastens wurde mit ein bisschen roher Gewalt geöffnet und Walter war bereits wieder verschwunden, als Herr Leyendecker etwas später neugierig aus der Haustür trat.
Mit Bestürzung entdeckte er da seine Rosen, deren Zweige gemeuchelt auf dem Boden lagen, umkränzt von abgefallenen Blütenblättern.
Das war der Tag, an dem Walters Chefin Sabine ihn das erste Mal in ihr Büro bat und ihn dringend aufforderte, sein Verhalten gegenüber Herrn Leyendecker zu überdenken. Auf diese massive Beschwerde würden bald viele weitere folgen, die wie zuschnappende Mausefallen auf Sabines Schreibtisch in die Luft sprangen und ihr die Tage ruinierten.
Walter dagegen hatte mit dem Betriebsrat gedroht und darüber hinaus nur das gesagt, was er in solchen Situationen immer sagte: »Nicht meine Schuld.«
5
So groß war der Kummer, dass Herr Leyendecker die abgeschnittenen Äste und herabgesegelten Blüten demonstrativ auf dem Boden verrotten ließ, als Fanal an die Schlechtigkeit der Welt im Allgemeinen und die der Zusteller im Besonderen.
Vielleicht hätte dieses Memento deutlicher verfangen, wenn er seinen Vorgarten in Ordnung gehalten hätte, aber in dessen verwilderter Liederlichkeit fiel der gestutzte Rosenbusch nicht einmal auf. Keiner der Nachbarn nahm ihm seine neu entdeckte Liebe zu duftender Vegetation ab. Herrn Leyendeckers Gefühl des Unverstandenseins wuchs mit jedem Tag. Und da er wie Walter das Bedürfnis hatte einzugreifen, wenn es der guten Sache diente, dachte er darüber nach, wie er alles wieder in Ordnung bringen könnte. Und kam zu dem wenig überraschenden Ergebnis: Walter musste weg!
Herr Leyendecker verbrachte von nun an seine Vormittage geduldig wartend, bis Walter die Post in der Straße eingeworfen hatte, stahl sich dann nach draußen und fischte Briefe aus den Kästen, um sie woanders wieder einzuwerfen, was ein großes Zustellchaos zur Folge hatte. Da im Gegensatz zu ihm selbst all seine Nachbarn einer Arbeit nachgingen, unterband niemand sein Treiben.
Zunächst nahmen die Nachbarn die fehlgeleiteten Sendungen noch mit einem Lächeln hin und warfen abends, wenn sie von der Arbeit zurückgekommen waren, die Irrläufer in die richtigen Briefkästen. Doch bald schon mussten sie feststellen, dass ihr Briefträger offensichtlich nicht nur einen schlechten Tag, sondern nur noch schlechte Tage hatte. Die Post war oft tagelang in der Nachbarschaft unterwegs, was zunehmend zum Ärgernis wurde und weitere Beschwerden auf Sabines Schreibtisch nach sich zog.
Walters Ehre als Zusteller war beschmutzt, denn er lieferte niemals falsch ab, was er auch all denen versicherte, die sich Tag für Tag ihre Post zusammensuchen mussten. Was ihn über alle Maßen frustrierte, war, dass niemand hören wollte, wovon er überzeugt war: dass Herr Leyendecker der Grund allen Übels war.
Das tat weh.
Eine Weile dachte Walter tatsächlich darüber nach, mit Herrn Leyendecker Frieden zu schließen, aber es widerstrebte ihm mit jeder Faser seines Seins, sich für abgeschnittene Rosen zu entschuldigen, die nur gepflanzt worden waren, um ihm das Leben schwer zu machen.
Und so spitzte sich der Streit weiter zu.
An einem Samstag fuhr Walter auf seinem Moped zum Supermarkt, wieder einmal verärgert über Herrn Leyendeckers hinterhältige Umsortierung der Post. Mit Schwung bog er auf den großen Parkplatz des Discounters, als plötzlich jemand gedankenlos zwischen zwei parkenden Wagen herausprang und ihn zu einer Vollbremsung zwang.
Quietschend und schlingernd kam Walter im letzten Moment zum Stehen und blickte in die schreckensweiten Augen von Herrn Leyendecker.
»SIE!«, schrie der wütend.
»Können Sie nicht aufpassen?«, schrie Walter genauso wütend zurück.
»Ich soll aufpassen? Sie sollten aufpassen!«
»Ich habe aufgepasst, sonst wären Sie jetzt tot!«
»Ah! Jetzt wollen Sie mich auch noch umbringen? Das könnte Ihnen so passen!«
Konnte es – so viel musste Walter zugeben. Aber er besann sich und rief gereizt: »Gehen Sie aus dem Weg!«
»Gehen Sie doch aus dem Weg!«
Sie starrten einander grimmig an.
Da legte Walter schließlich einen Gang ein, um Herrn Leyendecker zu umkurven, während Herr Leyendecker gleichzeitig aus dem Weg zu gehen versuchte, sodass Walter abermals hart bremsen musste und dabei Herrn Leyendeckers Schienenbein mit dem Reifen anstupste.
»SIE!«, giftete Herr Leyendecker erneut.
Walter verzichtete auf eine Replik, verdrehte stattdessen die Augen und wies Herrn Leyendecker mit einer übertriebenen Geste an voranzuschreiten, bevor er es sich anders überlegte und ihn vielleicht doch noch überfuhr.
Herr Leyendecker stapfte wutschnaubend davon.
Und besorgte sich einen Dobermann.
6
Knapp zwei Wochen später klopfte Walter an Sabines Büro und hörte schon an ihrem gut gelaunten Herein!, dass etwas anders war als an all den anderen Tagen, an denen sie ihn zum Rapport einbestellt hatte. Er drückte die Klinke herab und trat in ein aufgeräumtes Büro mit grauen Möbeln und gelben Wänden, in dem Sabine hinter ihrem Schreibtisch in gebügeltem Diensthemd, tadelloser Diensthose, mit akkurater Dienstfrisur und zurückhaltend geschminktem Dienstgesicht, nun ja, Dienst tat. Einzig ein buntes Seidentuch, ein für ihre Verhältnisse geradezu verwegenes Accessoire, steckte ordentlich in ihrer moderat geöffneten Bluse.
Sie saß dort, die Ellbogen auf den Schreibtisch gestützt, die Finger wie zum Gebet verschränkt, lächelte milde und gebot Walter mit einem freundlichen Nicken, sich zu setzen.
»Guten Morgen, Walter! Wie geht es Ihnen?«
Walter fand, dass so viel gute Laune am frühen Morgen ein Grund für Misstrauen war. Daher antwortete er lauernd: »Gut, warum?«
»Was macht Ihr Fuß?«
»Mein Fuß?«, fragte Walter zurück, um Zeit zu gewinnen.
Mit einer Unterbrechung brachte er jetzt seit fast fünfundvierzig Jahren den Menschen ihre Post, fünfundvierzig Jahre, in denen er bei Wind und Wetter anfangs noch einen Wagen vor sich hergeschoben hatte, später dann von seinem Elektrorad auf- und abgestiegen war. Bis heute rund zweihunderttausend Kilometer, die nicht ohne Folgen geblieben waren: Seit Monaten piesackte ihn eine Arthrose, die er aber vor den Kollegen und auch den Empfängern verbarg, weil es sie, wie er fand, nichts anging und er zudem wenig Lust hatte, sich darüber zu unterhalten.
»Was ist mit meinem Fuß?«, fragte er schließlich in Sabines vielsagendes Schweigen.
»Man teilte mir mit, dass Sie hinken?«
»Wer teilte Ihnen das mit?«
Sabine zögerte, was Walter vermuten ließ, dass sie, ewig gepeinigt von Bedenken, gerade abwog, ob sie mit der Antwort gegen Datenschutzrichtlinien verstieß oder nicht.
Dann aber antwortete sie: »Ein Kunde.«
»Sie meinen einen Empfänger?«, fragte Walter argwöhnisch zurück.
»Nein, ich meine einen Kunden, Walter. Ich weiß nicht, warum Sie sich damit so schwertun. Wir haben seit dreißig Jahren Kunden.«
»Als ich angefangen habe, und da waren Sie noch gar nicht geboren, hießen Briefträger Briefträger. Und die Menschen, denen wir jeden Tag die Post brachten, Empfänger.«
»Jetzt heißen sie Kunden. In Ihrem Fall sind es leider unzufriedene.«
Leyendecker, dachte Walter mürrisch und verschränkte die Arme vor der Brust.
Es wurde still im Büro.
Dann ließ ein letztes Röcheln der Kaffeemaschine sie beide zur Kanne blicken: Braune Schaumkronen tanzten auf einer schwarzen, duftenden Oberfläche.
Sabine lächelte versonnen. Kaffee!
Sie wandte sich Walter zu. »Kaffee?«
»Nein, danke«, antwortete er unfreundlicher als beabsichtigt.
Enttäuscht warf sie der Maschine einen sehnsüchtigen Blick zu.
»Nehmen Sie sich nur einen«, sagte Walter, doch augenscheinlich ärgerte es sie, dass er ihr in ihrem eigenen Büro eine Tasse ihres eigenen Kaffees anbot.
Sie verzichtete.
Und nahm dann das Gespräch wieder auf: »Hören Sie, diese Geschichte mit Herrn Leyendecker muss endlich aufhören.«
»Finde ich auch!«, antwortete Walter ruhig.
Sabine nickte erfreut. »Deswegen habe ich mir etwas überlegt …«
Walter starrte sie skeptisch an.
»Sie sind jetzt fast sechzig, nicht wahr?«
»Warum?«
»Da blicken Sie natürlich auf ein langes, erfülltes Arbeitsleben zurück. Vielleicht wäre es ja an der Zeit, es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen?«
»Was meinen Sie?«
»Vorruhestand!«
Walter starrte sie an. Das also war anders als an den sonstigen Anschisstagen! Sabine hatte eine Idee entwickelt, ihn loszuwerden.
»Nein, danke«, antwortete Walter abwehrend.
»Vorruhestand ist toll! Sie können Ihren Hobbys nachgehen. Müssen nicht mehr früh aufstehen. Vielleicht reisen Sie etwas, sehen sich die Welt an?«, lockte Sabine.
»Nein, danke«, entgegnete Walter knapp.
Einen Moment nahm Sabine ihn genau ins Visier, dann schoss sie ihren Trumpf ab: »Ich könnte Sie zum Amtsarzt schicken, Walter!«
Walter schwieg. Eine Arthrose im Fuß bei einem Briefträger war eine ernste Sache. So etwas konnte schnell dazu führen, für arbeitsunfähig erklärt zu werden. Und aus einer Arbeitsunfähigkeit konnte man noch schneller in das lauwarme Pinkelbecken der Frührentner geschubst werden.
»Ich hinke nicht!«, gab Walter zurück.
»Dann sagt Herr Leyendecker die Unwahrheit?«
»Nein!«, antwortete Walter bestimmt.
»Nein?«
»Er hat seinen Hund auf mich gehetzt. Der hat mich gebissen. Das ist alles.«
Ihrem Gesicht konnte Walter ansehen, dass Sie ihm nicht recht glaubte.
»Sie können sich die Merkkarte im Sortierspind gerne ansehen! Bissiger Hund!Gilt auch für die Kollegen.«
»Aber …«, begann Sabine verstört.
»Ich nehme an, seinen Köter hat Herr Leyendecker nicht erwähnt?«, setzte Walter rasch nach, die günstige Wendung für sich nutzend. »Typisch.«
»Ist das wirklich wahr?«
»Ist es.«
»Warum sollte Herr Leyendecker so etwas tun?«, fragte Sabine erschrocken.
Walter dachte kurz nach.
Und antwortete dann ungerührt: »Er ist ein schwieriger Typ.«
Walter nutzte die Gelegenheit, sprang auf und verabschiedete sich mit einem Kopfnicken. »Wenn sonst nichts mehr ist …«
Bevor Sabine antworten konnte, war er auch schon durch die Tür.
Das war knapp.
7
Das mit dem Biss war wahr.
Herr Leyendecker war schon am Montag nach dem Vorfall auf dem Parkplatz des Supermarktes stolzer Besitzer eines Dobermanns aus dem Tierheim geworden, den er in kürzester Zeit mit ein paar knackigen Befehlen steuern konnte.
Ein paar Tage später dann wartete das Mistvieh bereits knurrend und zähnefletschend im Flur, als Walter Herrn Leyendecker die Post brachte. Und obwohl Walter für einen Mann seines Alters, den zudem noch eine Arthrose plagte, erstaunlich schnell aus dem Vorgarten in Richtung des umgrenzenden Jägerzauns gesprungen war, erwischte ihn das Tier und zerbiss so lange seine Hose, bis Herr Leyendecker es am Halsband zurück ins Haus zerrte und erklärte, was die meisten Besitzer unberechenbarer Hunde in solchen Fällen erklärten: »Also wirklich, so was macht er sonst nie!«
Seitdem sah man Walter mehrfach aus dem leyendeckerschen Vorgarten sprinten, mit wechselndem Erfolg, was seine Hose betraf.
Natürlich wusste Walter, dass es so nicht weitergehen konnte, desgleichen, dass er sich nicht bei Herrn Leyendecker entschuldigen würde, genauso wenig wie der sich bei ihm. Und selbstverständlich würde Walter auf keinen Fall den Zustellbezirk wechseln, nicht nur, weil seine Route schon seit vielen Jahren seine Route war, sondern auch, weil es ihm wie eine Kapitulation vorgekommen wäre. Und mochte man Walter auch vieles vorwerfen: Feigheit vor dem Feind gehörte nicht dazu. Sabines Bemühungen, ihn zu versetzen, hatte er jedenfalls mithilfe des Betriebsrats ganz gut abwehren können.
Dennoch war der Dobermann ein Problem.
Es gab die Möglichkeit, seinerseits mit Beschwerden oder gar Anzeigen gegen das wilde Tier vorzugehen, aber Walter war sich sicher, dass Herr Leyendecker alles abstreiten und der Hund bei einer Begutachtung lammfromm und gehorsam sein würde. Am Ende würde Herr Leyendecker wahrscheinlich behaupten, dass Walter sich dem Tier gegenüber aggressiv benahm und somit einen Selbstverteidigungsreflex auslöste.
Für den Moment war es vielleicht das Beste, Herrn Leyendecker zu einer Zeit die Post zu bringen, wenn er ihn nicht erwartete, gleich morgens nämlich. Das aber war leichter gesagt als getan, denn der Weg eines Postboten war nicht zufällig, sondern von einem Computer berechnet. Die meisten Briefe aus den Verteilzentren kamen bereits als gepackte Tasche im Zustellstützpunkt Lindlar an, von einer Maschine in die richtige Gangfolge vorsortiert.
Eine Technik, die Walter nach all den Jahren immer noch faszinierte und die ihn manchmal versonnen mit dem Zeigefinger über die zarten blassorangen Strichcodierungen auf den Briefen fahren ließ, hinter denen sich die Adresse des Empfängers verbarg.
Eine Änderung der Gangfolge verlängerte unnötig den Arbeitstag, aber sie war allemal besser, als gebissen zu werden. So trat Walter dann schließlich eines Morgens um sieben Uhr seinen Dienst an, packte seine Tasche und zog die Briefe an die Anwohner des Wilhelmswegs ganz nach vorne.
Mit Erfolg.
Ein paar Tage überlistete Walter Herrn Leyendecker, aber irgendwann hatte der das Manöver dann doch durchblickt und erwischte ihn unvorbereitet eines Morgens, als er sich beinahe sorglos dem Briefkasten näherte und zu spät das boshafte Knurren des Dobermanns hinter den restlichen Rosenbüschen wahrnahm. Der Hund ging zum Angriff über, jagte Walter durch den Vorgarten und erwischte vor dem Jägerzaun nicht nur dessen Hose, sondern diesmal auch sein Bein. Mit großer Mühe gelang Walter die Flucht, mit ein paar Bisswunden in der Wade und nur noch einem halben Hosenbein. Das andere steckte dem Drecksköter zwischen den Lefzen.
Walter war wütend.
Er hatte es wirklich im Guten versucht, aber was zu viel war, war zu viel! Da er seit ein paar Monaten Oxycodon gegen die schmerzende Arthrose einnahm, das dann und wann auch die Verdauung stören konnte, hatte er zu Hause starke, rezeptpflichtige Abführtropfen vorrätig, mit denen er noch am selben Tag ein leckeres Steak großzügig einrieb.
Am nächsten Morgen entdeckte er den Dobermann rechtzeitig hinter den Rosenbüschen und warf ihm das Steak zu, das dieser in Sekunden auffraß. Gerade genug Zeit für Walter, zum Briefkasten und zurück auf den Gehsteig zu hetzen.
Zufrieden lächelnd setzte er seine Runde fort und stellte sich vor, wie Herr Leyendecker seinem Hund mit Putzlappen und Eimer nachlief, um das Desaster in seiner Bude wieder in den Griff zu bekommen. Er war sich sicher, dass Herr Leyendecker den Dobermann nicht mehr vor die Tür lassen würde, denn wo ein Steak herkam, konnten noch viele andere herkommen.
Tags darauf kehrte Walter dann zur alten Gangfolge zurück und erreichte das Haus am Ende des Wilhelmswegs zu der üblichen Zeit. Vorsichtig blickte er sich um, suchte Vorgarten wie die Rosenbüsche nach verräterisch spitzen Ohren und tückischen kleinen Augen ab, konnte den Dobermann aber nirgendwo entdecken.
Dann aber flog die Haustür auf und Herr Leyendecker schoss händefuchtelnd hinaus in seinen Vorgarten.
»SIE! … SIE!«, rief er wütend.
Walter blieb vorsichtshalber hinter dem Jägerzaun stehen – auch wenn der Dobermann nicht zu sehen war.
»Herr Leyendecker …«, antwortete Walter bedächtig.
»Sie haben meinen Hund vergiftet!«, schrie der.
»Ich?«
»Ja, Sie!«
»Was hat er denn?«, fragte Walter, so unschuldig er nur konnte.
»Das wissen Sie am besten!«
Walter schüttelte den Kopf. »Ich habe wirklich keine Ahnung …«
Herr Leyendecker drehte sich zum Eingang, wo prompt der Dobermann erschien.
»Der sieht doch ganz munter aus«, stellte Walter nüchtern fest.
Aber da hockte sich das Tier auch schon hin, um mit zitternden Beinen von sich zu geben, was das Abführmittel seinem Gedärm an Aufruhr verursacht hatte.
»Oh, nein! Nicht schon wieder!«, schimpfte Herr Leyendecker.
Rasch lief er dem Hund entgegen.
Hielt plötzlich inne.
Fasste sich ans Herz und ging mit einem Stöhnen in die Knie.
Walter, dem das ganze Spektakel bis dahin ausgesprochen gut gefallen hatte, erschrak. Ohne weiter darüber nachzudenken, sprang er über den Zaun und packte Herrn Leyendecker unter den Armen, bevor der zu Boden sinken konnte.
Vorsichtig setzte er ihn ab und knöpfte ihm den Hemdkragen auf.
»Das Herz?«
Herr Leyendecker nickte.
»Nehmen Sie Medikamente?«
Herr Leyendecker schüttelte den Kopf.
Walter zückte sein Handy und rief den Notarzt an.
Dann wandte er sich wieder Herrn Leyendecker zu: »Der Krankenwagen ist in ein paar Minuten da! Halten Sie durch!«
Herr Leyendecker nickte wieder.
Endlose Minuten verstrichen.
Walter hielt Herrn Leyendecker fest, der mit halb geschlossenen Augen versuchte, ruhig zu atmen. Das Scharmützel hatte mit einem Mal einen schalen Beigeschmack. Walters Gedanken kreisten, bis er sich gefährlich der einen Frage näherte, die ihm schon beinahe sein ganzes Leben den größten Kummer bereitete.
Das hier war doch nicht seine Schuld.
Bestimmt nicht.
Oder?
Schließlich flüsterte er: »Herr Leyendecker?«
Der nickte sachte, hörte zu.
»Wir müssen damit aufhören …«
Er nickte.
»Das ist es nicht wert.«
Wieder ein Nicken.
Schon hörte Walter ein schmetterndes Martinshorn herannahen und sah ein paar Sekunden später einen Rettungswagen in den Wilhelmsweg hineinstechen, der vor dem kleinen Bungalow zum Stehen kam. Arzt und Sanitäter sprangen heraus und übernahmen die Versorgung.
Walter stand ein wenig verloren nebendran und beobachtete, wie die Mediziner Puls, Blutdruck und Herztöne kontrollierten, den Patienten an einen Tropf anschlossen und ihm gezielt Fragen stellten. Dann wurde Herr Leyendecker auf eine Trage geschnallt und in den Fond gehoben. Mittlerweile waren auch einige Schaulustige dazugestoßen, die leise miteinander tuschelten.
»Kommt er durch?«, fragte Walter den Notarzt, als der bereits im Begriff war, wieder in den Rettungswagen zu steigen.
»War nur eine Ischämie. Hatte er viel Stress in letzter Zeit?«
»Stress?« Walter schluckte.
»Der Stress könnte ihn das nächste Mal umbringen«, sagte der Notarzt.
Walter sah zu Herrn Leyendecker, der jedes Wort gehört hatte. Seinem wütend flackernden Blick war unschwer zu entnehmen, was er gerade dachte. Eben noch halb ohnmächtig war in Herrn Leyendecker mit der ausgesprochenen Diagnose des Notarztes neuer Kampfgeist erwacht: Es war noch nicht vorbei.
8
Die Beharrlichkeit, mit der sich die beiden duelliert hatten, sorgte in Ründeroth für einiges amüsiertes Getuschel. Man hegte zunächst Sympathien für Walter, den die meisten natürlich vom Sehen kannten, so wie man einen Postboten eben kannte, und der den Bonus des seriösen Amtsmannes für sich verbuchen konnte.
Herr Leyendecker dagegen wurde von den meisten als wunderlich empfunden. Mit seiner Ischämie allerdings erfuhr er ein schönes Upgrade, weil aus der Komödie eine Tragödie hätte werden können und Herr Leyendecker doch nur ein einsamer Mann war, der Rosen liebte. Plötzlich war man der Meinung, dass man von einem Postbeamten etwas mehr Vernunft erwarten konnte, vor allem, wenn alte Leute kauzig wurden.
Walter spürte den Umschwung an den Blicken seiner Empfänger, an den kurzen, ernsten Grüßen, die ihm wie Mahnungen entgegenwehten. Er versuchte sie zu ignorieren, doch der Magen wurde ihm flau davon.
Schließlich aber trugen wechselvolle Tage die Erinnerung an Herrn Leyendeckers Zusammenbruch davon, die Mienen der Empfänger hellten langsam auf, die Begrüßungen wurden wieder freundlicher, Walters Magen begann sich zu beruhigen.
Eine Woche verging.
Zehn Tage.
Und dann, an einem Montagmorgen, als Walter aufstand und sich eine Tasse Kaffee brühte, stellte er fest, dass es ihm wieder gut ging, dass er fast schon wieder der Alte war und das ganze Wochenende nicht einmal an Herrn Leyendecker gedacht hatte.
Recht aufgeräumt trat er so seinen Dienst an und wurde kurz nach seiner Ankunft im Zustellstützpunkt in Sabines Büro bestellt. Wo er zu seiner Überraschung auch Detlef Kröber antraf, seinen Betriebsrat, der ihn mit einem so knappen Kopfnicken grüßte, dass Walter sich innerlich wappnete.
»Guten Morgen, Walter!«, grüßte Sabine freundlich.
»Guten Morgen«, grüßte Walter vorsichtig zurück.
»Setzen Sie sich doch!«
Sie nahmen alle Platz.
Die Kaffeemaschine gurgelte, letzte Tropfen fielen in die Kanne und verströmten einen satten Duft.
»Kaffee?«, fragte Sabine.
»Nein, danke!«, antwortete Walter.
Diesmal stand Sabine auf. »Also, ich gönn mir einen! Wie steht es mit Ihnen, Herr Kröber?«
Herr Kröber lehnte ebenfalls dankend ab.
Wenn die ewig zaudernde Sabine so beschwingt vorging, war er in echten Schwierigkeiten, ahnte Walter. Sie goss sich eine Tasse ein, nahm einen genießerischen Schluck und kommentierte ihn mit einem kleinen »Ahh!«.
Dann wandte sie sich wieder Walter zu. »Sie können sich sicher vorstellen, warum Sie hier sind?«
»Nein«, antwortete Walter.
»Dann will ich es Ihnen erklären. Der Anwalt von Herrn Leyendecker hat uns angerufen.«
»Sein Anwalt?«, fragte Walter irritiert.
»Ja, er will uns verklagen.«
»Uns?«
»Eigentlich Sie, aber er will das Ganze öffentlich machen, sodass wir unweigerlich mit an Bord sind.«
»Ich verstehe nicht …«
»Herr Leyendeckers Anwalt sagt, Sie haben versucht, seinen Hund umzubringen. Und ihn dazu.«
»Das ist doch ein Witz, oder?«, rief Walter empört.
»Leider nein. Unsere Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ist sehr besorgt. Die haben mich gefragt, warum einer unserer Zusteller in ein Mordkomplott verwickelt ist …«
»Wie bitte?«
Sabine winkte ab. »Die meinten den Hund. Dabei ist das juristisch gesehen nur Sachbeschädigung. Jedenfalls fürchtet sie um unser Image.«
»Was für ein Image?«, fragte Walter gereizt.
Sabine zögerte, nicht sicher, wie sie Walters Antwort zu werten hatte, dann aber sagte sie ruhig: »Unser Konzern lebt vom Vertrauen unserer Kunden. Jeder Konzern tut das. Verlieren wir das Vertrauen, schadet das unserem Geschäft.«
»Und?«, fragte Walter, immer noch gereizt.
»Unsere Zusteller sind nicht in Hundemorde verwickelt, Walter. Hundemorde sind nicht gut fürs Geschäft. Menschen mögen Hunde, vor allem ihre eigenen. Jedenfalls möchten wir diese Diskussion im Keim ersticken und ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden …«
»Die wäre?«
»Sie gehen in Rente.«
Es wurde ganz still im Büro.
Blicke wanderten.
Dann fauchte Walter Herrn Kröber an: »Würdest du dazu mal was sagen, Detlef?«
Herr Kröber sackte ein wenig in sich zusammen und antwortete: »Du hast es einfach übertrieben, Walter!«
»Ich? Jetzt ist das alles meine Schuld?«, rief Walter wütend.
Sabine machte eine beschwichtigende Geste mit den Händen. »Niemand redet von Schuld, Walter.«
»Sondern?«
»Von Image«, antwortete Sabine munter. »Der Konzern möchte nicht, dass seine Kunden unseretwegen tot sind.«
»Er ist ja gar nicht tot!«, stellte Walter fest.
»Mag sein, aber wenn die Leute glauben, wir killen sie oder noch schlimmer: ihre Hunde, können wir den Laden dichtmachen. Und Gott bewahre, das Fernsehen taucht auf und berichtet darüber! Niemand will so etwas, Walter.«
»Ich bin nicht schuld!«, beharrte Walter.
»Das wissen wir doch!«, beruhigte ihn Sabine. »Die Öffentlichkeit könnte das aber anders sehen. Und wir wollen nicht, dass die Öffentlichkeit es anders sieht. Wir wollen Sie schützen, Walter!«
»Sie wollen mich schützen?«, rief Walter ungläubig.
In seinen Ohren klang es eher so, als hätte Sabine Schwierigkeiten, die Verben schützen und opfern auseinanderzuhalten.
»Aber natürlich! Sie sind doch einer von uns!«
Wieder Schweigen.
Dann fragte Walter: »Und was bedeutet das jetzt?«
»Das bedeutet«, antwortete Sabine, »dass Sie in Ihren wohlverdienten Vorruhestand gehen. Und wir sorgen dafür, dass Herr Leyendecker klein beigibt! Wenn Sie weg sind, ist er bestimmt zufrieden. Und wir spendieren ihm unseren schönen Bildband Mittelrhein aus unserem Shop.«
»Oh, krieg ich auch einen?«, ätzte Walter.
»Nein«, gab Sabine ungerührt zurück.
»Ich kann nicht in den Vorruhestand gehen!«, entgegnete Walter wütend.
»Aber sicher können Sie!«, lächelte sie gewinnend. »Das wird toll!«
»Wird es nicht, weil ich mir einen Vorruhestand nicht leisten kann!«, antwortete Walter bestimmt.
Für einen kurzen Moment bröckelte Sabines Selbstsicherheit wie alter Putz von einer maroden Hauswand, dann streckte sie sich und sagte fröhlich: »Aber natürlich können Sie!«
Walter schob die Brauen zusammen. »Sie meinen, weil unser Konzern seine Zusteller so üppig entlohnt?«
»Bitte lassen Sie uns sachlich bleiben«, mahnte Sabine.
»Dann ganz sachlich: Wenn ich jetzt in den Ruhestand gehe, sind die Abzüge so hoch, dass ich mir ein ordentliches Rentnerleben nicht leisten kann!«
Sabine wandte sich Herrn Kröber zu. »Wir können ihm doch sicher seinen Abgang vergolden, oder?«
Der nickte. »Da ist eine schöne Abfindung für dich drin, Walter.«
»Ihr könnt mich nicht zwingen!«
»Können wir nicht, Walter«, stimmte Herr Kröber zu. »Aber dann legst du dich mit dem ganzen Konzern an. Und als dein Betriebsrat rate ich dir: Tu das nicht!«
Walter lehnte sich zurück und antwortete: »Und wenn doch? Ein Konzern, der einen verdienten Mitarbeiter wegen Altersrassismus loswerden will – was macht das mit eurem Image?«
Sabine, die im Begriff gewesen war, einen weiteren Schluck aus ihrem Becher zu nehmen, verschluckte sich und spuckte Kaffee auf ihren Kalender. Verärgert wischte sie über die Tropfen und machte damit alles nur noch schlimmer.
Dann fauchte sie: »Sie gehen, Walter!«
»Nein.«
»Dann schicke ich Sie zum Betriebsarzt!«
»Was?«
»Sie haben schon verstanden! Sie hinken. Das haben mir mittlerweile mehrere Quellen bestätigt. Und wenn der Betriebsarzt Sie für dienstunfähig erklärt, sieht die Sache schon anders aus!«
Walter protestierte: »Verstehen Sie doch! Ich kann mir eine Frührente nicht leisten. Es geht einfach nicht!«
Wieder Schweigen.
Wieder Blicke.
Da hellte sich plötzlich Herrn Kröbers Gesicht auf, er beugte sich zu Sabine, um ihr ein paar Worte ins Ohr zu flüstern. Die schien zunächst nicht sehr begeistert von dem Vorschlag, dachte dann aber nach und wandte sich schließlich wieder Walter zu. »Da gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, wie wir Sie aus der Schusslinie bringen können. Zumindest übergangsweise. Bis sich alles wieder beruhigt hat.«
»Welche?«, fragte Walter neugierig.
»Unsere Christkindfiliale!«
Walter starrte sie an. »Sie verarschen mich, oder?«
In Sabines Gesicht zogen blitzartig dunkle Sturmwolken auf. »Das oder Frührente! Sie haben die Wahl!«
»Mach es, Walter!«, appellierte Herr Kröber an ihn. »Das ist eine gute Sache. Du bleibst im Konzern. Und was später wird, sehen wir dann.«
Sie sahen ihn beide durchdringend an.
Unter dem Tisch ballte Walter die Fäuste.
Um sie Sekunden später wieder zu öffnen.
Er war geschlagen.
BEN
9
Viel Gutes konnte Walter an seiner neuen Aufgabe nicht erkennen, obwohl es objektiv gesehen viel Gutes gegeben hätte. Sein Weg zur Arbeit verkürzte sich beispielsweise. Nicht mehr zwölf Kilometer nach Lindlar, sondern nur noch knapp fünf nach Engelskirchen waren im windigen, oft kalten Oktoberwetter schon eine klare Verbesserung. Auch musste er nicht mehr um sieben Uhr morgens, sondern erst eine Stunde später anfangen. Und im Gegensatz zur schmucklosen Halle des Zustellstützpunkts der Postboten und Paketfahrer war sein neuer Arbeitsplatz wenigstens historisch interessant. Zudem blieb ihm die Fahrt durch die Gerberstraße in Lindlar erspart, mit all den Erinnerungen an eine Zeit, die gleichermaßen sein größtes Glück als auch Unglück war.
Jetzt stand er also vor der ehemaligen Baumwollspinnerei Ermen & Engels, hinter deren schönen Bruchsteinfassaden nicht nur ein Museum und das Rathaus, sondern auch die Christkindfiliale residierte. Letztere allerdings nur in den Wintermonaten.
Eigentlich war die Baumwollspinnerei nur eine von vielen in Deutschland und doch hatte sie einst große Bekanntheit erlangt, was vor allem am Sohn des Firmenmitgründers lag: Friedrich Engels, der Jüngere, hatte wegen der entsetzlichen Lebensbedingungen der Arbeiter dort im ständigen Clinch mit seinem Vater Friedrich Engels senior gelegen. Wütend über den heuchlerischen Pietismus seines Vaters hatte er über neue Gesellschaftsformen nachgedacht und in Karl Marx einen feurigen Mitstreiter gefunden. Zusammen wurden sie die Väter einer neuen Bewegung, die die Welt gerechter machen sollte und doch nur noch mehr Ungerechtigkeit und Willkür gebären würde.
An seinem ersten Arbeitstag jedenfalls hatte Walter nur wenig Sinn für Historisches, verdrossen ob der Tatsache, dass er jetzt kein Postbote mehr war. Als Fünfzehnjähriger hatte er seinen Beruf gelernt, jetzt durfte er ihn nicht mehr ausüben. Stattdessen musste er nun Dienst leisten in einer vom Konzern aus Imagegründen erfundenen Zentrale für Unzustellbares: Briefe an das Christkind oder den Weihnachtsmann landeten hier. Sechs weitere dieser Büros gab es über ganz Deutschland verteilt. In Himmelpfort und Himmelsthür, in Himmelpforten und Himmelstadt sowie in Nikolausdorf und St. Nikolaus.
Über einen Eckeingang stapfte er missmutig die Treppen hinauf in das zweite Stockwerk, wo sich eine große, renovierte Fabrikhalle mit riesigen Industriefenstern erstreckte, die jetzt, da die Ausstellung des Museums für den Winter bis auf ein paar antike Maschinen, Generatoren, Schalt- und Karteischränke ausgeräumt worden war, ziemlich kahl wirkte. Die Leiterin der Filiale begrüßte ihn freundlich und bot ihm gleich das Du an, welches er schlecht gelaunt annahm.
»Ich bin Sabine«, stellte sie sich vor und gab ihm die Hand.
»Echt jetzt?« Walter seufzte.
Sie sah ihn irritiert an.
»Warum?«
»Ach, nichts«, gab Walter zurück.