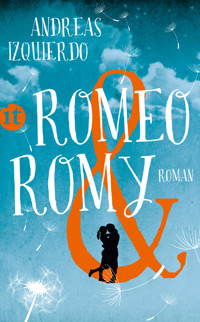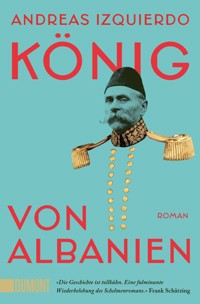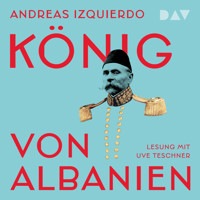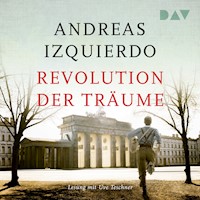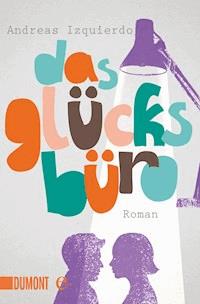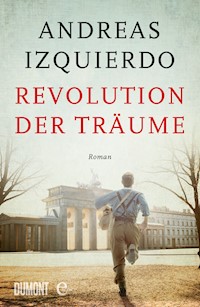
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wege-der-Zeit-Reihe
- Sprache: Deutsch
Berlin, Ende 1918: Die drei Freunde Carl, Isi und Artur haben sich bis in die Hauptstadt durchgeschlagen und erleben die Zeit des Umbruchs alle auf ihre Weise. Der Kaiser ist gestürzt – Träume von Freiheit liegen in der Luft. Carl beobachtet das Treiben der Aufständischen mit Sympathie, aber auch mit Sorge. Eigentlich will er nur noch eins: echten Frieden. Und Kameramann sein, bei der berühmten UFA! Artur hat sich derweil in kürzester Zeit zum König der Berliner Unterwelt hochgearbeitet. Doch Erfolg lockt Neider an – und Neider bedeuten Gefahr. Isi wiederum sucht im politischen Kampf die Herausforderung und freundet sich mit Leuten aus dem linken Umfeld an. Als sie allerdings den Adelssprössling Aldo von Torstayn kennenlernt, geraten ihre Prinzipien ins Wanken ... In ›Revolution der Träume‹ zeigt Andreas Izquierdo die Abgründe der jungen Weimarer Republik. Kenntnisreich und fesselnd erzählt er von drei Freunden, die versuchen, in einer Welt im Wandel zu bestehen: ein spannender historischer Roman für Herz und Kopf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
BERLIN, ENDE 1918: Die drei Freunde Carl, Isi und Artur haben sich bis in die Hauptstadt durchgeschlagen und erleben die Zeit des Umbruchs alle auf ihre Weise. Der Kaiser ist gestürzt – Träume von Freiheit liegen in der Luft. Carl beobachtet das Treiben der Aufständischen mit Sympathie, aber auch mit Sorge. Eigentlich will er nur noch eins: echten Frieden. Und Kameramann sein, bei der berühmten UFA! Artur hat sich derweil in kürzester Zeit zum König der Berliner Unterwelt hochgearbeitet. Doch Erfolg lockt Neider an – und Neider bedeuten Gefahr. Isi wiederum sucht im politischen Kampf die Herausforderung und freundet sich mit Leuten aus dem linken Umfeld an. Als sie allerdings den Adelssprössling Aldo von Torstayn kennenlernt, geraten ihre Prinzipien ins Wanken …
In ›Revolution der Träume‹ zeigt Andreas Izquierdo das Berlin vor den Goldenen Zwanzigern. Kenntnisreich und fesselnd erzählt er von drei Freunden, die versuchen, in einer Welt im Wandel zu bestehen: ein spannender historischer Roman für Herz und Kopf.
© Katrin Lorenz
ANDREAS IZQUIERDO ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Für den historischen Roman ›König von Albanien‹ (2007) wurde ihm der Sir-Walter-Scott-Preis verliehen. Er veröffentlichte zahlreiche weitere Romane, u.a. ›Das Glücksbüro‹ (2013), den SPIEGEL-Bestseller ›Der Club der Traumtänzer‹ (2014) und ›Fräulein Hedy träumt vom Fliegen‹ (2018). Für ›Schatten der Welt‹ erhielt er den bronzenen Homer für den besten historischen Roman 2021. ›Revolution der Träume‹ setzt die darin begonnene Geschichte der drei Freunde Carl, Artur und Isi fort. Andreas Izquierdo lebt in Köln.
Die drei Freunde
CARL FRIEDLÄNDER
Der Krieg ist vorbei, und Carl nutzt seine Erfahrungen als Kameramann, um bei der UFA anzuheuern. Er lernt die größten Sterne seiner Zeit kennen: Pola Negri, Emil Jannings und vor allem Regisseur Ernst Lubitsch, den Carl über alle Maßen bewundert. Eine steile Karriere bahnt sich an, aber dann nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung …
ARTUR BURWITZ
Artur hat den Krieg schwer verletzt überlebt und eine Gruppe treuer Gefährten um sich geschart. Als am 9. November der Kaiser stürzt und das Volk auf die Straßen geht, gelingt ihm ein Sensationscoup. Artur steigt zu einer Unterweltgröße auf, kämpft gegen Neider und Ganoven, aber vor allem will er eines: seinen ewigen Rivalen Falk Boysen tot sehen. Bald schon bekommt er seine Chance zur Rache …
LUISE »ISI« BEESE
Als die Revolution losbricht, ist Isi mittendrin und ständig in Gefahr. Sie kämpft mit dem Spartakusbund für eine gerechtere Gesellschaft und setzt alles daran, die Macht der Militärs zu brechen. Gleichzeitig haut sie reiche Witwen übers Ohr und gerät darüber schleichend in die größte Verschwörung der frühen Zwanzigerjahre …
ANDREASIZQUIERDO
REVOLUTIONDER TRÄUME
Roman
Von Andreas Izquierdo sind bei DuMont außerdem erschienen:
Das Glücksbüro
Der Club der Traumtänzer
Schatten der Welt
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: © Getty images/shomos uddin;
© Trevillion Images/CollaborationJS
Karte: © Rüdiger Trebels
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7116-2
www.dumont-buchverlag.de
Para Pilar,
REVOLUTION
1
Der Kaiser weilt gerade in Spa, als sein Volk ihn stürzt.
Es ist der Morgen des 9. November 1918, als die Untertanen Seiner Majestät endlich genug haben von Krieg, Hunger und Schmerz: Sie stürmen die Straßen.
Frieden soll sein!
Frieden muss sein!
Der Werkportier der AEG in der Ackerstraße sieht sie herankommen: graue Menschen mit grauen Jacken, Röcken und Mützen. Panisch stürzt er hinaus und versucht noch, die schweren Tore zu verriegeln, aber tausend graue Hände stoßen sie wieder auf.
»Auf die Straße! Mit uns, Brüder!«
Maschinen stoppen.
Einem Sog folgend zieht es die Arbeiter aus den Werkhallen hinaus, wo sie mit den Schwartzkopffwerklern aus der Zinnowitzer Straße und der Scheringstraße zusammenlaufen. Im Berliner Norden bäumt sich eine Welle auf und rollt der Voltastraße entgegen: noch ein AEG-Werk. Ein Backsteinbau mit blinden Fenstern, überzogen von Ruß, Staub und der Hoffnung auf ein Leben ohne Not, ohne Krieg.
Zehntausend sind es jetzt.
Sie drängen an den Mietskasernen vorbei, am Stettiner Bahnhof, hin zur Invalidenstraße. Plötzlich wehen rote Fahnen über den Köpfen der Entschlossenen, drängen Frauen und Kinder an die Spitze des Zuges und halten Plakate hoch: Brüder! Nicht schießen! Oder: Frieden! Auf einmal bleiben alle Straßenbahnen stehen. Die Lichter in den Geschäften erlöschen. Für einen Atemzug schauen sich die Aufständischen verwundert um, dann rumort es unter ihnen: Die Elektrizitätswerke wurden gestürmt.
Es ist wirklich Revolution!
So erreichen sie die Chausseestraße, Ecke Kesselstraße.
Vor ihnen: dreistöckige Kasernenblocks. Bedrohlich und stumm. Die Bogenfenster der Mannschaftsstuben mit Ketten gesichert, die Tore verschlossen. Das weiß-rote Wachhäuschen am Eingang verwaist. 1915 saß hier ein junger Soldat und schrieb in der Nacht zum Ostersonntag unmittelbar vor seiner Abfahrt an die Ostfront ein Lied, das ihn viele, viele Jahre später weltberühmt machen würde: »Lili Marleen«.
Jetzt starren zehntausend auf die Tore der Maikäferkaserne.
Wie niedlich das klingt: Maikäfer.
Aber es ist das Garde-Füsilier-Regiment.
Die Treusten der Treuen.
Sie sind die mit den bunten Regimentsuniformen: rote Ärmel- und gelbe Schulteraufschläge, weiße Litzen, braune Paspelierungen.
Maikäfer.
Gewehrläufe schieben sich vor.
Aus den Kellerschächten.
Den Schießscharten.
Und oben auf dem Dach: Maschinengewehre.
Jedes von ihnen feuert vierhundert Schuss in der Minute, und die Arbeiter stehen vor den Häuserwänden der anderen Straßenseite. Keine Möglichkeit zu fliehen.
Da tritt eine junge Frau vor, steht mit einem Mal zwischen Revolution und Armee. Sie trägt einen zerschlissenen Mantel, alte Schuhe und ist doch schön wie eine Königin. Mit strahlend blauen Augen blickt sie furchtlos hinauf in den Lauf eines Maschinengewehrs: Sie muss wahnsinnig sein.
Aber sie ist nicht wahnsinnig.
Nur verrückt.
Luise Beese.
Genannt Isi.
Dramatische Auftritte liegen ihr.
Sie atmet ein, sie atmet aus.
Und dann löst sich aus ihrer Brust ein langer, dunkler Schrei.
Laut, lauter, immer lauter.
Sie schreit, als ob sie die Mauern und Tore der Kaserne zum Einsturz bringen wollte.
Die Soldaten beugen sich über ihre Waffen und nehmen sie ins Visier.
Da sind noch mehr. Ein nicht enden wollender Strom treibt an diesem milden, grauen Samstag gegen das Brandenburger Tor, wälzt sich durch die sechs kannelierten Säulen hinein in den Prachtboulevard Unter den Linden, dem Schloss entgegen. Rechts und links der Häuserreihen drängen sich Menschentrauben in Fenstern, auf den Balkonen des Adlon klicken die Kameras der ausländischen Presse, während die Türen des Hotels verschlossen sind.
Der Monarchie letztes Geleit.
Dennoch geben sich einige Offiziere standhaft, stellen sich ebenso mutig wie sinnlos vor die Protestierenden: Man reißt ihnen die Schulterstücke ab. Die Kokarden. Zerbricht ihre Degen und nimmt ihnen ihre Waffen weg.
Es gibt keine Vorgesetzten.
Keine Befehlshaber.
Es gibt überhaupt kein Oben und Unten mehr, Reich und Arm, Adel und Proletariat. Alle sind gleich – endlich!
So zieht die Menge dann weiter – die Zerrissenen bleiben gedemütigt zurück als das, was sie sind: Uniformen ohne Funktion.
Ein feldgraues Auto mit dem kaiserlichen Adler braust vorbei, ein feldgrauer Lastwagen. Soldaten, Zivilisten, Frauen lassen rote Fahnen im Wind flattern. Zeitungshändler laufen mit Extrablättern durch die Straßen und schreien: »Der Kaiser hat abgedankt! Der Kronprinz verzichtet auf den Thron! Ebert zum Reichskanzler ernannt!«
Noch steht die Absperrung um das Schloss herum, aber im nächsten Moment drängen die Menschen daran vorbei, sickern schreiend und johlend ein, bis sich Schlossplatz und Lustgarten geradezu schwarz färben von ihren Mänteln und Hüten, bis kein freier Zentimeter mehr frei ist.
Das Schloss!
Ein barocker Prachtbau mit königlichem Sinn für Dramatik mitten auf die Spreeinsel gesetzt: fünf Tore, zwei Innenhöfe und eine sechzig Meter hohe Kuppel über dem Eosanderportal. Einst ritt von hier der Kaiser über die Linden hinaus in den Tiergarten. Zeigte sich in den schillerndsten Uniformen, gelangweilt von seinen Untertanen, die ihm dienernd auswichen. Jetzt gerade aber verzichtet Seine Majestät dankend auf den von seinen Offizieren anempfohlenen Heldentod an der Front und flieht lieber von Belgien nach Holland ins Exil.
Seine Untertanen dagegen wollen das Schloss. Denn es ist nicht nur ein Schloss: Es ist das Schloss. Es gehört dem Kaiser. Dem Mann, der die ganze Welt ins Unglück gestürzt hat.
Dieses Schloss ist ein Symbol.
Keiner hier draußen hat es je von innen gesehen.
Seine Tore waren auch vorher schon verschlossen und verriegelt.
Doch dann tritt einer vor, der hineinwill: Harry Neumann.
Harry ist Conférencier, zumindest war er es, gerade ist er arbeitslos, jedenfalls kennt Harry sich gut aus mit Bühnen. Mit Publikum. Mit Schauen.
Und Harry macht sich bereit für die Schau seines Lebens.
Hinter ihm stehen fünf Matrosen.
Die Art Männer, die in Kiel die Revolution entzündet haben, um sie anschließend über das ganze Reich hinwegbrennen zu lassen.
Harry hämmert gegen eines der Portale – ein Guckloch öffnet sich: Er blickt in die nervösen Augen eines einfachen Soldaten.
»Öffnen!«, befiehlt Harry, der im Gegensatz zu den anderen nur einen einfachen Anzug anhat.
Der Soldat im Innern starrt ihn erschrocken an.
»Öffnen!«, wiederholt Neumann. »Wir sind hier, um das Schloss zu übernehmen!«
»D-das Schloss … übernehmen?«, stammelt der Soldat.
Sein Blick springt zwischen Harry und den Matrosen hin und her.
»Es ist ganz einfach: Entweder wir kommen rein und retten das Schloss. Oder …«, er macht eine Geste, die den zigtausend in seinem Rücken gilt. »Oder die kommen rein und plündern es! Und jetzt bringen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten!«
Das Guckloch schnappt zu.
Endlose Minuten vergehen.
Dann taucht wieder ein Gesicht auf.
Ein Offizier, so viel kann Harry sehen.
»Nur Sie! Und Ihre Leute!«, zischt er.
Das Portal öffnet sich ein Stück, einer nach dem anderen schlüpft hinein.
Kurz darauf stehen sie vor den Verteidigern des Schlosses, und Harry weiß sofort, dass er leichtes Spiel haben wird. Es ist unübersehbar: Dies sind Männer, die der Belastung des Krieges nicht mehr gewachsen sind, zermürbt von den Aufregungen, an Körper und Geist erkrankt. Sie versuchen, es zu verbergen, aber Harry hat ein gutes Auge für Menschen und erkennt seinen Vorteil sofort.
Er wendet sich dem ranghöchsten Offizier zu: »Herr General, ziehen Sie Ihre Leute zurück. Ich kann sonst nicht mehr für die Sicherheit des Schlosses garantieren!«
Harry geht nicht weiter darauf ein, wie er mit seinen fünf mitgebrachten Matrosen überhaupt irgendjemandes Sicherheit garantieren will, er behauptet einfach, dass er es kann. Und das mit einer Selbstsicherheit, die den ohnehin schon schwer angeschlagenen General in weitere Verzagtheit stürzt.
Er starrt Harry an.
Und der zurück.
Neben dem General steht dessen Frau, eine weinende Matrone, daneben ein Oberst und der Polizeimajor, immerhin stolzer Träger des Roten Adlerordens vierter Klasse. Dahinter etwa ein Dutzend weiterer Offiziere und Mannschaften. Und hinter denen noch eine ganze Reihe blau uniformierter Polizisten.
Alle warten auf die Antwort des Generals.
Er könnte Harry und die Matrosen im Eosanderhof einfach an die Wand stellen und erschießen lassen. So viel Autorität hat er noch, dass man diesem Befehl augenblicklich nachkäme. Und vielleicht denkt er gerade darüber nach, als Harry zu dessen Frau schaut und der General es ihm nachtut. Als sich ihre Blicke wieder treffen, nickt ihm Harry zu, als würde er sagen: Denken Sie doch auch mal an Ihre Frau!
Da trifft der General eine Entscheidung.
Er dreht sich zu seinen Leuten um, auch zu den Polizisten, und ruft: »Abrücken!«
Heimlich atmet Harry durch.
Die Soldaten und Polizisten werfen Waffen und Munition auf das Pflaster des Eosanderhofs, degradieren sich selbst, indem sie ihre Schulterstücke abschneiden, die jetzt nur noch bunte Stofffetzen sind. Dann verschwinden sie so schnell durch das Portal II, als hätte Sturm Laub durch eine Tür gejagt.
Nur einer bleibt vor Harry stehen.
In der Livree eines Dieners.
Er will nicht gehen.
Sein Leben war das Schloss, wenn er jetzt flieht, hat er keines mehr.
»Wer sind Sie denn?«, fragt Harry.
»Oberkastellan Joseph Digmann.«
»Ich nehme an, Sie kennen sich im Schloss aus?«, fragt Harry.
Er nickt.
Harry wendet sich den Matrosen zu: »Holt den KaLeu!«
Die Matrosen eilen davon, zurück zu dem Portal, durch das sie hineingelassen worden sind. Sie öffnen das Tor einen Spalt: Sechs weitere Matrosen schlüpfen hindurch und als Letzter ein großer, muskulöser Mann in der Uniform eines Kapitänleutnants.
Er folgt den Matrosen in den Hof.
Gibt Harry die Hand.
Sieht den Diener an, der vor ihm zurückschreckt: Der Mann hat nur ein halbes Gesicht. Die andere Hälfte ist auf ein hauchdünnes hautfarbenes Kupferblech gemalt: Auge, Augenbraue, Wangenknochen, ein Stück des Mundes. Kurz über dem Kinn biegt das Blech wieder ab zum rechten Ohr, hinter dem ein dünnes Lederbändchen hervorspringt. Um den Kopf des Mannes herum führt es zum oberen Teil der Bedeckung und hält das gemalte Gesicht fest. Digmann weiß nicht, was schlimmer ist: das gezeichnete Auge, das ihn mitleidlos anzustarren scheint, oder das echte, in dem nichts als Entschlossenheit schimmert. Aber eines weiß er doch – er wird diesem Mann gehorchen, was immer er auch will.
Dieser Mann ist niemand anderes als Artur.
Die Soldaten zielen immer noch auf Isi, aber sie zögern.
Isi spürt die Zweifel in den Maschinengewehrnestern und ballt ihre Fäuste, bis sie hart wie Eisen sind.
Wenn sie schießen, gibt es ein furchtbares Blutbad.
Sie schreit nicht mehr, versucht, sich auf nur einen von ihnen zu konzentrieren. Wo der Mensch zu denken beginnt, hört der Soldat auf, heißt es, darauf hofft sie jetzt. Sie hält den Blick dieses einen fest, zieht ihn zu sich herab, lässt ihn in sich hinein: Sieh mich an!
Sieh! Nur! Mich!
Und plötzlich hakt er den Patronengürtel aus der Führung und wirft ihn auf die Straße.
Direkt vor ihre Füße.
Sie lächelt erleichtert.
Jubel bricht aus.
Schießt aus tausend Kehlen empor und überspült die Mauern der Kaserne.
Zehntausend geraten in Bewegung, queren die Straße und stürmen die Maikäferburg. Da sind plötzlich Leitern, von denen niemand weiß, wo die so schnell herkommen. Schon klettern Mutige die Sprossen hinauf, schlagen die Fenster der Mannschaftsstuben ein. Ketten werden gelöst, von drinnen reichen Soldaten ihre Waffen nach draußen. Als Nächstes steigen Uniformierte aus ihren Quartieren herab und werden euphorisch von den Aufständischen begrüßt: »Kameraden! Brüder!«
Die Kasernentore öffnen sich – Menschen preschen hinein.
Isi taumelt vor Glück, vor Erleichterung, Demonstranten laufen an ihr vorbei in die Kaserne, rempeln, stoßen, johlen.
Auf dem Kasernenhof: Soldaten.
Lastautos.
Kriegsgerät.
Alle legen ihre Waffen nieder.
Es ist genug.
Doch dann brechen Schüsse los!
Mitten hinein in die Welle der Begeisterung.
Jemand hat vom nördlichen Tor in die Menge geschossen, man kann die Pulverwölkchen hinter einer Schießscharte noch sehen. Eine Gruppe springt auseinander, Revolutionäre fliehen ringförmig nach außen.
Drei bleiben liegen. Zwei verwundet, einen traf der Schuss ins Herz.
Er hat die zweifelhafte Ehre, der Erste zu sein, den die Revolution mit sich nimmt. Die beiden anderen werden ihm bald folgen.
Isi hat alles mit angesehen und spürt erneut den Hass auf das Militär.
Auf das Elend, das es ihnen gebracht hat.
Auf die Arroganz der Macht, die sie einst ins Gefängnis befördert und darüber hinaus das Leben von Millionen Unschuldigen zerstört hat. Und während noch alle aufgeregt um den Toten und die Schwerverletzten herumspringen, sie aufnehmen und in eine Stube tragen, geht sie zu einem der Lastautos, auf dessen Trittbrett der Fahrerseite ein junger Soldat steht und die Ereignisse aus einigermaßen sicherer Distanz beobachtet.
Sie stellt sich vor ihn und lächelt kokett.
Es ist dasselbe Lächeln, das schon Artur bezaubert hat und sowieso alle, denen es je geschenkt worden ist: Isi, die Unwiderstehliche. Die Jagdgöttin, die sie sein kann, wann immer sie will.
»Na, wen haben wir denn da?«, gurrt sie.
Der Soldat ist überrascht: Meint sie ihn? Er sieht sich um, aber neben ihm ist sonst keiner. Als er sich ihr wieder zuwendet, kann er sein Glück gar nicht fassen: Sie meint wirklich ihn! Diese charismatische Schöne, neben der UFA-Stern Henny Porten wie ein übergewichtiger Bauerntrampel aussieht.
Verlegen räuspert er sich, springt vom Trittbrett des Lastautos und rupft sich gleichzeitig das Krätzchen vom Kopf.
»Oh, äh, guten Tag … Fräulein …«
Isi mustert ihn amüsiert: Viel hätte nicht gefehlt und er hätte stotternd gefragt, was so ein hübsches Ding wie sie an einem gefährlichen Ort wie diesem zu suchen habe.
»Das ist ein Mulag, oder?«
Erstaunt zieht er die Augenbrauen hoch: »Stimmt.«
Wieder gurrt sie: »Was hat er denn geladen?«
»Nun … so, so … äh, Dinge …«
»So Dinge?«, fragt sie belustigt zurück.
Er läuft rot an.
»I-ich meinte: Waffen, Munition. So Dinge.«
»Gefährliche Dinge«, antwortet sie mit anzüglichem Unterton und reicht ihm ihre Hand: »Lotte.«
Er verbeugt sich galant: »Es ist mir eine Ehre, Fräulein Lotte.«
Mir nicht, denkt Isi, aber sie schenkt ihm einen weiteren tiefen Blick, bevor sie sagt: »Ich bin so einen auch schon gefahren!«
Sie meint den Mulag. Der Soldat schaut erst verblüfft und bricht dann in schallendes Gelächter aus: »Der war gut!«
Isis Augen funkeln so kalt, dass ihm die gute Laune schnell einfriert.
»Sie meinten das ernst?«
Isi wendet sich von ihm ab: »Hat mich gefreut, Soldat …«
Den Frost in ihrer Stimme hätte man mit einem Eisen abkratzen müssen.
Sie kommt keine zwei Meter weit, da berührt er sie schon an der Schulter und stammelt: »Verzeihen Sie mir, Fräulein Lotte. Ich wollte nicht … Ich meine, ich, ich …«
»Ich! Ich!«, äfft Isi. »Ich weiß nur, dass der Armee offensichtlich die Ehrenmänner ausgegangen sind.«
»Ich bitte um Vergebung!«
»Warum? Sie glauben mir ja doch nicht!«
»Es ist nur sehr ungewöhnlich: eine Frau auf einem Lkw. Dazu noch so eine schöne wie Sie, Fräulein Lotte! Wenn Sie mir gesagt hätten, Sie wären eine Fürstin, ich hätte es Ihnen sofort abgenommen.«
Isis Blick wird weich, was der Gefreite als gutes Zeichen wertet. Vielleicht verzeiht sie ihm ja noch, scheint er zu denken. Sie dagegen seufzt in Gedanken: Gott, die sind alle so blöd in diesem Alter! Sie, die im selben Alter ist.
Dann aber nickt sie und bestimmt munter: »Kommen Sie! Ich beweise es Ihnen!«
»Beweisen? Was denn?«
»Dass ich diesen Lkw fahren kann!«
Er sieht sich hektisch um, aber obwohl hier Hunderte herumlaufen, beachtet sie sonst keiner.
»Aber … das … das …«, stammelt er und fügt dann schnell an: »Ich glaube es Ihnen auch so, Fräulein Lotte!«
»Das tun Sie nicht, Soldat!«
Bevor er antworten kann, warnt sie ihn mit einer Geste, die er genau so deutet, wie sie gemeint ist: Er sollte jetzt lieber mal den Mund halten.
Dann geht sie zum Angriff über: »Werfen Sie den Motor an, oder muss ich das etwa selbst tun?«
Hilfe suchend hält er nach jemandem Ausschau, aber da ist keiner, und in seinem Nacken hört er nur ihren eisigen Spott: »Suchen Sie jemanden, Soldat? Vielleicht einen Vorgesetzten, der Ihnen sagt, dass der Krieg wirklich vorbei ist? Der Ihnen sagt, dass Sie einen Laster ganz alleine starten dürfen? Ohne jeden Befehl?«
Er wäre jetzt gerne woanders, das kann Isi spüren, aber sie hebt ihn wie ein Kätzchen am Genick hoch und pustet ihm den nächsten Satz förmlich ins Gesicht: »Und ich dachte doch tatsächlich, der hübsche junge Soldat dort ist besser als die anderen!«
Das hat richtig wehgetan, sie sieht es ihm an.
Dann aber, in seiner Männlichkeit gekränkt, strafft er sich, löst entschlossen die Andrehkurbel von seinem Lkw und wirft energisch den Motor an, während Isi hinter das Steuer klettert und einen Gang einlegt. Langsam kommt der Lkw ins Rollen, umsichtig steuert sie ihn an den vielen Zivilisten vorbei, durch das Tor, hinaus auf die Chausseestraße.
Dann gibt sie Gas.
Erst grinst der Soldat noch, dann aber geht ihm ein Licht auf, und er rennt mit wild wedelnden Armen panisch hinter dem Lastkraftwagen her.
Allein: Es ist zu spät.
Isi biegt kichernd vom Hof der Kaserne und bricht dann in schallendes Gelächter aus: Nicht zu fassen! Sie hat soeben der Armee einen Lkw mit Waffen und Munition gestohlen. Und weiß nicht einmal, warum.
Aber Isi braucht keinen Grund: Sie tut Dinge, weil sie es kann.
Weil sie verrückt ist.
Unwiderstehliche Jagdgöttin.
Sie biegt sich geradezu vor Lachen, als sie über die Chausseestraße einfach verschwindet.
Im Eosanderhof bittet Harry Oberkastellan Digmann, ihn zum Portal IV zu bringen, hinauf in den ersten Stock, während Artur und seine Männer in alle Richtungen davoneilen.
Harry dagegen folgt dem alten Diener.
Als sie in den großen Säulensaal eintreten, bekommt er ein Gefühl dafür, wie verschwenderisch die Hohenzollern waren: Seidentapeten, eine perlfarbene Kassettendecke, ein gewaltiger Kristallkandelaber in der Mitte des Raumes. Die Säulenschäfte an den Wänden sind aus ockerfarbenem Stuckmarmor, kunstvoll verzierte Edelhölzer wie Nussbaum, Palisander, Zeder oder Rosenholz dienen als Fußboden.
Und das ist nur ein Zimmer von Hunderten.
Harry sieht Statuen aus Marmor, Bilder und Reliefs, die Alexander den Großen zeigen, und ahnt, in welchen Sphären sich der Kaiser selbst wähnte. Digmann und er gehen dem Balkonfenster entgegen, als Harry unverhofft eine herrliche goldfarbene Decke entdeckt, mit dem deutschen Adler obenauf. Interessanter jedoch ist ihre Rückseite, denn die ist mit rotem Samt ausgeschlagen. Einer Eingebung folgend nimmt er sie und legt sie sich über die Schultern, die rote Seite nach außen.
Digmann protestiert: »Bitte nicht anfassen!«
Harry schüttelt den Kopf und herrscht: »Aufmachen!«
Er steht vor den Flügeltüren des Balkons.
Digmann schiebt die Vorhänge zur Seite und öffnet die Türen.
Von hier aus sieht Harry nur die Brüstung, aber dahinter hört er das geradezu elektrische Brummen und Summen der vielen Tausend, die dort warten.
Ein paar Schritte nur.
Dann steht er dort, wo der Kaiser einst stand.
Dort, wo nur Kaiser stehen dürfen!
Ein paar Schritte bloß, dann wird er, Harry Neumann, arbeitsloser Conférencier, erreicht haben, was niemand vor ihm erreicht hat: Er wird Kaiser sein anstelle des Kaisers.
Währenddessen eilen Arturs Männer durch die Räume.
In der Kürze der Zeit ist dieses riesige Schloss mit seinen insgesamt drei Stockwerken gar nicht zu durchmessen, daher halten sie sich an das, was Artur ausgeheckt hat, denn wenn es etwas gibt, das Artur besser kann als jeder andere, dann Entwicklungen zu deuten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Deswegen ist dieser Coup auch nicht das Wagnis eines Hasardeurs, sondern allein kühle Berechnung desjenigen, der nur verknüpft, was jedem bekannt ist. Denn keine Information, die dieses Husarenstück überhaupt möglich macht, ist geheim.
Alles liegt vor den Augen aller.
Artur hat die Puzzlestücke nur gesehen und zusammengesetzt.
Am 4. Oktober bittet das Deutsche Reich seine Gegner um einen Waffenstillstand. Der Schock ist groß, denn nachdem der Osten im Gewaltfrieden von Brest-Litowsk zur großen Zufriedenheit des Oberkommandos erobert worden ist, richtet sich der Blick nach Westen, wo kein Feind je seinen Fuß auf deutschen Boden setzen konnte. Und während Kaiser und Generäle sich noch von Ludendorff und Hindenburg betrogen fühlen und gleichsam denken, dass die beiden doch immer ehrlich waren, weiß Artur längst, dass der Krieg verloren ist.
Dann, als der Kaiser Ende Oktober nach Spa abreist, ahnt Artur, dass er nicht mehr nach Berlin zurückkehren wird. Nicht nur, weil die Fahrt überstürzt wirkt, sondern auch, weil er wie alle, die den Kaiser in den letzten Jahrzehnten beobachten durften, genau weiß, was für ein unfähiges, feiges Großmaul er ist.
Schließlich meutern die Matrosen in Kiel.
Ein unerhörter Vorgang in einer Armee, die den Kadavergehorsam praktisch erfunden hat. Plötzlich steht das Reich in Flammen. Die Befehlshaber sind fassungslos darüber, dass niemand mehr gehorchen will, und sehen erstmals, wie viel Macht sie über Menschen haben, wenn die sich nichts mehr sagen lassen: nämlich gar keine.
Der Kaiser ist also fort.
Das Militär gebrochen.
Und das Schloss verwaist.
Das sind die Fakten – das ist, was jedermann weiß.
Artur fertigt daraus einen Plan.
Er stiehlt die Uniform, die er gerade trägt, und überzeugt ein gutes Dutzend Männer, an ihn zu glauben, darunter auch Harry Neumann, den er kennenlernt, als der sich in einer Diele seinen Frust mit vielen Mollen runterspült.
Artur, der geborene Anführer, versammelt alle hinter sich, und als dann nach einigen Tagen des Schwelens, des Pulsierens, des Aufkochens auch in der Reichshauptstadt die Revolution endlich ausbricht, ist er längst bereit.
Gerade marschiert er mit einigen seiner Männer über das schlütersche Treppenhaus hinauf in den zweiten Stock, und genau wie Harry klappt ihm der Kiefer runter angesichts des Reichtums der Hohenzollern. Säle wie ein goldenes oder silbernes Barockgewitter, an Pracht, Glanz und Detailreichtum explosiver und schillernder als Versailles: Königszimmer, Drap-d’Or-Kammer, Rittersaal, Rote-Samt-Kammer, Schwarze-Adler-Kammer, Kapitelsaal, Königin-Zimmer und als krönender Abschluss der Weiße Saal, dreißig Meter lang, fünfzehn breit und dreizehn hoch.
Und in jedem Zimmer, jeder Kammer, jedem Saal gibt Artur ein kurzes Zeichen, und einer derer, die ihn begleiten, fällt von der Gruppe ab und beginnt, Silber und Gold in einen großen Sack zu packen. Alles, was sich leicht transportieren lässt. Und davon gibt es genug, auch wenn das meiste Gold an den wulstigen Verzierungen der Wände und Decken klebt.
Über die Kapelle in der Schlosskuppel und die Weiße-Saal-Treppe eilt er hinab ins Erdgeschoss und trifft dort die, die in den Königskammern und in der kaiserlichen Wohnung waren. Alle haben fette Beute gemacht, einer zeigt ihm Korrespondenzstücke des Kaisers und fragt, ob sie die nicht wegwerfen sollten, doch Artur schüttelt nur den Kopf. »So was kaufen Ausländer. Briefe vom Kaiser. Dafür gibt es einen Markt.«
Ein anderer läuft ihm entgegen und ruft: »Wir brauchen einen Lastkraftwagen!«
Er war in der Küche, und was er berichtet, macht fassungslos: achthundert Säcke ukrainisches Mehl, ungezählte Säcke mit Kaffee, Tee, Konserven, Tausende Eier, Töpfe mit Schmalz und würzigen Tunken, Zuckerhüte, Hülsenfrüchte, Schokolade, Zigarren, Zigaretten. Und noch unzählige weitere Kisten, bauchige Krüge, Töpfe. Alles bis zum Rand gefüllt.
Artur nickt: Draußen stehen Lkws. Er wird einen kraft seiner gestohlenen Uniform requirieren.
Aber dann hören er und seine Männer, wie es laut gegen das Portal II hämmert. Und bevor sie es verhindern können, öffnet ein übrig gebliebener Diener. Schon aus der Entfernung kann Artur sehen, wer dort steht: Karl Liebknecht.
Artur weiß, dass man ihm, dem ehemaligen Reichstagsabgeordneten, vier Jahre Zuchthaus aufgebrummt hat, weil er gegen den Krieg gewesen ist, gegen den Militarismus, weil er immer von einer brüderlichen und gerechten Gesellschaft unter Gleichen geträumt hat. Zusammen mit Rosa Luxemburg führt er die Spartakusgruppe an, benannt nach dem berühmten Sklaven, der sich einst gegen die Weltmacht Rom auflehnte. An diesem 9. November sehen sich er und seine Mitstreiter endlich am Ziel ihrer Träume.
Aber dazu braucht er dieses Schloss.
Artur ahnt, was er vorhat: Portal IV. Genau da, wo der Kaiser einst die Welt in den Abgrund gestürzt hat, wird Liebknecht über ihn triumphieren und die sozialistische Republik ausrufen wollen.
Und er ist nicht allein. Hinter ihm stehen revolutionäre Obleute, doch was viel entscheidender ist: Sie sind alle bewaffnet.
Einer von Arturs Männern ruft: »Lass uns abhauen!«
»Nein!«, bestimmt Artur. »Nicht ohne die Lebensmittel!«
Er weist seine Männer an, sich zu verstecken und bereitzuhalten.
Und eilt selbst über das Eosanderportal nach draußen.
Harry tritt auf den Balkon und blickt hinab. Der Lustgarten ist schwarz vor Menschen. Da sieht einer auf und schreit, und gleich darauf gerät die Menge in Bewegung.
Harry tut das einzig Richtige. Er zieht die Decke von seinen Schultern und hebt sie vor sich: rot.
Die rote Flagge!
Was dann passiert, lässt seine Sinne förmlich schwinden: Ein einziger gewaltiger Schrei eruptiert, ein Jubel, wie ihn, und da ist sich Harry sicher, kein Mensch je erleben durfte.
Zehntausend lassen die Luft beben.
Die Mauern zittern.
Die Fenster klirren.
Ein flirrender, überschäumender, unbeschreiblicher Moment der Begeisterung.
Harry steht da und weint mit einem Mal Tränen der Rührung, denn er weiß, dass er gerade Geschichte schreibt: Er hat das Schloss eingenommen.
Die Monarchie gestürzt.
Den Kaiser zum Teufel gejagt.
Er ganz allein.
Er legt die rote Decke über die Brüstung und reißt die Fäuste in den Himmel: noch mehr Jubel! Oh, wie er ihre Liebe spüren kann! Er fühlt sie in jeder Faser seines Seins! Es ist, als hätte Gott seinen Finger gegen ein teures Weinglas geschnippt, so sehr summt das Glück in seinem Herzen.
Hier steht er: auf der größten Bühne der Welt!
Was für ein Publikum!
Hinter ihm räuspert sich jemand, und Harry denkt, dass nur einer, der dreißig Jahre für den Kaiser gearbeitet hat, sich so räuspern kann, dass man ihn selbst im Toben einer Revolution noch hört. Er dreht sich um, und zu seiner Überraschung sieht er einen anderen livrierten Diener vor sich stehen als zuletzt.
»W-wer sind Sie denn?«
»Schlossdiener Hildebrand. Königlicher Frotteur.«
Harry starrt ihn an: Bilder rasen durch seinen Kopf, die diesen einzigartigen Moment vollkommen ruinieren.
Hildebrand deutet seinen Gesichtsausdruck und fügt ruhig an: »Bodenpolierer, mein Herr.«
Harry nickt und grinst.
In seinem Rücken hört er immer noch die tosende Menge – wie gerne würde er diesen Augenblick noch auskosten! Doch Hildebrand sagt ohne weitere Regung: »Herr Liebknecht ist im Haus. Er ist vermutlich auf dem Weg hierhin.«
Harry blickt ihn unverwandt an.
Dann flucht er wütend: »Verdammte Kommunisten!«
Und eilt in Richtung Tür.
Von draußen hört er laute Stimmen.
Nicht seine Leute.
Harry schluckt und denkt: Das ist nicht gut.
Arturs Männer sehen Liebknecht und knapp dreißig seiner Begleiter davoneilen und tauchen aus ihren Verstecken wieder auf, jeder mindestens einen großen Sack über der Schulter. Sie legen ihre Beute in die Hofmitte, zwei eilen zum Eosanderportal, der Rest zurück ins Schloss, zur Küche.
Artur ist bereits da. Mit dem Lastkraftwagen.
Er musste ihn nicht einmal requirieren. Verlassen stand er an der nahen Schlossbrücke, wohl ursprünglich, um die Zufahrt zu blockieren, bevor die von Tausenden überrannt worden war.
Langsam fährt er vor, während die beiden anderen die Torflügel wieder schließen und eine Menge Neugierige aussperren.
Er hält an und beginnt, mit den beiden anderen die Säcke aufzuladen, als die Ersten eilig mit Mehl und schweren Krügen zurückkommen.
»Was ist mit Harry?«, fragt einer.
»Ich habe so eine Ahnung«, antwortet Artur.
Harry starrt auf die Tür vor sich und hört das Getrappel von vielen Füßen.
Hektisch blickt er sich um, hastet dann nach links, zwei weiteren Ausgängen entgegen, schlüpft gerade dann hinaus, als hinter ihm die Haupttür auffliegt und Liebknecht am Diener vorbei in den Raum drängelt.
Harry steht im roten Thronzimmer, irritiert von der Intensität der Farben, während hinter ihm die Tür zum Säulensaal im Durchzug zuschlägt. Einen Moment sieht er noch Liebknechts erstauntes Gesicht, dann nimmt er die Beine in die Hand, stürzt durch die nächste Tür in den Bunten Gang, einen farbenfrohen schmalen Flur mit Tonnengewölbe, und entscheidet sich für links.
Rechts wäre richtig gewesen.
Hinter sich hört er, wie Liebknecht seine Leute anschreit, ihm nachzueilen. Ausgerechnet Liebknecht, dessen Traum er mit dem Hissen der roten Flagge auf dem Balkon ruiniert hat. So etwas kann auch die sanfteste Natur auf ganz üble Ideen bringen.
Harry springt die Treppen hinab und reißt die nächste Tür auf: Es ist der Schlüterhof. Fluchend blickt er sich um, während er oben auf der Treppe schon wieder das Getrappel von Füßen hört. Diesmal jedoch im Laufschritt. Vor ihm eine weitere Tür – zu der stürzt er: die Treppen wieder hinauf.
Ein doppelflügeliges Portal.
Dann steht er im Alabastersaal, und langsam beginnt er, den Prunk und Protz des Kaisers aufrichtig zu hassen. Der verdammte Saal ist etwa fünfundzwanzig Meter lang, sechzehn breit und vierunddreißig Meter hoch. Es gibt jede Menge Stuck und Marmor, aber dem Namen zum Trotz keinen Alabaster. Der Saal diente offenbar mal als Theater, jetzt eher als Möbel- und Bilderlager. So wird der Sprint zur nächsten Tür schräg gegenüber zu einem einzigen Hindernislauf, bei dem er beiläufig wahrnimmt, wie ausgesucht schlecht der Geschmack der Hohenzollern ist: ein Ölschinken neben dem nächsten und die Möbel wuchtige Trümmer aus edelsten Hölzern.
Hinter ihm hört er wütende Stimmen, die ihn auffordern, stehen zu bleiben.
Einer gibt einen Warnschuss ab.
Endlich erreicht er den Ausgang.
Wieder geht es die Treppen runter, dann endlich steht er im Eosanderhof.
Artur und seine Männer laden gerade die letzten Säcke auf, als er ihnen schon von Weitem zuruft: »LOS! LOS! LOS!«
Artur springt in den Lkw und startet durch, während Harry hinten auf die Ladefläche hechtet und alle anderen aus dem Eosanderportal stürmen.
Die Torflügel schwingen auf – Artur fährt hindurch und ruft den draußen Wartenden zu, dass das Schloss jetzt ihnen gehöre.
»Geht rein und holt euch euren Teil!«
Dann biegt er ab zur Schlossbrücke.
Innerhalb von Sekunden strömen die Menschen in den großen Hof und spülen die Spartakusleute zurück ins Schloss.
SPARTAKUS
2
Die Menschen träumten.
Und während sie träumten, erwachten die Ungeheuer.
Für kurze Zeit taumelte das Reich zwischen Unglauben und Euphorie, alles schien plötzlich möglich und nichts mehr verboten. Brüder und Schwestern waren sie jetzt, es gab keinen Adel, kein Militär, keinen Standesdünkel, keinen Befehl und Gehorsam mehr. Es war, als hätte man einen schweren Deckel angehoben, und wo eben noch ewige Nacht war, stach jetzt das Licht einer neuen Zukunft hinab auf die, die sich nach einem gerechten Utopia sehnten, in dem es keinen Stahl mehr gab, keine Ketten und keine Riegel.
Für einen Moment blickten sie in einen freien und vorurteilslosen Himmel: Arbeiter bekamen ihren Achtstundentag, Gewerkschaften vertraten ihre Rechte. Die Zensur wurde aufgehoben, die Gesindeordnung abgeschafft, Frauen durften endlich wählen. Politische Häftlinge wurden freigelassen, und Pressefreiheit war garantiert. Kaisertreue Beamte wurden verhaftet, Direktoren abgesetzt, und es wurde sogar darüber debattiert, wie man die Macht der großen Industrien brechen und den Besitz sozialisieren könnte.
Das Reich beherrschten nicht mehr alte Eliten, sondern Räte nach russischem Vorbild: Arbeiter wählten ihresgleichen zu politischen Vertretern, Soldaten taten es ihnen gleich. Statt des Kaisers mit einem marionettenhaften Parlament bestimmten jetzt der Rat der Volksbeauftragten und der Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte.
Alles durfte gedacht, diskutiert, gefordert werden.
Es gab kein Denkverbot und keine Grenzen mehr.
So träumten sie.
Und erwachten am 6. Dezember 1918, gerade mal einen Monat nach dem großen Sturz, mit dem Geschmack von Blut auf ihren Lippen.
An diesem Tag stolperte ich gegen Mittag mit meinen beiden Koffern und einem Stativ unter dem Arm aus dem Anhalter Bahnhof, irrte über den dreieckig anmutenden Askanischen Platz und fragte mich, ob und in welche Elektrische ich steigen sollte. In alle vier Himmelsrichtungen fuhren sie hier davon. Es war laut, die Straßenbahnen bimmelten, und es hätte nicht viel gefehlt, dass mich eine von ihnen erwischt und mein neues Leben in der Hauptstadt des Reichs schon nach zehn Minuten beendet hätte. Ich konnte gerade noch ausweichen und beschloss, zu Fuß zu gehen, auch weil ich das wenige Geld, das ich noch besaß, lieber sparen wollte.
Über die breite, von knorrigen, kahlen Winterbäumen flankierte Königgrätzer Straße landete ich bald am Potsdamer Platz, der mich mit seinem Chaos schockierte. Es war, als hätte Gott hier sämtliche Fahrzeuge, Fuhrwerke und Passanten Berlins aus einem Sack ausgeschüttet und sie alle angewiesen, gleichzeitig die gigantische Kreuzung zu passieren. Ein wuseliges Gedränge, Geschrei, schrilles Klingeln oder genervtes Tröten, je nachdem, wer gerade auf Vorfahrt pochte und sie nicht bekam.
Und dann kamen Unter den Linden und das Brandenburger Tor.
Hier hatte sich vor bald vier Wochen Weltgeschichte abgespielt.
Hier waren Hunderttausende aufgestanden und hatten den Kaiser gestürzt.
Hier hatte Preußens Herz zu schlagen aufgehört.
Jetzt lagen Boulevard und Wahrzeichen trist und grau im Schneematsch eines nasskalten Tages da, huschten Männer mit hochgeschlagenen Revers und tief in die Stirn gezogenen Hüten an mir vorbei, standen Frauen an Bretterbuden fliegender Händler auf dem Mittelstreifen. Soldaten mit roten Armbinden lungerten herum, und empört sah ich zwei Damen von sehr zweifelhaftem Ruf über die Gehsteige flanieren – und das am helllichten Tag!
Was einst weltberühmte Prachtstraße war, hatte jeden Glanz verloren.
Ich kam mir wie der verspätete Gast des größten Feuerwerks aller Zeiten vor, der auf nasses Konfetti, leere Flaschen und zerbrochenes Glas schaute, den alkoholschwangeren, schweißigen Muff der verschwundenen Gäste in der Nase.
Die Arme wurden mir schwer.
Und gleich danach auch das Herz.
Wie sollte ich in einem solchen Moloch Isi finden? Oder Artur? Wo sollte ich überhaupt anfangen zu suchen? Um eine Unterkunft für die Nacht musste ich mich auch noch kümmern. Ich war so überstürzt losgefahren, dass ich weder Plan noch Vorstellung hatte, wie ich hier überleben konnte.
Nasse Schneeflocken landeten in meinem Gesicht, meine Hände färbten sich blau und fühlten sich taub an. Ich musste raus aus diesem Wetter, und so stieg ich schließlich doch in eine Elektrische, denn die war wenigstens trocken und in gewisser Weise beheizt – von den Körpern der Mitfahrenden.
Ruckelnd und schaukelnd fuhr ich durch die Stadt, starrte aus dem Fenster und fragte mich, wie die Menschen hier auf den Sohn eines einfachen Schneiders aus Thorn reagieren würden. Auf einen weiteren heimatlosen ostelbischen Flüchtling, dessen Gesicht sich gerade staunend gegen die Scheibe presste, während sein Atem das Glas rhythmisch beschlug.
Irgendwann blickte ich gedankenverloren zu dem vielleicht siebzehnjährigen Mädchens schräg gegenüber von mir. Offenbar ertappt wirbelte ihr Kopf schnell zur anderen Seite herum, um wenig später erneut zu mir herüberzuschielen: Ich lächelte sie an, und sie grinste keck. Unter normalen Umständen hätte ich es schon aus Schüchternheit bei diesem Getändel belassen, aber ich fühlte mich so verloren in dieser Stadt, dass ich unbedingt mit jemandem sprechen wollte. Und wäre es auch nur für die Dauer von zwei Haltestationen.
»Hallo!« Ich nickte ihr freundlich zu.
»Neu inne Stadt?«, fragte sie vorwitzig.
Ich nickte: »Erster Tag.«
»Uffrejent, wa?«
»Sehr.«
»Wat machste denn hier?«, fragte sie.
»Was meinst du?«
»Na, watte so machen tust?«
»Beruflich?«, fragte ich vorsichtig zurück.
»Na, ditte inne Elektrische sitzt, se ick selba. Klar, beruflich!«
Sie wollte offenbar keine Zeit mit Geplänkel verschwenden.
Waren die hier etwa alle so?
»Ich bin Fotograf.«
»Na, kiek ma an! Denn bin ick wohl de Jräfin Koks vonne Jasanstalt?«
Sie glaubte mir nicht. Dennoch blieb ihr Gesichtsausdruck amüsiert – offenbar war das ihre Art, mit einem Mann zu schäkern. Ziemlich rau, wie ich fand. Jedenfalls öffnete ich einen meiner Koffer und zeigte ihr meine Kamera und die unbelichteten Glasplatten darin.
»Djibsonich! Du bist ja wirklich ’n richtja Fotojraf!«
Ich nickte wieder.
Sie hielt kurz inne, dann fragte sie kokett: »Findtse mir schön?«
»W-was?«, fragte ich verdattert.
»Na, ob de mir schön findest?«
»Nun, äh, schon …«
»Nun, äh, schon?!« Sie schnaubte übertrieben. »Fängst dir jleich ne Schelle!«
Ich schluckte.
Da grinste sie wieder: »Ick mach doch nur Spaß! Ick weeß selba, dit ick keen Modell bin, aber wie de siehst, sitzt allet anne richtijen Stellen!«
Sie rückte mit einem kurzen Griff ihre Oberweite zurecht.
Fassungslos starrte ich sie an.
»Jertrud!«, sagte sie und gab mir die Hand. »Jertrud Komrowski.«
»Carl Friedländer.«
Sie nickte zufrieden: »So, Carl Friedländer, jetz wower uns so jut kennen, kannste et dir ja mal übalejen mitten Foto. Weeste denn, wo de heute übernachten tust?«
»Nein«, gab ich seufzend zu.
»Na, da wüsst ick vielleicht wat! Mutter sucht noch ’n Bettjänger …«
»Wie bitte?«, rief ich empört.
»Mensch, een Schlafburschen! Eener, der ’n Bett fürn kleenet Jeld braucht. Wat dachtest du denn, wat ’n Bettjänger is’?«
»Nichts, nichts«, antwortete ich schnell.
»Jibst wohl keene, da wo de herkommst, wa?«
Bevor ich verneinen konnte, fuhr sie auch schon fort: »Na, ejal. Jedenfalls könnt ick mir vorstellen, det Muttern ooch mit uffs Bild will. Denn kricht doch jeda, wat er will: du ne warme Stube und ick een echtet Foto.«
»Hm, ja, klingt gut.«
»Nu tu ma bloß nich’ so bejeistert!«
»Entschuldige, ich wollte nicht …«
»Ejal, lass man jut sein! Wir wohn’ inne Lynarstraße fuffzehn. Issen bissken Jottwehde, abba dafür ruhig. De Revolution hat et nich’ bis nach Spandau jeschafft.«
Quietschend hielt die Straßenbahn.
Von draußen waren laute Stimmen zu hören, skandierend, ein Protestmarsch, der offenbar zum Stehen gekommen war. Es mussten Hunderte sein, die plötzlich um die Straßenbahn herumstanden und Plakate über die Köpfe hielten.
»Kiek se dir an, Carl. Spartakusleute«, sagte Gertrud und blickte nach draußen. »Den Ärjer haste bei uns nich’!«
Plötzlich splitterte Glas.
Ein langer entsetzter Aufschrei ging durch die Protestierenden.
Im nächsten Moment spritzte mir warme Flüssigkeit ins Gesicht.
Dann erst nahm ich das aus dem Krieg so vertraute Rattern eines Maschinengewehrs wahr, hörte das Pfeifen der Geschosse und warf mich auf den Boden.
TakTakTakTakTakTak.
Splitter rieselten auf mich herab.
Den Kopf schützend unter meinen Armen.
Die Bahn schaukelte wild. Ein paar Passagiere stürzten heraus, während sich andere von draußen gegen die Wagen zu werfen schienen.
Noch mehr Schreie!
Dreißig Sekunden, eine Minute.
Endlich stoppte der Beschuss.
Gespenstische Stille.
Einige Atemzüge noch blieb ich liegen, dann rappelte ich mich vorsichtig auf.
Draußen war die Straße wie leer gefegt.
Ich sah die Toten.
Die zahlreichen Verletzten. Sie stöhnten schwer, ihre Arme fuhren kraftlos durch die Luft: Sie winkten nach Hilfe. Gegenüber in einem Hausflur kauerten gut ein Dutzend Menschen, die sich noch nicht herauswagten.
Gertrud saß immer noch auf ihrem Platz.
Ihr Gesichtsausdruck fast überrascht.
Die Augen leer.
In ihrem Kopf eine tiefe Wunde.
Es war ihr Blut, das ich auf meinen Lippen schmeckte.
Fast vier Wochen hatten die Menschen geträumt.
Davon, dass die Revolution denen gehören musste, die sie angeführt hatten. Denen, die mutig in die Mündungen der Gewehre geblickt und nicht ausgewichen waren. Denen, die alles gewagt hatten.
War es nicht an ihnen, die Zukunft zu bestimmen?
Aber während sie träumten, hatte Reichskanzler Ebert in aller Heimlichkeit bereits einen Tag nach der Revolution einen Pakt mit dem Teufel geschlossen: dem Militär.
Er hätte es besser wissen müssen.
3
Vor nicht einmal vier Wochen waren sie zu Brüdern der Revolution geworden. Sie hatten einander umarmt, die Waffen abgelegt und sich geschworen, sie nie wieder anzurühren. Hatten den Offizieren die Schulterstücke und Kokarden abgerissen, den Gehorsam verweigert und sich rote Armbinden umgebunden. Vor nicht einmal vier Wochen waren aus strengen Gardefüsilieren bunte Maikäfer geworden.
Jetzt standen sie da, eine waffenstarrende menschliche Mauer in der Chausseestraße. Dieselben Soldaten. Vor ihnen lagen vierzehn zerschossene Körper, schrien Dutzende vor Schmerzen. Zögernd lösten sich die Ersten aus den Hauseingängen und Unterschlupfen, versuchten zu helfen, während die Soldaten stumm auf das blickten, was sie angerichtet hatten.
Sie hatten gehorcht.
Ihren Treueschwur erneuert.
Die Leichen bezeugten es.
Ich blickte durch den durchlöcherten Straßenbahnwagen. Gertrud und ich waren die letzten verbliebenen Fahrgäste. Zusammengesunken und mit einem ungläubigen Ausdruck im Gesicht saß sie da, während ich zu ihren Füßen niederkniete, um Balgenkamera sowie Glasplatte aus einem meiner Koffer zu holen.
Ich fühlte weder Wut noch Trauer.
Im Krieg hatte ich jedes nur denkbare Entsetzen gesehen und gelernt, meine Emotionen wie hinter einem Theatervorhang zu verstecken, um mich auf das zu konzentrieren, was ich mit einer Fotografie erzählen wollte. Nur Dokumentar sein. Nichts weglassen, nichts erfinden.
Zurück auf der Straße baute ich die Kamera auf, suchte nach dem Winkel, der das Bild schuf, das zukünftigen Generationen als Guckloch in die Vergangenheit dienen sollte: Sie sollten nicht nur sehen – sie sollten vor allem verstehen.
Abseits der Straßenmitte fand ich eine Strecke, in deren Flucht sich die Toten fast schon geometrisch verteilten, während im Hintergrund die Täter in Reih und Glied standen. Eine Komposition der Einsamkeit: die Toten, die nackte Straße, die gesichtslosen Soldaten im Hintergrund. Keiner von ihnen hatte einen Namen, eine Identität.
Ein anonymes Stillleben.
»Carl?«
Ich zuckte zusammen.
Diese Stimme.
Da drehte ich mich um: Isi.
Ungläubig starrten wir einander an.
Um uns dann in die Arme zu fallen.
»Du bist es wirklich!«
Zwei Jahre hatten wir uns nicht gesehen.
Zwei Jahre, in denen wir beide auf brutale Art und Weise erwachsen geworden waren. In denen für mich aus einem inszenierten Krieg ein realer wurde und ich glaubte, nie wieder glücklich sein zu können. Und doch war es plötzlich, als sähe ich uns alle, Artur, Isi und mich, wieder an Papas Zuschneidetisch sitzen, wie wir gerade ein Vermögen mit einem hinreißenden Schwindel verdient hatten und uns das erste Mal mit Wein zuprosteten. Damals, als wir unsterblich waren und wussten, dass das, was uns verband, nicht einmal ein Krieg würde trennen können.
Hier stand ich nun, hielt sie und sah all unsere gemeinsamen Erinnerungen wie Fotografien an: ihr selbst gebauter Verkaufstisch für die Kometenpillen und die geklauten Arztkittel, der Rote Hirsch, ihr Hund Kopernikus, das Feuerwerk am Ufer der Weichsel und Arturs Heiratsantrag. Selbst unser allererstes Kennenlernen, Papas blaues Kleid und ihr denkwürdiger Auftritt im Modewarenladen Seelig – alles da, so frisch, als wäre es eben erst passiert. Und ja, ich gestehe, auch dieser eine Moment auf dem Kosackenberg, wo sie aus dem gleißenden Licht eines Scheunenfensters vor mir aufgetaucht war und mir einen Blick in ihre Seele erlaubt hatte.
Wie vertraut das alles war!
Als wären wir nie getrennt gewesen.
Mittlerweile heulte ich wie ein Schlosshund, während sie meine Wangen in ihre Hände nahm und mein Gesicht mit Küssen bedeckte.
»Carl! Mein Carle!«
Wieder Küsse.
Dann hielt sie mich vor sich und grinste: »Gott, du heulst ja immer noch wie ein Mädchen!«
»Und du bist immer noch da, wo es Ärger gibt«, antwortete ich halb schluchzend, halb lachend.
»Tja, dann haben wir uns beide nicht groß geändert … Carle, ich kann dir gar nicht sagen … ich …«
Jetzt liefen auch ihr Tränen der Rührung über die Wangen.
»Was machst du hier?«, fragte ich.
»Protestieren, Carl. Wir hatten hier eine Revolution, weißt du?«
»Ist mir nicht entgangen …«
»Gut, dann weißt du auch, dass hier mittlerweile ein paar Sachen ziemlich schieflaufen. Seit Tagen schwirren Gerüchte, dass das Militär putschen möchte. Diese Bastarde!«
Ich wischte mir die Tränen aus den Augenwinkeln: »Können wir trotzdem von hier weg? Bevor sie uns auch erschießen?«
Isi hielt scheinbar nach jemandem Ausschau, den sie in dem Chaos nicht ausfindig machen konnte. Dann nickte sie mir zu: »In Ordnung. Nur kurz noch, bitte …«
Sie marschierte den Soldaten entgegen, stellte sich vor einen Leutnant, hielt seinen Blick und spuckte ihm dann vor die Füße. Vor lauter Überraschung unfähig, sich zu rühren, sah er, wie sie wieder zu mir zurückkehrte und sich bei mir unterhakte.
»Wollen wir?«
Gemeinsam verließen wir die Straße der Toten.
4
Nicht weit von der Chausseestraße, mitten im Wedding, lebte Isi in der Voltastraße, und schon auf dem Fußmarsch dorthin fiel das überlebensgroße kaiserliche Berlin zu tristen, kalten Mietskasernen zusammen, in denen Menschen wie Vieh zusammengepfercht worden waren: schmutzige Kinder ohne Schuhe, gebeugte Mütterchen in Trauer und bettelnde Kriegskrüppel, die ihre Hüte vor sich hielten.
Wir erreichten Haus Nummer fünfundzwanzig, über dessen Torbogen Erster Hof prangte und in dessen Tiefe zwei weitere Plätze schwach auszumachen waren, über deren Torbögen Zweiter Hof und Dritter Hof geschrieben stand.
»Ich wohne im ersten Haus«, sagte Isi. »Weiter hinten hast du weder Licht noch frische Luft. Dafür ist es da aber billiger.«
Ich nickte und hörte gleichzeitig aus der Dunkelheit das laute Fluchen eines Mannes, gefolgt von wildem Hufgeklapper. Dann torkelte ein dürrer Gaul in den Lichtkegel einer Laterne, einen schmalen Wagen ziehend, auf dem ein Kutscher hektisch die Peitsche schwang.
Es nutzte nichts.
Das Pferd brach auf dem Pflaster zusammen und rührte sich nach zwei schweren letzten Atemzügen nicht mehr. Einen Moment saß der Alte noch auf dem Kutschbock, dann stieg er von seinem Wagen, befreite das Pferd von seinem Geschirr und kratzte sich ratlos am Kopf.
Dann aber kamen sie.
Schatten aus rußigen Hofeingängen.
Abgerissene Gestalten.
Wo eine Gaslaterne brannte, konnte man für kurze Zeit ihre zerfurchten, leeren Gesichter sehen.
In ihren Händen blitzten Messer.
Der Kutscher versuchte noch, sie zu verscheuchen, riss sich die Kappe vom Kopf und schlug nach den Ersten, aber da machten sich die anderen schon über den Kadaver her: Sie stachen in das Pferd, schlitzten es auf, schnitten dampfende Fleischstücke aus ihm heraus und verschwanden damit in der Dunkelheit. Es roch nach Blut, und je intensiver der Geruch wurde, desto mehr Menschen tauchten im Lichtkegel der Gaslaterne auf, rammten ihre Messer ins Fleisch und nahmen sich ihren Anteil. Der Kopf des Pferdes dagegen ruckte und zuckte, während der Ausdruck in seinem Gesicht unbeteiligt blieb. Es starrte ins Nichts, löste sich dabei Stück für Stück auf.
Und so schoss ich die Fotografie, die das Leben hier erklärte, ohne dass dafür auch nur eine einzige Silbe hätte ausgesprochen werden müssen: grauschwarze Rücken und blutige Hände im gelben Licht einer Gaslaterne. Eine menschliche Traube des Hungers, aus der ein Pferdekopf herausragte.
Ich empfand weder Ekel noch Verwunderung, sondern hatte mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild dessen gemacht, was hier in den letzten Kriegsjahren an Leid und Tod passiert sein musste. Armut war schon immer eine strenge Herrin: Was sie dir an Leben ließ, nahm sie dir an Würde wieder ab.
Isi zog an meinem Ärmel, sie wollte gehen.
Wir stiegen im ersten Haus die dunkle Treppe hinauf, auf der es nach Kohl, Schimmel und Hoffnungslosigkeit roch, bis in den vorletzten Stock, wo Isi die Tür zu einem kleinen, aber gemütlichen Zimmer aufschloss.
Dort entzündete sie zwei Gaslaternen.
»Das Klo ist auf der halben Treppe. Waschen geht ganz gut hier am Becken«, erklärte sie.
Immerhin hatte es einen Wasseranschluss, womit sich der Luxus auch schon erschöpfte. Es gab noch ein Bett, einen gusseisernen Ofen, auf dem man kochen konnte, einen Schrank, einen Tisch, zwei Stühle und einen Spiegel. Unwillkürlich grinste ich: Isi hätte in einem Erdloch leben können, aber auf einen Spiegel würde sie nicht verzichten.
»Normalerweise leben in einer Wohnung wie meiner fünf oder sechs Leute. Ich hoffe, du weißt die Annehmlichkeiten zu schätzen.«
»Das ist alles viel übler, als ich dachte.«
Sie nickte: »Viele sind verhungert, noch mehr an der Spanischen Grippe gestorben. In Thorn hatten wir es auch schwer, aber es war nichts verglichen mit dem, was hier ist. Darum ist es ja so wichtig, dass wir für eine bessere Gesellschaft kämpfen, Carl. Der Tod ist nicht das Schlimmste, glaub mir.«
»Ich will nicht mehr kämpfen, Isi.«
Sie kam auf mich zu, hob mit zwei Fingern mein Kinn an und lächelte: »Du willst! Und du wirst, Carl Schneiderssohn. Sie wollen uns die Revolution stehlen. Ich fühle es.«
Ich seufzte.
»Hunger?«, fragte sie.
Ich nickte zaghaft.
»Wie lange hast du nichts mehr gegessen?«
Ich zuckte mit den Schultern: »Zwei Tage.«
»Dann mache ich lieber ein bisschen mehr, hm?«
Wieder nickte ich.
Zu meiner Verwunderung hatte sie Bohnen, Speck und Kartoffeln. Auch Mehl, Zucker, Butter und Salz.
»Wie machst du das bloß?«, fragte ich sie mit Blick auf die Lebensmittel.
Doch sie lächelte nur.
Ich aß, als gäbe es kein Morgen mehr. Danach gab es Kaffee – natürlich hatte sie welchen! Wir saßen zusammen da und sprachen bis tief in die Nacht. Es war viel passiert in den letzten beiden Jahren, und so hörten wir einander schweigend zu. Ich erzählte von meiner Arbeit beim K.-u.-k.-Kriegspressequartier, von Masha und davon, wie ich Isis Hinweis auf das Ziel ihrer Flucht in unserem Versteck in Papas Schneiderstube gefunden hatte.
Sie von ihrer restlichen Zeit im Gefängnis, vom Tod ihrer Mutter und der Rache an ihrem Vater. Und wie ihr Polizeikommandant Adolf Tessmann auf die Pelle gerückt war und sie in der Nacht des großen Brands nach Berlin verschwunden war.
»Warst du das eigentlich?«, fragte ich sie.
»Der Brand?«
Sie zuckte gelangweilt mit den Schultern, was alles hätte heißen können: ja, nein, vielleicht.
Dann schwiegen wir eine Weile, und ich sah ihrem Gesicht an, dass sie nach Artur fragen wollte und es nicht wagte: Die mutige Isi fürchtete die Antwort.
Da nahm ich ihre Hand: »Artur lebt.«
Tränen schossen ihr in die Augen.
»Wirklich?«, würgte sie hervor.
»Jedenfalls hoffe ich das. Aber wenn, dann nicht unter seinem Namen Artur Burwitz, sondern als Anton Reimann.«
Sie sah mich stirnrunzelnd an.
»Ich glaube, er ist desertiert und hat seine Identität mit der eines toten Soldaten getauscht.«
Dann berichtete ich ihr, was Artur mir in seinem letzten Brief geschrieben hatte, von seiner Zeit in Lettland, von Larissa und dem Kind. Und natürlich von Falk Boysen, der Arturs und Larissas Tod gewollt und Isi ins Gefängnis geschickt hatte.
»Falk lebt also auch?«, zischte Isi wütend.
»Sieht so aus, ja.«
Wieder Schweigen.
Dann rief sie munter: »Morgen suchen wir nach Artur.«
»Gern.«
»Wir fangen in den Krankenhäusern an. Vielleicht finden wir da seine Spur.«
»In Ordnung.«
In jener Nacht übernachtete ich auf dem Boden und war mir sicher, noch nie besser geschlafen zu haben.
5
Wir erwachten früh am Morgen, immer noch beseelt davon, dass wir uns gefunden hatten, immer noch fest entschlossen, den Dritten im Bund auch aufzuspüren. Wir aßen nicht viel, redeten wenig, und als wir die Voltastraße betraten, war von dem Pferd nicht mehr viel übrig. Noch ein paar Knochen, der Schweif, drei Hufe, der Kopf und ein dunkler Fleck auf dem Boden.
Den Rest des Tages verbrachten wir mit Suchen.
Dem Durchkreuzen der Stadt.
Den immer gleichen Fragen nach einem Artur Burwitz oder Anton Reimann.
Dabei blieben uns die Sanitätskasernen grundsätzlich verschlossen, während alle anderen Krankenhäuser und Sanatorien, in denen wir vorsprachen, sich wenig begeistert zeigten, dass sie unseretwegen in den Archiven nach der Aufnahme eines Burwitz oder Reimann suchen sollten. Gleich der erste Rezeptionist im Lazarus-Krankenhaus in der Bernauer Straße fauchte uns an, dass es immer noch unzählige arme Teufel gebe, die von der ehemaligen Front zurückkämen, die jede Hilfe benötigten und sicher wenig Verständnis dafür aufbrächten, wenn wertvolle Mitarbeiter im Keller nach Patientenakten suchten.
»Wieso wertvolle Mitarbeiter?«, schnippte Isi zurück. »Es reicht doch, wenn Sie danach suchen!«
Das verbesserte unsere Position nicht gerade.
Mit Anbruch der Dämmerung gaben wir auf.
Zwar wollten wir auch in den nächsten Tagen noch unser Glück versuchen, aber es zeichnete sich jetzt schon ab, dass unser Ansatz zum Scheitern verurteilt war. Nicht nur die vielen Verletzten waren der Grund, sondern auch, dass sich niemand mehr mit dem Krieg beschäftigen wollte. Hinzu kam, dass wir nicht wussten, ob Artur überhaupt in Berlin war. Zwar hatte mir damals die Krankenschwester in Riga versichert, dass Anton Reimann mit seinen schweren Verletzungen nach Berlin verlegt werden würde, aber was, wenn er doch noch verstorben war?
»Er lebt!«, beschied Isi und klang dabei trotzig.
Wir kehrten zurück in die Voltastraße, aßen zu Abend, bevor Isi sich erneut vor dem Spiegel zurechtmachte.
»Gehst du noch aus?«, fragte ich.
»Wir gehen noch aus.«
Sie kniff sich in die Wangen, die sich zart röteten, drehte sich zu mir um und kündigte ruhig an: »Es gibt da etwas, das ich dir noch sagen muss …«
Ich seufzte: »Was hast du angestellt?«
Sie blieb unbeirrt: »Als du mir gestern erzählt hast, wie viele Fotos und Filme du für das KPQ gefälscht hast … und dass du in gewisser Weise auch Masha wegen diesem ganzen Irrsinn verloren hast … da meintest du doch, dass du eines gelernt hast: Nichts ist so gefährlich wie die Lüge.«
»Ja.«
»Das, was hier gerade passiert, ist auch eine Lüge.«
»Was meinst du?«
»Dass wir eine neue Gesellschaft bekommen. Dass endlich Gerechtigkeit ist. Dass alle die gleichen Chancen haben und alle glücklich sein dürfen. Alles Lügen.«
»Und?«
»UND?!«
Sie war plötzlich so wütend, dass ich unwillkürlich vor ihr zurückwich. Dann aber atmete sie tief durch: »Ich will, dass diese Lügen aufhören. Und deshalb habe ich der Armee Waffen gestohlen.«
Bei ihr musste man immer auf so einiges gefasst sein, aber das war einer dieser Sätze, bei denen man froh war, wenn man schon saß.
»Suchen Sie dich?« Ich schluckte.
Sie zuckte mit den Schultern: »Keine Ahnung. Eher nicht.«
»Eher nicht?«
»Ich werde bestimmt nicht nachfragen, Carl!«
Ich schnaubte.
Dann aber sagte ich versöhnlicher: »Na ja, ist in diesen Zeiten vielleicht gar nicht so schlecht, ein paar Gewehre zu besitzen.«
»Ich habe Maschinengewehre, Handgranaten, Gewehre, Pistolen und auch ein paar Minenwerfer. Und natürlich Munition für alles.«
Ich starrte sie an.
»War ’ne Gelegenheit«, lächelte sie entschuldigend.
Dann berichtete sie mir haarklein von der Eroberung der Maikäferkaserne und der plötzlichen Eingebung, sich den Lastkraftwagen unter den Nagel zu reißen.
»Ich dachte einfach, was ich ihnen abnehme, können sie nicht mehr gegen andere einsetzen. Und wie es aussieht, lag ich ja wohl nicht so schlecht mit meiner Einschätzung.«
Ich hob die Hand: »Schon gut! Sag mir lieber, was du damit vorhast.«
Sie nickte: »Komm! Ich will dich ein paar Leuten vorstellen.«
Wir verließen ihre Wohnung und erreichten wenige Minuten später eine Gießerei namens Keiling & Thomas in der Gartenstraße. Ein dunkles Fabrikgebäude mit blinden Fenstern, das Ruß und Staub zu atmen schien.
Drinnen wurde in kleinen Kupolöfen Gusseisen gegossen, und es war unerträglich heiß. Die Arbeit hier war hart, die Menschen, die sie taten, dreckig und durch die Hitze und Belastung sichtlich gereizt. Ich versuchte, mir nicht auszumalen, was passierte, wenn einer von ihnen versehentlich eine Ladung geschmolzenes Metall abbekam.
In sicherer Entfernung von den Maschinen sah ich gut dreißig Männer versammelt, allesamt in groben, schmutzigen Arbeitsanzügen, verschwitzt und müde. Eine kleine Gruppe, die, wie Isi mir zuflüsterte, ausnahmslos aus Spartakusleuten bestand, hatte sich mit einem Tisch und ein paar Stühlen vor ihnen aufgebaut. Unter ihnen war keine einzige Frau, und als wir zu den Leuten traten, konnte kaum jemand den Blick von Isi lassen.
Ein Kerl, den Isi mir als Obmann Wilhelm Lange vorstellte, sprach gerade zu den Männern und hielt sichtlich ungehalten inne, weil sich die Arbeiter die Hälse verrenkten und ihm niemand mehr zuhörte. Isi und ich traten neben ihn und einen blutjungen Matrosen. Lange konnte weiterreden.
»Genossen, ihr wisst alle, was da gestern passiert ist. Es sind nicht nur unsere Leute erschossen worden, die Regierung hat uns verkauft.«
Der Matrose neben uns unterbrach ihn: »Das ist unsere Revolution! Wir haben alles riskiert! WIR! Ebert und Scheidemann haben sie uns gestohlen! Was haben die denn schon gemacht in den letzten vier Jahren? Genossen, sagt mir: Was haben die für uns getan?«
Lautes Murren war die Antwort. Ich wusste nicht recht, ob ich einstimmen sollte oder nicht.
Einige riefen: »Nieder!«, andere: »Feiglinge!«
»So ist es, meine Freunde! Sie haben rumgesessen, während unsere Kameraden verreckt und eure Frauen und Kinder verhungert sind! Wir sind aufgestanden gegen den Kaiser! WIR!«
Die Männer jubelten.
Ich war erstaunt, wie gut dieser junge Matrose sprach. Er konnte keine zwanzig Jahre alt sein, aber er traf den Ton und die Herzen seiner Zuhörer.
Lange nickte: »Genosse Theo hat recht: Wir haben den Kaiser gestürzt und die Kasernen erobert. Doch was passiert gerade? Das Militär ist zurück! Und Reichskanzler Ebert hat einen Pakt mit ihnen geschlossen. Sie stehlen vor unseren Augen das, was wir erkämpft haben!«
Einer der Arbeiter trat vor und rief: »Genossen, Ebert und Scheidemann stehen doch auf unserer Seite! Die SPD und USPD sitzen in der Regierung – Spartakus könnte mitmachen, will aber nicht.«
Theo schrie: »Bist du wirklich so blind, Genosse? Sie haben gestern auf uns geschossen! Auf Unbewaffnete, Frauen und Kinder. Wie, glaubst du, ist es möglich, dass die das einfach so tun können? Wer gab dazu den Befehl? Polizeipräsident Eichhorn war es nicht!«
Wieder große Zustimmung unter den Arbeitern.
»Reichskanzler Ebert war es auch nicht!«, rief der Mann zurück.
»Aber er hat es nicht verhindern können! Richtig?«
Der Mann schwieg.
»Ist das richtig, Genosse?!«, schrie Theo jetzt.
Darauf wusste der Arbeiter nichts zu sagen, doch sein schmerzlicher Gesichtsausdruck sprach Bände: Auch ihm war klar, dass Ebert die Militärs nicht unter Kontrolle hatte.
Theo heizte seinen Zuhörern jetzt richtig ein: »Ich sage euch: Wir müssen uns wehren! Wir müssen ihnen zeigen, dass sie das nicht mit uns machen können. Liebknecht und Luxemburg sind für ihre Überzeugungen ins Gefängnis gegangen. Sind Ebert und Scheidemann je für irgendwas wirklich eingestanden?«
Wieder große Zustimmung, wieder einige, die »Feiglinge!« riefen.
»Aber sie werden! Alle Arbeiterverräter kommen ins Gefängnis! Wir sorgen dafür, Genossen!«
Heftiger Applaus.
Da trat ein anderer vor und fragte: »Und wie willst du das anstellen? Was sollen wir tun? Uns zusammenschießen lassen wie die gestern?«
Theo schüttelte den Kopf: »Nein, wir werden kämpfen!«
»Womit?« Der Mann ließ nicht locker. »Zum Kämpfen braucht man Waffen!«
Theo nickte. »Wir werden Waffen bekommen!«
»Tatsächlich?«
Theo nickte: »Ich verspreche es dir!«
Einen Moment schwiegen alle.
Ich starrte Isi an, bis sie meinen Blick erwiderte, und schüttelte unmerklich den Kopf.
Sie sah unentschlossen aus.
Obmann Lange rief: »Wichtig ist jetzt, dass wir alle zusammenstehen. Daher frage ich euch: Wollt ihr an unserer Seite sein?«
Ein lang gezogenes »Jaaaa!« war die Antwort.
»Dann, bitte, hört, was Genossin Luise euch zu sagen hat!«
Alle Blicke wandten sich Isi zu, die keine Anzeichen von Nervosität zeigte.
»Genossen, ihr habt alle schon mitbekommen, dass unser Heer in drei Tagen zurück nach Berlin kommt. Was ihr aber nicht wisst, ist, dass es ernst zu nehmende Gerüchte gibt, dass sie nicht heimkehren, sondern einmarschieren. Sie wollen zurück an die Macht. Und sie haben gestern bewiesen, dass sie den Kontrollverlust vom 9. November überwunden haben!«
Sie legte eine kleine Kunstpause ein und rief dann: »Genossen, wir sind sicher, dass die Truppen einen Putsch vorbereiten. Und das bedeutet für uns das Ende des Sozialismus. Das Ende der Freiheit!«
Die anfängliche Unruhe fiel zu einem betroffenen Schweigen zusammen.
»Woher willst du das wissen, Schwester?«, rief jemand.