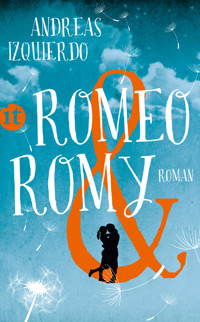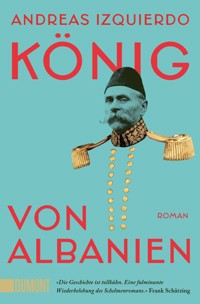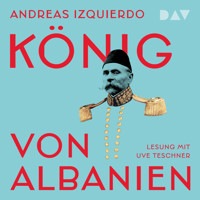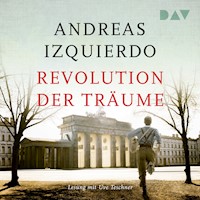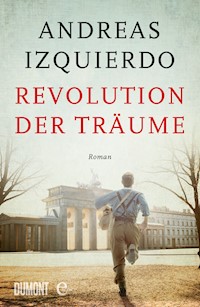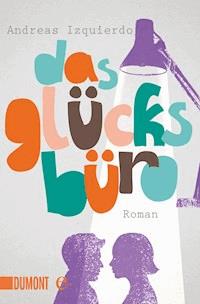11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Dame in den besten Jahren sucht Kavalier, der sie zum Nacktbadestrand fährt. Entgeltung garantiert.« – Eine Annonce in der örtlichen Tageszeitung bringt alles ins Rollen: Hedy von Pyritz, 88 Jahre, diszipliniert, scharfzüngig, eitel. Hellwacher Verstand, trockener Humor, zuweilen übergriffig. Eine alte Dame, die meist im Rollstuhl sitzt, sorgt für einen handfesten Skandal in dem kleinen Städtchen im Münsterland, wo sie herrschaftlich residiert.
Aber Fräulein Hedy bleibt unbeirrt: Sie wird ihren Willen durchsetzen! Und findet in ihrem schüchternen, sanften Physiotherapeuten Jan einen Mitstreiter. Vielmehr nötigt sie ihn förmlich dazu. Der junge Mann wird sie fahren. Basta!
Jan hat keinen Führerschein, dafür aber eine nie behandelte Lese-Rechtschreibschwäche, so dass Hedy den Unterricht übernimmt und sich schon bald eine ungewöhnliche Beziehung zwischen den beiden festigt. So vertraut sie ihm nach und nach die Geheimnisse ihrer schillernden Vergangenheit an und verändert damit auf ungeahnte Weise seine Zukunft ...
Andreas Izquierdo erzählt in seinem Roman die Geschichte einer Freundschaft zwischen einer alten Frau und einem jungen Mann, die beide für immer verändert – eine Geschichte, die federleicht beginnt und sich dann zu einem wuchtigen, mitreißenden Drama entwickelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Izquierdo
Fräulein Hedy träumt vom Fliegen
Roman
Insel Verlag
Fräulein Hedy träumt vom Fliegen
Für Pili
Timbuktu
1
Gegen drei Uhr in der Früh erwachte Fräulein Hedy aus einem herrlichen Traum und verlor den Verstand. Da war ein Kichern in ihrem Kopf und ein Kitzeln in ihrem Bauch, als sie mit einem lausbübischen Grinsen aus dem Bett stieg, auf Zehenspitzen zum Fenster tippelte, barfuß auf die Brüstung ihres französischen Balkons im Dachgeschoss stieg und die Arme weit von sich streckte. Da stand sie dann: ein fliegendes Nachthemd mit Dutt im bleichen Mondlicht.
Es war ganz still oben auf dem Hügel, auf dem ihre Villa stand, während sich die kleine Stadt zu ihren Füßen fast schon in mittelalterlicher Ehrfurcht vor ihr zu verbeugen schien. Dabei war es so kalt, dass die Luft klirrte und man die leisen Seufzer derer zu hören glaubte, die sich im Schlaf die Decken über die Köpfe gezogen hatten.
Fräulein Hedy kannte ihre kleinen und großen Wünsche, ihre Hoffnungen, Sehnsüchte und Niederlagen. Nichts war ihr in den vergangenen achtundachtzig Jahren verborgen geblieben, sie hatte sie alle überlebt, und jetzt flog sie über sie hinweg, und ihr war, als würde sie die kleinen Schluchzer und Stöhner mit sich nehmen auf ihrem Flug durch die Nacht, und je mehr sie davon sammelte, desto gewaltiger baute sich ein Ruf in ihren Lungen auf.
»TIM-BUK-TUUU! TIM-BUK-TUUU!«
Das Herz einer alten Frau hatte viele Geheimnisse.
Einen Moment später schon riss ihre Haushälterin Maria die Schlafzimmertür auf, stürmte zu ihr, umfasste mit kräftigen Armen ihre Taille und zog sie vom Balkon herunter, zurück ins Zimmer. Dann schloss sie die Fenster und rieb sich fröstelnd die nackten Arme.
»Was ist passiert?!«, rief sie besorgt.
Hedy sah sie lächelnd an.
»Sind Sie wach?«, fragte Maria und wedelte mit den Händen vor ihren Augen herum.
Hedy zog mürrisch die Brauen zusammen: »Was machen Sie denn da?«
»Ihr Leben retten.«
»Das ist doch Unsinn!«
»Draußen sind es minus zehn Grad. Und Sie stehen in der Kälte und heulen den Mond an!«
»Nichts dergleichen!«
»Ich bin davon wach geworden, Fräulein Hedy!«
»Dann gehen Sie jetzt wieder schlafen!«
»Und es ist alles in Ordnung?«, hakte Maria nach.
»Aber natürlich!«
»Sie sind nicht verrückt geworden?«
»Nein.«
»Und was soll dann dieses Geschrei?«
»Was für ein Geschrei?«
»Dieses ›Timbuktuuu! Timbuktuuu!‹.« Maria fuhr mit den Händen durch die Luft, um den absurden Vorgang zu unterstreichen.
Hedy zuckte mit den Schultern: »Eine Stadt in Afrika. Mali, genauer gesagt.«
»Und?«
»Nichts: und. Ich war nie dort.«
»Dann haben Sie geträumt?«
»Bestimmt.«
Maria fixierte sie noch einen Moment, dann seufzte sie leise und fragte: »Wollen Sie etwas essen?«
»Jetzt?«
»Essen hält Leib und Seele zusammen!«, beharrte Maria.
Hedy schüttelte den Kopf: »Gute Nacht, Maria!«
Sie kehrte ihr den Rücken und wartete, bis Maria leise das Zimmer verlassen hatte. Eine Weile starrte sie noch durch das Fenster in den Nachthimmel. Da dachte sie ebenso wirr wie schelmisch: Die Königin war erwacht, ein Spatz hatte an ihrem Haar gezupft. Lass ihn ein in den großen Irrgarten der unerzählten Geschichten.
Öffne das Fenster und biete ihm die Welt.
2
Am nächsten Morgen deutete nichts mehr darauf hin, dass Fräulein Hedy den Verstand verloren haben könnte, denn sie begann diesen Morgen, wie sie jeden Morgen begann: Sie nutzte den Treppenlift, um ins Parterre zu fahren, wo Maria bereits auf sie wartete, weil sie dort immer auf sie wartete, und es war, als schwebte ihre Hoheit aus dem Himmel herab zu ihren Untertanen.
Sie ließ sich aus dem Sitz helfen, schlüpfte in einen dicken Wintermantel, ging noch vor dem Morgengrauen zur Tür hinaus und marschierte dann die lange, beleuchtete Auffahrt ihres Anwesens genau sieben Mal auf und ab. Mit geradem Rücken und durchgedrückten Knien und für eine Dame ihres Alters mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
Obwohl Tauwetter eingesetzt hatte, zitterte Maria vor Kälte, während sie bei den Stufen zum Anwesen auf Hedy wartete und die Zeitung vom Boden aufhob. Sie beobachtete Fräulein Hedy bei ihrem morgendlichen Ausdauertraining: Atemwölkchen stiegen aus ihrem Mund wie Dampf aus einer Lokomotive, als sie dort die Auffahrt hoch- und runterschnaubte. Hedy hatte Schmerzen in den Knien, Fußgelenken und im Rücken, und Maria bewunderte sie jeden Morgen für ihre Disziplin und ihre Härte gegen sich selbst, denn Hedy verzog keine Miene beim Marschieren, und hätte man sie gefragt, wie es ihr ginge, hätte sie Blendend! gerufen und abgewunken.
Pünktlich zur siebten Runde ging Maria Hedy ein Stück entgegen und bot ihr den Arm, den Hedy beiläufig annahm. Sie war erschöpft, Maria sah es in Hedys Augen, aber sie sagte kein Wort, sondern stieg mit Maria langsam die Treppe zur Eingangstür hinauf, wo der Rollstuhl wartete, in den Hedy sich setzte, um sich fortan von Maria durch die Villa schieben zu lassen.
»Ins Bad!«, ordnete Hedy an.
»Sehr wohl!«, antwortete Maria.
Später schob sie die wie aus dem Ei gepellt aussehende Hedy in die Küche, wo ein karges Frühstück und ein starker Kaffee auf sie warteten. Sie aß und trank langsam und ließ sich von Maria die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Lokalteil der Zeitung vorlesen, die sie hier und da mit spöttischem Schnauben oder wohlwollendem Lächeln kommentierte.
»Was ist mit der Zeitung?«, fragte Hedy, als Maria gerade einen Beschluss des Stadtrats vorlas, der Kürzungen im Kulturhaushalt vorsah.
Maria blickte auf: »Was soll mit ihr sein?«
Hedy nickte kurz – Maria knickte mit einem Finger eine Ecke des Papiers um und kommentierte die Dreckschlieren darauf knapp mit: »Der Zeitungsjunge.«
Hedy nickte düster.
»Wie geht es Ihnen heute?«, fragte Maria.
»Blendend.«
»Ich meine … nach gestern Nacht!«
Hedy setzte die Kaffeetasse ab und tupfte sich die Mundwinkel: »Es war ein Traum.«
»Vielleicht sollten wir einen Arzt konsultieren?«
»Mir fehlt nichts, Maria.«
»Vielleicht der Mond?«
Hedy runzelte die Stirn.
»So etwas kommt vor!«, bekräftigte Maria.
Hedy schwieg eine Weile.
Und sagte dann: »Nein.«
»Nein?«
»Nein. Ich habe nur viel zu lange geschlafen. Aber jetzt bin ich wach.«
Maria sah sie unverwandt an.
»Und Sie sind sicher, dass es Ihnen gut geht?«, fragte sie misstrauisch.
Hedy lächelte sanft: »Ich bin wach. Nach all der Zeit endlich wach …«
Maria stand auf und sagte: »Ich rufe Dr. Weyers an.«
»Setzen Sie sich hin!«, befahl Hedy und beschied mit einer Geste, dass Maria mit der Lektüre fortzufahren habe. Die nahm nach kurzem Zögern wieder Platz, griff nach der Zeitung und begann zu lesen. Die Mittel für die Kammerkonzerte sollten gesenkt werden. Im Gegenzug hoffte man auf private Gönner, um die liebgewonnenen Auftritte der Musiker auch weiterhin finanzieren zu können.
Hedy trommelte ungeduldig mit den Fingern auf den Küchentisch und starrte auf die Zeitung.
»Genug!«, befand sie.
Maria sah sie über die Zeitung hinweg an.
»Wir fahren in die Stadt!«
»Jetzt? Es ist gerade mal halb acht! Wo wollen Sie denn hin?«
»Wir fahren zur Redaktion!«
»Wir könnten doch anrufen?«
»Bestellen Sie ein Taxi!«, gab Hedy zurück und schob sich mit dem Rollstuhl vom Tisch. »Es ist höchste Zeit!«
Was so drängte, sagte sie nicht, aber sie fuhren zum Pressehaus, doch nicht, um sich über den Zeitungsjungen zu beschweren. Und da wusste Maria, dass Hedy den Verstand verloren haben musste. Dass die letzte Nacht kein Zufall gewesen war, sondern allenfalls der Auftakt zu einer ganzen Reihe galoppierender Verrücktheiten, die nichts als Ärger einbringen würden.
Fräulein Hedy gab eine Anzeige auf.
Und diese Anzeige würde das brave, protestantische, münsterländische Städtchen, das die alte Dame so verehrte, in seinen Grundfesten erschüttern.
Denn Fräulein Hedy wollte zum Strand.
3
Der Tag hatte also kaum begonnen und schon bestand sein Sinn nur noch darin, dass er endlich vorüberzog, um einem neuen Platz zu machen, der einem Skandal Bühne bieten würde, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte. Jedenfalls war das Marias feste Überzeugung.
Hedy hingegen ging ihrer Arbeit völlig ungerührt nach, bestritt den Tag wie jeden anderen, beginnend mit der Bearbeitung der Post, den üblichen Telefonaten und der Organisation der von ihr begründeten Stiftung für begabte Kinder, der sie als Stiftungsratsvorsitzende vorstand.
Seit Jahrzehnten hatte sie unzähligen Talenten den Weg in eine bessere Zukunft geebnet, ganz gleich, auf welchem Feld ihre Begabungen lagen: Literatur, Kunst, Musik, Mathematik oder Wissenschaften. Die Stiftung prüfte, Fräulein Hedy entschied – nach Konsultation mit ihrem Stiftungsrat, dem auch ihre Tochter Hannah angehörte. Viele ihrer Kinder hatten es weit gebracht, fast ausnahmslos hatten sie einen Beruf gefunden, der sie glücklich machte, und sie wussten alle, wem sie dies zu verdanken hatten. Und ihre Eltern und Großeltern wussten das auch, was Fräulein Hedy zur unangefochtenen Herrscherin der Stadt machte, respektiert und auch ein bisschen gefürchtet von jedermann.
Aus diesen Gründen war Hedy sehr empfindlich, was Kürzungen in den Etats für Kultur und bildende Künste betraf, denn sie wurde nicht müde zu erklären, dass sie den furchtbarsten aller Kriege nicht überlebt hatte, um anschließend dabei zuzusehen, wie Verrohung und Dummheit einen möglichen weiteren heraufbeschworen.
So rief sie den Bürgermeister an und verabredete mit zuckersüßer Stimme für den nächsten Kammermusikabend ein Gespräch mit ihm. Da wusste Herr Schmidtke genau, was die Stunde geschlagen hatte, und verfluchte bereits den Beschluss der Fraktionen im Stadtrat, denn er saß ebenfalls im Stiftungsbeirat und hatte oft genug erlebt, wie unnachgiebig Fräulein Hedy war, wenn ihr irgendetwas gegen den Strich ging.
Danach prüfte sie Bewerbungen.
Ihre Stiftung verlangte eine Reihe von Vorgaben, um in den Genuss einer Förderung zu kommen, und schon die äußere Form der Bewerbung verriet Hedy viel über den Geist, der sie verfasst hatte. So wies sie schon mal Bewerber ab, die formvollendet, aber vollkommen blutleer um ein Stipendium baten, und zog andere vor, deren chaotische Gedankengänge sie interessierten. Junge Menschen, von denen sie sich erhoffte, dass sie der Gesellschaft eines Tages mehr zurückgeben würden als gute Noten und Konformität.
Dennoch liebte sie Regeln und irrte sich selten in Menschen.
Und wenn, dann gab sie es nicht zu.
Am Mittag ließ sie sich von Maria zwei Spiegeleier mit Spinat machen und ruhte anschließend eine Stunde.
Den Rest des Tages verhielt sie sich völlig unauffällig, erledigte wie immer diszipliniert und effizient Telefonate, schrieb Briefe, kleine Meisterwerke in geschliffenem Deutsch und mit intelligenten Pointen, auf die sie mit Recht sehr stolz war. Briefe, die Sponsoren an ihre Großzügigkeit oder ehemalige Stipendiaten an ihre Verantwortung zukünftigen Generationen gegenüber erinnerten. Briefe, die so geschickt formuliert waren, dass der Adressat nach der Lektüre tatsächlich glaubte, es wäre seine Idee gewesen, der Stiftung unter die Arme greifen zu müssen.
Hedy schrieb an diesem Nachmittag zwei oder drei ihrer berühmten Briefe, und nichts deutete darauf hin, dass sie sich auch nur eine Sekunde weiter mit ihrer Anzeige beschäftigt hatte, während Maria ihr stiller Schatten war und dabei das Gefühl hatte, als würde sie wie gelähmt auf den Einschlag einer Bombe warten.
Sie aßen zusammen zu Abend und gingen ins Bett.
Hedy erwachte um sechs Uhr aus einem tiefen Schlaf.
Sie öffnete die Fenster, atmete die kalte Morgenluft ein und dachte, dass es ein ausnehmend schöner Tag werden würde. Dann legte sie etwas Schminke auf und richtete den Dutt neu, denn sie leistete sich niemals Nachlässigkeiten, nicht einmal, wenn es dunkel war und es niemand sehen konnte. Mit der gleichen Haltung beendete sie auch jedes Bewerbungsgespräch – gleichgültig, ob der Kandidat genommen wurde oder nicht – mit den Worten: »Vergessen Sie bitte nie: Sie wissen erst, wer Sie sind, wenn Sie wissen, was Sie tun, wenn niemand hinschaut!«
Hedy liebte diesen Satz und lebte ihn gleichermaßen.
Gerüstet für einen neuen, aufregenden Tag schwebte sie mit dem Treppenlift hinab ins Erdgeschoss, wo Maria bereits strammstand und nervös die dicke Winterjacke knetete, die sie in den Händen hielt.
Hedy verließ das Haus und marschierte los.
Bei ihrer fünften Runde hörte sie hinter sich eine Fahrradklingel, im nächsten Moment schon schoss ein Bengel von vielleicht sechzehn Jahren auf einem Mountainbike an ihr vorbei, eine dicke Zeitungstasche auf dem Rücken und die heutige Ausgabe der Westfälischen Nachrichten in der Hand. Kurz bevor er Maria erreichte, riss er das Rad herum und warf in derselben Bewegung die Zeitung im hohen Bogen Richtung Treppe, die er, wie schon am Tag zuvor, um einen halben Meter verfehlte.
Sie landete vor Marias Füßen im Dreck.
Der Junge hingegen war schon wieder auf dem Weg zurück und raste jetzt auf Hedy zu, die sich ihm in den Weg stellte, die Arme in die Hüften gestemmt. Er schrammte grinsend an ihr vorbei, die Auffahrt hinab, zum Tor hinaus.
Hedy sah ihm nach: nicht gerade eine Hochbegabung, der Bursche. Sie hatte seine Bewerbung abgelehnt. Und die wütenden Proteste der Eltern – ebenfalls keine Hochbegabungen – mit Grandezza ertragen.
Sie beendete zwei Runden später ihre morgendliche Übung, nahm Marias Arm und ließ sich die Treppen hinauf in den Rollstuhl helfen.
»Ins Bad!«, befahl sie.
»Sehr wohl!«, antwortete Maria.
Erfrischt nach einer ausführlichen Morgentoilette nahm sie elegant gekleidet zusammen mit Maria am Frühstückstisch Platz. Endlich nickte sie Maria zu, aus der Zeitung vorzulesen, zuvor jedoch den Anzeigenteil zu prüfen. Marias Blick wanderte die kleinen Blöcke hinab und fand das Inserat auf Anhieb. Sie sog scharf die Luft ein: Das war alles noch viel schlimmer, als sie es sich ausgemalt hatte. Keine Chiffreanzeige!
Fräulein Hedy hatte wirklich den Verstand verloren!
Maria reichte ihr die Zeitung rüber und tippte mit dem Finger auf die betreffende Stelle.
Hedy las und nickte zufrieden.
Später ging Hedy ihrer täglichen Routine nach, beginnend mit der Post, während Maria den Haushalt versorgte, unkonzentriert und mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Die Hälfte der Einwohner hatte die Anzeige bestimmt schon gelesen, die andere Hälfte würde es nach der Arbeit tun. Oder vorher angerufen werden. So oder so: Bald würden es alle wissen.
Alle!
Gegen neun Uhr klingelte es an der Haustür.
Maria fuhr erschrocken hoch und dachte Guter Gott! Sie standen bereits vor der Tür, die Zeitung in den Händen. Doch als sie öffnete, wartete dort nur Jan, Hedys neuer Physiotherapeut.
Mit einer leeren Tupperdose in der Hand.
4
Ob Hedys Extravaganzen mit Jan begonnen hatten, ließ sich im Nachhinein nicht mehr so genau sagen, da sie schon immer ihren sehr eigenen Kopf hatte, in jedem Fall aber war es das kürzeste und seltsamste Bewerbungsgespräch, das ein Physiotherapeut je hatte. Und vor allem war es eines, um das Jan gar nicht gebeten hatte, aber bei Hedy wurde jede Unterhaltung über kurz oder lang zu einem Bewerbungsgespräch. Selbst wenn er nur mit ihr plauderte und dabei ihre Muskeln lockerte, hatte er stets das Gefühl, sich um ihre Gunst bemühen zu müssen und vor allem aber: nichts Dummes zu sagen!
Seit vier Wochen kam Jan fast täglich, um mit Mobilisations- und Koordinationsübungen Hedys Bewegungsapparat zu trainieren, doch wenn er ehrlich war, hatte sie diese Übungen kaum nötig. Sie war schlank, erstaunlich gelenkig und bis auf altersbedingte Arthrose in den Beinen und Wirbeln vollkommen gesund. Dennoch bestand Hedy auf Gymnastik, was Jan einerseits freute, denn er liebte die Gespräche mit ihr sehr, ihm andererseits ein schlechtes Gewissen bereitete, denn Hedy bezahlte ihn privat, und da kam im Monat schon einiges zusammen.
Rätselhafter als die eigentlich unnötigen Besuche war jedoch, wie Jan zu seinem Job gekommen war. Die Stadt, in der er lebte, war klein genug, um nach ein paar Jahren alle wichtigen Personen darin zu kennen, aber nicht so klein, dass jeder jeden kannte. Jan wusste daher, wer Hedy von Pyritz und die Von-Pyritz-Stiftung für begabte Kinder war, weil alle wussten, wer Hedy von Pyritz war, aber Hedy konnte Jan eigentlich nicht kennen. Jedenfalls nicht, weil er der einzige Physiotherapeut der Stadt war. Oder der beste. Es gab einige, die meisten davon in großen Gemeinschaftspraxen, die einen guten Ruf genossen und in aller Regel erster Anlaufpunkt für diejenigen waren, die eine Therapie brauchten. Jan hatte nicht einmal eine Praxis, sondern besuchte seine Patienten in deren Häusern, was ihm ein regelmäßiges, aber kein üppiges Einkommen bescherte.
Es gab also keinerlei Berührungspunkte zwischen den beiden, und doch stand Fräulein Hedy eines Tages vor ihm. Vielmehr saß sie vor ihm. Im Rollstuhl – dahinter Maria. Sie sah ihn so lange an, bis Jan sich unter ihrem Blick zu winden begann und sich automatisch fragte, was er falsch gemacht hatte, aber es fiel ihm nichts ein, denn es gab auch nichts, was dafür in Frage gekommen wäre. Er saß einfach nur im Stadtpark auf einer Bank und wärmte sich die Hände an einem heißen Kaffee. Gerade als er allen Mut zusammennehmen wollte, um Hedy darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Starren sehr wohl als unhöflich gelten konnte, wandte die sich Maria zu und ließ sich ein weißes Blatt Papier von ihr geben.
Sie reichte es ihm und sagte: »Falten Sie mir bitte einen Flieger!«
Jetzt war es Jan, der erst sie, dann das Papier anstarrte, das sie ihm entgegenhielt.
»W-was?«
»›Wie bitte‹, heißt es, und jetzt falten Sie mir bitte einen Flieger!«
Jan war so perplex, dass er das Papier griff und Sehr wohl! murmelte und damit nicht nur Maria ein Lächeln aufs Gesicht zauberte, sondern auch in diesen allerersten Momenten ihres Kennenlernens ihr Herz gewann.
Jan faltete also einen Flieger.
Und er tat es sehr gewissenhaft: Messerscharfe Kanten und ein kompliziertes Muster formten einen schneidigen, aerodynamischen Jäger, den er Hedy zurückreichte.
Die forderte: »Lassen Sie ihn fliegen, junger Mann!«
Jan stand auf und warf den Flieger, der rasch an Höhe gewann und dann in langen, eleganten Bögen Kreise zog, getragen von einer leichten Böe. Er hielt sich sehr lange in der Luft, während Hedy ihm versonnen nachsah, auch dann noch, als er bereits sanft auf dem Boden gelandet war.
Da erst drehte sie sich zu Maria um, ließ sich von ihr eine Visitenkarte geben und sagte knapp: »Sie sind engagiert! Morgen um neun Uhr?!«
Es klang wie eine Frage, doch Jan ahnte, dass sie allenfalls rhetorischer Natur war. Also nickte er einfach, während Hedy Maria ein Zeichen gab, weiterzuziehen.
Sie rollte davon, und Jan hatte einen neuen Job.
Natürlich fragte er sich, wie sie auf ihn gekommen war. Woher sie wusste, wer er war, was er beruflich tat und vor allem: warum sie ausgerechnet ihn engagiert hatte. Aber Hedy gab keine Erklärungen ab, und nach den ersten Stunden spielte es auch keine Rolle mehr. Sie verstanden sich gut, und Jan besuchte die alte Dame fast täglich und lockerte ihre Verspannungen.
Und auch für Maria wurden Jans Besuche bald schon liebgewonnene Gewohnheit, denn er alarmierte geradezu mütterliche Instinkte in ihr, und so zwang sie ihn, sich nach der Arbeit mit Hedy an den Küchentisch zu setzen und zu essen, weil sie ihn für viel zu dünn befand. Anfangs protestierte Jan dagegen, mit dem Ergebnis, dass Maria nur umso mehr kochte und es ihm dann in Tupperware mitgab für den Abend.
Da stand Jan nun und drückte ihr die leere Plastikbox in die Hand.
»O Gott, Jan, ich habe dich ganz vergessen!«, rief Maria erschrocken.
Jan grinste und hoffte, dass sie seine Enttäuschung nicht bemerkte. Es war erstaunlich, in welch kurzer Zeit man sich an gutes Essen gewöhnen konnte.
Sie zog ihn zu sich und sagte leise: »Du musst mit ihr sprechen, Junge! Sie hat den Verstand verloren!«
»W-was?«, fragte er verwirrt.
»Wie bitte!«, schallte es korrigierend in ihrem Rücken.
Er blickte über Marias Schulter, und da stand sie, Hedy, und lächelte fein. Sie war klein und schmal, doch niemand nahm sie so wahr, denn elegante Schuhe mit Absätzen, gerade Haltung und der strenge Dutt ließen sie groß und stolz wirken. Und ständig hatte man das Gefühl, dass sie wohlwollend auf einen herabblickte, selbst wenn man zwei Köpfe größer war.
»Wirklich, Jan, Sie sollten es langsam besser wissen, nicht wahr?«
»Natürlich, Fräulein von Pyritz, ich war nur … überrascht.«
»Kommen Sie!«
Sie wandte sich um, nicht ohne Maria einen kleinen, warnenden Blick zuzuwerfen: Maria war ihre treueste Verbündete, aber Neuigkeiten aller Art hatte sie noch nie gut für sich behalten können.
Sie betraten zusammen den Salon.
Alles in diesem Raum war von altertümlicher Eleganz. Die vier riesigen Flügeltüren erlaubten nicht nur einen beeindruckenden Blick in einen im Sommer überbordenden Garten, sondern fluteten den Raum auch mit Licht. Parkett und Stuck an den Decken rundeten das Bild ab.
»Was ist passiert?«, fragte Jan.
Er öffnete einen kleinen Koffer, gefüllt mit Ölen und Salben, und breitete eine gerollte Bodenmatte aus.
Hedy winkte ab: »Nichts.«
Und schon öffnete Maria die Tür, trat unaufgefordert in den Raum und wedelte mit den Westfälischen Nachrichten.
»Das ist passiert!«, rief sie fast schon empört.
»Ich glaube, wir sprachen bereits mehrmals darüber, dass Lauschen an der Tür ein grauenhafter Verstoß gegen die Etikette ist.«
»Dann sagen Sie ihm doch, was Sie gemacht haben!«, hielt Maria trotzig dagegen.
Hedy seufzte und gab Maria zu verstehen, dass sie ihr die Zeitung geben sollte. Sie schlug den Anzeigenteil auf und reichte ihn dann Jan. Der nahm die Zeitung entgegen und starrte hinein.
Sehr lange.
Dann blickte er auf und fragte: »Sie wollen einen Bundeswehrspind kaufen?«
Hedy runzelte die Stirn: »Unsinn!«
Sie rupfte ihm die Zeitung aus der Hand und sah hinein: »Nicht die Anzeige mit dem Foto. Die daneben!«
Damit gab sie ihm die Zeitung zurück.
Jan kniff die Augen zusammen, dann lächelte er entschuldigend: »Die Schrift ist ziemlich klein. Und ich hab meine Lesebrille nicht dabei …«
Maria nahm die Zeitung und las laut und überdeutlich vor: »›Dame in den besten Jahren sucht Kavalier, der sie zum Nacktbadestrand fährt. Entgeltung garantiert!‹ Inklusive Name und Adresse. Nicht einmal eine Chiffreanzeige!«
Jan schluckte: »Das ist nicht Ihr Ernst?!«
»Natürlich ist das mein Ernst!«, gab Hedy zurück.
»Was werden nur die Leute sagen?«, fragte Maria besorgt.
Hedy zuckte gleichgültig mit den Schultern.
»Vielleicht liest es ja niemand?«, wandte Jan ein. »Die Anzeige ist ziemlich klein, und wer liest schon regelmäßig Anzeigen?«
»Es muss nur einer diese Anzeige lesen«, Maria hob den Zeigefinger: »Nur einer! Dann garantiere ich dir, dass es innerhalb eines Tages die ganze Stadt weiß!«
»Wenn schon«, antwortete Hedy ruhig.
»Was ist denn nur los mit Ihnen?!«, schimpfte Maria. »Erst dieser Irrsinn in der Nacht und jetzt das hier!«
Hedy sah sie kühl an: »Danke, Maria, aber Sie werden jetzt nicht mehr gebraucht.«
Maria seufzte tief, dann verließ sie den Raum.
Jan stand etwas ratlos herum.
Hedy lächelte ihn an: »Was sorgt Sie, Jan?«
»Nun«, begann er vorsichtig, »die Anzeige …«
»Haben Sie moralische Bedenken?«
Er schüttelte den Kopf: »Das ist es nicht, Fräulein von Pyritz. Es ist nur … ich finde sie ein wenig unglücklich formuliert!«
Augenblicklich fiel die Zimmertemperatur um mehrere Grad.
Hedy ging es ziemlich gegen den Strich, kritisiert zu werden, aber dass jemand wagte, an ihren Formulierungen herumzudeuteln, kam beinahe einer Kriegserklärung gleich.
»So, so«, antwortete sie kalt. »Was gefällt Ihnen denn nicht?«
Jan wusste, dass es vollkommen gleichgültig war, ob er jetzt noch antwortete oder sich lieber gleich entschuldigte: Seine Position war hoffnungslos.
»›Entgeltung garantiert!‹«, brachte er leise heraus.
»Was ist damit?«, fragte Hedy ungeduldig.
Er begann, sich unter ihrem stahlblauen Blick zu winden. »Es ist … ich meine … diese Formulierung … ist … unglücklich.«
»Ist sie das?!«
»Nun ja, ein bisschen!«
Hedy starrte ihn einen Moment an.
Schnaubte kurz.
Dann hob sie das Kinn, wandte sich um und ging in den Garten hinaus. Eine Dame strafte mit Nichtbeachtung.
Und Hedy war eine Dame.
5
Drei Tage lang begegnete Hedy Jan mit eisigem Schweigen.
Einmal ließ sie Maria das Treffen sogar kurzfristig absagen, die anderen Male sagte sie kein Wort. Jan hatte einige Patienten, die wenig bis gar nicht sprachen, und er erledigte bei ihnen gewissenhaft und umsichtig seinen Job, ohne dass es ihn gekümmert hätte. Im Gegenteil: Es war auch zuweilen ganz erholsam, nicht plaudern oder sich endlose Gesundheits- oder Familiendramen anhören zu müssen.
Unter Hedys Nichtbeachtung litt er.
Der Einzige, der unglücklich formuliert hatte, war er selbst, und wenn Hedy wüsste, wie absurd die Situation tatsächlich war, dass ausgerechnet er ihr Ungenauigkeiten im schriftlichen Ausdruck vorwarf … Jan mochte gar nicht daran denken!
Drei Tage lang blieb es allerdings auch sonst ruhig. Niemand rief Hedy wegen der Anzeige an, niemand sprach mit Maria darüber, kein Klatsch schaffte es bis auf das Grundstück der Stiftung, so dass Hedy bereits annahm, dass niemand diese Anzeige gelesen hatte. Denn auch Post kam keine, jedenfalls keine, die sich auf ihre Anzeige bezog. Hedy war enttäuscht über die ausbleibende Reaktion, Maria hingegen höchst erfreut.
»Das ist gut, Fräulein von Pyritz! Sehr gut sogar!«
Hedy schwieg dazu, was Maria als Zustimmung wertete. Zukünftig würde es keine Mondsüchteleien mehr geben, keine Papierflieger und vor allem: keine Anzeigen. Es kehrte sich doch noch alles zum Guten.
Am Morgen des vierten Tages klingelte es an der Haustür.
Maria öffnete und wusste in dieser Sekunde, dass sie zu früh gejubelt hatte. Vor ihr stand der Postbote.
»Guten Morgen! Ich hab das nicht alles in den Briefkasten bekommen«, erklärte er, überreichte ihr einen gewaltigen Packen Briefe und legte die Tageszeitung obendrauf. Sie war besonders dreckig heute – es hatte in der Nacht geregnet.
»Guter Gott!«, rief Maria entsetzt.
»Fräulein von Pyritz schreibt wirklich gerne, was?«, fragte er unschuldig.
Maria antwortete nicht, sondern schob nur mit dem Fuß die Tür wieder zu.
Das konnte alles nicht wahr sein!
Sie kehrte um und erreichte die Treppe in dem Moment, in dem Hedy mit dem Lift zu ihr herabschwebte. Schon auf halber Strecke sah sie die Briefe und konnte sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Sie sah aber auch die dreckige Zeitung, und schon verschloss sich ihr Mund zu einem schmalen Strich.
»Was haben Sie nur getan, Fräulein Hedy!«, jammerte Maria.
»Bringen Sie alles in mein Büro!«, wies Hedy an und begann den Tag wie die anderen auch: mit einem knappen Frühstück und Maria, die ihr aus der Zeitung vorlas.
Als Jan am Vormittag die Villa betrat, hatte Hedy ihr Büro immer noch nicht verlassen, während sich Maria murmelnd und kopfschüttelnd in die Küche zurückgezogen hatte. Sie kochte, denn Kochen beruhigte, und besah man die Menge an gluckernden Töpfen auf dem Herd, musste sie sehr aufgewühlt sein.
Jan klopfte an die Tür von Hedys Büro und hörte von drinnen ein Herein!
Hedy saß an ihrem Schreibtisch, hatte fast alle Briefe geöffnet und das Papier zu einem großen Stapel zusammengelegt. Gerade schob sie den letzten gelesenen Brief zur Seite und trommelte unzufrieden mit den Fingern auf die Tischplatte.
Jan räusperte sich als Zeichen dafür, dass er noch in der Tür stand.
Hedy sah auf und fragte: »Wie haben Sie das gemeint? Mit der ›unglücklichen Formulierung‹?«
»Sie reden wieder mit mir?«
Hedy zog mürrisch die Augenbrauen zusammen: »Ich schätze es überhaupt nicht, wenn man eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet!«
»Verzeihung.«
»Kommen Sie näher!«, befand Hedy.
Jan schloss die Tür hinter sich und setzte sich auf einen Stuhl vor ihrem Schreibtisch.
»Und?«, hakte sie nach.
»Ich befürchte, dass die Kombination Dame in den besten Jahren mit Entgeltung garantiert möglicherweise Missverständnisse provozieren könnte.«
»Was ist daran eigentlich misszuverstehen?«, rief Hedy beinahe schon empört. »Mit Entgeltung sind selbstverständlich Kost, Logis, Fahrtkosten sowie ein angemessenes Honorar gemeint!«
Jan zuckte mit den Schultern: »Die Menschen haben sich geändert, Fräulein von Pyritz.«
Hedy winkte genervt ab: »Die Menschen sind immer noch dieselben. Dummköpfe gab es zu jeder Zeit. Aber offenbar scheinen Anstand und Erziehung von den schönen neuen Medien vollkommen hinweggeschwemmt worden zu sein!«
»Ich vermute fast, Sie haben eine ganze Reihe von ungebührlichen Angeboten bekommen?«
»Eine ganze Reihe?! Hier ist nicht ein einziger Ehrenmann darunter. Nicht einer!«
»Tut mir leid.«
»Kretins!«, schnaubte Hedy.
Sie sammelte sich einen Moment, dann stand sie auf, ging zur Tür ihres Büros und rief Maria. Die kam, sich die Hände an der Schürze abwischend, aus der Küche.
Hedy zeigte auf den Papierstapel: »Verbrennen Sie die Post!«
»Ich habe Essen auf dem Herd stehen!«, protestierte Maria.
»Sie können Sie auch auskochen, mir einerlei! Und dann holen Sie mir diesen Lokalchef der Westfälischen ans Telefon!«
»Sehr wohl!«, antwortete Maria.
Sie wandte sich Jan zu: »Kommen Sie, an die Arbeit!«
Und um ein Haar hätte Jan vor lauter Erleichterung, dass Hedy ihren Groll gegen ihn begraben hatte, auch mit Sehr wohl! geantwortet.
6
Die Beschwerde über den Zeitungsjungen wurde zwar mit dem Versprechen entgegengenommen, dem Burschen ordentlich ins Gewissen zu reden, doch schon der nächste Morgen zeigte, dass es offenbar vollkommen fruchtlos gewesen war: Die Zeitung lag wieder im Dreck.
Hedy wurde das Gefühl nicht los, dass jedes weitere Wort hier verschwendete Lebenszeit war, denn ganz offenbar hatte sich der Kleine – oder dessen Eltern – in den Kopf gesetzt, sich für die Zurückweisung zu rächen. Ein Indiz, das Hedys Einschätzung des Potentials des Jungen oder dessen Eltern nur bestätigte.
Auch die Post war eine einzige Enttäuschung.
Hedy war mit der Gesamtsituation ziemlich unzufrieden.
Die Anzeige war wirkungslos verpufft, und nach Lektüre und Vernichtung auch der zweiten Lieferung hatte sie keine Lust mehr, auch nur einen einzigen weiteren Brief zu öffnen. Die Welt außerhalb der Begabten schien einfach zu desillusionierend, als dass man ihr auch nur noch eine einzige weitere Sekunde Beachtung schenken sollte.
Glücklicherweise gab es aber auch noch die andere Welt, nämlich die der Kultur, des Talents und der Kreativität. Und ein solcher Tag war heute: Kammermusiktag. Ausgerechnet die Veranstaltung, die zukünftig nicht mehr durch die Stadt bezuschusst werden sollte, sich aber stabiler Beliebtheit erfreute, denn, ob die Zuhörer es mochten oder nicht, kaum jemand blieb dem Ereignis fern: Alles, was Rang und Namen hatte, traf sich dort. Und war es auch nur, um Kontakte zu pflegen oder neue Geschäfte einzustielen.
Hedy hatte sich in ihrem Schlafzimmer zurechtgemacht und prüfte nun ihr Aussehen im Spiegel, was eigentlich unnötig war, denn alles saß wie immer mustergültig. Sie wirkte für eine Dame von achtundachtzig Jahren deutlich jünger, ihr Blick war klar, ihr Gedächtnis geradezu furchterregend gut. Auch hatte sie nichts an Kampfeswillen eingebüßt, im Gegenteil: Seit ein paar Wochen empfand sie von Tag zu Tag immer größere Lust, sich mit jedem anzulegen, der dumm genug war, sich ihr in den Weg zu stellen. Sie fühlte sich ausgeruht und dynamisch. Doch je länger sie in den Spiegel starrte, desto unzufriedener war sie mit sich, ohne sagen zu können, warum.
Perfekt bis in die Details.
Dennoch …
Irgendwann löste sie sich dann doch und fuhr zusammen mit Maria im Taxi zum historischen Ratssaal, einem prächtigen holzgetäfelten Raum und gleichsam Kleinod niederländischer Renaissance, genau wie der schmucke Bau mit seinen vielen Spitzen, Obelisken und Fensterbekrönungen. Die Verwaltung war in ein moderneres Gebäude umgezogen, jetzt diente das Haus repräsentativen Zwecken, Konzerten oder Empfängen.
Hedy hatte Schmerzen, als sie aus dem Wagen stieg, aber bei öffentlichen Auftritten zeigte sie sich niemals im Rollstuhl. Sie streckte sich, nahm Marias Arm, und so schritten die beiden dem geöffneten Ratssaal entgegen, in dem lebhaftes Gemurmel und Klirren von Sektgläsern eine heitere Atmosphäre verrieten.
Bis die beiden eintraten.
Mit jedem Schritt in den Raum fielen die Geräusche mehr in sich zusammen, während sich gleichzeitig ein Spalier unsicher lächelnder Gesichter auftat, als ob sie ein Meer durchschritten, das Hedy wie Moses mit ihrem bloßen Auftritt geteilt hatte. Maria wäre am liebsten im Erdboden versunken, doch Hedy erwiderte die Blicke selbstbewusst und zwang jeden, der sie anstarrte, die Augen abzuwenden oder niederzuschlagen. Mit stillem Amüsement nahm sie zur Kenntnis, dass irgendjemand offenbar doch die Anzeigen las und alle anderen darüber informiert hatte. Hinter den beiden schloss sich die Gasse wieder, die Stimmen kehrten zurück. Nicht mehr fröhlich, sondern eher gedämpft: Die Luft schien plötzlich vor Energie zu knistern.
Vorne im Raum war Platz für die Musiker gelassen worden, davor fächerten sich Stuhlreihen in Halbbögen auf. Hedy winkte Bürgermeister Schmidtke zu sich heran, während an den verstohlenen Blicken zu erahnen war, dass sich das bunte Potpourri an Themen zu einem einzigen verdichtet hatte: Hedy.
»Guten Tag, Fräulein von Pyritz!«
Hedy nickte freundlich und gab ihm die Hand. »Guten Tag, Herr Bürgermeister!«
»Wie geht es Ihnen? Das Wetter ist ja scheußlich in letzter Zeit.«
»Ein Grund mehr, die Bevölkerung mit Kultur und Musik zu erfreuen, finden Sie nicht auch?«
Und damit war der Smalltalk dann auch schon beendet.
Bürgermeister Schmidtke nickte ergeben: »Natürlich, Fräulein von Pyritz!«
Hedy setzte nach: »Sie scheinen da neuerdings anderer Meinung zu sein?«
»Aber, Fräulein von Pyritz, wir haben mehr Veranstaltungen als alle anderen Städte in unserer Region!«
»Ein Grund, stolz auf diese Stadt zu sein. Ein Alleinstellungsmerkmal, um das uns viele beneiden, nicht wahr?«
»Wir haben immer noch viel zu bieten!«, wandte Herr Schmidtke ein.
»Sehen Sie, Herr Bürgermeister, ich glaube daran, dass kulturelle Schönheit den menschlichen Geist beflügelt und die Seele beruhigt. Sie nicht auch?«
»Unbedingt!«
»Dann werden Sie den Beschluss rückgängig machen?«
Bürgermeister Schmidtke seufzte bedauernd: »Das kann ich nicht, Fräulein von Pyritz. Ich bin zwar der Bürgermeister, aber die Fraktionen im Stadtrat stimmen über diese Dinge ab. Da sind mir die Hände gebunden.«
Hedy nickte: »Verstehe …«
Sie zog den Bürgermeister ein wenig zur Seite und flüsterte warnend: »Haben Sie vergessen, wem Sie Ihr Amt zu verdanken haben?«
Bürgermeister Schmidtke sah sich verstohlen um, dann flüsterte er zurück: »Nein, natürlich nicht, aber …«
»Bürgermeister kommen und gehen, Herr Schmidtke. Und nächstes Jahr sind Wahlen. Sie werden Ihre Parteifreunde überzeugen. Haben wir uns da verstanden?«
»Schon, aber …«
»Kein Aber!«
»Wir haben keine Mehrheit und die Opposition …«
»Sie kümmern sich um Ihre Leute – ich um meine. Einverstanden?«, fiel ihm Hedy ins Wort.
Bürgermeister Schmidtke nickte.
»Und jetzt sind Sie bitte so lieb und holen mir ein kleines Getränk, ja? Und wenn Sie schon dabei sind: Schicken Sie bitte Herrn Middendorp zu mir!«
Damit war er entlassen.
Wütend und geschlagen schlich er davon.
Hedy ließ sich von Maria zu ihrem Platz führen und setzte sich zusammen mit ihr in die erste Reihe. Maria seufzte so bedeutungsschwer, dass Hedy gar nichts anderes übrigblieb, als sich ihr zuzuwenden.
»Was ist denn?«, fragte sie.
Maria flüsterte: »Die reden über Sie. Schrecklich!«
Hedy winkte ab: »Und wenn schon! Morgen reden Sie über jemand anderen.«
»Alle wissen es! Sogar Ihre Tochter!«
Maria wandte sich verstohlen nach rechts: Dort, zwischen ein paar Honoratioren der Stadt, stand Hannah von Pyritz neben ihrem Ehemann Harald und klammerte sich an ihre Sektflöte wie eine Ertrinkende an einen Rettungsring. Ihr Blick sprach Bände und wurde umso düsterer, als Hedy sich ihr zuwandte und ihr mit einem Lächeln zunickte.
Dann drehte sie sich wieder zur Bühne und bestimmte: »Jetzt freuen wir uns erst mal auf das Konzert, Maria!«
Die seufzte erneut bedeutungsschwer.
Herr Middendorp baute sich vor Hedy auf und reichte ihr ein Glas Sekt: »Fräulein von Pyritz! Sie wollten mich sprechen?«
Hedy tätschelte den Stuhl neben sich und antwortete: »Nehmen Sie doch einen Moment Platz.«
Herr Middendorp setzte sich und begann sofort: »Ich ahne, weswegen, aber ich kann da leider nichts tun! Der Beschluss unserer Fraktion wurde einstimmig gefällt.«
»Tatsächlich?«, fragte Hedy zuckersüß.
»Ja, und nichts wird sich daran ändern. Ganz gleich, was Sie vorbringen, es ist entschieden!«
»Verstehe …«, nickte Hedy, und wie auch bei Herrn Schmidtke waren es die letzten drei Silben, bevor sie zum Angriff überging.
Herr Middendorp tröstete: »Tut mir leid. Ich weiß, dass Ihnen diese Konzerte am Herzen liegen, aber …«
»Sagen Sie, Lukas Middendorp ist doch ihr Neffe, richtig?«, fiel Hedy ihm ins Wort.
Herr Middendorp war für einen Moment aus dem Konzept: »Der Sohn meines Bruders, ja.«
»Hat vielleicht das Zeug zu einem Konzertpianisten …«
Er nickte heftig: »Ja, wir sind alle sehr stolz auf ihn.«
»Ist es nicht erstaunlich, dass die Familie Middendorp dem eigenen Nachwuchs gönnt, was sie anderen verweigert?«
Herr Middendorp richtete sich stocksteif auf: »Ich muss doch sehr bitten, Fräulein von Pyritz!«
»Lukas Middendorp hat sich für ein Stipendium bei der Von-Pyritz-Stiftung beworben, und Ihr Bruder drängt mit aller Macht darauf, dass er es auch bekommt.«
»Aber …«
»Wir haben also auf der einen Seite die Middendorps, die alle Vorteile einer musikalischen Förderung für das eigene Kind in Anspruch nehmen wollen, und auf der anderen Seite die Middendorps, die der Allgemeinheit die Vorteile musikalischer Erbauung verweigern. Das sehe ich doch richtig?«
Herr Middendorp schluckte, dann sagte er schnell: »Das kann man so doch nicht vergleichen …«
»Wissen Sie was, Herr Middendorp? Man kann … Ich kann!«
»Wir sind der Meinung, dass wir das eingesparte Geld für andere Projekte gut gebrauchen könnten«, antwortete Herr Middendorp.
»Welche Projekte?«
»Nun, das steht noch nicht fest, aber …«
Hedy fragte scharf: »Sie sparen sechstausend Euro im Jahr ein. Was wollen Sie damit finanzieren? Eine Aushilfskraft auf 450-Euro-Basis?«
»Wäre denkbar …«
»Für was?«
»Wie gesagt: Es steht noch nicht fest, Fräulein von Pyritz.«
»Sie wollen also Geld einsetzen für etwas, was es noch nicht gibt, und Geld abziehen von etwas, was großen Erfolg hat. Sehen Sie sich um, Herr Middendorp. Wie viele Menschen sehen Sie?«
»Nun …«
»Es sind fast hundert!«
»Aber zu diesen Konzerten kommen doch eh immer dieselben!«, verteidigte sich Herr Middendorp, und seinem Gesicht war anzusehen, dass er mit diesem Argument selbst nicht ganz glücklich war.
»Wissen Sie, Herr Middendorp, und wenn es nur ein Einziger wäre, der sich jeden Monat auf diese Konzerte freute, die er sich sonst nicht leisten könnte, hätte die Musik bereits ihre Berechtigung. Genau wie bei meiner Stiftung: Wenn es nur ein Einziger schafft, ohne Not, ohne Sorge seiner Bestimmung zu folgen, dann hat es sich schon gelohnt.«
Einen Moment schwieg Middendorp, dann sagte er leise: »Sie werden dem Jungen doch nicht seine Chance verbauen, nur weil Sie Ihren Kopf durchsetzen wollen?!«
»Ist es nicht Ihr Junge? Ihre Familie? Wie wäre es, wenn Sie ihm die Ausbildung finanzieren?«
»Die ist aber verdammt teuer!«
»Tatsächlich?«, antwortete Hedy mit einem so kalten Sarkasmus in ihrer Stimme, dass Herr Middendorp das Gefühl hatte, er müsste sich eine feine Schicht Eis vom Gesicht kratzen.
Sie gab ihm das Sektglas zurück und lächelte: »Ich bin sicher, Sie werden das Richtige tun, Herr Middendorp. Guten Tag!«
Und damit war er entlassen.
Wütend und geschlagen stapfte auch er davon.
Die Musiker betraten die Bühne, die Zuhörer nahmen ihre Plätze ein. Langsam sank der Geräuschpegel, während Hedy sich entspannt zurücklehnte und das Konzert frohgemut erwartete. Jemand beugte sich von hinten an ihr Ohr und flüsterte scharf: »Ich muss dich sprechen!«
Hannah.
Hedy wandte ihr den Kopf ein wenig zu und nickte: »Morgen.«
Einen Moment roch sie noch Hannahs Parfum, dann verschwand es ebenso wie der Atem an ihrem Hals.
Heute waren aber auch alle irgendwie wütend auf sie.
7
Hedy erwachte am nächsten Morgen gegen sechs Uhr, öffnete die Fenster und sah, wie der Austräger die Auffahrt heraufgeradelt kam und die Zeitung in den Dreck warf. Verärgert fragte sie sich selbst, ob ihr Einfluss in dieser Stadt nur dafür reichte, Politiker zur Räson zu bringen, nicht aber Zeitungsjungen. Entsprechend gelaunt absolvierte sie ihre morgendlichen Übungen und starrte anschließend verdrießlich die Schlieren auf den Schlagzeilen an, während Maria ihr aus dem Lokalteil vorlas. Sie musste etwas unternehmen, aber sie wusste nicht, was.
Gegen neun Uhr kam Jan – ihre Stimmung besserte sich.
Wenn auch nicht lange, denn kurz nach ihm klingelte es auf eine Art und Weise an der Haustür, die nichts Gutes verhieß. Und so war es dann auch: Maria ließ Hannah herein, in ihrem Kielwasser ihren Ehemann Harald hinter sich herziehend. Unverkennbar hatte Hannah ihre Durchsetzungskraft von Hedy geerbt, und Harald gehörte zu den Männern, die irgendwann herausgefunden hatten, dass ihr Leben ganz erträglich war, wenn sie gar nicht erst versuchten, gegen ihre Frauen anzukämpfen.
Hannah marschierte durch den Eingangsbereich, riss förmlich die Tür zum Salon auf und rief wütend: »Wie konntest du nur?!«
Jan, der gerade Hedys Bein streckte, ließ es vor lauter Schreck auf die Matte fallen und sprang so schnell auf, als hätte Hannah sie beide bei etwas Verbotenem erwischt.
»Guten Morgen, Hannah!«, sagte Hedy ungerührt und wies Jan mit einer Geste an, ihr aufzuhelfen.
»Wie konntest du nur einen solchen Skandal anzetteln?!«, rief Hannah außer sich und pfefferte ihre Handtasche auf eines der Sofas.
Hedy hatte sich mittlerweile aufgerichtet und wandte sich Jan zu: »Entschuldigen Sie uns einen Moment?«
»Natürlich!«
Jan verließ eilig das Zimmer, froh, nicht zwischen die Fronten der beiden Damen zu geraten. Draußen lief er beinahe in Maria hinein, die ihn herrisch zur Seite schob, die Tür verschloss und schnell wieder ihr Ohr anlegte.
Hedy bat Hannah, sich zu setzen, bot Harald aber keinen Platz an, so dass der ein wenig verloren herumstand, wie ein zu groß geratener Junge, der im Kinderparadies von seinen Eltern vergessen worden war.
»Wie konntest du uns nur so zum Gespött der Stadt machen?«, herrschte Hannah ihre Mutter an.
»Uns?«, fragte Hedy erstaunt zurück.
»Ja, uns! Ich bin auch eine von Pyritz. Ich sitze im Verwaltungsrat der Stiftung, führe den Wohltätigkeitsverein und bin Leiterin der Kulturabteilung des Kreises. Ich bin Teil dieser Stadt. Und die glotzt mich seit Tagen grinsend an, weil du offensichtlich den Verstand verloren hast!«
»Hannah, du bist über fünfzig Jahre alt. Was kümmert dich das Geschwätz der Nachbarn?«
»Wir sind nicht irgendwer! Wir sind Vorbilder, zu uns schaut man auf!«
Hedy zuckte gleichgültig mit den Schultern: »Es langweilt mich …«
Hannah zog die Luft scharf ein und rief: »Es langweilt dich? Dein ganzes Leben bist du die große Hedy, die Unerreichbare, die Königin auf dem Hügel. Und jetzt gilt das alles nicht mehr?!«
»Vielleicht brauche ich eine Pause von dieser Hedy«, antwortete Hedy ruhig.
Hannah blitzte sie an, zwang sich dann aber, ruhiger zu sprechen: »Hat es mit deiner Schlafwandelei zu tun? Fühlst du dich nicht wohl?«
Hedy runzelte verärgert die Stirn: »Woher weißt du … Moment … MARIA!«
Sogleich ging die Wohnzimmertür auf, Maria erschien im Türrahmen.
»Herrgott, Maria, hatten wir nicht unzählige Male über das Lauschen an Türen gesprochen?«
Maria nickte: »Hatten wir, Fräulein von Pyritz!«
Hedy seufzte leise.
Dann fragte sie scharf: »Haben Sie wieder geplappert?«
»Ich war in großer Sorge, Fräulein von Pyritz!«, verteidigte sich Maria.
»Sie sind entlassen!«
»Sehr wohl, Fräulein von Pyritz.«
Sie knickste kurz, dann verschloss sie die Tür und starrte in Jans entsetztes Gesicht. Da winkte sie nur ab und flüsterte: »Sie hat mich schon achtmal entlassen. Und jetzt mach Platz!«
Wieder drückte sie ihr Ohr an die Tür.
»Wie konntest du nur eine solche Anzeige schalten?«
Hannah schrie beinahe, ein Lauschen wäre gar nicht nötig gewesen, ihre Stimme war noch im Hauseingang zu hören.
»Ich bin einfach neugierig«, antwortete Hedy völlig ungerührt.
Hannahs Stimme überschlug sich fast: »WIEBITTE?«
»Ich bin jetzt achtundachtzig Jahre alt und kannte in meinem Leben nur einen einzigen Mann. Und den habe ich nicht mal gesehen, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich finde, es ist an der Zeit, diese Wissenslücke zu schließen.«
Für einen Moment war Hannah sprachlos.
Sie starrte Hedy an.
Ihren Ehemann Harald.
Dann wieder Hedy.
»Das ist es? Ich meine, das ist alles?!«, fragte sie konsterniert.
»Ja. Was dachtest du denn?«
Hannah suchte nach den richtigen Worten: »Du könntest … es gibt genügend Material über … Nacktheit. In entsprechenden Zeitschriften. Oder im Internet.«
»Das ist doch nicht dasselbe, Kind.«
»Nicht dasselbe?«
»Nein«, schüttelte Hedy den Kopf, »ich will mir keine Bilder ansehen. Oder Filme. Ich möchte die Männer sehen, wie sie sind. Ganz normale Durchschnittsmänner, keine Athleten.«
Hannah starrte sie mit großen Augen an: »Du bist wirklich verrückt geworden, weißt du das?«
»Dachte ich mir schon, dass du das nicht verstehen würdest«, antwortete Hedy.
Hannah atmete tief durch.
Dann wandte sie sich ihrem Mann zu: »Jetzt sag doch auch mal was!«
Harald schreckte auf. Er hatte gerade – gelangweilt von der Diskussion – die Miniatur eines Doppeldeckers auf dem Sideboard gelandet.
»Ich?«
»Ja, du. Wie wäre es, wenn du mal was Sinnvolles beitragen würdest?«, forderte Hannah.
Den Ton seiner Frau kannte er hinlänglich, und so antwortete er scheinbar gleichgültig: »Wenn sie unbedingt einen Mann sehen will, muss sie dazu nicht an den Nacktbadestrand fahren. Wir können das auch gleich hier und jetzt erledigen!«
Hannah riss entsetzt die Augen auf: »Hast du jetzt auch den Verstand verloren?!«
»Wenn das diesen albernen Streit beendet … bitte: Ich stehe zur Verfügung!«
Beide Frauen starrten ihn an, aber Hannahs Gesicht in einer Mischung aus Überraschung und purem Entsetzen zu erleben, bereitete ihm sichtlich Vergnügen.
Da räusperte sich Hedy und sagte: »Verstehe …«
Hannah rang immer noch mit ihrer Fassung: »Das kann doch nicht dein Ernst sein?!«
»Danke für das Angebot, Harald«, unterbrach Hedy kühl, »dachte mir schon, dass du dich bei Durchschnittsmann angesprochen fühlst, aber ich möchte lieber einen richtigen Mann sehen.«
Haralds gespielte Unschuld fiel zu einem zusammengekniffenen Augenpaar zusammen: »Was soll denn das wieder heißen?«
Hedy zuckte mit den Schultern: »Ach, nichts …«
»Neinneinnein, das würde ich jetzt gerne genau wissen. Was hast du damit gemeint?«
»Vielleicht solltest du das lieber mit deiner Frau besprechen?«, antwortete Hedy.
»Was besprechen?!«, fuhr Harald Hannah an.
»Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet!«, fauchte die zurück.
»Aber von irgendwas redet sie gerade. Und ich glaube, es gefällt mir nicht!«
»Harald, ich schwöre dir, ich habe nichts zu ihr gesagt!«
»Oh, das klingt jetzt aber schon so, als hättet ihr über mich gesprochen!«
Hannah schrie: »Sie ist verrückt geworden. Merkst du das denn nicht?!«
Hedy sagte ruhig: »Jetzt nimm dir das doch nicht so zu Herzen, Harald. Ich bin überzeugt davon, dass du trotzdem ein ganzer Mann bist.«
»Trotzdem?!«
»Aber natürlich!«, tröstete Hedy mit nachsichtigem Lächeln.
»Wovon redet sie da!«, zischte Harald seine Frau an.
»Ich weiß es nicht!«, zischte Hannah zurück.
Hedy stand auf und klatschte in die Hände: »Also, dann sind wir uns ja einig. Ich fahre zum Strand, und Gürkchens Hose bleibt zu.«
»GÜRKCHEN!?«
»Nun, Hannah hat dich mal so genannt, ich nahm an, dass …«
»SO SIEHSTDUMICH?!«
»Das bezog sich doch nicht darauf !«, schrie Hannah aufgebracht.
»UND SAGSTESAUCH NOCHANDEREN?!«
»Harald, bitte lass uns vernünftig bleiben. Sie bringt uns nur gegeneinander auf!«
»Tut mir leid, dass ich so eine Enttäuschung bin!«, zischte Harald übertrieben bitter. Dann wandte er sich schnell ab, stürmte zur Tür, riss sie auf, vorbei an der hochschnellenden Maria, durch die Empfangshalle, raus aus der Villa und anschließend mit Vollgas runter vom Grundstück. Mit einem entschuldigenden Lächeln schloss Maria währenddessen wieder die Salontür.
Hannah herrschte Hedy an: »Was hast du getan?!«
»Er hat geglaubt, er spricht mit einem alten Muttchen. Jetzt weiß er es besser!«
»Ich weiß nicht, was mit dir los ist in letzter Zeit, aber jetzt bist du zu weit gegangen! Mein ganzes Leben warst du die strenge Preußin, hast auf Etikette und Umgangsformen geachtet, aber seit ein paar Wochen bist du nicht mehr du selbst! Stehst mitten in der Nacht auf dem Balkon und fliegst! Stellst einen Physiotherapeuten ein, der gut Papierflieger falten kann. Und was war das mit diesem Burschen, der Schmetterlinge erforscht?! Du hast ihm ein Stipendium für einen einjährigen Aufenthalt in Afrika genehmigt!«
»Die Ceratopacha koellikeri sind herrliche Tiere, und es gibt sie nur in Afrika. Und wer weiß: Vielleicht entdeckt er noch ein paar Arten, die wir nicht kennen. Der Dschungel im Kongo birgt sicher viele Geheimnisse!«
»Das hättest du früher niemals genehmigt!«
»Wir haben auch früher Exoten unter den Stipendiaten gehabt!«
»Aber nicht solche! Was immer dich gepackt hat – jetzt reicht es!«
»Das entscheidest nicht du!«, entgegnete Hedy kühl.
Hannah zögerte einen Moment, dann stand sie auf, nahm das Kinn hoch und antwortete gefährlich ruhig: »Nun, nicht allein, das stimmt. Aber das hier ist noch nicht vorbei!«
Sie ging nach draußen.
Gerader Gang, ohne Eile.
Hedy sah ihr anerkennend nach: Es gärte offenbar schon lange in ihr, jetzt hatte sie genug. Sie hatte den Verstand, den Mut, den Willen und auch die nötige Kaltblütigkeit.
Hannah von Pyritz würde kämpfen.
Und nur eine von ihnen beiden würde übrigbleiben.
8
Jan hätte nach dem Streit eine bedrückte oder wenigstens nachdenkliche Hedy erwartet, vielleicht auch eine aufgebrachte, schließlich hatte er vor der Tür die ganze Auseinandersetzung mitbekommen, anstatt sich diskret in die Küche oder nach draußen zurückzuziehen, aber Hedy war nichts davon.
Sie verließ das Wohnzimmer in aufgeräumter Stimmung und beauftragte Maria mit ein paar Arbeiten – sie dachte also nicht daran, sie zu entlassen. Stattdessen wandte sie sich Jan zu, um die Übungen fortzuführen, hielt dann aber inne: Ein Lächeln umspielte plötzlich ihren Mund.
»Kommen Sie morgen wieder, Jan!«, beschied sie. »Ginge es auch ganz früh?«
Jan nickte: »Natürlich.«
»Gut, dann morgen früh um sechs Uhr.«
»So früh? Gibt es einen Grund dafür?«
»Ja, den gibt es.«
Mehr sagte sie nicht.
Nur ihre Augen glitzerten draufgängerisch.
Die Villa stand still und erhaben auf der Kuppe des Hügels im beginnenden Zwielicht eines kalten, aber herrlichen Frühlingstages. Die Vögel zwitscherten, aus dem Grün des Parks stieg sanfter Nebel, während die Laternen friedliche Lichtkegel auf die Zufahrt warfen. In diesen frühen Stunden gab es keinen Ort in der ganzen Stadt, der idyllischer hätte sein können, beschaulicher oder schöner.
Der Zeitungsjunge bog in die Einfahrt und strampelte in hohem Tempo die Auffahrt hinauf, beschleunigte kurz vor den Stufen noch einmal, dann riss er das Rad im Halbbogen herum und malte eine schwarze Brems- und Schleuderspur auf den feuchten Asphalt. Er nahm die Zeitung hoch und ließ sie mit breitem Grinsen und spitzen Fingern demonstrativ auf die Erde fallen.
Die Zeitung schlug auf – alle Lichter erloschen schlagartig.
Es war plötzlich stockdunkel.
Erschrocken sah er um sich, doch noch lag alles völlig ruhig da. Offenbar gab es eine Zeitschaltuhr, die zufällig in dem Moment angesprungen war, als er die Neuigkeiten des Tages auf den Boden hatte fallen lassen. Die Wahrheit aber war: Es gab keine Zeitschaltuhr, und die Neuigkeit des Tages würde ihm nicht gefallen, denn plötzlich heulte ein Motor auf.
Jemand legte krachend einen Gang ein und trat dann das Gaspedal durch.
Reifen quietschten!
Der Junge starrte ins Dunkel, dem Geräusch folgend, als seitlich hinter der Villa Scheinwerfer in den dunklen Himmel stießen und im nächsten Moment ein Mercedes 170 S, Baujahr 1954, mit singenden Reifen und ausbrechendem Heck um die Ecke schlitterte. Unter anderen Umständen hätte er sicher dieses wunderbare schwarze Auto bewundert: geschwungene Kotflügel, Trittbretter an den Seiten, Weißwandreifen, ein rechteckiger silberner Kühlergrill und rechts und links Scheinwerfer – die ihn ins Visier nahmen.
Geschockt schwang er sich aufs Rad und trat in die Pedale.
Hinter ihm der Mercedes, kreischend laut im ersten Gang.
Hedy am Steuer.
Der Wagen schlingerte mal nach rechts, mal nach links, kam kurz von der asphaltierten Auffahrt ab, schrammte hässliche Narben in den Rasen, kehrte auf die Straße zurück, während Hedy den Kopf aus dem Seitenfenster streckte und angriffslustig schrie: »TIMBUUUKTUUU! TIMBUKTUUU!«
Den Zeitungsjungen hatte nackte Panik erfasst, er trat um sein Leben, während Hedy die Auffahrt hinabjagte, ihn förmlich über den Mercedesstern auf der Kühlerhaube aufs Korn nahm.
Schon kam sie ihm Stück für Stück näher.
Er schrie entsetzt auf.
Sie entzückt.
Der Motor jaulte wie der einer Stuka im Krieg, die Reifen quietschten von Hedys hektischen Steuermanövern. Ihr Fahrstil war alles andere als gut und hatte sich seit den fünfziger Jahren, als sie sich das letzte Mal ans Steuer gesetzt hatte, nicht gerade verbessert.
In wilder Hatz floh der Junge mit rotierenden Beinen, verlor dabei die Tasche mit Zeitungen, die Hedy hinter ihm gnadenlos überfuhr. Mit Tränen der Verzweiflung erreichte er endlich die Grundstückseinfahrt und bog auf die Straße, als wäre der Teufel hinter ihm her.
Hedy bremste, der Wagen brach nach rechts aus und stoppte kurz vor der Grundstücksmauer. Sie stieg aus, marschierte auf die Straße und rief ihm laut nach: »Wir sehen uns morgen, Bursche!«
Gut gelaunt wandte sie sich um und blickte in Jans fassungsloses Gesicht. Er war von seinem Fahrrad abgestiegen, während sich seine Hände immer noch um den Lenker klammerten.
»Ich habe einen neuen Job für Sie!«
»W-was?«
»Es heißt: ›Wie bitte‹, Jan!«
»W-was?«
Hedy seufzte.
Dann klopfte sie ihm gegen die Schulter: »Sie werden mich zum Strand fahren! Haben Sie Hunger? Also, ich habe Hunger!«
»Ich?«
»Jawohl. Sie!«
Jan starrte sie immer noch an.
Dann sagte er schüchtern: »Ich kann nicht, Fräulein von Pyritz.«
»Papperlapapp! Sie können. Und Sie werden!«
Jan schluckte: »Es ist … es …«
»Was denn?«, fragte Hedy ungeduldig.
»Ich habe keinen Führerschein!«
»Das ist ein Witz, oder?«
Hedy musterte ihn streng.
»Nein, Fräulein von Pyritz!«
Einen Moment sah ihn Hedy erstaunt an, dann beschied sie: »Dann machen Sie ihn jetzt!«
»Jetzt?«
Hedy nickte: »Sie fangen morgen an. Ich zahle – Sie bestehen! Und rufen Sie den Pannendienst, die sollen den verdammten Wagen zurücksetzen. Ich kann nur vorwärts … Kommen Sie! Frühstück! Gott, habe ich einen Hunger!«
Damit drehte sie sich um und marschierte zurück ins Haus.
Jan sah ihr nach: Der Dutt war weg!
Sie hatte sich die Haare schneiden lassen: Sie fielen ihr schneeweiß und sanft gewellt auf die Schultern. Jan staunte, wie sehr es sie verändert hatte. Sie wirkte so anders.
Jünger.
Wilder.
Und auch ein bisschen verrückter.
Mount Everest
9
An diesem Tag las Maria Hedy das erste Mal seit langem aus einer sauberen, wenn auch zerknitterten Zeitung vor, denn Hedy hatte einfach eine neue aus der überfahrenen Tasche des Jungen herausgezogen und blickte zufrieden lächelnd auf die blitzblanken Schlagzeilen, während Maria dahinter die Neuigkeiten aus der Region vortrug. Jan kaute auf einem Käsebrötchen herum und grinste dann und wann, wenn er verstohlen zu Hedy herüberblickte: Man kam ihr besser nicht in die Quere. Und das durfte man mittlerweile schon wortwörtlich nehmen.
Hedy absolvierte ihre Übungen, ohne dass sie auch nur eine Silbe über den Führerschein verlor, so dass Jan annahm, dass sie ihn dazu lediglich in einer gewissen Euphorie nach dem kleinen Rennen mit dem Zeitungsburschen aufgefordert hatte. Dabei hätte er es besser wissen müssen, denn Hedy sagte, was sie tat, und tat, was sie sagte.
Der Tag verstrich ohne weitere Vorkommnisse oder Ankündigungen, aber schon am nächsten, als Jan Maria im Eingang stehend eine leere Tupperdose in die Hand drückte, hörte er Hedy durch die angelehnte Bürotür telefonieren. Sie war ziemlich geladen. Schließlich pfefferte sie den Telefonhörer auf die Gabel und marschierte kurz darauf so entschlossen auf Jan zu, dass der ganz automatisch einen Schritt zurück tat.
»Guten Morgen, mein lieber Junge!«, rief sie und hakte sich bei ihm ein. »Kommen Sie! Wir haben zu tun!«
»Guten Morgen, Fräulein von Pyritz. Gibt es Ärger?«, fragte Jan höflich.
»Den gibt es, seit Menschen beschlossen haben, von den Bäumen herabzusteigen. Das hat dem einen oder anderen nicht gutgetan!«
Sie zog ihn ins Büro und verschloss die Tür.
»Was ist denn passiert?«, fragte Jan.
Hedy winkte mürrisch ab: »Ach, dieser Taugenichts weigert sich, mir die Zeitung zu bringen!«
»Sie haben versucht, ihn zu überfahren!«, gab Jan zu bedenken.
»Jetzt klingen Sie schon wie dieser Chefredakteur. Wenn ich gewollt hätte, dann hätte ich ihn auch erwischt!«
Sie ging um ihren Schreibtisch herum und nahm eine dünne Kladde von der Unterlage.
»Vielleicht rufen Sie ihn einfach an und sagen ihm, dass es nicht so gemeint war?«, fragte Jan vorsichtig.
»Seien Sie nicht albern, Jan. Es war so gemeint.«
»Und was wird aus Ihrer Zeitung?«
Hedy zuckte mit den Schultern: »Ich habe eine abonniert, ich werde eine bekommen. Wie die das lösen, ist mir vollkommen egal … Setzen Sie sich!«
Jan nahm auf einem der Stühle Platz.
Hedy baute sich vor ihm auf und drückte ihm die Kladde in die Hand: »Das sind Ihre Anmeldungsunterlagen für die Fahrschule. Wir haben eine sehr gute im Ort. Man erwartet Sie heute Abend zur ersten Theoriestunde. Sie brauchen Ihren Pass, ein Lichtbild, und einen Sehtest müssen Sie auch noch machen. Schätze, Sie werden bald eine Brille tragen müssen! Aber machen Sie sich nichts draus. Sie sind immer noch ein gutaussehender junger Mann!«
Jan schluckte und sah auf das bedruckte Blatt Papier in der Kladde: Es war von Hedy bereits unterschrieben worden.
»Fräulein von Pyritz«, begann Jan vorsichtig. »Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen …«
»Ach, was!«, winkte Hedy ab. »Sie brauchen mir nicht zu danken! Und was die praktischen Fahrübungen angeht: Sie können den Mercedes nehmen. Er hat zwar nicht den üblichen Komfort wie Servolenkung oder Radio, aber ich versichere Ihnen, der Wagen ist fabelhaft. Ziehen Sie einen Anzug dazu an, und die jungen Frauen da draußen werden Ihnen zu Füßen liegen. Haben Sie eine Freundin?«
Jan schüttelte den Kopf.
»Das wird schon noch. Man sagte mir, dass die Schüler im Durchschnitt dreißig Fahrstunden bräuchten, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Das kommt für Sie natürlich nicht in Frage. Sie sind kein Durchschnitt, Jan.«
»Danke, aber …«
»Bei der Theorie erwarte ich null Fehlerpunkte. Versteht sich von selbst!«
»Dachte ich mir, nur …«
»Bleibt nur noch ein Übungsplatz. Ich werde mit dem Bürgermeister sprechen, ob wir ein städtisches Grundstück nutzen dürfen, damit Sie Einparken üben können oder Rückwärtsfahren.«
»Wir?«, fragte Jan.
»Natürlich wir. Sie fahren meinen Mercedes. Haben Sie eine Idee, wie teuer dieses Auto ist?«
»Nein, aber …«
»Sehen Sie, deswegen werden Maria und ich dabei sein. Es ist alles bereits organisiert!« Hedy nickte zufrieden und setzte sich neben Jan auf einen Stuhl: »Und im Sommer fahren Sie mich an den Strand.«
Jan seufzte, dann begann er stockend: »Fräulein von Pyritz … ich kann Ihnen nicht helfen. Wirklich!«
Hedy sah ihn verdutzt an: »Warum nicht?«
»Ich … ich … es gibt einen Grund, warum ich keinen Führerschein habe …«
»Und der wäre?«
Jan mied ihren Blick, suchte stattdessen scheinbar Halt an einem Bücherregal am gegenüberliegenden Ende des Raumes. Für einen Moment schien er etwas entdeckt zu haben, dann wandte er sich wieder Hedy zu: »Ich habe … eine Gleichgewichtsstörung.«
Hedy musterte ihn erstaunt: »Sie haben was?«
»Eine Gleichgewichtsstörung. Wenn ich fahre, wird mir schwindelig.«
»Das ist doch totaler Unsinn!«, antwortete Hedy fast schon amüsiert.
»Nein, es ist wirklich so!«, protestierte Jan.
»Was soll denn das für eine Krankheit sein?«, fragte Hedy neugierig.
»Irgendein Schaden im Ohr, nehme ich an. Die Ärzte konnten mir da auch nichts Genaues sagen.«
Hedy stand auf und streckte sich: »Im Ohr? Sie meinen ein zeitweises Aussetzen des Gleichgewichtsorgans?«
»Ja, so etwas in der Art!«
Hedy machte ein paar Schritte Richtung Regal: »Aber Radfahren funktioniert, wie ich gesehen habe?«
Jan zuckte mit den Schultern: »Ja, das geht problemlos. Ist schon sehr seltsam.«
»Es könnte natürlich auch etwas Psychosomatisches sein?«
»Wäre schon möglich, aber ich finde, zwanghaft bin ich nicht.«
»Nicht unbedingt zwanghaft. Vielleicht etwas ängstlich?«
»Vielleicht, ja.«
Hedy hatte das Regal erreicht und blickte einen Moment darauf – bis sie gefunden hatte, was sie suchte. Dann drehte sie sich um und antwortete: »Das ist natürlich schade. Ich hätte mir niemand Besseren vorstellen können als Sie, Jan!«
Jan nickte: »Ja, sehr bedauerlich.«
Hedy lief zurück zu ihrem Schreibtisch, schob eine Schublade auf und fischte aus einem Hängeregister eine Akte heraus: »Wissen Sie, vor ein paar Monaten stellte sich hier ein junger Mann vor, der ein paar wirklich interessante Ideen hatte, wie man Taubheit bekämpfen und vielleicht für immer besiegen könnte. Eine neue Strategie zum Thema bionisches Ohr. Er brauchte Geld für seine Forschung, aber unsere Vorgaben schließen Medizin nicht ein, weil die Forschungen auf diesem Feld in aller Regel so teuer sind, dass wir andere junge Menschen dann nicht fördern könnten. Da ist es mit einem Computer, einer Studienfinanzierung oder einem Forschungssemester nicht getan. So auch in diesem Fall, obwohl wir von diesem jungen Mann alle ganz angetan waren.«
»Schade«, nickte Jan beipflichtend.
»Ja, sehr schade«, bestätigte Hedy und setzte sich, die Akte in der Hand, wieder zu Jan. »Wir haben ihm aber ein Empfehlungsschreiben mitgeben können. Und zwei, drei Kontakte. Ich bin sicher, er wird seinen Weg machen.«
Sie legte ihm die Akte auf den Schoß und sagte: »Sehen Sie sich doch mal sein Bewerbungsanschreiben an. Es war der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Es ist witzig, ohne unseriös zu sein. Gescheit, ohne eitel zu wirken. Wenn Sie mich fragen, hätte er auch das Talent zu einem Schriftsteller.«
Jan gab ihr die Akte zurück und lächelte: »Ich glaube Ihnen.«
Hedy schob ihm die Akte wieder zu: »Sehen Sie hinein!«
Sie lächelte freundlich, aber ihre Forderung duldete keinen Widerspruch. Jan nahm die Akte, schlug sie auf und starrte eine Weile auf das bedruckte Papier. Dann lächelte er und sagte: »Ja, er ist wirklich witzig!«
Er wollte ihr die Akte zurückgeben, aber Hedy weigerte sich, sie anzunehmen: »Was fanden Sie am witzigsten?«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Jan vorsichtig.
»Nun, welche Stelle? Welchen Satz?«
Jan blickte wieder auf das Papier.
Nach einer kurzen Bedenkzeit antwortete er: »Ich weiß nicht. Es ist im Ganzen witzig. Da kann man nichts herauspicken.«
Hedy nickte: »Warum lesen Sie mir nicht ein bisschen daraus vor?«