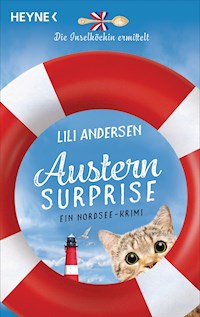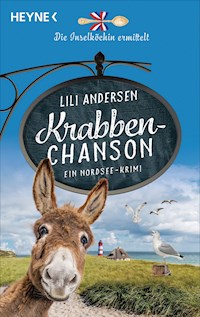
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inselköchin-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Schön war es, auf der Welt zu sein…
Zwischen Meeresrauschen und Möwengeschrei erholt sich Köchin Louise Dumas von einem gebrochenen Herzen. Seit sich die Französin bei ihrer Patentante auf Pellworm einquartiert hat, geht es ihr viel besser. Schon bald spricht sich herum, dass eine Sterneköchin auf der Nordseeinsel weilt – und Louise bekommt den Auftrag, für die Geburtstagsgäste eines gefeierten Schlagersängers zu kochen. Als am Ende des rauschenden Fests jedoch der Gastgeber tot aufgefunden wird, ahnt Louise, dass mehr als ein simples Unglück dahintersteckt. Während Kriminalkommissar Mommsen noch an einen Unfall glaubt, ist Inselköchin Louise bereits einem gefährlichen Mörder auf der Spur …
Der erste Fall für die Inselköchin Louise Dumas
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Ähnliche
Das Buch
Als am selben Tag erst ihre Liebe und dann ihre Karriere als Köchin vor dem Aus stehen, kann Louise Dumas ihr Unglück kaum fassen. Kurzerhand packt sie ihre besten Küchenmesser ein, ohne die sie nie das Haus verlässt, schwingt sich auf ihr Motorrad, kehrt Frankreich den Rücken und macht sich auf in Richtung Nordsee. Auf der friesischen Insel Pellworm, im gemütlichen Reetdachhaus ihrer Patentante Fine, will sich die temperamentvolle Französin erholen. Und vor allem: nicht kochen! Doch als sie von Schlagersänger Klas Thams für seine mondäne Party engagiert wird, sagt sie dennoch zu. Immerhin ist Thams der größte Stern am Schlagerhimmel! Als der Sänger jedoch während der Party tot aufgefunden wird, ist es mit Louises Ruhe vorbei. Angeblich starb er wegen einer allergischen Reaktion auf ihre berühmten Krabbenbällchen. Doch Louise hat so eine Ahnung, dass das nicht die ganze Wahrheit ist …
Die Autorin
Lili Andersen ist das Pseudonym der Krimiautorin und Kunsthistorikerin Liliane Skalecki. Wie ihre Protagonistin Louise Dumas hat auch Lili Andersen französische Wurzeln, ein Herz für kleine friesische Inseln und einen Hang zum Kochen köstlicher Gerichte. Sie lebt mit ihrer Familie in Bremen und Südfrankreich.
https://liliane.skalecki.info/
LILI ANDERSEN
Die Inselköchin ermittelt
Ein Nordsee-Krimi
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 04/2021
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, und
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
© 2021 by Lili Andersen
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung von © Bigstock (Hans_Chr, Alexander Baumann, maystra); iStockphoto (Christian Horz); Shutterstock.com (Bisli, Eric Isselee, gabriel12)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-26690-5V002www.heyne.de
Prolog
On the third day he took me to the river
He showed me the roses and we kissed
And the last thing I heard was a muttered word
As he stood smiling above me with a rock in his fist
Sie wusste nicht, wie lange sie schon im nasskalten Watt kniete. Ihr Blick ging zum Horizont. Die Schwärze der Nacht verschmolz mit dem Nichts. Sie war am Ende ihrer Reise angelangt, der winzige Rest Lebenswille verschwand mit jedem Atemzug. Seine Worte hatten sie getroffen wie Hiebe, hatten sie immer kleiner und unscheinbarer werden lassen. Sie war langsam in die Knie gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Er hatte sich einfach umgedreht und war gegangen. Hatte er gespürt, dass sie keine Kraft mehr hatte, aufzustehen und sich zu wehren?
Und so kniete sie noch immer im nassen Schlick. Die Hände um den Oberkörper geschlungen, wiegte sie sich hin und her, summte die Melodie.
On the last day I took her where the wild roses grow
Die warme bedrohliche Stimme Nick Caves machte sich in ihrem Kopf breit. Sein Schmeicheln, sein Werben, das Bild der Rose, die er knickte, tötete.
Das Wasser leckte bereits an ihren Füßen, die Flut kam. Das Wasser kam und ging, und es würde sie mitnehmen. Dieses Wasser war so ganz anders, voller Kraft, Urgewalt, gnadenlos. Sie würde sich ihm anvertrauen. So war es auch damals gewesen, als sie zwischen den Kieseln am Flussufer gelegen, und das leise murmelnde Rauschen des langsam dahingleitenden Gewässers vernommen hatte. Mehr tot als lebendig. Doch der Fluss hatte sie wieder ausgespuckt.
Das Wasser reichte jetzt bis zu ihren Hüften. Sie musste einfach geduldig sein. Die Flut wusste, was zu tun war.
Sie spürte seine Anwesenheit, noch ehe sie ihn sah. Zuerst nur ein dunkler Schatten, dessen Umriss mehr und mehr Kontur annahm. Kehrte er zurück?
Kapitel 1
Wie im Zeitraffer. So hatten sich die letzten zweiundsiebzig Stunden für Louise angefühlt. Eintausend Kilometer in drei Tagen hatte sie zurückgelegt, durch eine Landschaft, die unbemerkt an ihr vorüberflog, als hätte jemand auf die Vorspultaste gedrückt. Zurückgelassen hatte sie ein Leben, das in tausend Scherben zerbrochen war, ein Leben, das ebenso an ihr vorbeigeflogen war wie die Landschaft im Zeitraffer.
Erst jetzt, seit sie an Bord der Fähre war, das Wummern der Motoren und das Geschrei der Möwen in den Ohren, schien die Zeit wieder in ihren gewohnten Rhythmus zu verfallen. Die Wolken flogen bald in geschlossenen Formationen, bald zerfetzt wie ein zerrissenes Tuch über den bleigrauen Himmel. Sie legte den Kopf in den Nacken, fixierte eine der Wolken, beobachtete, wie sie auseinanderwirbelte, sich in einer neuen Form zusammenfügte, in Stücke gerissen wurde, um dann mit einer anderen Wolke zu kollidieren, sich mit ihr zu vereinen und weiterzuziehen. Und das alles in rasender Geschwindigkeit. Wolken im Zeitraffer. Die Fähre pflügte durch das Wasser, Schaumkronen bildeten sich, sprangen wie eine Herde wilder Pferde davon, die ihre langen weißen Mähnen schüttelten. Bald war sie am Ende ihrer Reise angelangt. La mer m’a donné sa carte de visite pour me dire: Je t’invite à voyager. Die Textzeilen aus dem Lied von Georges Moustaki kamen ihr in den Sinn. Das Meer hat mir seine Visitenkarte überreicht, um mir zu sagen: Ich lade dich ein zu reisen. Leise summte sie die Melodie vor sich hin. In Louises Leben gab es zwei Männer, die sie rückhaltlos für ihre Kunst verehrte – den Chansonnier Georges Moustaki und den Regisseur François Truffaut. Sie kannte jedes Lied, jede Textzeile, jeden Film, jeden Dialog.
Als sie fünfzehn war, hatte ihr Vater eine Kur in Lamalou-les-Bains machen müssen und die Gelegenheit für einen seltenen Urlaub mit seiner Frau und seiner Tochter genutzt. Kaum in dem kleinen Ort nördlich von Bézièrs angekommen, sah Louise Menschen zum Platz vor dem Casino pilgern. Irgendetwas Besonderes schien hier stattzufinden. Ihre Eltern, müde von der Fahrt, zogen es vor, sich gemütlich im Ferienhaus einzunisten, doch Louise folgte dem Menschenstrom. Bis zu diesem Tag hatte sie die üblichen Tralala-Popsongs gehört. Sie hatte keine Lieblingsband, auch keinen Sänger, den sie favorisiert hätte. Sie hörte Radio, meist den Sender RFM mit seiner Mischung aus Chansons und internationaler Musik, und das wars. Die Begegnung mit Georges Moustaki, der in diesem Kurort ein Gratiskonzert gab, eröffnete ihr eine Musik, die sie fesselte und sie seitdem nicht mehr verlassen hatte. Es waren die Texte, die Melodien, die Ausstrahlung des alternden Chansonniers und seine Stimme, die schmeichelte und forderte und immer eine Weichheit in sich trug, die Louise tief ins Herz drang.
Ihre Augen tränten, vom Wind, vor Erschöpfung oder wegen der Erinnerung wusste sie nicht genau, und rasch setzte sie sich die Sonnenbrille auf. In Norderstrand hatte sich die Sonne in bester Junilaune gezeigt, und Louise hatte in einem leichten Pullover am Fähranleger im Hafen Strucklahnungshörn auf die Fähre gewartet, die sie zur Insel bringen sollte. Als sie ihr Motorrad auf die Pellworm 1 schob, hatte ihr die Frau, die die Fahrkarte kontrollierte, geraten, sich noch eine Jacke überzuziehen, die halbstündige Überfahrt würde eine frische Angelegenheit werden. Louise hatte auf ihre Lederjacke gezeigt, die über der Hecktasche, in der sie ihre wichtigsten Reiseutensilien aufbewahrte, lag, und sich für den Rat bedankt.
Louise sah sich an Deck um. Es waren nur wenige Reisende an Bord. Eine Handvoll Touristen, deren vollgeladene Autos an Deck standen, und Inselbewohner, die auf dem Festland arbeiteten. Oder die sich dort mit alledem eingedeckt hatten, was es auf Pellworm nicht zu kaufen gab. Auch wenn Tante Fine ihr hundertmal versichert hatte, dass es die wichtigsten Dinge und mehr, viel mehr! auf der Insel gab. Die kleinen Geschäfte und der Supermarkt in Tammensiel seien mit allem bestückt, was das Herz begehrt, die Brötchen in der einzigen Bäckerei wären frisch und kross, an nichts würde es ihr fehlen.
Louise fröstelte. Leider würde es auf Pellworm keineswegs das geben, was ihr Herz begehrte … Wieder traten ihr Tränen in die Augen. Doch diesmal war ganz sicher nicht der starke Wind daran schuld. Sie zog den Reißverschluss ihrer Motorradjacke bis zum Hals und packte den länglichen schmalen Lederkoffer, den sie über der rechten Schulter trug, auf die linke.
»Machen Sie Urlaub auf Pellworm? Oder …«
Louise fuhr herum. Der Wind hatte die letzten Worte mitgenommen. Oder gab es einen Zeitraffer auch in der Sprache? Einen Wortraffer? Der Mann, der wie aus dem Nichts neben ihr aufgetaucht war, hatte seine Arme fröstelnd vor dem Körper gekreuzt, die Hände in den Achselhöhlen vergraben. Kein Wunder, er trug ein Poloshirt, den wärmenden blau-weiß gestreiften Pullover hatte er um seine Hüften über dem deutlich sichtbaren Bauchansatz geknotet.
»Ziehen Sie den mal lieber an«, brummte Louise und machte eine Kopfbewegung in Richtung des molligen Kleidungsstücks. Dann wandte sie sich wieder ihren Wolkenbetrachtungen zu. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte, war Small Talk mit einem Fremden. Doch der Mann ließ sich nicht beirren und stellte sich neben sie an die Reling. Langsam drehte sie sich wieder zu ihm um und musterte ihn.
Der Mann war in den späten Fünfzigern, das spärliche Haar war kurz geschnitten. Bis auf den kleinen Bauchansatz wirkte er sportlich, war groß gewachsen, und man hätte ihn attraktiv nennen können, wenn seine Ohren nicht wie zwei aufgeblähte Miniatursegel an seinem Kopf gesessen hätten. Louise konnte nicht anders, sie starrte auf die Ohren. Der Mann fing ihren Blick auf und lachte gutmütig. »Mein Markenzeichen. Ich kann damit wie eine Satellitenschüssel jedes noch so kleine Signal wahrnehmen.«
Louise musste lächeln.
»Das ist kein Scherz! Ich glaube, ich höre tatsächlich besser als andere Menschen. Eine Eigenschaft, die meine Kunden davon überzeugt, dass ich weiß was, ich tue. Na, haben Sie eine Idee, was ich beruflich mache?« Der Mann lächelte verschmitzt.
Louise unterdrückte ein Seufzen. Sie war hier offensichtlich an einen Witzbold geraten. »Hmmm …« Sie tat so, als denke sie angestrengt nach. »Ich glaube, Sie sind Direktor eines Flohzirkus. Wenn sich Ihre kleinen Akrobaten aus dem Staub machen, hören Sie sie niesen, et hop, haben Sie Ihren Trupp wieder eingefangen.«
Ihr Gegenüber brach in ein herzhaftes Lachen aus. »Na, Sie sind mir eine. Nein, Sie kommen ja doch nicht drauf. Ich werde es Ihnen verraten. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin Hörgeräteakustiker.«
Nun musste auch Louise lachen. »Da haben Sie ja wirklich den perfekten Beruf gefunden! Und um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ich besuche meine Patentante auf Pellworm. Und ich werde höchstwahrscheinlich längere Zeit hierbleiben. Mal sehen. Also irgendwie ein Urlaub, aber doch nicht so richtig. Und Sie?«
»Wir machen Urlaub. Richtigen. Wir verbringen unsere Ferien schon seit zehn Jahren auf der Insel. Es gibt keinen schöneren Platz auf dieser Welt als Pellworm. Es ist ein Paradies. Aber wenn Ihre Tante hier wohnt, kennen Sie dieses herrliche Fleckchen Erde wahrscheinlich bestens.«
»Wie man es nimmt. Ich bin als Kind viel dort gewesen. Das letzte Mal ist, oh je, da muss ich nachrechnen, fünfzehn Jahre her.«
»Hubertus, willst du dir etwa den Tod holen?«
Eingepackt in eine Jacke, die vielleicht einem Aufenthalt auf der Zugspitze alle Ehre gemacht hätte, trat eine rundliche Frau auf sie zu. Sie kam nur langsam voran, da sie sich gegen eine aufkommende Windböe stemmte, dabei wedelte sie mit einer dunkelroten Daunenjacke.
»Zieh sofort deinen Pullover über! Und die Jacke! Meinst du, du schindest Eindruck bei der Dame, wenn deine Haut wie die einer gerupften Gans aussieht?« Sie schüttelte verständnislos den Kopf und reichte Louise die Hand.
»Simone Schulte. Puh, ist das ein Wind. Und so kalt. Man sollte nicht glauben, dass wir Mitte Juni haben. Aber das wird noch, nicht wahr, Knuffelchen? Wir sind für alle Eventualitäten gewappnet. Daunenjacken für Schietwetter, kurze Hosen für die Wattwanderung bei Sonnenschein. Zwei Wochen Pellworm. Wir können es kaum erwarten. Nicht wahr, Knuffelchen? Jetzt sag doch auch mal was. Männer sind so mundfaul. Manchmal denke ich, er hört trotz seiner großen Ohren nicht mehr richtig. Oder, er will mich nicht hören.«
Sie beschirmte ihre Augen mit der Hand und blickte gen Horizont. Dann trompetete sie, als habe sie das Eiland höchstselbst soeben entdeckt, »Land in Sicht!«. Geschäftig wandte sie sich an ihren Mann: »Hubertus, wir müssen zum Wagen. Wir stehen ganz vorne. War schön, Sie kennengelernt zu haben. Machen Sie auch Urlaub hier? Wird Ihnen guttun Kindchen, Sie sehen nämlich etwas blass um die Nase aus.« Mit diesen Worten und einer besorgten Miene, die sowohl Louise als auch Hubertus galt, drehte sich Simone Schulte um und ließ sich vom Wind zu ihrem Wagen geleiten.
Louise schmunzelte und Hubertus seufzte. Er machte keine Anstalten, seiner Frau zu folgen.
»Sie wird auch wieder ruhiger, glauben Sie mir. Das kenne ich schon. Sie betritt die Insel wie ein aufgescheuchtes Huhn, schnattert die ersten zwei Tage wie eine Gans. Und dann, wie durch einen Zauber, beginnt die Entschleunigung. Auf Pellworm wird man einfach entspannt und gelassen. Ja, ein echter Zauber. Aber das kennen Sie ja, wenn Sie schön öfter hier waren, Frau … Ach herrje, Sie hatten ja noch nicht einmal die Möglichkeit, sich vorzustellen«, fügte Hubertus Schulte mit entschuldigendem Blick hinzu.
»Dumas, Louise Dumas.«
»Wie der Schriftsteller? Alexandre Dumas? Der Graf von Monte Christo und Die Drei Musketiere haben mich durch meine frühe Jugend begleitet.«
»Ja, wie Alexandre Dumas. Aber weder, wie sagt man im Deutschen, verwandt noch verschwägert.«
»Habe ich mir’s doch gedacht! Sie sprechen hervorragend deutsch, aber da ist dieser entzückende kleine französische Akzent. Und eben dieses et hop. Einfach wunderbar.« Hubertus Schulte strahlte, als habe er soeben das letzte Exemplar einer ausgestorbenen Spezies entdeckt. »Und bitte sehen Sie über die etwas unverblümte Art meiner Gattin einfach hinweg.«
»Schon okay.«
Unschlüssig blieb Hubertus Schulte noch einen Moment stehen. Louise fing seinen Blick auf, der am schmalen Koffer, den sie geschultert hatte, hängen blieb.
»Ihre Fotoausrüstung? Wissen Sie, ich fotografiere auch sehr gerne. Am Tag und in der Dämmerung. Sogar in der Nacht. Und was es auf Pellworm nicht alles zu entdecken gibt! Ich habe eine Makroaufnahme im Watt gemacht von den Hinterlassenschaften eines Sandwurms. Unglaublich, aus der Nähe betrachtet und vergrößert sehen sie aus wie ein Kunstwerk.«
Louise schüttelte den Kopf. »Nein, da ist keine Fotoausrüstung drin. Fürs Knipsen habe ich kein Talent.«
»Na ja, ich knipse nicht. Das ist schon sehr viel ambitionierter, was ich mache«, meinte Hubertus Schulte freundlich und fuhr dann hartnäckig fort, »Also, was transportieren Sie denn nun? Doch nicht etwa eine Kalaschnikow?« Er lachte.
Louise starrte ihn entsetzt an. »Woher wussten Sie das?« Erschrocken trat Hubertus Schulte einen Schritt zurück.
»Sie machen Witze!«, rief er aus. Und fügte dann in einem leisen, verschwörerischen Ton hinzu: »Sind Sie etwa eine Berufskillerin?«
Louise lächelte milde und klopfte auf den Koffer. »Pardon, ein kleiner Scherz. Da ist selbstverständlich keine Knarre drin, nur meine Messer.«
Das Lächeln, zu dem Hubertus Schulte gerade ansetzen wollte, gefror ihm auf den Lippen. Fassungslos starrte er Louise an, die nicht mehr an sich halten konnte und in Lachen ausbrach. »Nein, keine Angst, ich kille nicht, ich koche!«
Als Hubertus sie immer noch verständnislos anstarrte, seufzte sie. »Ich bin Köchin. Das sind meine Messer. Es sind besonders wertvolle Messer, und ich habe keine Lust, dass sie mir geklaut werden. Denn ohne ein gutes Messer gibt es kein gutes Essen. Aber weil die Dinger so verdammt scharf sind, kann man sie nicht einfach lose transportieren. Deswegen sind sie hier drin, fest verschnallt und gesichert.«
»Und Sie dürfen das? Einfach so Messer mit sich herumtragen?«
»Ja, als Berufsköchin ist es mir erlaubt. Die Messer müssen allerdings in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Andernfalls kann mich das nicht nur 10.000 Euro Bußgeld kosten, sondern womöglich auch meine Lizenz.«
»Ach, das hätte ich nun aber nicht gedacht, ist ja interessant.« Hubertus schien sich von seinem Schreck erholt zu haben. »In welchem Restaurant werden Sie arbeiten? Wir kommen gerne vorbei und lassen uns von Ihrer Kochkunst überraschen.«
Louise blieb es erspart, darauf antworten zu müssen. Die Fähre verlangsamte ihr Tempo, in wenigen Minuten würde sie anlegen, und Simone Schultes in den Wind geschriene herrische Aufforderung an ihren Gatten, doch jetzt endlich zu kommen, ließ Hubertus mit entschuldigendem Blick und eiligen Schritten in Richtung Auto verschwinden. »Hat mich gefreut!«, rief er ihr noch zu. Louise hob die Hand zum Gruß, wandte sich um und streckte den Kopf in den Wind.
Südlich des Anlegers ragte der rot-weiß gestreifte Leuchtturm in den Himmel, und gegenüber des Fähranlegers erahnte Louise im Westen der Insel die braun-rot aufragende Turmruine der Alten Kirche. Das Überbleibsel des romanischen Bauwerks, das im 13. Jahrhundert gebaut worden war, wachte als stattliche Ruine über die Insulaner und war eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten für Touristen. Der Wind frischte noch einmal auf, zerriss die Wolkendecke und rupfte sie in kleine Stücke. Ein fast unnatürlich blauer Himmel brach sich Bahn, und die Sonne schickte ihre Strahlen auf die Insel, versprach einen sommerlich milden Tag.
Mit einer instinktiven Bewegung, die sie tausende Male vollführt hatte, wollte sich Louise ihre widerspenstigen Locken aus dem Gesicht streichen. Doch mitten in der Bewegung hielt sie inne. Ihre ehemals langen dunklen Haare waren vor einer Woche der Schere zum Opfer gefallen. Die neue Frisur stehe ihr superb, hatte Adonis (ja, er hieß wirklich so), Coiffeur und Haarkünstler, ihr mit spitzen Schreien der Entzückung versichert. Doch noch hatte sie sich nicht daran gewöhnt. Ihr Gesicht wirkte nun runder. Rund und flach wie eine Crêpe, hatte sie gejammert, als sie später mit ihrer Mutter wie ein Häufchen Elend in der Küche saß.
Maman hatte ihr liebevoll über die Haare gestrichen. »Wie eine Crêpe zum Anbeißen«, hatte sie gesagt und nach kurzem Zögern gefragt: »Was willst du jetzt machen?«
»Keine Ahnung. Ich will nur noch weg. Weg vom Restaurant, weg von hier, und vor allem weg von diesem Miststück. Sie hat gesagt, sie findet mich in jedem Karnickelloch.« Louise heulte auf. »Maman, ich bin erledigt, ich bekomme im Elsass, ach was sag ich, in ganz Frankreich kein Bein mehr auf den Boden. Je suis foutue.«
Als Louise sah, wie ihre Mutter sie mit großen Augen ansah, schmunzelte sie.
»Du musst gar nicht so gucken. Deswegen habe ich es ja auf Französisch gesagt. Das hört sich doch erheblich netter an, als hätte ich gesagt, ich bin am A…, meinst du nicht auch?« Kathrin Dumas lächelte liebevoll. »Da hast du allerdings recht. Wir haben dich offensichtlich wirklich gut erzogen, mon cœur.«
Der kurze Moment der Heiterkeit verflog, und Louises Stimme war wieder voller Verzweiflung.
»Ich war so kurz vor meinem ersten Stern«, sie hob die Hand und drückte Daumen und Zeigefinger so fest zusammen, dass kein Blatt Papier dazwischen gepasst hätte. »Ich hatte ihn sicher. Und jetzt? Ich kann mich nirgendwo mehr blicken lassen! Und nicht nur das, das Ganze ist noch viel schlimmer! Zwar könnte ich nach Übersee gehen, nach Guayana, oder in den letzten Winkel der Bretagne, wo mich niemand kennt. Aber …«, nun liefen ihr Tränen des Kummers über die Wangen. »Maman, ich kann plötzlich nicht mehr kochen! Als hätte ich alles vergessen, was ich jemals gelernt habe. Gestern wollte ich eine Mousseline de Rascasse machen. Weißt du, was dabei rausgekommen ist? Statt einer luftig-leichten Mousse, ein pampiger pürierter Kabeljau, der wie von einem Hund geschissen auf dem Teller lag. Weder was für die Augen noch für den Gaumen.« Louise schniefte, und ihre Mutter reichte ihr ein Taschentuch und eine Schale mit dampfendem Kaffee.
»Hier, trink das. Dann sehen wir weiter.«
Louise nickte dankbar und nahm einen Schluck des heißen Gebräus. Das war typisch für ihre Mutter. Zuerst einmal ein starker Kaffee, der die Sinne schärfte, wie sie immer sagte, und durch den man alles klarer und meist auch gelassener sah. Was dem Engländer die Tasse Tee, war ihrer deutschen Mutter ein starker frisch aufgebrühter Kaffee. Sie zog sich den Brotkorb mit dem rot karierten Deckchen heran, nahm ein goldbuttriges Croissant heraus, legte es wieder zurück. Sie hatte überhaupt keinen Appetit. Und wenn Louise Dumas auf ein Croissant au beurre verzichtete, dann ging es ihr wirklich hundsmiserabel. Sie seufzte tief. Wie anheimelnd hier alles war. Der große Holztisch mit der altmodischen Eckbank. Hier hatte sie ihre Hausaufgaben immer gemacht mit Blick auf den riesigen Tellerschrank mit den geschnitzten Türen. Hier stand das Geschirr mit den Elsässer Motiven – Frauen und Männer in Trachten, Fachwerkhäuser, ein Hirte mit seinen Schafen.
Es herrschte ein Moment der absoluten Stille in der Küche. Nur das Plätschern des Brunnens vor dem Rathaus drang durch das halb geöffnete Fenster.
Kathrin Dumas strich sich eine dunkelblonde Haarsträhne hinter das Ohr. Sie war eine attraktive Frau, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand. Die Auberge La Tulipe Noire, benannt nach einem Roman von Alexandre Dumas, in dem schmucken Fachwerkhaus im Herzen von Riquewihr hatten sie und ihr Mann Michel vor mehr als dreißig Jahren gekauft, und die Gäste liebten das kleine familiäre Hotel und schätzten seine traditionelle elsässische Küche. Kathrin nahm die Hände ihrer Tochter zwischen ihre.
»Und nun hör mir zu. Du hast dir nichts zuschulden kommen lassen, du hast dich einfach nur verliebt. Er hat einen Fehler gemacht. Und diese Frau hat die Macht, dich für die nächste Zeit …«
Louise wollte widersprechen.
»… lass mich ausreden! Für die nächste Zeit, vielleicht für ein paar Monate, vielleicht auch länger, aus dem Verkehr zu ziehen. Aber diese Wogen werden sich glätten, glaub mir. Und bis dahin kannst du hier bei uns wohnen und in der Auberge helfen. Wir könnten Kochkurse für unsere Gäste anbieten. Dann kommst du nicht aus der Übung. Wäre das nicht eine wundervolle Lösung?«
»Ich habe dir doch eben gesagt, dass ich nicht mehr kochen kann. Es ist weg, einfach weg!«
Ihre Mutter musterte sie nun streng. »Das ist doch dummes Zeug. Man verlernt einen Beruf nicht einfach. Das ist wie Radfahren oder Schwimmen. Das ist höchstens eine Blockade, und die wird sich bald wieder lösen.«
Ein Satz, den ihre Mutter eben gesagt hatte, spukte durch Louises Kopf. »Die Wogen werden sich glätten.« Ein Hoffnungsschimmer ließ ihr eben noch düsteres Gesicht strahlen.
»Ich weiß, was ich machen werde! Ich fahre zu Tante Fine auf die Insel. Auf Pellworm kann ich in Ruhe über alles nachdenken. Und Madame wird mir dort gewiss nicht nachspüren und neue Knüppel zwischen die Beine werfen.«
Und da war sie nun. Louise war auf Pellworm angekommen.
Kapitel 2
Ein Jahr zuvor
Die große Verheißung. Der Durchbruch. Durchstarten in eine neue Dimension. Dieser Moment, wenn sie die Bühne betritt, das Mikro in die Hand nimmt, kurz die Augen schließt und sich konzentriert. Um sie herum ist zunächst alles still. Sie hört nichts, sie sieht nichts. Dann öffnet sie die Augen, gibt das Zeichen, und der Rhythmus nimmt sie gefangen. Die Unruhe und spannungsvolle Erwartung, die von ihren Zuhören Besitz ergriffen hat, weicht einer fast andachtsvollen Stille. Ihre Stimme erklingt, ruhig und kraftvoll und sie hofft, dass sie ihr Publikum in eine andere Welt trägt.
Meist steht sie ganz ruhig, klopft vielleicht mit ihrem rechten Fuß den Rhythmus mit. Mehr nicht. Sie singt von Liebe, vom Verlassenwerden, von Sehnsucht, von Treue – das ganze Repertoire. Sie möchte ihre Sehnsüchte, ihren Schmerz, ihr Verlangen mit ihren Zuhörern teilen. Ein Kritiker eines Kreisblattes hat ihre Musik und ihre Texte einmal authentisch genannt. Das ist es, was sie auf der Bühne rüberbringen möchte.
Ihr erster Auftritt bei einem Schulfest ihres Gymnasiums vor ein paar Jahren war allerdings eine bittere Erfahrung gewesen. Sie war so nervös gewesen, dass ihr die Stimme immer wieder wegbrach – sodass sie entweder gar nicht zu hören war oder kiekste. Das laute Klatschen und Johlen ihrer Mutter hatten es nicht besser gemacht, und sie wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ein paar Wochen später jubelten ihr Freunde, Klassenkameraden und ein paar Gäste aus dem Nachbardorf nach einer Vorstellung im Jugendzentrum ihres Dorfes zu. Und jetzt – der Auftritt ihres Lebens, die Chance ihres Lebens. Wenn sie ihn überzeugen kann, dann hat sie nicht nur eine Tür aufgestoßen, dann ist sie bereits mittendrin in der Welt, die sie sich erträumt.
Als sie ihn an der Bar etwas abseits der kleinen Bühne entdeckt – er steht einfach da und trinkt mit irgendwelchen Leuten ein Bier – weiß sie, es gibt eine göttliche Fügung. Zuerst glaubte sie, sie habe sich getäuscht. Er hat eine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, möchte wohl unerkannt bleiben. Was ihm auch gelingt, denn niemand schenkt ihm groß Aufmerksamkeit. Hier in der kleinen Musikkneipe verkehrt auch nicht das Publikum, das er zu seinen Fans hätte zählen können. Aber sie weiß, heute muss sie alles geben, und sie gibt alles. Und als sie zum Abschluss Alicia Keys Fallin’ interpretiert, ist es stumm vor der Bühne. Es ist ihr Abend.
Unauffällig stellt sie sich nach ihrem Auftritt an die Theke, nimmt die eiskalte Cola, die ihr Marco, der Wirt, hingestellt hat. Sie trinkt einen großen Schluck. Wenn sie ihm auf der Bühne aufgefallen ist, wird er sie vielleicht ansprechen, hofft sie. Und ihr Wunsch geht in Erfüllung.
»Einen tollen Auftritt hast du da hingelegt. Kompliment. Ganz ehrlich, wenn man die Augen schließt, glaubt man, Alicia stehe höchstpersönlich auf der Bühne. Du warst, du bist einfach umwerfend. Eine Klasse für sich. Hättest du nicht Lust, mit meinen Freunden und mir noch irgendwo auf deinen Erfolg anzustoßen?«
Er hat sie gesehen, er hat sie gehört, und er ist begeistert. Seine Worte gehen ihr runter wie Öl. Er weiß, dass sie ihn erkannt hat. Und dann sind sie plötzlich in diesem Szeneclub, in den sie noch nie einen Fuß gesetzt hat. Noch nie hat sie nach einem Auftritt in einem solchen Ambiente gefeiert. Meist trinkt sie noch eine Cola oder ein Glas Prosecco mit Freunden, die zu ihrem Gig gekommen sind. Und wo hat sie seit ihren ersten Gehversuchen in der Musikszene im dörflichen Jugendzentrum nicht schon überall gesungen? In Kaufhäusern, bei Schützenfesten, bei der Eröffnung eines Autohauses, im Jahrmarktsfestzelt. Das war die kleine Welt gewesen. Und das hier ist die große Welt.
Hier gibt es keinen Prosecco, nur Champagner, und der steigt ihr schnell zu Kopf. Die Lautstärke im Club, das sich steigernde Stimmengewirr lassen ihre anfängliche Euphorie in eine zunehmende Beklemmung umschlagen. Sie hat die wie zufällig wirkenden Berührungen ihrer Brust, das Tätscheln ihres Hinterns, wenn sie aufsteht, durchaus bemerkt. Sie rückt ein Stück weg, lächelt weiter freundlich. Das gehört eben zu diesem Spiel. Die Typen versuchen es, aber sie ist nicht so eine. Das fünfte – oder war es das sechste? – Glas Champagner lehnt sie ab. Sie ist müde, Übelkeit und Kopfschmerzen plagen sie. Suchend sieht sie sich um. Sie kann ihn in der Menschenmenge nicht ausmachen. Ist er vielleicht schon gegangen? Aber er hat ihr versprochen, sich bei ihr zu melden. »Ich bring dich ganz groß raus, Mädchen.«
Sie ist nicht so naiv, dass sie solche Versprechen für bare Münze nimmt, aber vielleicht hat er es ja ernst gemeint.
»Eine Cola bitte«, sie winkt dem Barkeeper zu, »mit viel Eis.«
Warmer Atem streicht ihr über den Nacken, ein Typ versucht, ihr seine Zunge ins Ohr zu stecken. Unwillig schüttelt sie den Kopf und schaut sich hilfesuchend um. Alle sind mit irgendetwas beschäftigt. Es wird zu viel getrunken, zu laut gelacht, zu wild getanzt, Schweiß steht auf den Gesichtern der Menschen um sie herum. Sie trinkt ihr Glas Cola mit einem Zug leer.
»Bestellen Sie mir bitte ein Taxi?«, bittet sie den Mann hinter der Theke.
»Ach was. Du bleibst noch ein bisschen.« Der Atem stinkt nach Alkohol.
Sie macht sich von dem Arm los, der sich von hinten um ihre Hüfte legt.
»Lass das, hör auf. Ich möchte jetzt nach Hause.«
Ihr Mund fühlt sich an, als wäre er mit einem Fell ausgekleidet, das die Worte in sich aufsaugt und nur widerwillig über die Lippen lässt. Wo ist der Ausgang? Orientierungslos irren ihre Augen in die Richtung, wo sie ihn vermutet. Unsicher gleitet sie vom Barhocker, knickt in den Beinen ein, fällt fast zu Boden. Ein Arm packt sie, zieht sie hoch, schleift sie aus dem Lokal. Die klare Luft draußen schlägt ihr ins Gesicht. Eine Autotür wird geöffnet, und jemand schiebt sie in den Wagen, setzt sich neben sie. Ein Motor brummt, übertönt die zahlreichen Geräusche, die aus dem Club dringen.
Kapitel 3
Louise verließ als Letzte die Fähre. Die Autos rollten langsam über den Anleger ihren Zielen entgegen.
Tante Fines reetgedecktes kleines Haus gehörte zu Tammensiel, Verwaltungssitz des Amtes Pellworm und zugleich größte Ansiedlung auf der Insel, die aber immer noch zu klein war, um als Dorf bezeichnet zu werden. Louise hatte sich vor ihrem Aufbruch vom Elsass in den Norden Deutschlands die kurze Strecke eingeprägt, die sie ab dem Anleger fahren musste. Aussprechen konnte sie die Namen nicht – zuerst über den Ostersiel, das ging noch gerade eben, es folgte der Ütermarkermitteldeich, von dort zum Nordermitteldeich. Auf diesem ging es etwa achthundert Meter geradeaus, bis sie auf der rechten Seite Fines Zuhause erreichen würde.
Sie hatte die Messertasche wieder im Tankrucksack verstaut, den sie passend für ihre Tasche ausgewählt hatte. Das wenige Gepäck, das sie ansonsten dabeihatte, lag sicher in einem abschließbaren Topcase, der fest auf dem Kofferträger montiert war. Kurz überlegte Louise, ob sie den Motorradhelm nicht einfach samt Helmschloss an ihrem Bike hängen lassen sollte, um auf der kurzen Fahrt den nordischen Wind in ihren Haaren zu spüren. Die Polizei würde ja wohl nicht gleich die ankommenden Fahrzeuge kontrollieren, und sie ohne Kopfschutz erwischen. Doch sie ließ es sein, stülpte den Helm über ihre kurzen Locken und fuhr vorbildlich hinein nach Tammensiel.
Pellworm hätte sie nicht freundlicher begrüßen können. Wie überall an der Nordsee lagen Schön- und Schietwetter dicht beieinander. Der Himmel war nun von einem durchdringenden Blau, über das die Wolken, eher zarten Nebelschwaden gleich, von einem leichten Wind getrieben wurden. Louise schob das getönte Visier hoch und reduzierte ihr Tempo auf fast Schrittgeschwindigkeit. Sie wollte die ersten Eindrücke gleich mit allen Sinnen genießen und in sich aufnehmen. Schließlich sollte Pellworm für die nächsten Wochen und Monate ihr Zuhause werden. Bildete sie es sich ein, oder war das Gras auf den Wiesen und Deichen grüner als im Elsass oder entlang der Straßen, über die sie geglitten war? Oder war es der Kontrast zu dem hellen Fell der Schafe, die vereinzelt oder in kleinen Gruppen auf der Wiese standen – oder zum blauen Himmel, auf dem nun kaum noch ein Wölkchen zu erkennen war? Ein Auto mit einer jungen Familie überholte sie. Aber keine Faust ballte sich aus dem Fahrerfenster, weil sie wie eine Schnecke über die Fahrbahn kroch, sondern sie sah in entspannte, fröhliche Gesichter.
Louise kreuzte den Hafen, in dem drei Kutter lagen und folgte der Straße, von der bald links und rechts der Rungholtweg abging. Schlagartig wurde ihr klar, dass sie die Insel kaum kannte. Sie war als Kind in den Ferien hier gewesen und dann vor Jahren noch einmal für wenige Tage, in denen sie vor allem gefaulenzt und gelesen und sich einer Wattwanderung angeschlossen hatte. Doch jetzt wollte sie die Insel und ihre Geschichte erkunden, sich mit ihr bekannt und vertraut machen. Zum Beispiel mit der sagenumwobenen Stadt Rungholt, über die sie im kleinen Pellwormreiseführer gelesen hatte, den ihre Eltern ihr zum Abschied geschenkt hatten. Sie hatte ihn allerdings nur flüchtig durchgeblättert – denn wenn ihr jemand etwas über Pellworm und seine Vergangenheit erzählen konnte, war es Tante Fine, deren Familie seit mehr als fünf Generationen auf der Insel lebte.
Nach dem Rungholtweg folgte der Deichgrafenweg. Noch so ein Begriff, der prägend für dieses Land war. Storms Schimmelreiter war so ein Deichgraf gewesen, auch das hatte ihr Tante Fine einmal erzählt. Louise hatte die Novelle nie gelesen, aber sich fest vorgenommen, das nun auf Pellworm nachzuholen.
Entspannt lenkte Louise ihr Motorrad weiter. Hatte die Ruhe, die einer der unbezahlbaren Schätze dieser Insel war, bereits von ihr Besitz ergriffen? Nur noch wenige Minuten trennten sie von Fines Haus, als ihr Blick auf ein schlichtes Holzkreuz fiel, das rechts am Wegesrand stand. Ein Strauß mit bunten Blumen war am rechten Kreuzarm befestigt. Louise fragte sich, was hier wohl passiert war. Weit und breit waren weder ein Baum, ein Findling noch ein Graben zu sehen, durch die es zu einem tödlichen Unfall hätte kommen können. Oder war an dieser Stelle vielleicht jemand überfahren worden? Fast nicht zu glauben, bei dem geringen Verkehrsaufkommen, das auf der gut überschaubaren Straße herrschte. Ihr Bike glitt weiter, und da kam es schon in Sicht, ihr neues Zuhause, Tante Fines reetgedeckte Kate, die in einem Meer von Rosen verschwand wie das verwunschene Schloss Dornröschens.
Louise parkte ihr Motorrad zunächst an der Straße. Sie nahm den Helm ab und schüttelte den Kopf wie ein Pferd, das eine lästige Fliege loswerden will. Früher hatte sie so ihre durch den Helm zusammengepressten Locken auseinandergeschüttelt. Früher. Noch vor einer Woche.
»Phantomlocken«, murmelte sie vor sich hin und dachte an ihren schon lange verstorbenen Onkel Fred, dem man nach einem Unfall den Unterschenkel amputiert hatte. Wie oft hatte er sich daran kratzen wollen, obwohl dieser Körperteil nicht mehr da war. Louise hatte als Kind große Angst, aber auch eine gewisse Faszination empfunden, wenn Fred fluchend mit seiner Hand in der Luft herumfuchtelte, weil es so furchtbar juckte, und er nichts dagegen tun konnte.
Sie hängte den Helm an das Motorrad, packte ihre Messertasche aus und ging zwischen prächtig wuchernden dunkelroten Stockrosen den säuberlich geharkten Weg auf Fines Haus zu. Der obere, von einem dunkelgrünen Holzrahmen gefasste Teil der Klöntür war offen, eine Einladung an die, die vorbeikamen und auf einen Schnack aus waren, anzuhalten und mit Fine die neusten Nachrichten auszutauschen. Die weißen Kreuzstockfenster saßen wie glänzende Augen in den Mauern aus dunkelrotem Klinker, und es schien, als würde sich die Kate duldsam unter dem breiten Dach aus Reet ducken.
»Tante Fine?«
Nichts regte sich. Louise spähte durch den oberen geöffneten Teil der Haustür direkt in die Küche. Niemand zu sehen. Wahrscheinlich war Fine hinten in ihrem Gemüsegarten. Louise ging rechts am Haus vorbei. Es summte und brummte um sie herum. Bienen steuerten die Rosenblüten an der Hauswand und in den Beeten an und verließen sie mit gelb bestäubten Beinchen und Gesichtern. Neugierig hielt Louise inne und begutachtete die Rosen, die von rosa bis violett, von weiß bis gelb ihre Pracht entfalteten. Es waren ursprüngliche Rosen, die nur eine oder auch zwei Reihen mit Blütenblättern besaßen, sodass die kleinen Wesen ungehindert in das Innere der Blume gelangen konnten. Louise hatte die Pellwormer Rosentage um eine Woche verpasst, wie Fine ihr bedauernd gesagt hatte, als sie vor ein paar Tagen zuletzt miteinander telefoniert hatten. Pellworms Gärten waren dann für Besucher zugänglich, und alles drehte sich um die Rose. Dreihundertfünfzig Rosenstöcke wurden verlost, Rosenlikör und Rosenmarmelade wurden den zahlreichen Gästen, die sich an den unterschiedlichsten Farben und Düften erfreuen durften, angeboten.
An der Hausecke stand immer noch der riesige Holzbottich, in dem das Regenwasser aufgefangen wurde, daneben wartete eine grüne Plastikgießkanne auf ihren Einsatz. Louise konnte sich noch gut an den Vorgänger aus Zink erinnern, den sie, mit Wasser gefüllt, als Kind kaum hochheben konnte.
»Wollt ihr wohl da runter, ihr Taugenichtse!« Eine große getigerte Katze und eine junge graue sprangen von einem runden Holztisch, auf dem Fine gerade zwei Gedecke ablud. Ihr geliebtes gutes Porzellan mit Strohblumenmuster, blau und weiß, die Farben, die auch in ihrer Küche dominierten. Für jeden Tag gab es ebenfalls blau-weißes Geschirr aus Steingut, das Fine, wie auch das gute, von ihrer Mutter geerbt hatte. Das Sonntagsgeschirr stammte noch von Fines Großmutter, die eine betuchte Patin in Hamburg gehabt hatte, die ihr das Service für zwölf Personen zur Hochzeit in einer großen Holzkiste vor mehr als hundert Jahren hatte zukommen lassen. Seitdem wurde immer, wenn ein Teil kaputtgegangen war, dieses nachgekauft, denn das Strohblumendekor war zeitlos. Eine Vase mit einer wild bunten Blumenmischung zog Louises Blick auf sich, ihre Augen wanderten weiter zu einer Plastikhaube, unter der sich ganz sicher ein Streuselkuchen verbarg, der mit viel Liebe und noch mehr Butter gebacken worden war.
Louise stand einfach nur stumm da, unterdrückte Tränen der Rührung, genoss die anheimelnde Atmosphäre, die sie willkommen hieß. Liebevoll beobachtete sie jede Bewegung Fines, die konzentriert und voller selbstverständlicher Anmut waren. Hier rückte sie eine Tasse zurecht, da zupfte sie ein welkes Blütenblättchen aus dem Strauß. Wie lange hatte Louise sie nicht mehr gesehen, und doch erschien es ihr jetzt, wo sie angekommen war, als sei es erst gestern gewesen. Der dunkelblaue Rock, der die festen Waden Fines umspielte, die bequemen, derben Schuhe, die dicke selbst gestrickte Jacke aus beiger Schafwolle, die die Jahre überdauert hatte und sie auch noch überdauern würde. Eine Woge des Glücks durchströmte Louise.
Fine drehte sich um. Auch Figur und Gesicht sind Louise noch so vertraut. Sie war schlank und groß mit einem aufrechten Gang. Ihre blauen Augen blitzten in dem breiten Gesicht, das immer zu lächeln schien. Nur in Fines dunkelblonde Haare, die zu einem Zopf geflochten waren, der am Hinterkopf festgesteckt war, hatte sich üppiges Grau geschlichen.
»Mien groote Deern«, mit ausgebreiteten Armen kam Fine auf Louise zu, drückte sie an sich, schob sie wieder ein Stück von sich weg und musterte sie von oben bis unten.
»Nix mehr lütte Deern«, erwiderte Louise lachend. Viel mehr gab ihr plattdeutscher Sprachschatz auch nicht her. Die Lütte, die Kleine, das war sie gewesen. Und irgendwie war sie es noch immer, lütt, denn seit ihrem sechzehnten Lebensjahr hatte sich an ihrer Größe von knapp einhundertsechzig Zentimetern nichts mehr getan.
Fine wechselte ins Hochdeutsche. Auch wenn Louise zweisprachig aufgewachsen war, so dominierte durch ihr Leben und ihre Arbeit in Frankreich letztendlich die französische Sprache. Den Besonderheiten des Plattdeutschen war sie jedenfalls nicht, noch nicht, gewachsen.
»Zieh erst mal die dicke Jacke aus. Ist das heute nicht ein herrlicher Tag?«
Die beiden Frauen schauten gleichzeitig zum Himmel, über den wenige Wolken glitten. Ein lautes Schnattern lenkte ihren Blick auf eine große Gruppe von Nonnengänsen mit ihren eleganten schwarzen Hälsen und weißen Gesichtern. Sie waren jetzt am späten Nachmittag auf dem Weg von ihren Fressplätzen auf den grünen Weiden hinter den Deichen ins Binnenland, um dort zu übernachten. Louise schloss die Augen. Außer dem Geschrei der Vögel und dem satten Brummen der Bienen, die auch den hinteren Teil des Gartens nach Blüten absuchten, war nichts zu hören. Sie atmete tief ein, die würzige Seeluft belebte ihre Sinne, und plötzlich hatte sie einen Bärenhunger.
»Ich habe Streuselkuchen gebacken. Du liebst ihn doch immer noch?«
Louise lief das Wasser im Mund zusammen. »Ach Fine, ist das schön, hier bei dir zu sein! Und ich kann es gar nicht erwarten, das erste Stück zu verputzen.«
»Dann leg mal Jacke und die Tasche ab. Dein Gepäck ist übrigens gestern in zwei Kartons eingetroffen. Sie stehen schon oben in deinem Zimmer. Aber zuerst mal ein starker Kaffee. Immer noch ohne Zucker und Milch? Brrr.« Fine schüttelte sich. »Bitter ist ja gar nicht mein Ding. Aber egal. Und jetzt ab mit dir. Du willst dich sicher frisch machen. Du weißt ja noch, wo das Badezimmer ist. Ich hol den Kaffee. Und wenn du irgendwann Lust hast, erzählst du mir, was eigentlich passiert ist«, fügte sie sanft hinzu.
Das war Tante Fine. Bodenständig, richtraus und überaus praktisch veranlagt. Noch einmal drückte sie Louise fest an sich. Dann verschwand sie über die hintere Stube in die Küche.
Eine einzelne Nonnengans glitt über den Himmel. Sie musste sich beeilen, wenn sie sich noch ihrem Schwarm anschließen wollte, um das gemeinsame Nachtlager zu erreichen.
Kapitel 4
Zwei Wochen zuvor
Sie liebt es, am See zu sitzen und die sich fein kräuselnden Wellen zu beobachten, die von der leichten Brise an Land getrieben werden, einen Kiesel umspülen und ihm für einen Moment das Aussehen eines edlen Steins verleihen, bis der Wind und die Sonne ihn wieder trocknen, ihn zu dem machen was er ist, einen über die Jahrtausende rund gespülten einfachen Stein. Ihre Eltern können nicht verstehen, dass es sie immer wieder zurück an diesen Ort zieht. Hier hat ein Spaziergänger, das heißt, sein Hund, sie gefunden, mehr tot als lebendig. Doch sie erinnert sich an nichts. Dieser Ort birgt für sie keinen Schrecken, keine Angst, kein Erinnern.
Bis gestern. Bis gestern war die Erinnerung auf eine einzige Tatsache beschränkt gewesen.
Sie war zu ihrem Auftritt in der Buschtrommel gefahren. Das war’s. Mehr gab ihr Kopf nicht mehr her. Danach war alles wie ausradiert. Offenbar war sie hinterher in einem Club gewesen, in dem sie zu viel getrunken hatte. Als ihr übel geworden war, hatte sie um ein Taxi gebeten. Weder das Unternehmen noch der Fahrer hatten ausfindig gemacht werden können. Niemand hatte sie in ein Taxi einsteigen sehen. Die Polizei ging irgendwann davon aus, dass jemand sie in seinem Wagen mitgenommen hatte. Sie war vergewaltigt worden, und es gab keine Spuren. Weder von ihm oder ihnen, das ließ sich nicht genau sagen, noch Abwehrspuren von ihr. Tropfen, die sie willenlos gemacht haben könnten, waren nicht oder nicht mehr nachweisbar.
»Wenn es ein Zeug wie Liquid Ecstasy war, und man es Ihrer Tochter in einer nicht zu hohen Dosis verabreicht hat und das im Zusammenspiel mit sehr viel Alkohol, ist es nach ein paar Stunden weder im Blut noch im Urin, ja noch nicht einmal in den Haaren nachweisbar«, hatte ein Arzt bedauernd ihrer Mutter mitgeteilt, die sie überallhin begleitet hatte.
Kein Nachweis, kein Beweis. Die Polizei hatte ihr Fragen gestellt. Könnte sie mit einem Freund, einem Bekannten unterwegs gewesen sein? War es zu einvernehmlichem Verkehr gekommen? Waren leise Zweifel in den Stimmen zu hören gewesen? Irgendwann?
Sie konnte nur immer wieder wiederholen: ICHWEISSESNICHT!
Wie lange ist es jetzt her, dass man sie wie ein Stück Müll am Ufer hatte liegen lassen? Wie durch ein Wunder war sie nicht ertrunken. Der Hundespaziergänger hatte zuerst gedacht, sie wäre betrunken und schliefe ihren Rausch aus. Sie lag einfach da, komplett angezogen. Doch der Hund hatte nicht aufgegeben, hatte gewinselt und gefiept, während er um sie herumsprang. Er hatte gespürt, dass hier etwas unsagbar Schreckliches geschehen war. Und irgendwann hatte er sein Herrchen davon überzeugt, der dann einen Rettungswagen gerufen hatte.
Seitdem war fast ein Jahr vergangen. Ein Jahr, das in den ersten Wochen nur aus Schmerzen bestanden hatte, gefolgt aus Wochen voller Übelkeit, Grübeleien, Verzweiflung, neuem Kopfzerbrechen und schließlich Resignation. Ihr Gehirn wollte einfach nicht preisgeben, was in jener Nacht geschehen war.
Bis gestern.
Ihre Mutter hatte keine Ruhe gegeben, bis sie endlich ihr Zimmer verlassen hatte. Ihre Wohnhöhle.
»Chiara, du musst unter Leute. Du kannst dich nicht ewig einschließen, Schatz.«
Doch, sie konnte, und sie wollte. Ihr lag nichts mehr am Draußen, an anderen Menschen, am Bummeln, an Partys, an der Musik. Nur ihrer Mutter zuliebe hatte sie sich angezogen und mit ihr das Haus verlassen, war mit ihr in die Stadt gefahren, um sie, wie ihre Mutter vorgab, beim Kauf eines Sommerkleides zu beraten. Als ob sie das nicht vorher auch schon immer alleine gemacht hätte. Ein mehr als fadenscheiniger Vorwand. Doch sie war auf den Vorschlag eingegangen. Ihre Mutter hatte sie glücklich in die Arme genommen, voller Hoffnung, ihr Kind würde sich allmählich aus seinem dunklen Gedankengefängnis befreien.
Sie kamen gerade aus einer kleinen Boutique, die Chiara ihrer Mutter empfohlen hatte. Allerdings verließen sie das Geschäft mit leeren Händen, da sie keine Mode für ältere Herrschaften führten, wie die junge Verkäuferin ihnen kess mitteilte. Und da entdeckte sie ihn, einen Mann mit einer grünen Baseballkappe und Sonnenbrille, der vor einer Litfaßsäule stand, die über und über mit bunten Plakaten beklebt war. Sie hatte keine Ahnung, für welche Reklame oder welches Event sich der Mann interessierte. Es spielte auch keine Rolle. Genauso wenig, wer dieser Mann war. Ihr Blick blieb an dem größten Plakat hängen, das mittig an der Säule befestigt war. In riesigen Lettern wurde verkündet, dass er, Megastar, Liebling der Volksmusikfreunde im November in der zwölftausend Menschen fassenden Maximus-Arena mit seiner Show zu Gast sein würde. Das lachende Gesicht, die Zähne, die vom bunten Papier blitzten, als handele es sich um eine Werbung für Zahnpasta, das blonde Haar, das über der Stirn zu einer Tolle gedreht war und sich unter einer weißen Prinz-Heinrich-Mütze versteckte, die fröhlichen Sommersprossen, die jedem verrieten, was für ein bodenständiger und fröhlicher Kumpel er doch war. Das Foto dieser singenden Frohnatur, in Kombination mit einem ihr vollkommen Unbekannten, der eine Baseballkappe und eine Sonnenbrille trug, ließen in Chiaras Kopf Scherben vom Boden nach oben segeln, Bruchstücke, die sich wieder grob zueinanderfügten, als ob ein Film rückwärts abgespult wurde.
»Chiara, Schatz, was ist los? Warum schaust du so entgeistert?«
Ihre Mutter hatte sie vorsichtig am Arm gefasst, als sie nicht reagierte und wie paralysiert abwechselnd auf den Mann aus Fleisch und Blut und die zweidimensionale Ausgabe von Jeff Storm, Charmeur und Volksliedheld in Lederhosen und Ringelshirt, starrte. Eine Erinnerung war erwacht. Das Aufblitzen einer Ahnung, noch nicht wirklich greifbar. Doch eines war sicher, dieser Mann auf dem Plakat hatte irgendetwas mit der Nacht zu tun, in der Chiara Petermann aufgehört hatte zu existieren.
Kapitel 5
Louise erwachte von einem Geräusch, das ihr durch Mark und Bein ging. Ein klagender, blecherner Laut, der sich in schöner Regelmäßigkeit wiederholte, ein helles Ihhh, ein kehliges Ahhh. Das gab es doch nicht! War das der Schrei eines Esels? Und das in einer Lautstärke, als würde das Grautier direkt vor ihrer Schlafzimmertür stehen. Louise sprang aus dem Bett und riss die Tür auf. Wie albern, natürlich stand da kein Esel. Doch da war er wieder, der klagende Laut, diesmal in schneller Folge hintereinander. Und er kam direkt aus der Küche. Fine! Louise rannte die Treppe hinunter, schlitterte in die Küche und blieb abrupt stehen. Sie rieb sich die Augen. Keine Fine, aber ein kleiner Esel, der mitten in der Küche stand und sie aus vorwurfsvollen großen Augen anblickte. Auf dem Boden lag ein Körbchen, und Louise erinnerte sich daran, dass in diesem gestern noch ein paar Äpfel gelegen hatten. Der Esel musste sie wohl gefressen haben. Unglaublich. Und wie überhaupt war er in Fines Küche gelangt? Und wem gehörte das Langohr?
Louise schmunzelte. »Ein Esel, in Fines Küche, ein langohriger kleiner grauer Dieb. Aber süß bist du.«
Als habe er Louise verstanden, drehte er seine langen Ohren in ihre Richtung und machte auf seinen kleinen Hufen einen Schritt auf sie zu. Louise konnte nicht anders, sie kraulte seine Stirn und fuhr ihm über die weichen Nüstern.
»Sture, du kannst was erleben!«
Konnten Esel eine schuldbewusste Miene aufsetzen? Ja, sie konnten. Sture konnte es. Mit Gummistiefeln an den Füßen und einem rosa Halfter in der Hand polterte Fine in die Küche. »Das habe ich mir doch gedacht. Ausgebüxt von der Weide hinterm Haus. Der Kerl bekommt das Gatter auf, keine Ahnung wie, aber er kann’s.«
Louise lachte, bis ihr die Tränen kamen. Das Bild war wirklich zu köstlich. Der leere Korb, die wütende Fine, das kleine rosa, rosa! Halfter und Sture, der seinem Namen offensichtlich alle Ehre machte. Denn als Fine ihm das Halfter über den Kopf ziehen wollte, drehte er einfach um und spazierte aus der Küche. Wenn er jetzt noch auf den Fliesenboden äppelte … Louise wischte sich die Tränen aus den Augen, und nun musste auch Fine lachen. »Bringen wir ihn auf die Weide, komm.«
Das ließ sich Louise nicht zweimal sagen. Sture stand mittlerweile draußen und scharte mit seinem linken Vorderhuf vor einem Rosmarinbusch in der Erde herum.
»Lässt du das wohl bleiben. Husch, weiter, auf der Wiese ist genügend Futter für dich.«
Sture musste es einsehen. Gegen zwei Frauen kam er nicht an. Mit einem ergebenen Schnauben marschierte er los und kaum auf seiner Weide angelangt, senkte er den Kopf und fing an zu grasen. Fine verschloss das Gatter, prüfte noch einmal den Riegel und zuckte mit den Schultern. »Alles heil. Dieser kleine Teufel. Keine Ahnung, wie er das macht.«
Louise bekam einen erneuten Lachanfall. »Seit wann hast du Sture?«, prustete sie. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so herzhaft gelacht hatte.
»Er stand bei Harms. Für die Kinder der Feriengäste. Nur, dass Sture keine Lust hatte, die Kleinen durch die Gegend zu tragen. Wenn es ihm zu viel wurde, ist er einfach in die Knie gegangen und hat sich hingelegt. Das war natürlich für die Kinder zu gefährlich, und Harms wollte ihn wieder loswerden. Ich hatte schon immer eine Schwäche für Esel, und die Wiese hinterm Haus ist groß genug. Sture und ich, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Und ich bin auch schon auf der Suche nach einer Partnerin. So ein Eselchen sollte Gesellschaft auf vier Beinen haben.«
»Il est si drôle. Ich wollte schon immer mit einem Grautierchen wie einstmals Stevenson durch die Cevennen wandern. Jetzt werde ich, natürlich nur, wenn Sture Lust dazu hat, mit ihm über die Insel streifen.« Louise strahlte über das ganze Gesicht bei dieser Vorstellung.
»Apropos Lust. Ich hätte jetzt Lust auf ein ordentliches Frühstück. Du könntest bei Cornilsen Brötchen besorgen.«
Noch war es kühl, und eine leichte, frische Brise wehte über die Insel. Louise zog sich ein molliges Sweatshirt über und strampelte auf Fines Hollandrad los. Fahrradfahren war sie kaum noch gewohnt, und sie stellte schon nach wenigen Metern ein Ziehen in ihren Waden fest. Doch ihre Mutter hatte recht: Dinge wie Fahrradfahren verlernte man nicht. Den Himmel überzog in dieser Morgenstunde ein feiner Dunstschleier. Die Touristen schienen noch in ihren Unterkünften zu sein. Louise begegnete auf dem Radweg, der etwas tiefer lag als die Straße, lediglich einem alten Mann, der ihr entgegenradelte und dabei mit der Hand zum Gruß wedelte, was sein Rad gefährlich zum Schlingern brachte. Die frische Luft belebte ihre Sinne, und als sie in der Ferne den Leuchtturm entdeckte, der sich aus dem feinen Morgendunst, der aus den Weiden stieg, emporhob, machte ihr Herz einen Freudensprung. Sie fühlte sich mit einem Mal frei und stieß einen lauten Freudenschrei aus. Ein kleine Herde Schafe, von denen nur die wolligen Körper und die Köpfe zu sehen waren, die Beine waren im Morgennebel verschwunden, sahen erschrocken auf. Louise entschuldigte sich fröhlich bei ihnen und radelte weiter.
Bereits gestern war sie auf dem Weg zu Fine an dem Bäckerei-Café vorbeigekommen. Das große Gebäude aus rotem Klinker und mit einem breiten Krüppelwalmdach war nur dreihundert Meter vom Hafen in Tammensiel entfernt. Mit einem lauten Moin trat Louise in die Bäckerei und musste sogleich feststellen, dass den Inselbewohnern so leicht nichts entging.
»Moin, Sie sind das Patenkind von Fine, die Französin, stimmt’s?«, konstatierte eine Stimme hinter ihr.
Louise sah zuerst an sich herunter – wodurch war sie identifiziert worden? – und drehte sich dann um. Ein Mann, nicht alt, nicht jung, schätzungsweise Anfang bis Mitte vierzig, stand mit den Händen in den Hosentaschen da und grinste sie frech an.
»Stimmt. Und wenn Sie mir jetzt noch sagen, was mich verraten hat?«
»Ihre Kleidung. So etwas sieht man hier nicht alle Tage. Diese Raffinesse, mit der Sie das Oberteil und die Hose kombiniert haben – sehr elegant. Das macht eben den Unterschied aus.«
Noch einmal schaute Louise an sich herunter. Der Kerl war wohl nicht ganz dicht im Kopf. Die Hose war eine uralte Jogginghose, im Hintern zu weit, und mit engen Bündchen um die Knöchel. Ihr weißes Sweatshirt war einfach nur ein Sweatshirt. Noch nicht einmal mit irgendeinem Aufdruck, der auf ihre Nationalität hätte schließen lassen. Der wollte sie wohl auf den Arm nehmen, oder er war wirklich ein armer Irrer, vielleicht der Inseldepp. Indigniert sah sie wieder hoch. Der Typ, der zwei Kopf größer war als sie, brach in ein lautes Lachen aus, und Verkäuferinnen und Kunden drehten sich nach ihnen um.
»Das war nur ein Scherz. Aber wenn Sie am Wochenende mit mir essen gehen, verrate ich Ihnen, woher ich weiß, wer Sie sind«, flüsterte er nun, um dann laut einer Verkäuferin mit kurzen fuchsroten Haaren zuzurufen, der Feriengast von Haus Möwenhütte käme doch erst nächste Woche, wegen des Brötchenservice.
Die Verkäuferin nickte, tippte sich an den Kopf. »Ist notiert«.
Dann winkte er zum Abschied in die Kundenrunde und verließ das Geschäft.
Was war das denn gewesen?
»Sie wünschen?«
»Äh, vier Brötchen bitte.«
Die junge Verkäuferin schmunzelte. Louise wurde rot. Hatte sie was Falsches gesagt? Fine hatte ihr doch aufgetragen, Brötchen zu kaufen. Brötchen, petits pains. Oder gab es hier einen besonderen Ausdruck für Brötchen? Aber nein. Vier Brötchen wurden in eine Papiertüte gepackt und über die Theke gereicht. Louise zahlte. Gott sei Dank wurde in Deutschland und in Frankreich mit Euro gezahlt. Zumindest gab es damit keine Irritationen.
»Ihr Fahrrad hat Sie verraten. Jan wollte Sie ein wenig foppen, auf den Arm nehmen, verstehen Sie? Jeder hier kennt Fines Rad mit dem giftgrünen Rahmen und dem blauen Sattel mit den Punkten. Und Ihre Tante redet schon seit Tagen von dem Besuch ihres Patenkindes aus Frankreich. Jan hat einfach eins und eins zusammengezählt. Zählen kann er nämlich, der Jan. Er betreibt das Immobilienbüro und eine Ferienwohnungvermietung in Ostertilli. Wenn Sie also mal was Eigenes suchen …« Sie lachte fröhlich und kniff verschwörerisch ein Auge zu.
»Hilke, höör up to schnacken,« rief eine strenge Stimme durch die zur Backstube angrenzende Tür.
Hilke rollte mit den Augen, reichte Louise das Wechselgeld und wandte sich dem nächsten Kunden zu.
Zu Hause legte Louise die Brötchen in einen mit einer bunten Serviette ausgelegten kleinen Korb. Der Tisch war schon gedeckt, der aufgebrühte Kaffee verströmte sein Aroma in der gemütlichen Küche. Fine war nirgendwo zu sehen, und so suchte Louise aus dem Kühlschrank die restlichen Begleiter für ihr gemeinsames Frühstück zusammen. Butter, Käse und eine, wie das kleine Etikett auf dem Glas verriet, Quittenmarmelade aus dem Vorjahr.
Fine ließ weiterhin auf sich warten. Wo mochte sie denn stecken? Louise stromerte durch die Küche, öffnete neugierig die Schränke. Wenn man kochen wollte, die Betonung lag auf wenn, würde man hier schon das passende Equipment finden. Töpfe von guter Qualität in mehreren Größen, Schneidebretter, Siebe. Das Spülbecken aus Stein hatte sie schon als Kind fasziniert. Es war riesig mit einer gerillten Abtropffläche, wo so leicht nichts herunterrutschte. Daneben hing an der Wand ein altmodischer Handtuchhalter aus Kacheln, die wie ein Spiegel in einem Metallrahmen gefasst und an denen vier Haken angebracht waren. Ein ähnlicher Halter hing neben dem Herd, nur, dass sich an diesem oben eine kleine Stange befand, an der Schöpflöffel, eine Kelle und eine große Fleischgabel hingen. Auf dem schlichten Tellerschrank standen in drei Regalreihen übereinander die Tassen und Teller aus Steingut mit dem bekannten Strohblumendekor. Auf der Ablage des Schranks lag ein sorgfältig gebügeltes weißes Deckchen, in das jemand im Kreuzstich mit dunkelblauem Faden vor langer Zeit einen Spruch hineingestickt hatte.
Louise las laut vor: »Herr, hol dien Hand in See und Storm, Herr, schütz Pellworm.«
»Das habe ich zu meiner Konfirmation bekommen.«
Fine war in die Küche getreten, in der Hand zwei frische Eier, die sie aus dem Hühnergehege geholt hatte. »Das Schicksal liegt zwar nicht nur in Gottes Hand, sondern auch in den Händen der Deichbauer und zuletzt in unseren eigenen, aber es ist schon wichtig, dass wir uns jeden Tag bewusst machen, wie vergänglich doch alles ist. Unser Leben und letztendlich auch unsere Erde. Pellworm weiß ein Lied davon zu singen. Aber das ist ein anderes Thema, zu schwermütig für eine Tasse Kaffee am Morgen.«
Sie setzte Wasser für die Frühstückseier auf.
»Gestern warst du ja auf dem Sofa eingeschlafen und hast keinen Ton mehr von dir gegeben. Aber jetzt will ich wissen, was dich in die Flucht getrieben hat. Deine Mutter hat ja nichts erzählt. Ist es so schlimm?«
»Vielleicht nicht so schwermütig wie deine Inselgeschichten, aber für mich schon sehr schlimm.«
Louise schenkte zwei Becher Kaffee voll und nahm einen ersten heißen Schluck.
»Um es kurz zu machen, ich hatte ein Verhältnis mit einem geschiedenen Mann, seiner Ex hat das nicht gefallen, er hat mich verlassen, und sie hat versucht, meine Karriere zu ruinieren.« Sie schwieg und wartete ab, was Fine dazu zu sagen hatte.
»Nun, das ist schon eine seltsame Geschichte. Er war ungebunden, sagst du. Also, ich muss schon sagen, ich verstehe nicht so ganz. Welches Recht hat seine Exfrau, sich da überhaupt einzumischen? Und was für ein schwacher Charakter muss dieser Mann gewesen sein? Verlässt dich, nur weil seine Ehemalige was dagegen hatte?«, fragte Fine nach einem Moment des Nachdenkens mit ärgerlich gerunzelter Stirn.«
Louise pustete auf ihren Kaffee. Beim ersten Schluck hatte sie sich prompt die Oberlippe verbrannt.
»Er ist wieder zu ihr zurück. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ob ihm das aber gut bekommen wird, ist fraglich. Die Frau ist ein Biest. Sie wird es ihn ein Leben lang spüren lassen, dass er mit mir leben wollte. Allerdings ist er von ihr abhängig, finanziell, und auch beruflich. Auf diese Weise hat sie mir meine Beziehung zu ihrem Exmann schon heimgezahlt. Fine, ich bin beruflich am Ende.«
Louise traten Tränen in die Augen. Das musste endlich aufhören, diese ewige Heulerei. Das war doch nicht sie, Louise, die alles mit einem Lächeln hinnehmen konnte. Aber was zu viel war, war zu viel. Stockend erzählte sie, was in den letzten Wochen geschehen war und ihr bisheriges Leben so gnadenlos umgekrempelt hatte.
»Erzähl doch mal der Reihe nach«, forderte Fine sie geduldig auf.
Acht Monate war es her, als Thierry Worms das Restaurant La Grenouille d’Or in Soufflenheim betreten hatte. Wie Louise später erfuhr, ließ er sich vom Oberkellner ein Menu zusammenstellen, und der Sommelier beriet ihn mit den passenden Weinen. Louise erinnerte sich noch wie gestern daran, wie Vincent in die Küche kam und meinte, draußen säße Worms, der Restaurantkritiker, der mit einer wöchentlichen Kolumne und Restaurantkritik in der Wochenzeitung Bonjour Alsace entweder ein mehr oder weniger vernichtendes Urteil abgab, sich freundlich, aber verhalten äußerte, die Existenz eines Restaurants zerstörte oder aber ein Essen so lobte, dass sich das Restaurant in der Folgezeit nicht mehr vor Anfragen und Reservierungen retten konnte. In diesem letzten Fall folgte nicht selten irgendwann ein Gast, der ähnlich spezielle Wünsche äußerte wie Thierry Worms, der jedoch ein Abgesandter einer der führenden Gourmetbibeln war, die ihre Sterne oder Gabeln verteilten.
»Bei unserer ersten Begegnung hat Thierry als Vorspeise Quenelles de brochet, Hechtklößchen an einem reduzierten Weißweinschaum mit Safran, gewählt. Als er fertig gespeist hatte, wollte er den begnadeten Koch, der diese Kreation gezaubert hatte, sprechen. Das war ich. Wir haben uns am nächsten Vormittag zum Frühstück getroffen, drei Tage später sind wir in einem Hotelzimmer gelandet. Alors, was war dabei? Nichts, wir waren zwei ungebundene Menschen, die sich ineinander verliebt hatten. Wir haben uns getroffen, wann immer es unsere Zeit erlaubte. Ich war einfach nur glücklich. Dieser Mann, der mir begegnet war, und die Hoffnung, dem Grenouille d’Or würde bald der erste Stern verliehen. Und als die Nachricht der Auszeichnung dann kam, waren die Aufregung und die Freude natürlich groß. Das ganze Team hat mit Champagner gefeiert. Am nächsten Vormittag wollten Thierry und ich bei mir zu Hause auf den Erfolg anstoßen. Wir saßen also gemütlich bei einem Glas Veuve Macou, als es an der Tür klingelte. Ich öffnete nichts ahnend, und da stand sie in ihrem Kostüm von Chanel und dreifacher Perlenkette um den Hals. Sie ist einfach an mir vorbeistolziert, als wäre ich Luft. Hat keinen Ton gesagt, doch Thierry hat sie auch so verstanden. Er ist aufgestanden und hat mich verlassen. Und mir hat sie seitdem das Leben zur Hölle gemacht. Natürlich habe ich versucht, ihn zurückzugewinnen, aber das ist mir nicht gut bekommen.«
Fine goss noch einmal die Kaffeebecher voll.
»Aber, warum dieser Hass auf dich? Warum hat sie ihren geschiedenen Mann nicht einfach ziehen lassen? Und wie hat sie es fertiggebracht, dass du das Restaurant verlässt? Kann dein Chef denn einfach so auf dich verzichten? Er hat ja nicht nur dich verloren, sondern wahrscheinlich auch mit dir seinen Stern, oder?«