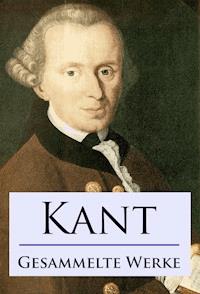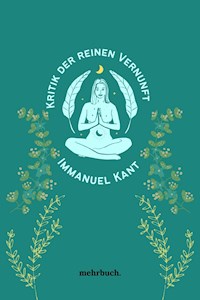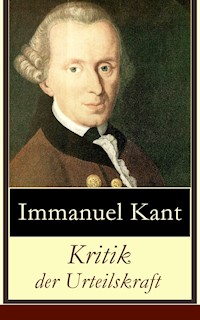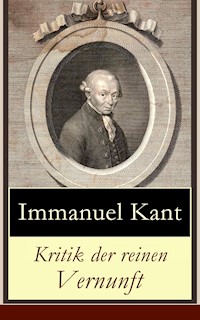Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Kritik der Urteilskraft (KdU) ist Immanuel Kants drittes Hauptwerk nach der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der praktischen Vernunft, erschienen 1790. Sie enthält in einem ersten Teil Kants Ästhetik (Lehre vom ästhetischen Urteil) und im zweiten Teil die Teleologie (Lehre von der Auslegung der Natur mittels Zweckkategorien). (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kritik der Urteilskraft
Immanuel Kant
Inhalt:
Immanuel Kant – Biografie und Bibliografie
Kritik der Urteilskraft
Vorrede zur ersten Auflage, 1790
Einleitung
I. Von der Einteilung der Philosophie
II. Vom Gebiete der Philosophie überhaupt
III. Von der Kritik der Urteilskraft, als einem Verbindungsmittel der zwei Teile der Philosophie zu einem Ganzen
IV. Von der Urteilskraft, als einem a priori gesetzgebenden Vermögen
V. Das Prinzip der formalen Zweckmäßigkeit der Natur ist ein transzendentales Prinzip der Urteilskraft
VI. Von der Verbindung des Gefühls der Lust mit dem Begriffe der Zweckmäßigkeit der Natur
VII. Von der ästhetischen Vorstellung der Zweckmäßigkeit der Natur
VIII. Von der logischen Vorstellung der Zweckmäßigkeit der Natur
IX. Von der Verknüpfung der Gesetzgebungen des Verstandes und der Vernunft durch die Urteilskraft
Der Kritik der Urteilskraft erster Teil
Kritik der ästhetischen Urteilskraft
Erster Abschnitt. Analytik der ästhetischen Urteilskraft
Zweiter Abschnitt. Die Dialektik der ästhetischen Urteilskraft
Der Kritik der Urteilskraft zweiter Teil.
Kritik der teleologischen Urteilskraft
Erste Abteilung. Analytik der teleologischen Urteilskraft
Zweite Abteilung. Dialektik der teleologischen Urteilskraft
Anhang.
Methodenlehre der teleologischen Urteilskraft
Fußnoten
Kritik der Urteilskraft, Immanuel Kant
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849614898
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Immanuel Kant – Biografie und Bibliografie
Der einflussreichste Philosoph neuerer Zeit, geb. 22. April 1724 zu Königsberg i. Pr., gest. daselbst 12. Febr. 1804, Sohn eines Sattlermeisters, dessen Familie einer Tradition zufolge aus Schottland stammte, erhielt eine streng religiöse Erziehung und studierte seit 1740 an der Universität seiner Vaterstadt und zwar mit besonderem Eifer Mathematik (unter dem Wolffianer Knutzen), Physik und Philosophie. Die Frucht der Beschäftigung mit den beiden ersten Wissenschaften war Kants Erstlingsschrift »Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte« (Königsb. 1747). Nachdem er neun Jahre als Hauslehrer tätig gewesen war, erwarb er 1755 durch eine Dissertation: »De igne«, die Doktorwürde und in demselben Jahre durch die Verteidigung seiner Abhandlung »Principiorum primorum cognitionis metaphysicae novae dilucidatio« die Venia legendi. In seiner »Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels« (Königsb 1755) antizipierte er in gewisser Weise die spätere Laplacesche Theorie von der Entstehung unsers Sonnensystems und versuchte die mechanische Theorie mit der teleologischen zu vereinigen. Sein philosophischer Standpunkt war in dieser ersten Periode noch der Wolffsche, bald lernte er aber englische Philosophen, insbes. Hutcheson und wohl auch Hume genauer kennen, so dass er sich zum Empirismus und Skeptizismus hinneigte und seine zweite Periode geradezu die empiristisch-skeptische genannt werden kann. Diesem Zeitraum gehören an die Schriften: »Der einzige mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes« (1765), die von Burke beeinflussten »Betrachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen« (1764), die »Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik« (1762) und besonders seine Preisschrift für die Berliner Akademie der Wissenschaften: »Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral« (1763). Erst nachdem er 15 Jahre lang Privatdozent gewesen war und Rufe nach Erlangen und Jena aus Liebe zur Heimat ausgeschlagen hatte, ward ihm 1770 die ordentliche Professur der Logik und Metaphysik zuteil, die er mit der Verteidigung der Dissertation »De mundi visibilis atque intelligibilis forma et principiis« eröffnete. In ihr waren schon die Grundgedanken der transzendentalen Ästhetik, z. T. auch die der transzendentalen Analytik enthalten und damit ein Teil der »Kritik der reinen Vernunft«, aber er neigt mit seiner Lehre vom mundus intelligibilis der alten Metaphysik wieder mehr zu als in den »Träumen eines Geistersehers«. Danach kann diese wichtige Schrift als Übergang zu seiner dritten Periode betrachtet werden. Es dauerte aber noch mehr als zehn Jahre, ehe sein lange überlegtes, zuletzt in vier Monaten ausgearbeitetes und zum Druck fertiggestelltes Hauptwerk. »Die Kritik der reinen Vernunft« (1781,2. veränderte Aufl. 1787), aus Tageslicht trat, dem in kurzen Zwischenräumen die übrigen Hauptwerke: 1783 die »Prolegomena zu einer künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können«, 1785 die »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten«, 1786 die »Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaften«, 1788 die »Kritik der praktischen Vernunft«, 1790 die »Kritik der Urteilskraft«, 1793 die »Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft«, 1797 die »Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre« und die »der Tugendlehre«, 1798 »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«, nachfolgten. Kleinere Abhandlungen waren: »Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht«, »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« (beide 1784); die Aufsehen erregende Rezension von Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« von 1785, die Herder übel aufnahm; »Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte«; »Was heißt sich im Denken orientieren?«; »Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie« (1788); »Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee« (1791); »Über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolff« (aus demselben Jahr); »Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis« (1793); »Das Ende aller Dinge«, »Über Philosophie überhaupt« (beide von 1794); »Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf« (1795); »Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie« (1796); »Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen«, in der K. als strenger Wahrheitsfreund die Notlüge unbedingt verwirft, »Der Streit der Fakultäten«, worin die (in vielen Sonderdrucken, z. B. von Hufeland herausgegebene) Abhandlung enthalten ist: »Von der Macht des Gemüts, durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein« (sämtlich 1798). Aus einem in Kants Nachlass vorgefundenen Manuskript: »Vom Übergang von der Metaphysik zur Physik«, haben neuerlich Reicke und A. Krause Bruchstücke veröffentlicht. Kants Briefwechsel bietet viel zur Kenntnis seines Lebens und Charakters sowie seiner Lehre. Zu berücksichtigen sind auch Vorlesungen Kants, die zum Teil während seines Lebens, z. B. die Logik von Jäsche (Königsb. 1800), zum Teil lange nach seinem Tode, nämlich die Vorlesungen über die philosophische Religionslehre (aus dem Winter 1783/84) von Pölitz (Leipz. 1817, 2. Aufl. 1830), ferner die über Metaphysik (zum Teil aus dem Ende der 1770er Jahre, zum Teil wahrscheinlich aus dem Winter 1790/91) von Pölitz (Erf. 1821) herausgegeben wurden. Vgl. zu letzteren Heinze, Vorlesungen Kants über Metaphysik aus drei Semestern (Leipz. 1894).
Kants System erregte bald nach dem Erscheinen der ersten Hauptwerke in allen Teilen Deutschlands sowie im Ausland das größte Aufsehen. In seinem Vaterland Preußen witterte man aber unter der Regierung Friedrich Wilhelms II., als der freisinnige Minister v. Zedlitz durch den vormaligen Prediger Wöllner (1788), den Urheber des Religionsedikts, ersetzt worden war, in K. einen gefährlichen Neuerer. Nach der Herausgabe seiner »Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« erschien 1794 eine Kabinettsorder, die deren Verfasser wegen »Entstellung und Herabwürdigung des Christentums« einen Verweis erteilte und allen theologischen und philosophischen Dozenten der Königsberger Universität untersagte, über jenes Werk Vorlesungen zu halten. In einem Verantwortungsschreiben erklärte K., sich aller öffentlichen Vorträge über Religion auf dem Katheder und in Schriften enthalten zu wollen. Nach dem Tode Friedrich Wilhelms II., dem er dies Versprechen gegeben, glaubte er sich wieder berechtigt zu Äußerungen über Religion. Wie seine Schriften von einem weiten Umfang seiner Studien zeugen, war auch der Kreis seiner Vorlesungen, in denen er die Zuhörer zum Selbstdenken anregen wollte, ein sehr weiter: er las außer über die philosophischen Disziplinen, von denen er die Logik und die Metaphysik bevorzugte, auch über Mathematik, Physik, Mineralogie, physische Geographie, Anthropologie und Pädagogik. K. war von Person klein, kaum 5 Fuß groß, von schwachem Knochenbau und noch schwächerer Muskelkraft; seine Brust war sehr flach und fast eingebogen, der rechte Schulterknochen hinterwärts etwas verrenkt, womit der Befund bei der 1880 erfolgten Ausgrabung übereinstimmt (vgl. Bessel-Hagen, Die Grabstätte Kants, Königsb. 1881). Mit mehreren angesehenen Männern stand er in inniger und langjähriger Freundschaft. Den öffentlichen Gottesdienst hielt er, wie das Äußere der Religion überhaupt, für ein höchst wichtiges, dem Denker aber entbehrliches Staatsinstitut. Zum kunstgerechten Redner war er nicht gemacht; in sozialer und politischer Hinsicht war er ein entschiedener Vertreter der Freiheit, unterwarf sich jedoch in der politischen Ordnung den Befehlen der Obrigkeit, selbst gegen seine bessere Überzeugung. In seinem Hauswesen herrschte neben solider Einfachheit die größte Ordnung. Der Geselligkeit war er nicht abgeneigt. Unverheiratet, liebte er es, bei Tische einige Freunde bei sich zu haben. Sein Leben war das strengster Pflichterfüllung und Regelmäßigkeit. Die Berliner Akademie der Wissenschaften ernannte ihn 1763 zu ihrem Mitglied, die Petersburger 1794. Am 18. Okt. 1864 ward in Königsberg sein Standbild, das letzte Werk Rauchs, errichtet. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Philosophen I«.
Gesamtausgaben seiner Werke sind die von G. Hartenstein (Leipz. 1838–39, 10 Bde.), von K. Rosenkranz und F. W. Schubert (das. 1838–40, 12 Bde.), eine zweite »in chronologischer Folge« von G. Hartenstein (das. 1867–69, 8 Bde.) und die von Kirchmann (in der »Philosophischen Bibliothek«, Berl. 1868–1873, 8 Bde. und Supplement, mit Erläuterungen). Seit 1900 erscheint in Berlin eine neue Gesamtausgabe: »Kants gesammelte Schriften«, herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Sie soll vier Abteilungen umfassen: die Werke, den Briefwechsel (besorgt von Reicke), den handschriftlichen Nachlass (durch E. Adickes) und die Vorlesungen (durch M. Heinze). Bis jetzt sind 6 Bände erschienen, darunter der »Briefwechsel« (Bd. 10–12,1900–02). Eine sehr brauchbare kritische Ausgabe der Hauptschriften besorgte Kehrbach (in Reclams Universal-Bibliothek). Auch sind mehrere Schriften Kants ins Lateinische, Französische (von Tissot, Barni, neuerdings von Andler u. Chavannes, Picavet, Lemonnier, Thamin) und ins Englische (von Hayward, Abbott, Max Müller, Mahaffy, Morris, Bernard, Watson, M. Campbell Smith u. a.) übersetzt worden.
Kants Philosophie.
K. ging bei seinen philosophischen Untersuchungen der späteren, d. h. der kritischen Zeit aus von der Scheidung der Vermögen der menschlichen Seele (»des Gemüts«) in Erkenntnis-, Begehrungs- und Gefühlsvermögen. Hiermit hängt zusammen, dass er in Anlehnung an die Engländer dem Subjekt vornehmlich die Aufmerksamkeit zuwandte und dieses nach dem in ihm Gegebenen zu analysieren suchte, indem sich seine Philosophie nach den drei angegebenen Vermögen gliederte. Seine Absicht war, ein »Inventarium« dessen zu liefern, was jederzeit und von jedermann, also mit Allgemeinheit und Notwendigkeit (theoretisch) erkannt, (praktisch) gewollt und (ästhetisch) wohlgefällig oder missfällig empfunden wird.
1) Kritik der reinen (theoretischen) Vernunft. K. selbst bezeichnete seine Philosophie als Kritizismus oder Kritik und setzte sie einerseits der Wolffschen, die er Dogmatismus, anderseits der Humeschen, die er Skeptizismus nannte, entgegen. Im Gegensatz zu jenem, welcher der menschlichen Vernunft die Fähigkeit, jenseits der sinnlichen Erfahrung gelegene Gegenstände zu erkennen, zusprach, ohne die Erkenntniskraft geprüft zu haben, und im Gegensatz zu diesem, der ebenfalls ohne Prüfung der menschlichen Erkenntniskraft alle über den Erfahrungskreis hinausgehende Erkenntnis leugnete, untersuchte K. vor allen Dingen Umfang, Grenzen und Ursprung der menschlichen Erkenntnis, und indem er unter reiner Vernunft die von aller Erfahrung unabhängige Vernunft versteht, ist ihm Kritik der reinen Vernunft eine Prüfung, wie weit die menschliche Vernunft ohne alle Erfahrung in der Erkenntnis kommt, ist sie eine Kritik des Rationalismus, wie dieser namentlich von Wolff vertreten war. Zeigt sich, dass unser Erkenntnisvermögen auf solche Gegenstände, die jenseits der sinnlichen Wahrnehmbarkeit liegen, gar nicht angelegt ist, so wäre es eitler Wahn, von ihm eine Erkenntnis solcher zu erwarten. Gerade diejenigen Objekte der Erkenntnis, die nach Wolff zum wesentlichen Inhalt der theoretischen Philosophie (Metaphysik) gehören, nämlich: Seele, Welt und Gott, die Gegenstände der rationalen Psychologie, Kosmologie und Theologie, wurden infolge der Kantschen Kritik der Vernunft transzendent, d. h. fielen über die Grenze reiner Vernunfterkenntnis hinaus. Und zwar aus folgendem Grunde: Da alles Erkennen im Urteilen besteht, so hängt die Möglichkeit des ersteren notwendig von der Beschaffenheit des letzteren ab. Nun ist aber jedes Urteil entweder von der Art, dass das Prädikat im Subjekt schon ganz oder teilweise enthalten (ganze oder teilweise Wiederholung des Subjekts) ist, oder derart, dass das Gegenteil der Fall ist, das Prädikat zum Subjekt etwas Neues hinzubringt. Urteile ersterer Art nennt K. (wie vor ihm schon Hume) analytische, letzterer Art synthetische, jene auch bloße Erläuterungs-, diese dagegen Erweiterungsurteile. Erstere sind zwar richtig, aber nicht von Bedeutung, da sie die Erkenntnis nicht erweitern, letztere dagegen, da auf ihnen aller Fortschritt im Wissen beruht, höchst wichtig, aber, wenn nicht bekräftigende Umstände hinzutreten, von zweifelhafter Richtigkeit. Da in ihnen das Prädikat zum Subjekt hinzukommt, ohne in diesem enthalten zu sein, so muss irgend ein äußeres Zeugnis gegeben sein, dass dem Subjekt dieses Prädikat auch wirklich angehört. Ein solches liegt, wo der Gegenstand ein sinnlich wahrnehmbarer ist, in der sinnlichen Anschauung, die Subjekt und Prädikat verbunden zeigt: »die Rose ist rot«. Solche synthetische Urteile nennt K. a posteriori, weil sie durch eine sinnliche Anschauung bekräftigt sind. Wo dagegen der Gegenstand kein sinnlich wahrnehmbarer ist, da ist keine Überzeugung durch Augenschein möglich, und solche Urteile, die K. synthetische a priori nennt, bleiben notwendig ungewiss. Dies sind aber solche, durch die sich das Wissen aus reiner Vernunft erweitert, so dass die Hauptfrage bei der Kritik der reinen Vernunft lautet: »Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?«, die sich wieder in die drei besonderen gliedert: 1) Wie ist reine Mathematik möglich? 2) Wie ist reine Naturwissenschaft möglich? 3) Wie ist Metaphysik überhaupt möglich? Die beiden ersten Fragen setzen voraus, dass es reine Mathematik und reine Naturwissenschaft gibt, dass also Wissenschaften ohne alle Erfahrung zustande kommen. Bei der Metaphysik, die sich allerdings auch aus reiner Vernunft aufbauen soll, muss es noch zweifelhaft bleiben, ob sie eine Wissenschaft sei. Als selbstverständlich, also ohne Beweis, wird von K. angenommen, dass strenge Notwendigkeit und Allgemeinheit sich nie aus Erfahrung, sondern nur unabhängig von aller Erfahrung, aus der menschlichen Seele oder dem Bewusstsein überhaupt gewinnen lasse, dass alle aus der Erfahrung geschöpften Urteile nur komparative (induktive) Allgemeinheit besitzen könnten. Freilich fängt nach K., der hierin mit den Empiristen übereinstimmt, alle unsre Erkenntnis mit der Erfahrung an, damit sei aber noch nicht gesagt, dass sie auch nur aus der Erfahrung entspringe. denn es könnte wohl möglich sein, dass unsre Erfahrungserkenntnis zusammengesetzt sei »aus dem, was wir durch Eindrücke empfangen, und aus dem, was unser eignes Erkenntnisvermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß veranlasst) aus sich selbst hergibt«, welchen Zusatz aus jenem Grundstoff zu unterscheiden freilich nicht leicht sei. So wird mit jenen erwähnten drei Fragen die nach den Bestandteilen der Erfahrung oder eine Theorie der Erfahrung in Verbindung gebracht. Die auf die Entdeckung des von aller Erfahrung unabhängigen, aber zugleich aller Erfahrung zugrunde liegenden (apriorischen) Elements gerichtete Untersuchung nennt K. transzendental, und insofern seine Kritik sich mit solcher beschäftigt, nennt er sie auch Transzendentalphilosophie oder transzendentalen Idealismus. Da dies apriorische Element von aller Erfahrung unabhängig ist, so wird es von dem erfahrenden Subjekt (und zwar von jedem Individuum der Menschheit auf gleiche Weise) zu dem von den äußern Eindrücken abhängigen Element der Erfahrung hinzu gebracht, so dass jenes den sich gleichbleibenden, dieses dagegen den veränderlichen Faktor der Erfahrung ausmacht, die dann das Produkt beider ist. Jenen, den apriorischen Faktor, nennt K. die Form, diesen, den aposteriorischen Faktor, der einem uns nur durch seine in uns hervorgebrachten Wirkungen, die Sinnesempfindungen, bekannt werdenden, jenseits des Subjekts liegenden Dinge, dem Ding an sich, entstammt, die Materie aller Erfahrung. Erstere, weil dem Subjekt angehörig, macht das idealistische, im weitern Sinne rationalistische, letztere, weil auf ein von dem Subjekt verschiedenes Ding bezogen, das realistische Element von Kants Philosophie aus. An diese beiden Elemente haben nachher die entgegengesetzten Richtungen der Nachfolger Kants angeknüpft, an das idealistische: Fichte, Schelling, Hegel, an das realistische: Herbart, Schopenhauer. Um die apriorischen Elemente des Erkenntnisvermögens aufzudecken, werden in der »Kritik der reinen Vernunft« die drei Teile des Erkenntnisvermögens, Sinn, Verstand, Vernunft, nacheinander vorgenommen und auf die apriorischen Bestandteile, die in denselben enthalten sein mögen, geprüft.
Da zeigt es sich, dass als sogen. reine oder apriorische Anschauungsformen des Sinnes oder der Sinnlichkeit die des Raumes und der Zeit, des Nebeneinander und des Nacheinander, anzunehmen sind. Durch sie werden vom wahrnehmenden Subjekt räumliche und zeitliche Anordnung in das Chaos sinnlicher Empfindungen »hineingeschaut« und dieses dadurch in eine Welt räumlich und zeitlich verbundener und geschiedener Erscheinungen verwandelt. Letztere machen daher das eigentliche Objekt des Sinnes aus, und durch sie wird dem sonst ganz leeren Verstand Stoff zu weiterer Verarbeitung geliefert. Dieses sinnliche Anschauen macht auch zugleich sinnliche Erkenntnis durch synthetisch-aposteriorische Urteile möglich, indem es die zur Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt nötige sinnliche Anschauung liefert. Das reine Anschauen dagegen ist dasjenige, das mathematische Erkenntnis durch synthetisch-apriorische Urteile möglich macht, indem es die zur Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt nötige Anschauung liefert, die hier, wo es sich um nichtsinnenfällige Objekte handelt, keine sinnliche sein darf. Demjenigen Abschnitt der Kritik, in dem es sich um die Entdeckung der apriorischen Elemente der Sinnlichkeit (Raum und Zeit) handelt, hat K. deshalb den Namen: transzendentale Ästhetik (Wahrnehmungslehre) gegeben. Und hiermit ist die Frage beantwortet, wie reine Mathematik möglich sei, nämlich nur unter der Voraussetzung der reinen Anschauungsformen von Raum und Zeit. Die nächste Folge aus dieser von K. behaupteten »Idealität« von Raum und Zeit ist die, dass beide auf das, was unabhängig von ihnen ist, das Ding an sich, keine Anwendung finden können, dieses also gar nichts mit Raum und Zeit zu tun hat. Unsre gesamte Erkenntnis bleibt auf die Erscheinungswelt (phaenomenon im Gegensatz zur »intelligibeln«, noumenon, unter der das Ding an sich verstanden wird) beschränkt. Wie Raum und Zeit die apriorischen Formen des Sinnes, so stellen zwölf ursprüngliche Urteilsformen die apriorischen Funktionen des Verstandes und drei ursprüngliche Schlußformen diejenigen der (theoretischen) Vernunft dar. Wie durch Raum und Zeit die unverbundenen Sinnesempfindungen zu Anschauungen, so werden durch die verschiedenen Verstandesfunktionen die unverbundenen Sinnesvorstellungen in ebenso vielfacher Weise zu Begriffen und durch die verschiedenen Schlußfunktionen die unverbundenen Verstandesbegriffe in ebenso vielfacher Weise zur Einheit, zu Ideen zusammengefasst. Jeder der zwölf apriorischen Verstandesfunktionen, der Urteilsformen, entspricht ein reiner Verstandesbegriff (Stammbegriff, Kategorie), jeder der drei apriorischen Vernunftfunktionen eine reine Vernunftidee. Wie Raum und Zeit apriorisch sind, so auch die Kategorien, nämlich: Allheit, Vielheit, Einheit, die der Quantität, Realität, Negation, Limitation, die der Qualität, Substanz und Inhärenz, Kausalität, Wechselwirkung, die der Relation, Wirklichkeit, Möglichkeit, Notwendigkeit, die der Modalität unterstehen. Ebenso apriorisch sind die Ideen: die der Seele, die der kategorischen, der Welt, die der hypothetischen, der Gottheit, die der disjunktiven Schlußform entsprechen. Die Deduktion der Kategorien als apriorischer Verstandes- und die der Ideen als apriorischer Vernunftfunktionen bildet zusammen die transzendentale Logik, die wieder in die transzendentale Analytik (Verstandes-) und transzendentale Dialektik (Vernunftlehre) zerfällt. Aus den Kategorien leiten sich wieder Grundsätze des reinen Verstandes ab, d. h. die Regeln des objektiven Gebrauchs der Kategorien; ein solcher Grundsatz ist z. B.: Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetz der Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Diese Grundsätze liegen aller Erfahrungskenntnis zugrunde, bilden eine reine Wissenschaft, so dass hiermit die zweite Frage erledigt ist, wie reine Naturwissenschaft möglich sei. Zugleich sind nun die Elemente der Erfahrung angegeben: die reinen Anschauungsformen, die reinen Verstandesformen und die Materie, die in die Anschauungsformen kommt, damit eine Anschauung daraus wird, d. h. die Empfindung, die, als auf Affektion beruhend, »ein Ding an sich« voraussetzen lässt, über dessen Qualität wir freilich gar nichts aussagen können, weder dass es eins, noch dass es vieles, weder dass es Substanz, noch dass es Ursache sei (wenn letztere ihm abgesprochen wird, so liegt allerdings ein Widerspruch vor zu der Notwendigkeit, dass es affiziert). Zugleich finden aber die Erkenntnisformen nur Anwendung auf die Erscheinungsobjekte, nicht auf Transzendentes. Auf solches sie aber doch zu beziehen, wird der Mensch durch seine ganze Anlage genötigt, so dass Metaphysik nicht nur möglich, sondern wirklich ist, und hiermit die dritte oben erwähnte Frage beantwortet ist. Freilich kommen hierbei nur Sophistikationen der Vernunft zustande, da den Ideen nur regulative, nicht konstitutive Bedeutung zukommt. Der Schluss von der Idee der Seele auf deren Existenz ist ein »zwar unvermeidlicher«, aber nichtsdestoweniger ein Fehlschluss (»Paralogismus der reinen Vernunft«). Der Versuch, der Idee der Welt Realität beizulegen, führt unter jedem der vier möglichen Hauptgesichtspunkte auf eine Antinomie, d. h. auf ein Paar einander ausschließender Gegensätze, von denen jeder sich mit gleich guten Gründen bejahen und verneinen lässt, z. B.: die Welt hat einen Anfang in der Zeit und Grenzen im Raum, und: sie hat beides nicht. Die für die Realität der Gottesidee möglichen oder doch wenigstens bisher versuchten Beweise: der ontologische, kosmologische und physiko-teleologische, sind sämtlich irrig. Dieses Ergebnis der »Kritik der reinen Vernunft«, das von der gesamten Welt außer uns, von der absoluten, nur das raum- und zeitlose Ding an sich und auch dieses nur nach seiner Existenz, nicht nach seiner uns gänzlich unbekannt bleibenden Qualität übriglässt, ist es, das K. bei seinen Zeitgenossen den Beinamen des »Alleszermalmers« verschafft hat. Hiermit ist die alte dogmatische Metaphysik, wiewohl sie ihren Grund in der menschlichen Anlage hat, gestürzt, und als Wissenschaft hat nur die kritische Metaphysik, d. h. die Kritik, Geltung.
2) Kritik der (reinen) praktischen Vernunft. K. hatte so die wichtigsten Gegenstände unsrer ganzen Forschung dem Streite der Meinungen auf dem Gebiete der Erkenntnis enthoben, er musste das Wissen aufheben, um für den Glauben Platz zu machen, den er für wichtiger hielt als das Wissen, und dem er hiernach einen hervorragenden Platz in seiner Philosophie einräumte. Er gewann ihn seiner Ansicht nach mit Sicherheit auf dem Gebiete der praktischen Vernunft, von dem auch die Gegenstände der natürlichen Religion abhängig sind. Wie die Kritik der reinen Vernunft auf die Entdeckung des a priori im Erkenntnis-, so geht die der praktischen auf die Auffindung des a priori im Begehrungsvermögen aus. Wie ohne Allgemeinheit und Notwendigkeit kein wirkliches Wissen, so ist ohne Allgemeingültigkeit kein wirklich tugendhaft zu nennendes Wollen möglich. Das Wollen, das als gut anerkannt werden soll, muss daher von der Beschaffenheit sein, dass es ohne Widerspruch allgemein werden könnte. Daraus erhellt, dass die Luft oder der eigne Vorteil niemals als Prinzip einer Sittenlehre gelten kann, weil sowohl jene als dieser nur individuelle Geltung besitzen. Wie nicht der Inhalt, sondern die Form Allgemeinheit und Notwendigkeit auf dem Gebiete des Wissens möglich macht, so entscheidet nicht der Inhalt, sondern die Form (die Allgemeingültigkeit der Maxime) des Wollens, ob es als solches gut sei. Das sittliche Wollen schließt jedes andre Motiv als die erkannte Pflichtmäßigkeit aus; der kategorische Imperativ, wie K. die Forderung des Sittengesetzes bezeichnete, ist unbedingt, ein Sollen, das von jeder Rücksicht auf Sein oder Seinkönnen unabhängig ist. Er lautet: »Handle so, dass die Maxime (der subjektive Grundsatz) deines Willens zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne«.
Durch die Reinheit der sittlichen Triebfedern dem materiellen Eudämonismus und Hedonismus gegenüber hat K. erhebend und läuternd auf seine Zeitgenossen und die späteren Geschlechter gewirkt. Seine Abneigung gegen die Glückseligkeit als Beweggrund der Sittlichkeit war so groß, dass selbst Schiller fand, Kants Rigorismus »schrecke die Grazien zurück«. Geschieht eine Handlung zwar dem Gesetz gemäß, aber nicht rein um des Gesetzes willen, so ist bloße Legalität, nicht Moralität vorhanden. Als höchstes Gut, nach dem der Mensch strebt oder streben soll, ist freilich die Verbindung von Tugend und Glückseligkeit zu betrachten, womit dem Eudämonismus doch ein gewisses Recht eingeräumt ist. Da nun die sinnliche Welt weder die Tugend in ihrer Vollendung, noch die Glückseligkeit in ihrer höchsten Potenz gewährt, noch auch beide hier immer verbunden vorkommen, so macht die praktische Vernunft folgende Postulate: Zur Erreichung der höchsten Tugend wird die Unsterblichkeit gefordert, zur Verwirklichung der Verbindung der höchsten Glückseligkeit mit der vollendetsten Tugend, d. h. zur Realisierung des höchsten Gutes, aber ist das Dasein Gottes notwendige Bedingung. Wenn also das höchste Gut verwirklicht werden soll, so muss die Unsterblichkeit der Seele und mit ihr ein unendliches Fortschreiten zu höherer Vollendung und Heiligkeit vorausgesetzt werden; es muss ferner ein Wesen geben, das die gemeinsame Ursache der natürlichen und sittlichen Welt ist und Tugend und Glückseligkeit in ein entsprechendes Verhältnis zu setzen vermag. Ein solches Wesen ist aber Gott. Auch die Idee der Freiheit entwickelt sich aus der praktischen Vernunft. Sie leitet ihre Realität ab aus der Gültigkeit des moralischen Gesetzes überhaupt: du sollst, also kannst du, sonst wäre das Sollen etwas Widersinniges. Frei ist der Mensch als intelligibles Wesen, als Ding an sich, soweit er aber als Erscheinung angesehen wird, ist er der Notwendigkeit unterworfen. Diese drei Ideen, unlösbare Aufgaben für die theoretische, gewinnen Boden im Gebiet der praktischen Vernunft. Auch jetzt aber sind sie nicht theoretische Dogmen, sondern praktische Postulate, notwendige Voraussetzungen des sittlichen Handelns; als solche haben sie für das Subjekt Gewissheit, um so mehr, als die praktische Vernunft, wo sie mit der theoretischen in Widerstreit kommt, den »Primat« hat. Diesen Ansichten entsprechen auch die Grundsätze über Religion, die K. in der Schrift »Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft« niedergelegt hat. Der Grundgedanke ist hier die Zurückführung der Religion auf Moral. Die religiöse Gesinnung besteht in der Erkenntnis unsrer Pflichten als göttliches Gebot. Je reifer die Vernunft wird, um so entbehrlicher werden die statutarischen Satzungen des Kirchenglaubens.
3) Kritik der Urteilskraft. Wie die beiden vorangegangenen Kritiken die apriorischen Elemente des Erkenntnis- und Begehrungsvermögens, so deckte die dritte, die Kritik der Urteilskraft, jene des Mittelgliedes zwischen beiden, des Gefühlsvermögens oder, wie K. es nennt, der Urteilskraft, auf. Gegenstand dieser letzteren ist der Begriff der Zweckmäßigkeit der Natur und zwar sowohl der ästhetischen als der teleologischen Zweckmäßigkeit. Die ästhetische Zweckmäßigkeit, welche die Dinge subjektiv für uns haben, entfaltet sich in den Begriffen des Schönen und des Erhabenen. Schön ist das, was durch seine mit dem menschlichen Erkenntnisvermögen übereinstimmende Form ein uninteressiertes, allgemeines und notwendiges Wohlgefallen erregt; das Erhabene gefällt unmittelbar durch den Widerstand gegen das Interesse der Sinne. Die teleologische Zweckmäßigkeit bezieht sich auf das Verhältnis der Dinge unter sich und ist entweder eine äußere und zufällige oder eine innere, in dem Organismus des Dinges bedingte und notwendige. Ob der Natur an und für sich innere Zweckmäßigkeit zukomme oder nicht, können wir nicht bestimmen; wir behaupten nur, dass unsre Urteilskraft die Natur als zweckmäßig ansehen müsse. Wir schauen den Zweckbegriff in die Natur hinein, indem wir gänzlich dahingestellt sein lassen, ob nicht vielleicht ein andrer Verstand, der nicht denkt wie der unsrige, zum Verständnis der Natur den Zweckbegriff gar nicht nötig hat. Gäbe es einen Verstand, der im Allgemeinen das Besondere, im Ganzen die Teile mit Bestimmtheit erkennen könnte, so würde ein solcher die ganze Natur aus einem Prinzip begreifen, den Begriff des Zweckes nicht brauchen.
Kants Hauptwerk blieb einige Jahre hindurch ziemlich unbeachtet, bis die »Briefe über die Kantsche Philosophie« von Reinhold (s. d.), die zuerst (seit 1786) in Wielands »Deutschem Merkur« erschienen, die Denker- und Leserwelt für K. gewannen. Als Gegner Kants traten auf die Popularphilosophen Feder, Garve, Tiedemann, der Wolffianer Eberhard, Herder, dessen »Metakritik« (Leipz. 1799) und »Kalligone« (Berl. 1800) von keinem tiefen Verständnis Kants zeugen, der »Glaubensphilosoph« F. H. Jacobi und der Skeptiker G. E. Schulze (»Änesidemus«, Helmst. 1792), Sal. Maimon, Beck, Bardili u. a. Als Anhänger Kants machten sich außer Reinhold zuerst Joh. Schulze (durch »Erläuterungen zu Kants Kritik«, Königsb. 1791; neu hrsg. von Hafferberg, Jena 1897), Jakob, Erhard Schmid, auf dem Gebiete der Religionsphilosophie: Heidenreich, Tieftrunk, Wegscheider u. a., auf dem der Logik: Kiesewetter, Hoffbauer, Krug, Maaß, Fries, auf dem der Psychologie: Maaß, Fries, auf dem der Ästhetik: Schiller, Bouterwek, auf dem der Geschichte der Philosophie: Tennemann, Buhle, Wendt u. a. bemerklich. Indirekt sind fast alle nach K. Philosophierenden durch ihn beeinflusst worden. Fichte hielt sich anfänglich selbst für einen Kantianer, Herbart nannte sich einen Kantianer »vom Jahre 1828«, Schopenhauer erkannte von allen seinen Vorgängern nur K. als seinen Lehrer an. Eine Geschichte der Kantschen Philosophie hat Rosenkranz im 12. Band seiner Ausgabe der Werke Kants geliefert. Nach der Abwendung von der Hegelschen Schule und dem Misserfolg der positiven Philosophie Schellings kehrte das philosophische Interesse vielfach zu K. als dem ursprünglichen Ausgangspunkt der neuern deutschen Philosophie zurück, und es begann ein erneuertes, z. T. philologisch vertieftes Studium seiner Werke. Eine Reaktion zugunsten der Kantschen idealistischen Erkenntnistheorie ging von den Naturforschern, insbes. von den Physiologen aus der Schule des eifrigen Verehrers Kants, Johannes Müller, aus, an der Helmholtz u. a. sich beteiligten. Sehr viel Arbeit hat man der Erläuterung und Erneuerung Kants gewidmet, wie die zahlreichen Schriften neuerer Zeit, hauptsächlich über dessen Erkenntnistheorie, von Cohen, Paulsen, R. Zimmermann, Stadler, Hölder, Volkelt, Thiele, Laas, Frederichs, Zeller, Pünjer, Witte, Romundt, Laßwitz, Schweitzer, Messer u. a., der von Vaihinger zur Säkularfeier der »Kritik der reinen Vernunft« begonnene »Kommentar« (Bd. 1, Stuttg. 1881; Bd. 2, 1892) und Arnoldts »Kritische Exkurse im Gebiete der Kantforschung« (Königsb. 1894), beweisen. Vgl. auch die von Vaihinger, seit 1904 zusammen mit Bauch herausgegebene Zeitschrift »Kantstudien« (Hamb. 1896 f., seit 1899 in Berlin).
Literatur. Das Leben Kants haben geschildert: Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters Kants (Königsb. 1804), Wasianski, K. in seinen letzten Lebensjahren (das. 1804), Jachmann, J. K., geschildert in Briefen (das. 1804), vgl. hierzu A. Hoffmann, Immanuel K., ein Lebensbild nach Darstellungen der Zeitgenossen (Halle 1902); Schubert (im 11. Bd. der Rosenkranzschen Gesamtausgabe); Reicke, Kantiana (das. 1860); Saintes, Histoire de la vie et de la philosophie de K. (Par. 1844); Stuckenberg, The life of Immanuel K. (Lond. 1882); Arnoldt, Kants Jugend und die fünf ersten Jahre seiner Privatdozentur (Königsb. 1882).
Über Kants Philosophie vgl. Chalybäus, Historische Entwickelung der spekulativen Philosophie von K. bis Hegel (Leipz. 1837, 5. Aufl. 1860); Kuno Fischer, Immanuel K. (Mannh. 1860, 2 Bde.; 4. Aufl., Heidelb. 1898–99); B. Erdmann, Kants Kritizismus in der 1. und 2. Auflage der »Kritik der reinen Vernunft« (Leipz. 1877); Fried. Paulsen, K. Sein Leben und seine Lehre (Stuttg. 1898, 4. Aufl. 1904); Kronenberg, K., sein Leben und seine Lehre (3. Aufl., Münch. 1905). Zur Feier des 100jährigen Todestags Kants ist eine große Anzahl Reden, Aufsätze, kleinere Schriften erschienen, darunter »Zur Erinnerung an J. K.«, hrsg. von der Universität Königsberg (Halle 1904). Über seine Schule vgl. außer obigem Werk von Rosenkranz noch: K. Fischer, Die beiden kantischen Schulen in Jena (Stuttg. 1862); Liebmann, K. und die Epigonen (das. 1865). Von nichtdeutschen Werken seien erwähnt: Villers, La philosophie de K. (Metz 1801); Cousin, Leçons sur la philosophie de K. (Par. 1842, 4.Aufl., 1864); Desdouits, La philosophie de K. (das. 1875); Adamson, Philosophy of K. (Lond. 1879; deutsch, Leipz. 1880); Caird, The critical philosophy of I. K. (Lond. 1889, 2 Bde.); Cantoni, Emanuele K. (Mail. 1879–84, 3 Bde.); Seth, The development from K. to Hegel (Lond. 1882); Ruyssen, K. (Par. 1900).Die sonstige reiche Kant-Literatur s. bei Überweg-Heinze, Grundriß der Geschichte der Philosophie, Bd. 3 (9. Aufl., Berl. 1901).
Kritik der Urteilskraft
Vorrede zur ersten Auflage, 1790
Man kann das Vermögen der Erkenntnis aus Prinzipien a priori die reine Vernunft, und die Untersuchung der Möglichkeit und Grenzen derselben überhaupt die Kritik der reinen Vernunft nennen: ob man gleich unter diesem Vermögen nur die Vernunft in ihrem theoretischen Gebrauche versteht, wie es auch in dem ersten Werke unter jener Benennung geschehen ist, ohne noch ihr Vermögen, als praktische Vernunft, nach ihren besonderen Prinzipien in Untersuchung ziehen zu wollen. Jene geht alsdann bloß auf unser Vermögen, Dinge a priori zu erkennen; und beschäftigt sich also nur mit dem Erkenntnisvermögen, mit Ausschließung des Gefühls der Lust und Unlust und des Begehrungsvermögens; und unter den Erkenntnisvermögen mit dem Verstande nach seinen Prinzipien a priori, mit Ausschließung der Urteilskraft und der Vernunft (als zum theoretischen Erkenntnis gleichfalls gehöriger Vermögen), weil es sich in dem Fortgange findet, daß kein anderes Erkenntnisvermögen, als der Verstand, konstitutive Erkenntnisprinzipien a priori an die Hand geben kann. Die Kritik also, welche sie insgesamt, nach dem Anteile, den jedes der anderen an dem baren Besitz der Erkenntnis aus eigener Wurzel zu haben vorgeben möchte, sichtet, läßt nichts übrig, als was der Verstand a priori als Gesetz für die Natur, als den Inbegriff von Erscheinungen (deren Form eben sowohl a priori gegeben ist), vorschreibt; verweiset aber alle andere reine Begriffe unter die Ideen, die für unser theoretisches Erkenntnisvermögen überschwenglich, dabei aber doch nicht etwa unnütz oder entbehrlich sind, sondern als regulative Prinzipien dienen: teils die besorglichen Anmaßungen des Verstandes, als ob er (indem er a priori die Bedingungen der Möglichkeit aller Dinge, die er erkennen kann, anzugeben vermag) dadurch auch die Möglichkeit aller Dinge überhaupt in diesen Grenzen beschlossen habe, zurück zu halten, teils um ihn selbst in der Betrachtung der Natur nach einem Prinzip der Vollständigkeit, wiewohl er sie nie erreichen kann, zu leiten, und dadurch die Endabsicht alles Erkenntnisses zu befördern.
Es war also eigentlich der Verstand, der sein eigenes Gebiet und zwar im Erkenntnisvermögen hat, sofern er konstitutive Erkenntnisprinzipien a priori enthält, welcher durch die im allgemeinen so benannte Kritik der reinen Vernunft gegen alle übrige Kompetenten in sicheren aber einigen Besitz gesetzt werden sollte. Eben so ist der Vernunft, welche nirgend als lediglich in Ansehung des Begehrungsvermögens konstitutive Prinzipien a priori enthält, in der Kritik der praktischen Vernunft ihr Besitz angewiesen worden.
Ob nun die Urteilskraft, die in der Ordnung unserer Erkenntnisvermögen zwischen dem Verstande und der Vernunft ein Mittelglied ausmacht, auch für sich Prinzipien a priori habe; ob diese konstitutiv oder bloß regulativ sind (und also kein eigenes Gebiet beweisen), und ob sie dem Gefühle der Lust und Unlust, als dem Mittelgliede zwischen dem Erkenntnisvermögen und Begehrungsvermögen (eben so, wie der Verstand dem ersteren, die Vernunft aber dem letzteren a priori Gesetze vorschreiben), a priori die Regel gebe: das ist es, womit sich gegenwärtige Kritik der Urteilskraft beschäftigt.
Eine Kritik der reinen Vernunft, d.i. unseres Vermögens, nach Prinzipien a priori zu urteilen, würde unvollständig sein, wenn die der Urteilskraft, welche für sich als Erkenntnisvermögen darauf auch Anspruch macht, nicht als ein besonderer Teil derselben abgehandelt würde; obgleich ihre Prinzipien in einem System der reinen Philosophie keinen besonderen Teil zwischen der theoretischen und praktischen ausmachen dürfen, sondern im Notfalle jedem von beiden gelegentlich angeschlossen werden können. Denn, wenn ein solches System unter dem allgemeinen Namen der Metaphysik einmal zu Stande kommen soll (welches ganz vollständig zu bewerkstelligen möglich und für den Gebrauch der Vernunft in aller Beziehung höchst wichtig ist): so muß die Kritik den Boden zu diesem Gebäude vorher so tief, als die erste Grundlage des Vermögens von der Erfahrung unabhängiger Prinzipien liegt, erforscht haben, damit es nicht an irgend einem Teile sinke, welches den Einsturz des Ganzen unvermeidlich nach sich ziehen würde.
Man kann aber aus der Natur der Urteilskraft (deren richtiger Gebrauch so notwendig und allgemein erforderlich ist, daß daher unter dem Namen des gesunden Verstandes kein anderes, als eben dieses Vermögen gemeinet wird) leicht abnehmen, daß es mit großen Schwierigkeiten begleitet sein müsse, ein eigentümliches Prinzip derselben auszufinden (denn irgend eins muß es a priori in sich enthalten, weil es sonst nicht, als ein besonderes Erkenntnisvermögen, selbst der gemeinsten Kritik ausgesetzt sein würde), welches gleichwohl nicht aus Begriffen a priori abgeleitet sein muß; denn die gehören dem Verstande an, und die Urteilskraft geht nur auf die Anwendung derselben. Sie soll also selbst einen Begriff angeben, durch den eigentlich kein Ding erkannt wird, sondern der nur ihr selbst zur Regel dient, aber nicht zu einer objektiven, der sie ihr Urteil anpassen kann, weil dazu wiederum eine andere Urteilskraft erforderlich sein würde, um unterscheiden zu können, ob es der Fall der Regel sei oder nicht.
Diese Verlegenheit wegen eines Prinzips (es sei nun ein subjektives oder objektives) findet sich hauptsächlich in denjenigen Beurteilungen, die man ästhetisch nennt, die das Schöne und Erhabne, der Natur oder der Kunst, betreffen. Und gleichwohl ist die kritische Untersuchung eines Prinzips der Urteilskraft in denselben das wichtigste Stück einer Kritik dieses Vermögens. Denn, ob sie gleich für sich allein zum Erkenntnis der Dinge gar nichts beitragen, so gehören sie doch dem Erkenntnisvermögen allein an, und beweisen eine unmittelbare Beziehung dieses Vermögens auf das Gefühl der Lust oder Unlust nach irgend einem Prinzip a priori, ohne es mit dem, was Bestimmungsgrund des Begehrungsvermögens sein kann, zu vermengen, weil dieses seine Prinzipien a priori in Begriffen der Vernunft hat. - Was aber die logische Beurteilung der Natur anbelangt, da, wo die Erfahrung eine Gesetzmäßigkeit an Dingen aufstellt, welche zu verstehen oder zu erklären der allgemeine Verstandesbegriff vom Sinnlichen nicht mehr zulangt, und die Urteilskraft aus sich selbst ein Prinzip der Beziehung des Naturdinges auf das unerkennbare Übersinnliche nehmen kann, es auch nur in Absicht auf sich selbst zum Erkenntnis der Natur brauchen muß, da kann und muß ein solches Prinzip a priori zwar zum Erkenntnis der Weltwesen angewandt werden, und eröffnet zugleich Aussichten, die für die praktische Vernunft vorteilhaft sind: aber es hat keine unmittelbare Beziehung auf das Gefühl der Lust und Unlust, die gerade das Rätselhafte in dem Prinzip der Urteilskraft ist, welches eine besondere Abteilung in der Kritik für dieses Vermögen notwendig macht, da die logische Beurteilung nach Begriffen (aus welchen niemals eine unmittelbare Folgerung auf das Gefühl der Lust und Unlust gezogen werden kann) allenfalls dem theoretischen Teile der Philosophie, samt einer kritischen Einschränkung derselben, hätte angehängt werden können.
Da die Untersuchung des Geschmacksvermögens, als ästhetischer Urteilskraft, hier nicht zur Bildung und Kultur des Geschmacks (denn diese wird auch ohne alle solche Nachforschungen, wie bisher, so fernerhin, ihren Gang nehmen), sondern bloß in transzendentaler Absicht angestellt wird: so wird sie, wie ich mir schmeichle, in Ansehung der Mangelhaftigkeit jenes Zwecks auch mit Nachsicht beurteilt werden. Was aber die letztere Absicht betrifft, so muß sie sich auf die strengste Prüfung gefaßt machen. Aber auch da kann die große Schwierigkeit, ein Problem, welches die Natur so verwickelt hat, aufzulösen, einiger nicht ganz zu vermeidenden Dunkelheit in der Auflösung desselben, wie ich hoffe, zur Entschuldigung dienen, wenn nur, daß das Prinzip richtig angegeben worden, klar genug dargetan ist; gesetzt, die Art, das Phänomen der Urteilskraft davon abzuleiten, habe nicht alle Deutlichkeit, die man anderwärts, nämlich von einem Erkenntnis nach Begriffen, mit Recht fordern kann, die ich auch im zweiten Teile dieses Werks erreicht zu haben glaube.
Hiemit endige ich also mein ganzes kritisches Geschäft. Ich werde ungesäumt zum Doktrinalen schreiten, um, wo möglich, meinem zunehmenden Alter die dazu noch einigermaßen günstige Zeit noch abzugewinnen. Es versteht sich von selbst, daß für die Urteilskraft darin kein besonderer Teil sei, weil in Ansehung derselben die Kritik statt der Theorie dient; sondern daß, nach der Einteilung der Philosophie in die theoretische und praktische, und der reinen in eben solche Teile, die Metaphysik der Natur und die der Sitten jenes Geschäft ausmachen werden.
Einleitung
I. Von der Einteilung der Philosophie
Wenn man die Philosophie, sofern sie Prinzipien der Vernunfterkenntnis der Dinge (nicht bloß, wie die Logik, Prinzipien der Form des Denkens überhaupt, ohne Unterschied der Objekte) durch Begriffe enthält, wie gewöhnlich, in die theoretische und praktische einteilt: so verfährt man ganz recht. Aber alsdann müssen auch die Begriffe, welche den Prinzipien dieser Vernunfterkenntnis ihr Objekt anweisen, spezifisch verschieden sein, weil sie sonst zu keiner Einteilung berechtigen würden, welche jederzeit eine Entgegensetzung der Prinzipien, der zu den verschiedenen Teilen einer Wissenschaft gehörigen Vernunfterkenntnis, voraussetzt.
Es sind aber nur zweierlei Begriffe, welche eben so viel verschiedene Prinzipien der Möglichkeit ihrer Gegenstände zulassen: nämlich die Naturbegriffe, und der Freiheitsbegriff. Da nun die ersteren ein theoretisches Erkenntnis nach Prinzipien a priori möglich machen, der zweite aber in Ansehung derselben nur ein negatives Prinzip (der bloßen Entgegensetzung) schon in seinem Begriffe bei sich führt, dagegen für die Willensbestimmung erweiternde Grundsätze, welche darum praktisch heißen, errichtet: so wird die Philosophie in zwei, den Prinzipien nach ganz verschiedene, Teile, in die theoretische als Naturphilosophie, und die praktische als Moralphilosophie (denn so wird die praktische Gesetzgebung der Vernunft nach dem Freiheitsbegriffe genannt) mit Recht eingeteilt. Es hat aber bisher ein großer Mißbrauch mit diesen Ausdrücken zur Einteilung der verschiedenen Prinzipien, und mit ihnen auch der Philosophie, geherrscht: indem man das Praktische nach Naturbegriffen mit dem Praktischen nach dem Freiheitsbegriffe für einerlei nahm, und so, unter denselben Benennungen einer theoretischen und praktischen Philosophie, eine Einteilung machte, durch welche (da beide Teile einerlei Prinzipien haben konnten) in der Tat nichts eingeteilt war.
Der Wille, als Begehrungsvermögen, ist nämlich eine von den mancherlei Naturursachen in der Welt, nämlich diejenige, welche nach Begriffen wirkt; und alles, was als durch einen Willen möglich (oder notwendig) vorgestellt wird, heißt praktisch-möglich (oder notwendig): zum Unterschiede von der physischen Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Wirkung, wozu die Ursache nicht durch Begriffe (sondern, wie bei der leblosen Materie, durch Mechanism, und, bei Tieren, durch Instinkt) zur Kausalität bestimmt wird. - Hier wird nun in Ansehung des Praktischen unbestimmt gelassen: ob der Begriff, der der Kausalität des Willens die Regel gibt, ein Naturbegriff, oder ein Freiheitsbegriff sei.
Der letztere Unterschied aber ist wesentlich. Denn, ist der die Kausalität bestimmende Begriff ein Naturbegriff, so sind die Prinzipien technisch-praktisch; ist er aber ein Freiheitsbegriff, so sind diese moralisch-praktisch: und weil es in der Einteilung einer Vernunftwissenschaft gänzlich auf diejenige Verschiedenheit der Gegenstände ankommt, deren Erkenntnis verschiedener Prinzipien bedarf, so werden die ersteren zur theoretischen Philosophie (als Naturlehre) gehören, die andern aber ganz allein den zweiten Teil, nämlich (als Sittenlehre) die praktische Philosophie, ausmachen.
Alle technisch-praktische Regeln (d.i. die der Kunst und Geschicklichkeit überhaupt, oder auch der Klugheit, als einer Geschicklichkeit, auf Menschen und ihren Willen Einfluß zu haben), so fern ihre Prinzipien auf Begriffen beruhen, müssen nur als Korollarien zur theoretischen Philosophie gezählt werden. Denn sie betreffen nur die Möglichkeit der Dinge nach Naturbegriffen, wozu nicht allein die Mittel, die in der Natur dazu anzutreffen sind, sondern selbst der Wille (als Begehrungs-, mithin als Naturvermögen) gehört, sofern er durch Triebfedern der Natur jenen Regeln gemäß bestimmt werden kann. Doch heißen dergleichen praktische Regeln nicht Gesetze (etwa so wie physische), sondern nur Vorschriften: und zwar darum, weil der Wille nicht bloß unter dem Naturbegriffe, sondern auch unter dem Freiheitsbegriffe steht, in Beziehung auf welchen die Prinzipien desselben Gesetze heißen, und, mit ihren Folgerungen, den zweiten Teil der Philosophie, nämlich den praktischen, allein ausmachen.
So wenig also die Auflösung der Probleme der reinen Geometrie zu einem besonderen Teile derselben gehört, oder die Feldmeßkunst den Namen einer praktischen Geometrie, zum Unterschiede von der reinen, als ein zweiter Teil der Geometrie überhaupt verdient: so, und noch weniger, darf die mechanische oder chemische Kunst der Experimente, oder der Beobachtungen, für einen praktischen Teil der Naturlehre, endlich die Haus-, Land-, Staatswirtschaft, die Kunst des Umganges, die Vorschrift der Diätetik, selbst nicht die allgemeine Glückseligkeitslehre, sogar nicht einmal die Bezähmung der Neigungen und Bändigung der Affekten zum Behuf der letzteren, zur praktischen Philosophie gezählt werden, oder die letzteren wohl gar den zweiten Teil der Philosophie überhaupt ausmachen; weil sie insgesamt nur Regeln der Geschicklichkeit, die mithin nur technisch-praktisch sind, enthalten, um eine Wirkung hervorzubringen, die nach Naturbegriffen der Ursachen und Wirkungen möglich ist, welche, da sie zur theoretischen Philosophie gehören, jenen Vorschriften als bloßen Korollarien aus derselben (der Naturwissenschaft) unterworfen sind, und also keine Stelle in einer besonderen Philosophie, die praktische genannt, verlangen können. Dagegen machen die moralisch-praktischen Vorschriften, die sich gänzlich auf dem Freiheitsbegriffe, mit völliger Ausschließung der Bestimmungsgründe des Willens aus der Natur, gründen, eine ganz besondere Art von Vorschriften aus: welche auch, gleich denen Regeln, welchen die Natur gehorcht, schlechthin Gesetze heißen, aber nicht, wie diese, auf sinnlichen Bedingungen, sondern auf einem übersinnlichen Prinzip beruhen, und, neben dem theoretischen Teile der Philosophie, für sich ganz allein, einen anderen Teil, unter dem Namen der praktischen Philosophie, fordern.
Man siehet hieraus, daß ein Inbegriff praktischer Vorschriften, welche die Philosophie gibt, nicht einen besonderen, dem theoretischen zur Seite gesetzten, Teil derselben darum ausmache, weil sie praktisch sind; denn das könnten sie sein, wenn ihre Prinzipien gleich gänzlich aus der theoretischen Erkenntnis der Natur hergenommen wären (als technisch-praktische Regeln); sondern, weil und wenn ihr Prinzip gar nicht vom Naturbegriffe, der jederzeit sinnlich bedingt ist, entlehnt ist, mithin auf dem Übersinnlichen, welches der Freiheitsbegriff allein durch formale Gesetze kennbar macht, beruht, und sie also moralisch-praktisch, d.i. nicht bloß Vorschriften und Regeln in dieser oder jener Absicht, sondern, ohne vorgehende Bezugnehmung auf Zwecke und Absichten, Gesetze sind.
II. Vom Gebiete der Philosophie überhaupt
So weit Begriffe a priori ihre Anwendung haben, so weit reicht der Gebrauch unseres Erkenntnisvermögens nach Prinzipien, und mit ihm die Philosophie.
Der Inbegriff aller Gegenstände aber, worauf jene Begriffe bezogen werden, um, wo möglich, ein Erkenntnis derselben zu Stande zu bringen, kann, nach der verschiedenen Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit unserer Vermögen zu dieser Absicht, eingeteilt werden.
Begriffe, sofern sie auf Gegenstände bezogen werden, unangesehen, ob ein Erkenntnis derselben möglich sei oder nicht, haben ihr Feld, welches bloß nach dem Verhältnisse, das ihr Objekt zu unserem Erkenntnisvermögen überhaupt hat, bestimmt wird. - Der Teil dieses Feldes, worin für uns Erkenntnis möglich ist, ist ein Boden (territorium) für diese Begriffe und das dazu erforderliche Erkenntnisvermögen. Der Teil des Bodens, worauf diese gesetzgebend sind, ist das Gebiet (ditio) dieser Begriffe, und der ihnen zustehenden Erkenntnisvermögen. Erfahrungsbegriffe haben also zwar ihren Boden in der Natur, als dem Inbegriffe aller Gegenstände der Sinne, aber kein Gebiet (sondern nur ihren Aufenthalt, domicilium); weil sie zwar gesetzlich erzeugt werden, aber nicht gesetzgebend sind, sondern die auf sie gegründeten Regeln empirisch, mithin zufällig, sind.
Unser gesamtes Erkenntnisvermögen hat zwei Gebiete, das der Naturbegriffe, und das des Freiheitsbegriffs; denn durch beide ist es a priori gesetzgebend. Die Philosophie teilt sich nun auch, diesem gemäß, in die theoretische und die praktische. Aber der Boden, auf welchem ihr Gebiet errichtet, und ihre Gesetzgebung ausgeübt wird, ist immer doch nur der Inbegriff der Gegenstände aller möglichen Erfahrung, sofern sie für nichts mehr als bloße Erscheinungen genommen werden; denn ohne das würde keine Gesetzgebung des Verstandes in Ansehung derselben gedacht werden können.
Die Gesetzgebung durch Naturbegriffe geschieht durch den Verstand, und ist theoretisch. Die Gesetzgebung durch den Freiheitsbegriff geschieht von der Vernunft, und ist bloß praktisch. Nur allein im Praktischen kann die Vernunft gesetzgebend sein; in Ansehung des theoretischen Erkenntnisses (der Natur) kann sie nur (als gesetzkundig, vermittelst des Verstandes) aus gegebenen Gesetzen durch Schlüsse Folgerungen ziehen, die doch immer nur bei der Natur stehen bleiben. Umgekehrt aber, wo Regeln praktisch sind, ist die Vernunft nicht darum sofort gesetzgebend, weil sie auch technisch-praktisch sein können.
Verstand und Vernunft haben also zwei verschiedene Gesetzgebungen auf einem und demselben Boden der Erfahrung, ohne daß eine der anderen Eintrag tun darf. Denn so wenig der Naturbegriff auf die Gesetzgebung durch den Freiheitsbegriff Einfluß hat, eben so wenig stört dieser die Gesetzgebung der Natur. - Die Möglichkeit, das Zusammenbestehen beider Gesetzgebungen und der dazu gehörigen Vermögen in demselben Subjekt sich wenigstens ohne Widerspruch zu denken, bewies die Kritik der r. V., indem sie die Einwürfe dawider durch Aufdeckung des dialektischen Scheins in denselben vernichtete.
Aber, daß diese zwei verschiedenen Gebiete, die sich zwar nicht in ihrer Gesetzgebung, aber doch in ihren Wirkungen in der Sinnenwelt unaufhörlich einschränken, nicht eines ausmachen, kommt daher: daß der Naturbegriff zwar seine Gegenstände in der Anschauung, aber nicht als Dinge an sich selbst, sondern als bloße Erscheinungen, der Freiheitsbegriff dagegen in seinem Objekte zwar ein Ding an sich selbst, aber nicht in der Anschauung vorstellig machen, mithin keiner von beiden ein theoretisches Erkenntnis von seinem Objekte (und selbst dem denkenden Subjekte) als Dinge an sich verschaffen kann, welches das Übersinnliche sein würde, wovon man die Idee zwar der Möglichkeit aller jener Gegenstände der Erfahrung unterlegen muß, sie selbst aber niemals zu einem Erkenntnisse erheben und erweitern kann.
Es gibt also ein unbegrenztes, aber auch unzugängliches Feld für unser gesamtes Erkenntnisvermögen, nämlich das Feld des Übersinnlichen, worin wir keinen Boden für uns finden, also auf demselben weder für die Verstandes- noch Vernunftbegriffe ein Gebiet zum theoretischen Erkenntnis haben können; ein Feld, welches wir zwar zum Behuf des theoretischen sowohl als praktischen Gebrauchs der Vernunft mit Ideen besetzen müssen, denen wir aber, in Beziehung auf die Gesetze aus dem Freiheitsbegriffe, keine andere als praktische Realität verschaffen können, wodurch demnach unser theoretisches Erkenntnis nicht im mindesten zu dem Übersinnlichen erweitert wird.
Ob nun zwar eine unübersehbare Kluft zwischen dem Gebiete des Naturbegriffs, als dem Sinnlichen, und dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem Übersinnlichen, befestigt ist, so daß von dem ersteren zum anderen (also vermittelst des theoretischen Gebrauchs der Vernunft) kein Übergang möglich ist, gleich als ob es so viel verschiedene Welten wären, deren erste auf die zweite keinen Einfluß haben kann: so soll doch diese auf jene einen Einfluß haben, nämlich der Freiheitsbegriff soll den durch seine Gesetze aufgegebenen Zweck in der Sinnenwelt wirklich machen; und die Natur muß folglich auch so gedacht werden können, daß die Gesetzmäßigkeit ihrer Form wenigstens zur Möglichkeit der in ihr zu bewirkenden Zwecke nach Freiheitsgesetzen zusammenstimme. - Also muß es doch einen Grund der Einheit des Übersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt, mit dem, was der Freiheitsbegriff praktisch enthält, geben, wovon der Begriff, wenn er gleich weder theoretisch noch praktisch zu einem Erkenntnisse desselben gelangt, mithin kein eigentümliches Gebiet hat, dennoch den Übergang von der Denkungsart nach den Prinzipien der einen, zu der nach Prinzipien der anderen, möglich macht.
III. Von der Kritik der Urteilskraft, als einem Verbindungsmittel der zwei Teile der Philosophie zu einem Ganzen
Die Kritik der Erkenntnisvermögen in Ansehung dessen, was sie a priori leisten können, hat eigentlich kein Gebiet in Ansehung der Objekte; weil sie keine Doktrin ist, sondern nur, ob und wie, nach der Bewandtnis, die es mit unseren Vermögen hat, eine Doktrin durch sie möglich sei, zu untersuchen hat. Ihr Feld erstreckt sich auf alle Anmaßungen derselben, um sie in die Grenzen ihrer Rechtmäßigkeit zu setzen. Was aber nicht in die Einteilung der Philosophie kommen kann, das kann doch, als ein Hauptteil, in die Kritik des reinen Erkenntnisvermögens überhaupt kommen, wenn es nämlich Prinzipien enthält, die für sich weder zum theoretischen noch praktischen Gebrauche tauglich sind.
Die Naturbegriffe, welche den Grund zu allem theoretischen Erkenntnis a priori enthalten, beruheten auf der Gesetzgebung des Verstandes. - Der Freiheitsbegriff, der den Grund zu allen sinnlich-unbedingten praktischen Vorschriften a priori enthielt, beruhete auf der Gesetzgebung der Vernunft. Beide Vermögen also haben, außer dem, daß sie der logischen Form nach auf Prinzipien, welchen Ursprungs sie auch sein mögen, angewandt werden können, überdem noch jedes seine eigene Gesetzgebung dem Inhalte nach, über die es keine andere (a priori) gibt, und die daher die Einteilung der Philosophie in die theoretische und praktische rechtfertigt.
Allein in der Familie der oberen Erkenntnisvermögen gibt es doch noch ein Mittelglied zwischen dem Verstande und der Vernunft. Dieses ist die Urteilskraft, von welcher man Ursache hat, nach der Analogie zu vermuten, daß sie eben sowohl, wenn gleich nicht eine eigene Gesetzgebung, doch ein ihr eigenes Prinzip, nach Gesetzen zu suchen, allenfalls ein bloß subjektives a priori, in sich enthalten dürfte: welches, wenn ihm gleich kein Feld der Gegenstände als sein Gebiet zustände, doch irgend einen Boden haben kann, und eine gewisse Beschaffenheit desselben, wofür gerade nur dieses Prinzip geltend sein möchte.
Hierzu kommt aber noch (nach der Analogie zu urteilen) ein neuer Grund, die Urteilskraft mit einer anderen Ordnung unserer Vorstellungskräfte in Verknüpfung zu bringen, welche von noch größerer Wichtigkeit zu sein scheint, als die der Verwandtschaft mit der Familie der Erkenntnisvermögen. Denn alle Seelenvermögen, oder Fähigkeiten, können auf die drei zurück geführt werden, welche sich nicht ferner aus einem gemeinschaftlichem Grunde ableiten lassen: das Erkenntnisvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust, und das Begehrungsvermögen.1 Für das Erkenntnisvermögen ist allein der Verstand gesetzgebend, wenn jenes (wie es auch geschehen muß, wenn es für sich, ohne Vermischung mit dem Begehrungsvermögen, betrachtet wird) als Vermögen eines theoretischen Erkenntnisses auf die Natur bezogen wird, in Ansehung deren allein (als Erscheinung) es uns möglich ist, durch Naturbegriffe a priori, welche eigentlich reine Verstandesbegriffe sind, Gesetze zu geben. - Für das Begehrungsvermögen, als ein oberes Vermögen nach dem Freiheitsbegriffe, ist allein die Vernunft (in der allein dieser Begriff Statt hat) a priori gesetzgebend. - Nun ist zwischen dem Erkenntnis-und dem Begehrungsvermögen das Gefühl der Lust, so wie zwischen dem Verstande und der Vernunft die Urteilskraft, enthalten. Es ist also wenigstens vorläufig zu vermuten, daß die Urteilskraft eben so wohl für sich ein Prinzip a priori enthalte, und, da mit dem Begehrungsvermögen notwendig Lust oder Unlust verbunden ist (es sei, daß sie, wie beim unteren, vor dem Prinzip desselben vorhergehe, oder, wie beim oberen, nur aus der Bestimmung desselben durch das moralische Gesetz folge), eben so wohl einen Übergang von reinen Erkenntnisvermögen, d.i. vom Gebiete der Naturbegriffe zum Gebiete des Freiheitsbegriffs, bewirken werde, als sie im logischen Gebrauche den Übergang vom Verstande zur Vernunft möglich macht.
Wenn also gleich die Philosophie nur in zwei Hauptteile, die theoretische und praktische, eingeteilt werden kann; wenn gleich alles, was wir von den eignen Prinzipien der Urteilskraft zu sagen haben möchten, in ihr zum theoretischen Teile, d.i. dem Vernunfterkenntnis nach Naturbegriffen, gezählt werden müßte: so besteht doch die Kritik der reinen Vernunft, die alles dieses vor der Unternehmung jenes Systems, zum Behuf der Möglichkeit desselben, ausmachen muß, aus drei Teilen: der Kritik des reinen Verstandes, der reinen Urteilskraft, und der reinen Vernunft, welche Vermögen darum rein genannt werden, weil sie a priori gesetzgebend sind.
IV. Von der Urteilskraft, als einem a priori gesetzgebenden Vermögen
Urteilskraft überhaupt ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. Ist das Allgemeine (die Regel, das Prinzip, das Gesetz) gegeben, so ist die Urteilskraft, welche das Besondere darunter subsumiert, (auch, wenn sie, als transzendentale Urteilskraft, a priori die Bedingungen angibt, welchen gemäß allein unter jenem Allgemeinen subsumiert werden kann) bestimmend. Ist aber nur das Besondere gegeben, wozu sie das Allgemeine finden soll, so ist die Urteilskraft bloß reflektierend.
Die bestimmende Urteilskraft unter allgemeinen transzendentalen Gesetzen, die der Verstand gibt, ist nur subsumierend; das Gesetz ist ihr a priori vorgezeichnet, und sie hat also nicht nötig, für sich selbst auf ein Gesetz zu denken, um das Besondere in der Natur dem Allgemeinen unterordnen zu können. - Allein es sind so mannigfaltige Formen der Natur, gleichsam so viele Modifikationen der allgemeinen transzendentalen Naturbegriffe, die durch jene Gesetze, welche der reine Verstand a priori gibt, weil dieselben nur auf die Möglichkeit einer Natur (als Gegenstandes der Sinne) überhaupt gehen, unbestimmt gelassen werden, daß dafür doch auch Gesetze sein müssen, die zwar, als empirische, nach unserer Verstandeseinsicht zufällig sein mögen, die aber doch, wenn sie Gesetze heißen sollen (wie es auch der Begriff einer Natur erfordert), aus einem, wenn gleich uns unbekannten, Prinzip der Einheit des Mannigfaltigen, als notwendig angesehen werden müssen. - Die reflektierende Urteilskraft, die von dem Besondern in der Natur zum Allgemeinen aufzusteigen die Obliegenheit hat, bedarf also eines Prinzips, welches sie nicht von der Erfahrung entlehnen kann, weil es eben die Einheit aller empirischen Prinzipien unter gleichfalls empirischen aber höheren Prinzipien, und also die Möglichkeit der systematischen Unterordnung derselben unter einander, begründen soll. Ein solches transzendentales Prinzip kann also die reflektierende Urteilskraft sich nur selbst als Gesetz geben, nicht anderwärts hernehmen (weil sie sonst bestimmende Urteilskraft sein würde), noch der Natur vorschreiben; weil die Reflexion über die Gesetze der Natur sich nach der Natur, und diese nicht nach den Bedingungen richtet, nach welchen wir einen in Ansehung dieser ganz zufälligen Begriff von ihr zu erwerben trachten.
Nun kann dieses Prinzip kein anderes sein, als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande haben, der sie der Natur (ob zwar nur nach dem allgemeinen Begriffe von ihr als Natur) vorschreibt, die besondern empirischen Gesetze in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene unbestimmt gelassen ist, nach einer solchen Einheit betrachtet werden müssen, als ob gleichfalls ein Verstand (wenn gleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte. Nicht, als wenn auf diese Art wirklich ein solcher Verstand angenommen werden müßte (denn es ist nur die reflektierende Urteilskraft, der diese Idee zum Prinzip dient, zum Reflektieren, nicht zum Bestimmen); sondern dieses Vermögen gibt sich dadurch nur selbst, und nicht der Natur, ein Gesetz.
Weil nun der Begriff von einem Objekt, sofern er zugleich den Grund der Wirklichkeit dieses Objekts enthält, der Zweck, und die Übereinstimmung eines Dinges mit derjenigen Beschaffenheit der Dinge, die nur nach Zwecken möglich ist, die Zweckmäßigkeit der Form derselben heißt: so ist das Prinzip der Urteilskraft, in Ansehung der Form der Dinge der Natur unter empirischen Gesetzen überhaupt, die Zweckmäßigkeit der Natur in ihrer Mannigfaltigkeit. D. i. die Natur wird durch diesen Begriff so vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund der Einheit des Mannigfaltigen ihrer empirischen Gesetze enthalte.
Die Zweckmäßigkeit der Natur ist also ein besonderer Begriff a priori, der lediglich in der reflektierenden Urteilskraft seinen Ursprung hat. Denn den Naturprodukten kann man so etwas, als Beziehung der Natur an ihnen auf Zwecke, nicht beilegen, sondern diesen Begriff nur brauchen, um über sie in Ansehung der Verknüpfung der Erscheinungen in ihr, die nach empirischen Gesetzen gegeben ist, zu reflektieren. Auch ist dieser Begriff von der praktischen Zweckmäßigkeit (der menschlichen Kunst oder auch der Sitten) ganz unterschieden, ob er zwar nach einer Analogie mit derselben gedacht wird.
V. Das Prinzip der formalen Zweckmäßigkeit der Natur ist ein transzendentales Prinzip der Urteilskraft
Ein transzendentales Prinzip ist dasjenige, durch welches die allgemeine Bedingung a priori vorgestellt wird, unter der allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis überhaupt werden können. Dagegen heißt ein Prinzip metaphysisch, wenn es die Bedingung a priori vorstellt, unter der allein Objekte, deren Begriff empirisch gegeben sein muß, a priori weiter bestimmet werden können. So ist das Prinzip der Erkenntnis der Körper, als Substanzen und als veränderlicher Substanzen, transzendental, wenn dadurch gesagt wird, daß ihre Veränderung eine Ursache haben müsse; es ist aber metaphysisch, wenn dadurch gesagt wird, ihre Veränderung müsse eine äußere Ursache haben: weil im ersteren Falle der Körper nur durch ontologische Prädikate (reine Verstandesbegriffe), z.B. als Substanz, gedacht werden darf, um den Satz a priori zu erkennen; im zweiten aber der empirische Begriff eines Körpers (als eines beweglichen Dinges im Raum) diesem Satze zum Grunde gelegt werden muß, alsdann aber, daß dem Körper das letztere Prädikat (der Bewegung nur durch äußere Ursache) zukomme, völlig a priori eingesehen werden kann. - So ist, wie ich sogleich zeigen werde, das Prinzip der Zweckmäßigkeit der Natur (in der Mannigfaltigkeit ihrer empirischen Gesetze) ein transzendentales Prinzip. Denn der Begriff von den Objekten, sofern sie als unter diesem Prinzip stehend gedacht werden, ist nur der reine Begriff von Gegenständen des möglichen Erfahrungserkenntnisses überhaupt, und enthält nichts Empirisches. Dagegen wäre das Prinzip der praktischen Zweckmäßigkeit, die in der Idee der Bestimmung eines freien Willens gedacht werden muß, ein metaphysisches Prinzip; weil der Begriff eines Begehrungsvermögens als eines Willens doch empirisch gegeben werden muß (nicht zu den transzendentalen Prädikaten gehört). Beide Prinzipien aber sind dennoch nicht empirisch, sondern Prinzipien a priori: weil es zur Verbindung des Prädikats mit dem empirischen Begriffe des Subjekts ihrer Urteile keiner weiteren Erfahrung bedarf, sondern jene völlig a priori eingesehen werden kann.
Daß der Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur zu den transzendentalen Prinzipien gehöre, kann man aus den Maximen der Urteilskraft, die der Nachforschung der Natur a priori zum Grunde gelegt werden, und die dennoch auf nichts, als die Möglichkeit der Erfahrung, mithin der Erkenntnis der Natur, aber nicht bloß als Natur überhaupt, sondern als durch eine Mannigfaltigkeit besonderer Gesetze bestimmten Natur, gehen, hinreichend ersehen. - Sie kommen, als Sentenzen der metaphysischen Weisheit, bei Gelegenheit mancher Regeln, deren Notwendigkeit man nicht aus Begriffen dartun kann, im Laufe dieser Wissenschaft oft genug, aber nur zerstreut, vor. »Die Natur nimmt den kürzesten Weg (lex parsimoniae); sie tut gleichwohl keinen Sprung, weder in der Folge ihrer Veränderungen, noch der Zusammenstellung spezifisch verschiedener Formen (lex continui in natura); ihre große Mannigfaltigkeit in empirischen Gesetzen ist gleichwohl Einheit unter wenigen Prinzipien (principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda)«; u. d. g. m.
Wenn man aber von diesen Grundsätzen den Ursprung anzugeben denkt, und es auf dem psychologischen Wege versucht, so ist dies dem Sinne derselben gänzlich zuwider. Denn sie sagen nicht was geschieht, d.i. nach welcher Regel unsere Erkenntniskräfte ihr Spiel wirklich treiben, und wie geurteilt wird, sondern wie geurteilt werden soll; und da kommt diese logische objektive Notwendigkeit nicht heraus, wenn die Prinzipien bloß empirisch sind. Also ist die Zweckmäßigkeit der Natur für unsere Erkenntnisvermögen und ihren Gebrauch, welche offenbar aus ihnen hervorleuchtet, ein transzendentales Prinzip der Urteile, und bedarf also auch einer transzendentalen Deduktion, vermittelst deren der Grund, so zu urteilen, in den Erkenntnisquellen a priori aufgesucht werden muß.