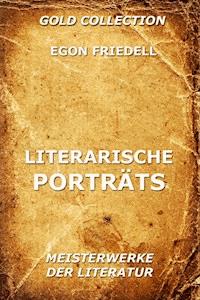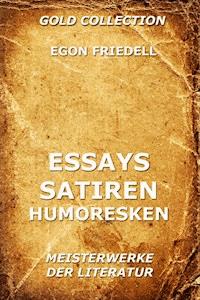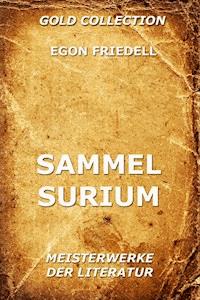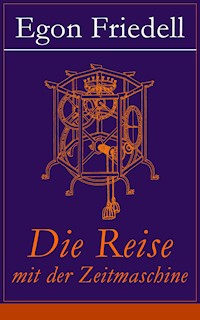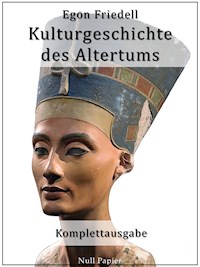
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sachbücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Der "geschichtsschreibende Schauspieler" (so der Verleger Hermann Ullstein über Friedel) schuf in seinem Werk "Kulturgeschichte des Altertums" eines der unterhaltsamsten Geschichtsbücher im deutschsprachigen Raum. Das Buch wurde ein großer Erfolg und (für historische Sachbücher erstaunlich) in mehrere Sprachen übersetzt. In einem minutiös durchtakteten Tagesablauf widmete sich der Autor nach 1920 seinem Opus Magnum "Kulturgeschichte der Neuzeit", das mit "Kulturgeschichte des Altertums" seinen posthum veröffentlichten Nachfolger fand. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1326
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Egon Friedell
Kulturgeschichte des Altertums
Leben und Legende der vorchristlichen Seele
Egon Friedell
Kulturgeschichte des Altertums
Leben und Legende der vorchristlichen Seele
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954188-47-5
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kulturgeschichte Ägyptens und des alten Orients
Einleitung – Die Mär der Weltgeschichte
Erstes Kapitel – Das Geheimnis Ägyptens
Zweites Kapitel – Der Turm von Babel
Drittes Kapitel – Gott und Erde
Viertes Kapitel – Die verzauberte Insel
Kulturgeschichte Griechenlands
Erstes Kapitel – Ionischer Frühling
Zweites Kapitel – Der Welttag Athens
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Sachbücher bei Null Papier
Aufstand in der Wüste
Das Leben Jesu
Vom Kriege
Geschmacksverirrungen im Kunstgewerbe
Ansichten der Natur
Über den Umgang mit Menschen
Die Kunst Recht zu behalten
Walden
Römische Geschichte
Der Untergang des Abendlandes
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Vorwort
Diese Kulturgeschichte des Altertums steht zu meiner dreibändigen Kulturgeschichte der Neuzeit in keiner unmittelbaren Beziehung: sie setzt deren Lektüre nirgends voraus, auch nicht an den seltenen Stellen, wo sie sich auf sie beruft; sie will aber auch nicht umgekehrt eine Art nachträgliche Einleitung zu ihr bilden; und sie stellt nicht einmal ein »Parallelwerk« dar, denn sie ist nach einer anderen Methode angelegt und ausgeführt. Man kann daher ebensogut dieses Werk vor jenem lesen wie jenes vor diesem, aber auch nur dieses oder nur jenes und sogar beide nebeneinander; und man kann auch keines von beiden lesen.
E. F.
Es ist mein tiefster Glaube, daß eine jegliche Arbeit, die das Recht auf diesen Namen hat, eine Berufung vom Sichtbaren auf das Unsichtbare ist, eine Anrufung höherer Mächte. Carlyle
Kulturgeschichte Ägyptens und des alten Orients
Leben und Legende der vorchristlichen Seele
Einleitung – Die Mär der Weltgeschichte
Versinke denn! Ich könnt’ auch sagen: steige! ’s ist einerlei. Entfliehe dem Entstandnen In der Gebilde losgebundne Reiche! Ergetze dich am längst nicht mehr Vorhandnen!
Faust
Die Dissonanz
Durch den donnernden Flutgang der Jahrtausende tönt eine Stimme, tröstend und warnend: des Menschen Reich ist nicht von dieser Welt. Aber daneben erklingt eine brausende Gegenstimme: diese Erde voll Glanz und Finsternis gehört Dir, dem Menschen; sie ist Dein Werk und Du das ihrige: ihr kannst Du nicht entfliehen. Und Du dürftest es auch gar nicht, selbst wenn Du es könntest! Wie sie geschaffen ist, furchtbar und wunderbar: Du mußt ihr die Treue halten. Diese unaufgelöste Dissonanz bildet das Thema der Weltgeschichte.
Man sollte nun meinen, ja man müßte geradezu fordern, daß jeglicher Geschichtsbetrachtung die Deutung dieses rätselhaften Widerstreits voraufzugehen habe. Denn sonst ist alle Historie ein verschleierter Schlüsselroman. Ehe wir dies nicht erklärt haben, können wir ja gar nicht anfangen. Aber wir können es nicht erklären! Hier sich Klarheit oder gar ein Wissen eintäuschen zu wollen, wäre eine Art feinerer Atheismus. In diesem Dilemma besteht das Wesen der Geschichtsphilosophie.
Jeder Mensch, ob er sich dessen deutlich bewußt ist oder nicht, ringt unaufhörlich mit dieser dunkeln Frage. Sie ist die Wurzel und Krone aller Religion, ja: sie zu stellen, ist bereits Religion. Sie verwandelt unsere farbenmächtigsten Künste und unsere fruchtbarsten Wissenschaften in grauen Dunst. Sie erfüllt unseren oberflächlichsten Alltag mit Tiefgang und nimmt unseren wuchtigsten Taten das Schwergewicht. Aber nur ein einziges Mal im Gange des uns bekannten Weltgeschehens ist der Versuch gemacht worden, sie ganz zu Ende zu denken und dadurch zu lösen; und dieser ist mißlungen. Er ist mißlungen; aber trotzdem verdient er unsere ernste und nachdenkliche Betrachtung.
Der unbekannte Gott
Der griechische Kunstschriftsteller Pausanias, der zur Zeit der antoninischen Kaiser seine »Rundreise«, eine Art Cicerone durch die hellenischen Sehenswürdigkeiten, verfaßte, berichtet in Übereinstimmung mit anderen Autoren, daß es in Griechenland von alters her Altäre gegeben habe, die »dem sogenannten unbekannten Gotte« geweiht waren, darunter einen neben der Bildsäule des Zeus von Olympia, dem weltberühmten Goldelfenbeinwerk des Phidias. Und der Kompilator Diogenes Laertius, der etwa ein halbes Jahrhundert später gelebt haben dürfte, erzählt in seinem Buch über »Leben, Lehren und Aussprüche der berühmten Denker«, einem mehr belletristischen als philosophischen, aber in den Angaben sehr zuverlässigen Werk, daß sogar »anonyme Altäre« vorhanden waren, die überhaupt keine Aufschrift trugen. Man versichert uns zwar, dies seien bloße Äußerungen einer religio eventualis gewesen, einer Religion für alle Fälle, die besorgte, man möge vielleicht einen Gott übersehen haben, der in Vergessenheit geraten oder nur im Ausland bekannt geworden sei, auch habe es auf jenen Altaraufschriften nur ganz allgemein geheißen: »Den unbekannten Göttern«, und die Berichterstatter hätten sich bloß verlesen, aus den anonymen Opfersteinen aber spreche die Verehrung einer Art von namenlosen »Gattungsgöttern«; indes, alle diese späten Kalküle einer engbrüstigen Philologenspitzfindigkeit tragen, so »belegt« sie sein mögen, den Stempel superkluger Unglaubwürdigkeit. Viel natürlicher und menschlicher, größer und einfacher wäre es, anzunehmen, schon in den Alten habe ein dunkles Gefühl dafür gelebt, daß der ganze Kreis der Olympischen und selbst der zur »reinen Vernunft« geläuterte Zeus nicht das Wesen der Gottheit umspanne, daß vielmehr einer noch fehle, der sich noch nicht geoffenbart habe und daher unbekannt sei; und zugleich namenlos, da er über allen Namen sei.
An ein solches Heiligtum, das in Athen dem unbekannten Gotte geweiht war, knüpft die Predigt an, die der heilige Paulus auf dem Areopag hielt. Er sagte: »Ihr Männer von Athen! Ich verkündige euch eben diesen Gott, den ihr bisher, ohne um ihn zu wissen, verehrt habt. Denn er ist ja nicht fern von einem jeglichen unter uns: in ihm leben, weben und sind wir.«
Das Licht der Gnosis
Jenes »Wissen um Gott« war auch das Ziel der gnostischen Bewegung, deren Blütezeit in die erste Hälfte des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts fällt. Gnosis ist Eingeweihtsein in die Mysterien des Himmels und der Erde, der Natur und der Geschichte, aber nicht durch Spekulation oder Empirie, sondern durch Offenbarung; sie ist mathesis, höhere Erkenntnis, gnosis soterias, Wissen des heiligen Weges. Sie ist das »Licht«, ein erleuchtetes Schauen, eine innere Erfahrung, man könnte auch sagen: Erfassen durch Intuition, wenn dieser Begriff durch seine heutige Anwendung auf das Schaffen des Künstlers und Forschers nicht schon zu sehr rationalisiert wäre. Diese höchst suggestive Geheimlehre, bilderwütig und orakelsüchtig, verwirrt durch mystifizierenden Formelspuk, barbarische Kultsymbole, abenteuerliche Allegorik, nebulose Weltentstehungslehren, schwankte zwischen Heidenchristentum und neuplatonischer Philosophie, sublimem Spiritualismus und massivem Zauberglauben, Ekstase und Begriffsspalterei unentschlossen hin und her und war auch in der Lebenspraxis halb Askese, halb Libertinismus, da beides sich als eine Konsequenz aus der grundsätzlichen Verachtung der Sinnenwelt rechtfertigen ließ. Denn das Herzstück aller Gnosis ist das Wissen des Geistes um seine Befreiung vom Erdenrest, die Erinnerung der Seele an ihren göttlichen Ursprung. Die vier Grundkräfte, die im Kosmos walten, sind die Materie, die Seele, der Logos und der Geist. Nach ihnen ordnet sich die Hierarchie der Wesen: zuunterst stehen die Gesteine, die bloß Materie sind; auf sie folgen die Pflanzen, die eine Ernährungsseele, und die Tiere, die eine Sinnenseele besitzen; über sie erhebt sich der Mensch, begabt mit der Kraft des Logos, der Vernunft, und befähigt zum Geist zu gelangen, dessen Stufen durch eine immer höher steigende Schar immaterieller Potenzen repräsentiert werden und vor dem Throne Gottes endigen. Auf dieser Leiter entspricht die Seele etwa dem Nervenleben, der Logos den rationalen Fähigkeiten, der Geist aber, das Pneuma, einem Vermögen, das nicht von dieser Welt ist. Dementsprechend gliedert sich auch die Rangordnung der Menschen in die Sarkiker, die bloß dem Fleisch leben, die Psychiker und die Pneumatiker. Reiner Geist und Gott sind dasselbe; aber, sagt der berühmte Basilides, der Hauptvertreter der sogenannten ägyptischen Gnosis, alles Positive und alles Negative, das man von Gott aussagen könne, habe nur den Wert eines Zeichens.
Dem über alles Denken erhabenen göttlichen Urwesen, dem »Unaussprechbaren, Unnennbaren, mit Schweigen Angerufenen« völlig entgegengesetzt ist die Materie, der Grund alles Bösen, aber zugleich das Nichtseiende. Sie ist das Werk des Bildners oder Demiurgen, eines von der Gottheit geduldeten untergeordneten Geistes, eines bösen, aber reuigen Wesens. Die Welt ist also eine Art Gegenschöpfung und zugleich eine Scheinschöpfung. Dies erkannt zu haben, ist identisch mit der Rückkehr zu Gott. Dieses Wissen bereits erlöst; aber nur dieses Wissen. Ohne Gnosis ist der Mensch verdammt. Die Gottheit, ungeworden, unsichtbar, unfaßbar, wie sie ist, war auch dem Demiurgen unbekannt; aber sie hat sich Christus offenbart und durch ihn allen, die der Gnade der Gnosis teilhaftig geworden sind. Nach der Auffassung des syrischen Gnostikers Saturnilus ist der Weltschöpfer einer der Engel Gottes; aber, fügt Valentinus hinzu, der Stifter einer der angesehensten gnostischen Sekten, der Mensch ist mehr als die Engel, die ihn schufen. Zwar herrscht auch im Reich der Seele der Demiurg: sie ist, wie Valentinus es sehr anschaulich ausdrückt, eine schmutzige Kneipe, in der die Dämonen aus- und eingehen. Aber der Mensch trägt in sich einen Funken des göttlichen Lichts, er ist »groß und elend«. Es ist dieselbe Formel, zu der anderthalb Jahrtausende später der größte Christ der gallischen Rasse, Blaise Pascal, gelangte: »Alles Elend des Menschen erweist seine Größe. Es ist das Elend eines großen Herrn, das Elend eines entthronten Königs.«
Der größte Ketzer
Indes hat es die ganze gnostische Bewegung nirgends zu mehr gebracht als zu verstreuten unterirdischen Gedankenkeimen, halben Ahnungen und widerstreitenden Aperçus. Zu Licht und Frucht sind sie erst im Geiste Marcions gelangt, eines religiösen Genies von großartiger Einfachheit, profunder Frömmigkeit und rasanter Denkschärfe, der aber seit vielen Jahrhunderten für die Nachwelt kaum einen Namen bedeutet. Marcion ist für das religiöse Bewußtsein der Gegenwart verschollen. Für die meisten Historiker der christlichen Kirche ist er »ein Gnostiker«. Er war aber weder dieses, vielmehr ein abgesagter Gegner der gnostischen Sekten: ihres buntgewürfelten Synkretismus, ihrer geheimniskrämerischen Esoterik, ihrer gewalttätigen allegorischen Methoden, noch war er überhaupt einer unter anderen, sondern eine einmalige Erscheinung von unwiederholbarer Prägnanz, die hart bis an die Grenze der Bizarrerie und Monomanie streift. Alle Mysterienweisheit, ja alle Philosophie gilt ihm als »leerer Betrug«, und er verhält sich zu den Gnostikern ähnlich wie Sokrates zu den Sophisten, dem ja auch das paradoxe Schicksal widerfuhr, daß er von seinen Zeitgenossen gerade jener Schule zugerechnet wurde, die er sein Leben lang aufs heftigste bekämpfte. Er war, um es mit einem Worte zu sagen, der größte Ketzer, der jemals aus dem Christentum hervorgegangen ist. Adolf von Harnack erklärt, keine zweite religiöse Persönlichkeit nach Paulus und vor Augustin könne an Bedeutung mit Marcion rivalisieren, und in der Tat bezeichnen diese drei die gewichtigsten Marksteine in der Entwicklung der katholischen Kirche: der größte Apostel, der größte Kirchenvater und der größte Häretiker. Bei Polykarp heißt er der Erstgeborene des Satans, bei Tertullian »antichristus Marcion«, Origenes hingegen rühmt ihm feurigen Geist und göttliche Gaben nach, ohne die er eine solche Häresie nie hätte stiften können, und Clemens Alexandrinus nennt ihn einen Giganten und Theomachen.
Er wurde um das Jahr 85 in Sinope am Pontus geboren, als Sohn des dortigen Bischofs, der ihn wegen der Irrlehren, mit denen er schon früh hervortrat, selbst exkommunizierte: ein Geist von diesem diamantenen Ernst und Diogenes, der Buffo der griechischen Philosophie, in dem diese wie in einem Satyrspiel sich selbst den Epilog spricht, waren Söhne derselben Stadt. Marcion begab sich zunächst nach Kleinasien, wo seine Doktrin zurückgewiesen wurde; dasselbe widerfuhr ihm in Rom: die dortige Gemeinde verdammte seine Thesen und schloß ihn aus. Damals war Marcion schon fast sechzig Jahre alt; der Tag seines Bruchs mit Rom wurde von der marcionitischen Kirche als Stiftungsfest gefeiert, ähnlich wie der Wittenberger Thesenanschlag von der lutherischen; er fiel in den Juli des Jahres 144. Ort und Zeit seines Todes sind unbekannt.
Die Marcioniten
Die Marcioniten waren nicht etwa eine Sekte wie die Montanisten, die Basilidianer, die Valentinianer und zahlreiche andere, sondern eine mächtige Gegenkirche, die im zweiten Jahrhundert mit der werdenden katholischen Kirche um die Vorherrschaft rang. Sie verehrten Marcion als ihren Stifter: sein Hauptwerk, die Antithesen, stand in ihrem Kanon, galt also als eine Art heilige Schrift; sie sahen im Himmel zur Rechten des thronenden Heilands Paulus sitzen, zur Linken Marcion. Er selbst aber hat sich niemals für etwas anderes gehalten als für einen getreuen Verkünder des Evangeliums und den wahren oder vielleicht auch: einzigen Schüler des Paulus. Sein Zeitgenosse Justinus bezeugt bereits: »Sein Evangelium erstreckt sich über das ganze Menschengeschlecht«, und etwa ein halbes Jahrhundert später versichert Tertullian: »Marcions häretische Tradition hat die ganze Welt erfüllt.« Kompakte Marcionitengemeinden fanden sich um jene Zeit in ganz Kleinasien und Syrien, auf Kreta und Zypern, in den Weltstädten Rom und Alexandria; ihr Ausbreitungsradius reichte von Persien bis Lyon. Noch im vierten Jahrhundert hielt man es in einzelnen asiatischen Gemeinden für notwendig, in das Glaubensbekenntnis einen Passus einzufügen, der sich gegen den Marcionitismus richtete; letzte Reste seiner Anhänger gab es im Orient noch im zehnten Jahrhundert. August Neander, einer der feinsten Kirchenhistoriker des Vormärz, hat Marcion den ersten Protestanten genannt. Wollte man diese Auffassung gelten lassen, so wäre der Protestantismus älter als der Katholizismus; jedenfalls aber hat es sich um ein gewaltiges Schisma gehandelt, das an Bedeutung hinter der Reformation nicht zurücksteht, nur hat es das umgekehrte Schicksal erlitten: es ist von der katholischen Kirche aufgesogen worden und in dieser Form aufbewahrt geblieben. Man kann daher sagen: der Marcionitismus hat sich behauptet, so gut wie der Protestantismus, nur in der Gegenreformation, etwa wie wenn eine Erneuerung der römischen Kirche seinerzeit das Luthertum, hegelianisch gesprochen, »aufgehoben«, nämlich zugleich negiert und konserviert hätte. Der Katholizismus hat vieles, das dadurch anonym weiterlebte, von Marcion übernommen, nur gerade den Wurzelgedanken seiner Lehre nicht, der auch in der Tat, wie wir bald sehen werden, für die Kirche unannehmbar war.
Die Verschwörung
Wir können uns den Gedankengang, durch den Marcion zu seiner Doktrin gelangte, noch heute ohne jede Mühe und Gewaltsamkeit nachkonstruieren. Die einzige heilige Schrift, die die Urchristen besaßen, war das Alte Testament. Indem er nun dessen Bücher als frommer Christ las, kam ihm eines Tages die Erleuchtung: Christus ist gar nicht der dort verkündete Messias, Christus ist ein ganz anderer! Daher sind die Juden vollkommen im Recht, wenn sie den Messias noch erwarten; Jesus aber, dessen Name nirgends im Alten Testament erwähnt wird, hat das Gesetz nicht erfüllt, sondern aufgelöst. Sein ganzes Leben war ein Kampf gegen das Gesetz und seine Lehrer. Er hat mit dem Alten Testament völlig gebrochen, das Band zerrissen, sich von Mose in allem geschieden und deutlich davor gewarnt, einen neuen Lappen auf ein altes Kleid zu flicken, neuen Wein in alte Schläuche zu gießen. Nur durch die allegorische Erklärung gewisser Bibelstellen kann überhaupt das Weissagungsprinzip aufrechterhalten werden; im Alten Testament darf aber nichts allegorisch, muß alles wörtlich und buchstäblich ausgelegt werden. Demnach ist Christus nirgends geweissagt, er ist unerwartet und plötzlich erschienen: der Sohn Gottes braucht keine Propheten, die ihn »bezeugen«; seine Zeugen sind seine Heilandsworte und seine Wundertaten. Man wird bei dieser Deduktion Marcions an einen Ausspruch Lagardes erinnert, eines der wenigen Menschen des neunzehnten Jahrhunderts, in denen der echt protestantische Geist des Protestierens noch einmal Fleisch geworden ist: »Es gibt ja noch Leute genug, welche das Verhältnis des Alten und Neuen Testaments als das von Weissagung und Erfüllung ansehen, während in Wirklichkeit nie eine Weissagung erfüllt ist. Erfüllt in dem gemeinen Verstand des Worts werden nur Wahrsagungen, und auf Wahrsagungen läßt sich eine Religion niemals ein.«
Wie aber konnte diese einfache und fast selbstverständliche Wahrheit den Christgläubigen so lange verborgen bleiben? Dies vermochte sich Marcion nur dadurch zu erklären, daß sogleich nach der Entrückung des Heilands eine ungeheure Verschwörung einsetzte und ihr finsteres Werk verrichtete. Dieses bestand in einer systematischen Verfälschung der Botschaft, die der Heiland in die Welt gebracht hatte. Nur ein Christentum, das von allen judaistischen Elementen völlig rein ist, kann als wahres Christentum gelten. Die vier Evangelien enthalten aber solche Bestandteile, also sind sie alle vier falsch. Paulus spricht immer nur von einem Evangelium, welches das Evangelium ist: also kann es nicht vier geben; eines aber muß es wiederum geben, folglich ist eines von den vieren bloß verfälscht. Die Wahl Marcions fiel auf Lukas, der in der Tat von allen Evangelisten am meisten Heidenchrist ist. Alle zwölf Apostel haben den Heiland nicht verstanden; darum mußte dieser sich in Paulus einen neuen Apostel erwecken, der die wahre Lehre verkündigte. Wie ein einziges Evangelium, so gibt es auch nur einen Apostel; aber auch dessen Briefe enthalten viel Judaistisches. Also sind auch sie falsch oder vielmehr, wie Lukas, verfälscht. Von diesen Überzeugungen ausgehend, unternahm es Marcion, den Christen eine heilige Schrift zu schaffen, bestehend aus dem Evangelium des Lukas und zehn Paulusbriefen, wobei er aber in aller Naivität selbst eine gewaltige Fälschung beging, indem er durch Kürzungen, die zum Teil sehr beträchtlich, und Zusätze, die allerdings meist nur geringfügig waren, einen »gereinigten« Text herstellte. Andrerseits ist es aber höchst merkwürdig, daß er dem Alten Testament, das er völlig verwarf, kein derartiges Mißtrauen entgegenbrachte; er erachtete es für ein durchaus zuverlässiges Geschichtswerk und hat keine Zeile darin redigiert.
Das Neue Testament
Indes durch dieses sonderbare Verfahren, das sich nur aus dem geringen Verantwortungsgefühl erklären läßt, das die Antike dem geschriebenen Wort entgegenbrachte, ist Marcion der Schöpfer des Neuen Testaments geworden. Vor Marcion galten die Evangelien weder als heilige Schrift noch befanden sie sich im Besitz sämtlicher Gemeinden; und Paulus wurde den Uraposteln keineswegs im Range gleichgestellt, da er nicht den Umgang des Herrn genossen hatte. Noch um 160 verweigerten die »Aloger«, die so genannt wurden, weil sie die Gleichung Jesus = Logos nicht billigten, dem Johannesevangelium, das diese Lehre vertritt, ihre Anerkennung; und andrerseits stand das »Ägypterevangelium«, dem später die Kanonisierung versagt wurde, noch vielfach in Gebrauch. Auch war der Text noch keineswegs in dem Maße fixiert, wie dies beim Alten Testament der Fall war. Hierin bestand die große theologische Tat Marcions: er setzte Urkunde gegen Urkunde, Schrift gegen Schrift, Evangelium gegen Gesetz, Apostolat gegen Prophetie. Erst durch Marcion ist die werdende katholische Kirche dazu geführt worden, dasselbe zu tun und ihren eigenen neutestamentlichen Kanon dem marcionitischen gegenüberzustellen. Paulus zitiert immer nur aus dem Alten Testament; andere schriftliche Autoritäten kennt er nicht. Erst um 200, als Marcion sicher schon tot war, besaßen die großen Kirchen des Westens ein »Neues Testament«: vier Evangelien und dreizehn Paulusbriefe, dazu die Apostelgeschichte, die als Bindeglied eingeschoben wurde, und die Apokalypse Johannis, die aber hundert Jahre später von den meisten Griechen wieder aufgegeben wurde. Die syrische Kirche hielt an einem einzigen Evangelium fest, dem »Diatessaron«, das Tatian, allerdings einer anderen Methode folgend als Marcion, aus den vier kanonischen Evangelien komponiert hatte. Aber erst im Jahr 367 proklamierte Athanasius den Kanon von siebenundzwanzig Büchern, den wir heute besitzen, indem er die sieben »katholischen« Briefe (zwei von Petrus, drei von Johannes, je einen von Jakobus und Judas) hinzufügte und den lange umstrittenen Hebräerbrief dem Paulus zuerkannte. Die Kirche hat, in der Weitherzigkeit ihrer Auswahl viel weniger dogmatisch als der Ketzer Marcion, einen bewunderungswürdigen Takt bekundet, indem sie, vor Widersprüchen der Überlieferung nicht zurückschreckend, das urchristliche Leben in seiner ganzen Gnade und Fülle durch die Zeiten gerettet hat.
Der gute Fremde
Wenn aber Christus nicht der Messias war, was war er? Der Sohn Gottes! Aber welches Gottes? Doch nicht des alttestamentlichen, dessen Gesetz er zerstört hat? Hier erhebt sich das ungeheure Problem, dem Marcion mit der größten Kühnheit ins Auge geblickt hat. Er entschloß sich, nicht nur Altes und Neues Testament, sondern auch den Gott Mosis und den Gott Christi völlig voneinander zu trennen. Dieser Scheidung und Gegenüberstellung diente eben sein Werk Antithesen, worin in streng zweigliedriger Anordnung die beiden Welten miteinander konfrontiert wurden. So sagt zum Beispiel der Judengott zu Mose beim Auszug aus Ägypten: seid bereit, beschuht, die Stäbe in den Händen, die Säcke auf den Schultern, und traget alles Gold und Silber mit euch davon; der Herr aber sprach zu seinen Jüngern bei ihrer Aussendung in die Welt: habt keine Schuhe an den Füßen, keinen Sack auf dem Rücken, kein Geld in den Gürteln! Josua hat mit Gewalt und Grausamkeit das Land erobert, Christus verbietet alle Gewalt und predigt Barmherzigkeit und Frieden. Im Gesetz heißt es: Aug’ um Auge, Zahn um Zahn, im Evangelium: wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Der Gott des Alten Testaments verlangt Gehorsam und richtet die Ungehorsamen, der Gott Jesu verlangt nur Glauben und straft die Sünder nicht. Der alte Gott war schon Adam und allen folgenden Geschlechtern bekannt, der Vater Christi war unbekannt, wie Christus selbst bezeugt hat: niemand hat den Vater erkannt außer der Sohn. Und als Petrus in Cäsarea das große Bekenntnis zur Gottessohnschaft seines Meisters ablegte, mußte dieser ihm Schweigen auferlegen, denn Petrus hielt ihn fälschlich für den Sohn des anderen Gottes.
Wie verhält sich nun nach Marcions Konzept der bekannte, wie der unbekannte Gott zur Welt und zum Menschen? Der Bekannte hat die Welt geschaffen: er ist der Demiurg; der Unbekannte hat bloß seinen Sohn gesandt. Er ist außer der Welt, ein hyperkosmisches Wesen, die Welt geht ihn nichts an. Er ist der »Fremde«, der »gute Fremde«: in allen marcionitischen Gemeinden und allen Sprachen, deren sie sich bedienten, war dies die Bezeichnung für die Gottheit. Das Evangelium ist die frohe Botschaft vom fremden Gott: Unser Raum ist die Welt, die grauenvolle Welt des Schöpfergottes, der gute Gott aber winkt uns in eine selige Ferne. Wir leben auf der Erde nicht etwa im Exil: Sie ist unsere Heimat, und wir können ihr nur entrinnen, wenn wir uns von ihrem und unserem Schöpfer lossagen. Dies ist die großartigste Leugnung der Materie, die vielleicht jemals durch eines Menschen Haupt gegangen.
Der fremde Gott ist reine Güte und nichts als Güte; keine anderen Eigenschaften können von ihm ausgesagt werden. Sein ganzes Wesen erschöpft sich in erbarmender Liebe, seine Wirksamkeit in Selbstoffenbarung, die identisch ist mit Erlösung. Eben weil dieser Gott ganz Liebe ist, hat er sich aus purer Gnade eines Gebildes angenommen, das ihm völlig fremd ist: Er ist die unbegreifliche Liebe. Und eben weil er ganz und gar nicht von dieser Welt, nicht einmal als ihr Schöpfer mit ihr verbunden ist, vermag er die Menschen über die Welt zu erheben. Dies ist das unfaßliche Mirakel der christlichen Heilsbotschaft. »O Wunder über Wunder, Verzückung, Macht und Staunen, daß man gar nichts über das Evangelium sagen, nichts darüber denken, es mit nichts vergleichen kann«: So lauteten die ersten Worte der Antithesen.
Betrachten wir es recht, so ist jener geheimnisvolle Fremde niemand anders als der »liebe Gott«, zu dem noch heute jedes kleine Kind betet. Denn die Metaphysikerfrage, ob Gott die Welt »geschaffen« habe, bekümmert eine reine und ursprüngliche Frömmigkeit nicht; ihr genügt, daß er ist.
Der gerechte Demiurg
Welche Eigenschaften aber besitzt der Demiurg? Er ist, sagt Marcion, weder αγαϑός noch κακός, weder gut noch böse, sondern δίκαιοςκαὶπονηρός, gerecht und schlimm, nicht malus, aber conditor malorum, Urheber der Übel: ein Gott, der seine Sache schlecht gemacht hat. Er sandte die Sintflut, den Brand Sodoms, die ägyptischen Plagen, er bestraft die Väter an den Kindern und begünstigt sündhafte Menschen: den ehebrecherischen David, den unzüchtigen Salomo, den betrügerischen Jakob. Das vernichtendste Argument gegen ihn aber ist die Welt selbst, seine ganze Schöpfung. Und es reut ihn auch, daß er sie gemacht hat. Daß aber in einer solchen Welt für den Menschen die Askese das einzig mögliche Verhalten ist, ergibt sich von selbst. Und auch hier ist Marcion bis ans Ende gegangen: Er gebot nicht nur größte Enthaltsamkeit in Speise und Trank (die Ernährung, sagt Tertullian, halten die Marcioniten gewissermaßen für etwas Entehrendes), sondern untersagte auch seinen Gläubigen jeglichen Geschlechtsverkehr und taufte nur Ehelose oder die Verehelichten, die Keuschheit gelobten; denn wer sich fortpflanzt, hilft die Welt des Demiurgen verewigen, und weil wir Söhne des Höchsten geworden sind, soll die leibliche Sohnschaft aufhören.
Der Demiurg ist nicht etwa der Widersacher des fremden Gottes: dies kann er schon deshalb nicht sein, weil er ihn ja gar nicht kennt, und seine Welt ist auch keineswegs teuflisch, viel mehr so gut, wie sie eben, aus Materie gemacht, sein kann. Er ist nicht das Prinzip des schlechthin Bösen wie Satan oder Ahriman oder wie »Mâra, der Versucher« in der buddhistischen Religion. Aber was ist er? Hier gelangt Marcion zu einem der zartesten und erhabensten Gedanken, die je ein Mensch gedacht hat: der Schöpfer der Welt ist gerecht! Deshalb ist er nicht böse; aber deshalb ist er auch nicht gut. Deshalb konnte er nur die »schlimme Welt« schaffen, in der alles gerecht zugeht, aber nicht gut, in der gerichtet wird, aber nicht geheiligt, in der die Rache herrscht, aber nicht die Gnade. Christus aber, der Sohn des fremden Gottes, hat die Liebe gebracht, die von der Welt erlöst, von allem in dieser Welt, auch von ihrer Gerechtigkeit. Sogar in die Unterwelt ist er hinabgestiegen und hat alle Verworfenen befreit: den bösen Pharao, die Sodomiter, alle Heiden, selbst Kain. Nur Abel, Henoch, Mose, alle Patriarchen und Propheten konnten nicht gerettet werden. Denn sie glaubten an den Schöpfergott und seine Welt der Gerechtigkeit. Nur der Sünder kann erlöst werden, denn er vermag die grundlose Gnade und uferlose Liebe des fremden Gottes zu erkennen, der Gerechte aber nicht, denn er ist im Gesetz verhärtet, in Gesetzestreue und Gesetzesstolz blind für das Licht aus der Fremde.
Messias
Versuchen wir uns das theologische System Marcions in großen Zügen zu vergegenwärtigen, so springen als seine reformatorischen Hauptgedanken ins Auge: die Leugnung der Messianität Jesu, die Ausscheidung des Alten Testaments aus dem christlichen Kanon und der Dualismus des fremden Gottes und des Schöpfergottes. Daß Christus nicht der jüdische Messias war, kann wohl von keiner vorurteilslosen Betrachtung geleugnet werden. Ursprünglich ist der Messias bekanntlich ein weltlicher Nationalheros, aber auch in der geläuterten Auffassung des späteren Judentums ist er niemals der leidende Messias, der die Schuld der ganzen Menschheit sühnt. In keinem einzigen der Zukunftsbilder, sosehr sie sich im Laufe der vielen Jahrhunderte gewandelt haben, ist von seinem Opfertode die Rede. Die berühmte Stelle aus Deuterojesaja, die einzige, die so gedeutet werden könnte, versteht unter dem »leidenden Gottesknecht« ein Kollektivum und ist überhaupt nicht Weissagung, sondern Rückblick. Ist aber der Heiland nirgends im Alten Bunde verkündigt, welche Beziehung besteht dann zwischen den beiden Teilen der Bibel? Nach Marcion verhalten sie sich wie polare Gegensätze, nach der Auffassung der Kirche wie Stufen: das Alte Testament ist legisdatio in servitutem, das Neue Testament legisdatio in libertatem. Aber ist das Judentum wirklich eine Art Vorhalle des Christentums? Wenn man will, ist alles Vorhalle, und eine im vorigen Jahrhundert sehr beliebte, heute glücklicherweise schon im Verschwinden begriffene Geschichtsmethode pflegte jedes historische Phänomen mosaikartig aus »vorbereitenden Momenten« aufzubauen. Dann freilich sind nicht bloß Mose und Daniel, sondern auch Plato und Philo, Buddha und Zarathustra Vorläufer des Christentums. Aber das Christentum hat keinen »Unterbau«! Eben weil Marcion das schlechthin Neue, Weltumwandelnde des Evangeliums so erschütternd empfand, wollte er von einem Alten Testament als Heiliger Schrift nichts wissen, ohne daß er geleugnet hätte, daß darin viel Nützliches und Schönes zu lesen sei. Deshalb erlaubte er auch seinen Jüngern dessen Lektüre; jedoch nur an der Hand der Antithesen. Aber es ist schon so, wie Harnack sagt: »Was christlich ist, kann man aus dem Alten Testament nicht ersehen.« Dasselbe hatte bereits Schleiermacher erkannt. Aber auch Nietzsche empfand mit voller Deutlichkeit, daß es sich hier um zwei ganz verschiedene Ebenen handelt, als er (natürlich von seinem Standpunkt des »Antichrist«) in Jenseits sagte: Dieses »Neue Testament, eine Art Rokoko des Geschmacks in jedem Betrachte, mit dem Alten Testament zu einem Buche zusammengeleimt zu haben, als ›Bibel‹, als ›das Buch an sich‹: das ist vielleicht die größte Verwegenheit und ›Sünde wider den Geist‹, welche das literarische Europa auf dem Gewissen hat«; und in der Morgenröte spricht er von dem »unerhörten philologischen Possenspiel«, das man um das Alte Testament herum aufgeführt habe: »Ich meine den Versuch, das Alte Testament den Juden unter dem Leib wegzuziehen, mit der Behauptung, es enthalte nichts als christliche Lehren und gehöre den Christen als dem wahren Volke Israels: während die Juden es sich nur angemaßt hätten … überall sollte im Alten Testament von Christus und nur von Christus die Rede sein … alles Anspielungen und gleichsam Vorspiele des Kreuzes!«
Das Buch der Rache
Gerade weil das Alte Testament in einzelnen Teilen ein Dokument der reinsten und erhabensten Ethik ist, die überhaupt vor dem Erscheinen des Heilands möglich war, darf man jene anderen Partien nicht geflissentlich übersehen, in denen der Gegengeist sich offenbart: die Predigt der Rachsucht und Roheit, des Hasses und Hochmuts. Man denke zum Beispiel an die Eroberung des Gelobten Landes: nichts als Mord und Tücke, giftige Schadenfreude, teuflische Grausamkeit, ein einziger langer Jubelschrei des Blutrausches: »Keiner blieb übrig!« Man darf freilich diese kranken Halluzinationen einer zügellosen Vernichtungswut nicht allzu wörtlich nehmen, denn die nachexilischen Juden (von denen diese späte Schilderung stammt) waren groß im Aufschneiden; aber es bleibt das barbarische Behagen an diesen in der Phantasie wollüstig nachgeschmeckten Animalitäten. Nirgends die geringste Anwandlung, die Seele des Feindes zu achten, ja auch nur zu beachten: er ist nur Schlachtvieh. Dieser erschütternde Kampf zwischen zwei Welten, der sich durch das ganze Alte Testament zieht, macht dieses zu einem der dramatischsten Bücher der Weltliteratur.
Man sagt uns zwar, diese Dinge müßten »entwicklungsgeschichtlich« betrachtet werden: dieser Jahwe der Wüste sei nur eine Art »Vorjahwe«, es handle sich hier (und anderwärts im Alten Testament) um eine frühe Schicht der israelitischen Gottesvorstellungen, die sich nur gleichsam illegitim behauptet habe. Aber ist der Gegenstand der Bibel die hebräische Geschichte oder der christliche Glaube? Was wir aus dem Buch der Bücher zu empfangen wünschen, ist Anleitung zum seligen Leben, nicht zur Religionswissenschaft. Wir wollen daraus erfahren, wie wir zu Gott gelangen können, nicht, wie die Juden allmählich zu ihrem Gott gelangten. Dieses gewiß höchst lehrreiche, ja sogar erbauliche Thema möge der Ethnolog, der Altertumsforscher, der Geschichtspsycholog, der Kulturphilosoph ergründen: ein christliches Problem ist es nicht.
Das Alte Testament ist, wie jedermann weiß, eine Sammlung von literarischen Produkten sehr ungleichen Alters und sehr ungleichen Werts. Eine Sichtung und Redaktion hat wohl im Lauf der Zeiten stattgefunden; aber sie geschah nie nach religiösen Gesichtspunkten: nämlich nicht nach den Gesichtspunkten der einzigen Religion, die diesen Namen verdient: der christlichen. Als Christus erschien, war der Text des Alten Testaments bereits unwiderruflich fixiert, und wir haben bereits gehört, daß es bis auf Marcion die einzige heilige Schrift auch für die Christen bildete und daß selbst Marcion es nicht wagte, seinen Inhalt durch Streichungen oder Änderungen zu korrigieren. Das Judentum, wie es sich nach dem Exil entwickelt hat, ist von allem Anfang an eine Buchreligion gewesen, im Gegensatz zum Urchristentum, das in erster Linie Botschaft, Predigt, Gemeindebewußtsein war. Es liegt in der Natur einer solchen Religion, daß sie einen übertriebenen Respekt vor dem »Es steht geschrieben« bekundet und dazu neigt, alles »Alte«, soweit es literarisch bezeugt ist, kritiklos für »heilig« hinzunehmen; und dazu kommt noch, daß die Juden immer eine besondere Vorliebe für Schriftliches hatten: alles in Buchstaben Fixierte ist für sie eine Wahrheit höherer Ordnung und daher bis zu einem gewissen Grade sakrosankt; nur ein geschriebener Vertrag ist wirklich gültig, dieser aber unter allen Umständen: und das ganze Alte Testament ist ja eigentlich nichts anderes als ein immer wieder erneuerter Vertrag zwischen Jahwe und Israel, der fortlaufende Schriftsatz eines Prozesses zwischen Volk und Gott. So kam es, daß sie in der Auswahl wenig rigoros waren und vieles mitschleppten, was sie selbst nicht mehr glaubten.
Der Sündenfall
Aber es gibt ein Stück im Alten Testament, um deswillen man fast versucht wäre, alles übrige in den Kauf zu nehmen, und es steht ganz am Anfang: es ist die Geschichte vom Sündenfall. Die Sünde der ersten Menschen besteht darin, daß sie vom Baum der Erkenntnis essen; der Verstand ist also das Böse, er ist nicht von Gott, sondern vom Teufel, »des Teufels Hure«, wie Luther sich drastisch ausdrückte, die Mitgift der Schlange, auf deren Rat es zum Genuß der verbotenen Frucht kommt. Er ist die große Versuchung des Menschen, die dieser nicht bestanden hat. Und seine Strafe dafür ist die Arbeit, zu der er verflucht wird. Erkenntnis und Arbeit sind fortan das Los des Menschen, seine Erbsünde und sein Erbfluch. Und seitdem muß er sterben.
Aber wo in der grauen Geschichte des Alten Bundes kehrt dieses machtvoll angeschlagene Leitmotiv wieder, obgleich es doch, so sollte man annehmen, wie ein eherner Glockenton durch das ganze fernere Menschheitsdrama schallen müßte? Als Adam und Eva vom Apfel gegessen hatten, sahen sie, daß sie nackt waren, das heißt: sie erkannten, daß sie Mann und Weib waren: also auch Geschlechtlichkeit ist Sünde. Die höchsten Güter aber, die alle Frommen Israels preisen, Könige und Propheten, Priester und Patriarchen, sind unbegrenzte Fruchtbarkeit des Menschen, unerschöpflicher Segen der Erde, unfehlbares Wissen um das Gesetz: Brunst, Arbeit, Erkenntnis; der dreifache Adamsfluch.
Und in der Tat ist der Anfang der Genesis ein eingesprengter Fremdkörper. Schon eine sehr alte babylonische Abbildung zeigt einen Baum, zur Rechten einen Mann, zur Linken ein Weib und dahinter eine Schlange. Das Paradies entspricht den Inseln der Seligen in der epischen Dichtung der Babylonier. Dort findet sich auch die Verführungsgeschichte. Die Entstehung des ganzen Abschnittes fällt in die Zeit der Assyrerherrschaft, die in Palästina eine Periode des religiösen Synkretismus war. Deshalb sagt auch Schopenhauer: »Die Verbindung des Neuen Testaments mit dem Alten ist im Grunde nur eine äußerliche, eine zufällige, ja erzwungene, und den einzigen Anknüpfungspunkt für die christliche Lehre bot dieses nur in der Geschichte vom Sündenfall dar … der im Alten Testament wie ein hors d’œuvre dasteht.«
Zwischen der Gottheit des Alten und der Gottheit des Neuen Testaments kann es daher nicht Identität oder Harmonie, auch nicht das Verhältnis halber und voller Offenbarung geben, sondern nur schroffe Alternative. »Ihr müßt«, sagt Kant, »zwischen Jahwe, dem deus ex machina, und Gott, dem deus ex anima, wählen, für beide ist nebeneinander nicht Platz.«
Der Fürst der Welt
Warum aber hat Marcion Adonai nicht einfach als falschen Gott verworfen? Weil er überzeugt war, daß dieser die Welt wirklich regiert. Als sein Werk verkündet sie seinen Namen. Und der Mensch ist sein Ebenbild, ein kleiner Gott, freilich: ein Judengott. Auch hierfür ließe sich manche Andeutung im Neuen Testament finden. Im ersten Brief Johannis heißt es: »So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters … denn alles, was in der Welt ist … ist nicht vom Vater, sondern von der Welt«, und in dem Evangelium desselben Johannes sagt der Heiland zu den Juden: »Ihr seid von Eurem Vater, dem Teufel.« Von hier bedurfte es für Marcion offenbar nur eines Schritts, um dem Demiurgen, dem Vater des Bösen, dem Herrn der Erde oder wie man ihn sonst nennen will, Schöpferkräfte zuzuerkennen und ihm die Welt zuzuschreiben. Auch Augustinus lehrt im Einklang mit fast allen Kirchenvätern, das Reich der Welt sei ein magnum latrocinium, eine große Räuberhöhle, von Dämonen regiert. Das Böse, sagt Kant, ist der Fürst dieser Welt, das Gute ist nicht von dieser Welt, das Böse ist nur von dieser Welt.
Der gute Gott muß daher notwendig der fremde Gott sein. Er ist, wie Meister Eckhart sagt, von der Welt »abgeschieden«: »Wißt ihr, wovon Gott Gott ist? Davon, daß er ohne alle Kreaturen ist! Selbst als er Himmel und Erde schuf und alle Kreatur, das ging seine Abgeschiedenheit sowenig an, als ob er nie etwas geschaffen hätte.« Und der fremde Gott kann nur der unbekannte sein; auch dies predigt Meister Eckhart: »Wollt ihr Gott aber in Wahrheit erkennen, so müßt ihr einsehen, daß er etwas Unbekanntes ist! Dionysius hat das gesagt«; und in der Tat lehrte dieser, Gott lasse sich nur durch Verneinungen, lautlos und im Dunkel erkennen. Insofern kann man sagen, daß jeder wahre Christ zugleich Gnostiker und Agnostiker ist. »Erhabener, lebendiger Wille«, ruft Fichte in der »Bestimmung des Menschen«, »den kein Name nennt und kein Begriff umfaßt, wohl darf ich mein Gemüt zu Dir erheben, denn Du und ich sind nicht getrennt … Wie Du für Dich selbst bist und Dir selbst erscheinst, kann ich nie einsehen. Nach tausendmal tausend durchlebten Geisterleben werde ich Dich noch ebensowenig begreifen als jetzt, in dieser Hütte von Erde.«
Wir sehen, wie die tiefsten christlichen Denker um den Marcionitismus ihre Kreise ziehen, ohne daß sie ihn doch jemals zu berühren wagen. Denn in der Tat: hier herrscht in rätselhafter Durchdringung lauterstes Licht und dazwischen schrecklichste Finsternis: nämlich Zweigötterei! Wäre dies nicht, so wären wir vielleicht heute alle Marcioniten. Der Marcionitismus ist etwas Schauerliches, zweifellos: und trotzdem kann man ihn nicht unchristlich nennen.
Die Weltschöpfung durch Luzifer
Aber vielleicht ist der Demiurg bloß ein Engel des guten Gottes? Wir haben schon gehört, daß der Gnostiker Saturnilus dies behauptete; auch Apelles, der bedeutendste Schüler Marcions, der aber dessen ebenso kühnes wie konsequentes System doch schon stark umgebogen und verwässert hat, lehrte die Monarchie Gottes und wies dem Schöpfer nur einen untergeordneten Rang an. Wir könnten auch sagen: der Demiurg ist Luzifer, der gefallene Engel; sein Fall besteht eben darin, daß er die Welt geschaffen hat. Eine Weltschöpfung durch Luzifer würde nicht der Allmacht Gottes widerstreiten, denn Gott, über allem Schaffen und Nichtschaffen thronend, vermag jeden Schöpfungsakt zuzulassen. Ob man hierbei die kosmologischen Vorstellungen der Genesis oder der heutigen Astronomie im Auge hat, ist für den theologischen Aspekt belanglos: es ist völlig gleichgültig, ob man sagt, Gott (oder Luzifer) habe die Welt geschaffen, oder ob man sagt, er habe die Erde geschaffen, denn dem Menschen ist von Gott, seinem Vater, die irdische Laufbahn aufgegeben und nur diese; Milchstraßen und Spiralnebel können daran nichts ändern und verschieben das Problem auf eine falsche Ebene, wodurch nur Konfusion entstehen kann.
Ferner könnte man versuchen, sich den Marcionitismus dadurch annehmbarer zu machen, daß man sich vorstellt, die Schöpfung Luzifers sei eine Scheinwelt. Das ist sie natürlich. Weshalb auch, im naiven, aber tief symbolischen Volksglauben so gut wie bei allen Theosophen und Mystikern, Satan immer als der Realist gekennzeichnet ist. Darin eben besteht seine Hinterlist. Aber andrerseits muß er zwangsläufig diesen Standort einnehmen, denn wollte er diese Welt als Schein, Traum und Trug demaskieren, so müßte er ja sein eigenes Werk diskreditieren. Aus demselben Grunde ist er stets der hartnäckige und exklusive Rationalist (so erscheint er auch noch in seiner letzten, völlig verbürgerlichten Form bei Goethe), denn das Organ, womit diese Welt als die »wirkliche« erkannt wird, ist der Verstand. Dies meint ja auch der Name Luzifer, Lichtbringer (und nicht viel anders verhält es sich mit dem gestürzten Halbgott Prometheus, dem Feuerbringer oder Vater der Technik). Und schließlich ist Satan auch Sensualist, Verteidiger und Förderer der Sinnenlust, denn die Sinne bestätigen ebenfalls seine Welt. Für das gesunde Empfinden aber ist er der Winkeladvokat, Taschenspieler und Oberintrigant, seine »Realität« Schwindel, seine Ratio Sophistik, seine Sinnenbejahung Versuchung.
Das Satansspektakel
Denn es ist höchst unwahrscheinlich, daß es öfter als hie und da einen Menschen gegeben hat, der an die Realität wirklich und wahrhaftig, mit voller Überzeugung und Inbrunst, ohne jeden Abstrich und Vorbehalt geglaubt hätte. Alle unsere Erlebnisse und Erkenntnisse, Taten und Theoreme umgibt ein trüber Hof von Ungewißheit. Zwischen uns und die Dinge ist ein Flor gespannt, wie im Theater, wenn »Vision« markiert werden soll. Alles, was »geschieht«, hat das Stigma des Provisoriums, Manövers und Intermezzos. Gerade auf den Höhepunkten unseres Daseins: in den Augenblicken der tiefsten Ergriffenheit durch die Macht der Natur, die Macht der Liebe, unsere eigene Macht, überfällt uns dieses Gefühl am stärksten. Es ist, wie Seneca sagt, »alles nur geliehenes Tafelgerät« und, nach Marc Aurels düsterer Weisheit, »unsere Zeit ein Augenblick, was zum Leib gehört, ein Strom, was zur Seele gehört, ein Traum, das Leben eine Reise in fremdem Land und der Nachruhm Vergessenheit«. Wer wagt es, »mein« zum Dasein zu sagen? Alle Dörfer dieser Welt sind von Potemkin. Es herrscht eine stillschweigende Übereinkunft unter allen, bloß so mitzumachen, und zugleich die Verabredung, kein Spaßverderber zu sein und über diese geheime Spielregel niemals laut zu sprechen. Schon der »Wilde« oder »Primitive« (und gerade er, weil er, naturnah, die Natur durchschaut), glaubt nicht an die Solidität der Szenerie und Maschinerie, die ihn umgibt, er hält sie für einen Zauber, ja vielleicht sogar für einen »faulen Zauber«. Aber wir alle wissen so gut wie er, daß wir in einem großen Spukhaus leben. Niemand ist, auch wenn er die Stimme des Zweifels zu dämpfen oder niederzuzischen versucht, in Wahrheit so dumm, seinem Verstand und dessen Gespinsten zu trauen. Es ist alles nur Rauch und Rausch, Wolkenspiel und Schleiertanz, eine Viertelstunde Regenbogen: »und selbst die Träume sind ein Traum«. Dies kommt daher, daß der Teufel bloß Blendwerk zu schaffen vermag, virtuose Imitation, von der sich nur der Intellekt foppen läßt, weil er selbst ein ohnmächtiges Satansspektakel ist.
Im Unsichtbaren
Aber dies alles erwogen: Man kann sich dennoch, so erhaben der Gedanke der grundlosen Güte des fremden Gottes ist, unmöglich mit der Voraussetzung abfinden, daß Gott bis zum Erscheinen seines Sohnes der Welt völlig abgewendet gewesen sei, daß er je eine rein luziferische geduldet habe. Denn da Gott die unendliche Güte ist, so muß diese alles berühren, auch was außer ihr ist, auch was gegen sie ist. Hier könnte uns vielleicht ein Rätselwort Marcions den Weg weisen, aber nur wie ein düsteres und flackerndes Fackellicht. Er sagt nämlich einmal, der gute Gott habe das Unsichtbare geschaffen. Meinte er damit, daß es neben der Welt des Demiurgen noch eine zweite Welt gebe, eine »gute« Welt, die entweder vor der materiellen bestand, als eine präexistente geistige, oder hinter der luziferischen besteht, als die »wahre«? Denn das Sichtbare ist nicht bloß das Böse, sondern auch das Unwirkliche. Wir wissen es nicht, denn der Text Marcions ist uns weder vollständig noch authentisch erhalten, er ist untergegangen und wir können ihn uns nur aus den Schriften rekonstruieren, die gegen den Marcionitismus gerichtet waren: es sind dies in erster Linie die christliche Apologie Justins, das große Werk des Irenäus Adversus haereses, die Stromata des Clemens Alexandrinus und die Fünf Bücher gegen Marcion, die Tertullian verfaßt hat. Sehr bemerkenswert ist es, daß der bedeutendste heidnische Polemiker der Frühzeit, Celsus, der in seinem »Sermo verus« einen umfassenden Angriff gegen das Christentum richtete, die marcionitische Kirche als eine der katholischen vollkommen ebenbürtige behandelte; ihm erwiderte der große Origenes in seiner Schrift Adversus Celsum.
»Warum«, fragt Celsus, »läßt der obere Gott einen schlechten Demiurgen, der sich ihm widersetzt, schalten und walten? Das ist mir ein verehrungswürdiger Gott, der danach trachtet, der Vater von Sündern zu sein, die von einem anderen verdammt und verworfen sind, und der nicht imstande ist, den er gesandt hat, zu rächen!« Man kann von Celsus, der kein Christ war, kein Verständnis dafür erwarten, daß der gute Gott gerade danach trachtet, der Vater der Sünder zu sein, und daß er den Tod seines Sohnes nicht rächt; aber der Einwand, warum er den Demiurgen frei schalten lasse, mußte in der Tat auch damaligen Christen zu denken geben. Vielleicht hat Marcion gemeint, daß der Geist Gottes, in Unsichtbarkeiten thronend, schon immer durch die Welt wehte und deren Lauf daher auf die Ankunft seines Sohnes angelegt war, welche freilich nur seiner Allwissenheit bekannt war. Doch das sind bloße Vermutungen; was aber Marcion mit voller Deutlichkeit und höchstem Nachdruck betont hat, ist die Fortdauer des demiurgischen Regiments auch während des christlichen Aeons. »Marcion glaubt«, sagt Tertullian, »daß er vom Reich des Schöpfers erlöst sei, aber in der Zukunft, nicht in der Gegenwart.« Die Herrschaft des Schöpfergottes endet also erst mit dem Jüngsten Gericht. Solange dieses Säkulum besteht, dauert auch noch die Regierung des Gottes dieses Säkulums.
Und so verhält es sich ja auch in der Tat. Das einzige, wodurch sich die christliche Welt von der vorchristlichen unterscheidet, ist das Wissen um Gott und seinen Sohn und der Glaube an dieses Wissen; Glauben aber heißt sich auf die unverdiente Liebe Gottes in Christo verlassen. Der luziferische Lauf der Welt hat sich nicht geändert. Daß aber Gott dennoch hienieden wirkt und webt, ist ebenso unbezweifelbar wie unerklärlich. Hier stehen wir, in dem tiefsten Sinne, der diesem Wort gegeben werden kann, im »Unsichtbaren«.
Das Gewissen
Dies ist alles, was eine christliche Geschichtsbetrachtung, die die Ehrlichkeit der Bequemlichkeit vorzieht, an Theodizee beizubringen vermag. Und dennoch sagt Gustav Droysen in der Einleitung zum zweiten Bande seiner Geschichte des Hellenismus mit Recht: »Die höchste Aufgabe unserer Wissenschaft ist ja die Theodizee.« Aber es ist eine unendliche Aufgabe. Gerade darin, daß sie immer wieder: von jedem Zeitalter, jedem Volk, jedem Stand, jedem Individuum aufs neue gestellt wird, erfüllt sich das historische Schicksal. »Über allem«, schreibt Ranke in einem Brief an seinen Bruder Otto, »schwebt die göttliche Ordnung der Dinge, welche zwar nicht gerade nachzuweisen, aber doch zu ahnen ist.« Diese göttliche Ordnung der Dinge ist identisch mit der Aufeinanderfolge der Zeiten.
Wir wissen nur von einem wirklich Gewissen: dem Gewissen. Das Gewissen ist die einzige (obschon fast unsichtbare) Tatsache, sowohl im privaten Leben wie im öffentlichen. Es richtet über alles, und nach ihm richtet sich alles; auch wenn die Menschen es nicht wissen oder leugnen. Dies ist der Weg der Seele; und alle anderen Wege sind nur falsche Spiegelungen. Die Weltgeschichte, von außen betrachtet, Geschichte der Macht, ist von innen gesehen, Geschichte des Gewissens.
Geschichte der Geschichte
Von der Geschichte hat es zu allen Zeiten eine Art Wissenschaft gegeben; aber mit sehr verschiedenen Methoden. Denn nicht nur jede Wissenschaft, sondern auch jedes Teilgebiet einer Wissenschaft erfordert seine besondere Methode, man kann auch sagen: seinen eigenen Stil. So besteht zum Beispiel zwischen Geschichte der Neuzeit und Geschichte des Mittelalters ein Unterschied nicht bloß des Themas, sondern auch der angemessenen Darstellungsart: das Mittelalter kann man nämlich nur als Theolog behandeln. Zu jener Zeit waren alle Menschen Theologen, vom Bauern bis zum Papst, also muß es doch wohl auch ihr Historiker sein. Tritt man mit dem Aspekt eines Profanen an diese Epoche heran, so entsteht: nun, man hat gesehen, was seit der Aufklärung entstanden ist. Andrerseits aber hat auch jedes Zeitalter selber, ja vielleicht schon jedes Menschenalter seine eigentümlichen Stilprinzipien, sozusagen »Baugedanken« im Hinblick auf die Wissenschaft im allgemeinen und deren sämtliche Einzeldisziplinen. So haben auch über Zweck und Wesen der Geschichtsschreibung nacheinander die unterschiedlichsten Auffassungen geherrscht. Schon über den Maßstab, nach dem man den Quellen »Autorität« zuzuschreiben habe, war man durchaus nicht immer derselben Ansicht. Im Mittelalter galten als absolut zuverlässiges Fundament alle Autoren, von denen man annahm, daß sie entweder direkt inspiriert seien oder doch auf inspirierten Berichten fußten, also in erster Linie alle Apostel, alle Kirchenväter, aber auch, mit gewissen Einschränkungen, sowohl die späteren Lehrer von Rang, die scriptores ecclesiastici, als auch die Hagiographen, die Verfasser der Heiligenlegenden. An ihre Stelle traten in der Renaissance alle antiken Autoren: Sie galten für sakrosankt; wahr, sagt der Humanist Manetti, sei alles, was zum Beispiel von Curtius, Justin, Livius, Sallust, Plinius und Sueton berichtet werde, was die Späteren erzählten, sei nur wahrscheinlich. Für die moderne Forschung spielt diese Rolle das sogenannte »diplomatische« Material: Gesandtschaftsberichte, Verwaltungspapiere, Verhandlungsprotokolle und ähnliche Urkunden, wie sie vornehmlich in den Archiven aufgestapelt sind. Es ist vielleicht nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, daß dieser Gesichtspunkt um nichts weniger subjektiv und daher um nichts wissenschaftlicher ist als die früheren; denn es ist beim besten Willen nicht einzusehen, warum das Zirkular einer Regierung keine Lüge und die Relation eines Attachés keinen Unsinn enthalten soll. Vielmehr muß der Begriff der absolut zuverlässigen Quelle für alle Zeiten und Völker dahin definiert werden, daß sie dazu wird, nicht weil sie »wahr« ist, sondern weil die Zeiten und Völker ihr glauben. Im Mittelalter glaubte man an die Kirche, in der Renaissance an die Antike und im neunzehnten Jahrhundert an die Behörde.
Was die Form der Geschichtsschreibung anlangt, so kann man sagen, daß jedem Zeitalter ein anderer Typus als Ideal vorgeschwebt hat, und fast jedem einer, der sich mit dem Begriff des Historikers nicht deckt. Im Altertum ist es der Rhetor. Die langen eingelegten Reden waren, obgleich durchwegs erfunden, die Glanzlichter und Kernstücke der Darstellung und entscheidenden Prüfsteine für das Talent des Geschichtsschreibers. Aber auch die übrigen Partien waren nach rhetorischen Gesichtspunkten geformt, nämlich für den lauten Vortrag, der in der Antike musikalischen Charakter hatte; sie waren eine Art von Partituren. Da man künstlerische Einheit forderte, so war alles verpönt, was von einer anderen Person und daher in einem anderen Stil verfaßt war. Deshalb wurden Reden, die so vorlagen, wie sie wirklich gehalten worden waren, sowie Briefe und überhaupt alle schriftlichen Belege stets umgearbeitet und der Ausdrucksweise des Autors angepaßt. Es ist dies eben das rhetorische Prinzip. Denn in einer Rede stört jeder fremde Ton.
Die mittelalterliche Geschichtsschreibung dient der Erbauung. Sie schildert die Taten Gottes durch Völker und Führer, die gesta Dei per Francos. Sie wäre vor dem Gedanken zurückgeschaudert, Selbstzweck zu sein. Zwischen einer Chronik und einer Predigt besteht kein Unterschied der Form. Beide sind ein Gefäß, in das frommer Sinn sein Gefühl ergießt. Darum vermeiden sie auch im allgemeinen das Individualisieren. Denn der homo religiosus denkt in Universalien. Diese Art, die Vergangenheit zu schauen, ist mit dem Mittelalter nicht verschwunden, sie hat in Bossuets gewaltigen Geschichtsdichtungen weitergeblüht und lebt noch in dem feurigen Schwung der zürnenden Kanzelreden Carlyles.
Die Historiker der Renaissance hingegen wollten spannen und erschüttern, Furcht und Mitleid erwecken. Ihr eingestandenes Vorbild waren die Tragödien Senecas. Neben die üblichen drei Dichtungsgattungen trat für sie als vierte die Historie. Waren die antiken Geschichtswerke Partituren, so waren die ihrigen gewissermaßen Libretti. Auch dieses Genre hat Nachtriebe hervorgebracht, zum Beispiel in den dramatisch bewegten Kompositionen Schillers, die ebenfalls von der großen Oper herkommen. Indes hat schon die Renaissance noch eine zweite Form hervorgebracht, die am vollsten von Machiavelli verkörpert ist. Für ihn ist die Geschichte Lehrmeisterin der praktischen Politik, Magazin der Staatskunst, Demonstrationssaal für Regenten und Diplomaten. Diese Art Historiographie hat bis in die jüngste Vergangenheit immer wieder Vertreter gefunden, ebenso wie die der Aufklärungszeit, die pikant und populär, haranguierend und polemisch, aktuell und tendenziös, kurz eine Art Zeitung ist: ihr glänzendster Vertreter war im achtzehnten Jahrhundert Voltaire, im neunzehnten Macaulay, aber auch die Weltgeschichte von Wells bewegt sich noch genau in derselben Richtung des eleganten Leitartikels eines liberalen Weltblatts. Aber es hat bekanntlich auch eine »romantische« Geschichtsschreibung gegeben, die sich an der Malerei orientierte: ihr Programmatiker war Chateaubriand, der die Parole von der »couleur locale« ausgab, und ihre Muster waren die pittoresken Sittenschilderungen Walter Scotts; und aus dem Impressionismus ist die »naturwissenschaftliche« Schule hervorgegangen, die im Historiker eine Art Eprouvettenchemiker und Fossilienanatomen erblickt: ihr faszinierendster Virtuose war Taine.
Wir sehen also, wie die Form der Geschichtsschreibung selber einem geschichtlichen Wandel unterworfen ist: Sie erinnert abwechselnd an eine Arie und ein Fresko, eine Exhorte und eine Parlamentsrede, ein Theaterstück und ein Laboratorium. Aber mit dem Inhalt verhält es sich nicht anders. Was ist das Objekt der Geschichte? Vielleicht erhalten wir hierüber bei jener höchsten Instanz Aufschluß, die schon in so vielen Fragen der Erkenntnistheorie klassische Entscheidungen gefällt hat, nämlich bei der Philosophie Kants.
Die ästhetische Urteilskraft
Kant nennt den »Inbegriff aller Gegenstände einer möglichen Erfahrung« Natur und knüpft daran die Frage: Wie ist Wissenschaft von diesem Gesamtkomplex der Erfahrung, wie ist Naturwissenschaft möglich? Oder mit anderen Worten: Gibt es Begriffe, die für alle Erfahrung Gültigkeit haben, und wenn dies der Fall ist, warum gelten sie? Es gibt solche Begriffe, zum Beispiel: Einheit des Ich, Substanz, Kausalität; und sie haben empirische Geltung oder, was dasselbe bedeutet, Realität, weil sie die Erfahrung machen, weil durch sie die Erfahrung überhaupt erst möglich wird. Kant nennt sie »reine« Begriffe, weil sie der Erfahrung nicht bedürfen, vielmehr ohne Zuhilfenahme der Erfahrung in uns entstanden sind, und das Vermögen, sie zu bilden, »transzendental«, weil es, als bloße Möglichkeit der Erfahrung, vor aller Erfahrung liegt, ihr vorhergeht. Alle Erfahrung wird nachträglich, a posteriori, gewonnen, diese Begriffe aber sind als die apriorische Ausstattung unseres Verstandes in uns allen von Anfang an vorhanden, und ebendarum haben sie allgemeine, notwendige und objektive Geltung; aber bloß für uns. Sie gelten, soweit die Erfahrung reicht; und nur so weit. Der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, vielmehr verhält es sich gerade umgekehrt: er diktiert sie ihr. Da aber die gesamte Natur durch die subjektive Organisation des Menschen (nicht des Individuums, aber der Gattung) bedingt, bestimmt und vorausbestimmt, da sie ein Produkt seiner Denkformen ist, so trägt sie den Charakter der bloßen Erscheinung.
Gegeben sind uns nur die Eindrücke oder Empfindungen. Indem wir diesen dunklen Stoff durch die uns innewohnende Anschauung in eine zeitliche und räumliche Ordnung, durch unseren Verstand in eine gesetzmäßige Verknüpfung bringen, entsteht erst Natur, Erfahrung, Realität. Was wir hinzubringen, ist lediglich die Form: Zeit und Raum, Kausalität und die anderen Kategorien. Aber die Form ist für die Erfahrung alles, ohne sie wäre nichts da, oder vielmehr: wir können nicht im geringsten sagen, was dann noch da ist. Was zurückbleibt, ist das »Ding an sich«, das Ding, wie es, abzüglich aller Apperzeption, die wir von ihm haben, an sich selbst ist, das Ding ohne unsere Vorstellungen, also das vollkommen Unvorstellbare.
Während die Kritik der reinen Vernunft sich mit der Untersuchung befaßt: was ist Wahrheit?, beantwortet die Kritik der Urteilskraft die Frage: was ist Schönheit? Der Gedankengang ist hier wiederum ein ganz ähnlicher. Wie die Naturgesetze ein Produkt unseres Verstandes, so sind die ästhetischen Gesetze ein Produkt unseres Geschmacks, einer ganz bestimmten Betrachtungsart, durch die die Objekte erst unter die Kategorie des Schönen gebracht werden. Schönheit ist ein Prädikat, das wir den Dingen verleihen, das ihnen ebenso hinzugefügt wird wie der Begriff der Kausalität dem Stoff unserer Erfahrung; nicht die Dinge sind ästhetisch, sondern unsere Vorstellungen von ihnen, unsere Urteile über sie. Das Vermögen, solche Vorstellungen zu bilden, nennt Kant die »ästhetische Urteilskraft«. (Die Bezeichnung ist nicht sehr glücklich gewählt, so wenig wie die Ausdrücke »rein«, »transzendental«, »Ding an sich« und überhaupt die meisten Vokabeln der kantischen Terminologie; aber man darf sich durch sie nicht abschrecken oder beirren lassen: es verhält sich hier ähnlich wie mit gewissen Ortschaften, bei denen im Baedeker die Warnung steht: »man achte darauf, daß bisweilen die Straßentafeln vertauscht sind«; deshalb können die Straßen noch immer vorzüglich angelegt und geführt sein.)
Die ästhetischen Urteile gründen sich auf ein universelles Gefühl, das Kant den ästhetischen Gemeinsinn nennt: eben weil es universell ist, ist es auch allgemein mitteilbar. Dadurch, daß die ästhetischen Vorstellungen auf einem apriorischen Gefühl beruhen, unterscheiden sie sich einerseits von den logischen Urteilen, die sich auf Funktionen des Verstandes stützen, und andrerseits von den Prädikaten der Nützlichkeit wie der Annehmlichkeit, da diese aus der Erfahrung geschöpft, also aposteriorisch, außerdem subjektiv und individuell, also nicht allgemeingültig sind. Das ästhetische Urteil aber tritt mit einem Gefühl der Universalität und Beglaubigung auf: »Die Lust, die wir fühlen, muten wir einem jeden anderen im Geschmacksurteile als notwendig zu.« Geschmacksurteile sind allerdings nicht beweisbar, weil sie eben nicht auf Begriffen beruhen. De gustibus non est disputandum. Aber dadurch entziehen sie sich auch dem Streit.
Die teleologische Urteilskraft
Der zweite Teil der Kritik der Urteilskraft handelt von der »teleologischen Urteilskraft«. Diese ist das uns eingepflanzte Vermögen, die Natur unter dem Aspekt der Zweckmäßigkeit anzusehen. Sie ist nicht Naturerkenntnis, sondern bloße Naturbetrachtung, eine Maxime der Naturbeurteilung. Sie hat wie alle anderen Vermögen ihre Wurzel in der Einrichtung unserer Vernunft, in einer bestimmten Beschaffenheit unseres Erkenntnisvermögens, die bewirkt, daß wir uns die Phänomene der organischen Natur nicht aus bloß mechanischen Ursachen erklären können, sondern nur durch die Idee der Zweckmäßigkeit. Die Prinzipien der teleologischen Urteilskraft sind heuristisch, »regulativ«, indem sie nicht Gesetze geben wie die Kategorien, sondern nur Richtlinien.
Erkennen können wir nur mechanisch wirkende Ursachen. Aber begreifen können wir die Lebenserscheinungen nur durch eine teleologische Betrachtungsweise. Dieses ist ein »als ob«, aber darum doch vom Range der Allgemeingültigkeit und Objektivität, denn sie ist eine vernunftnotwendige Ansicht. Die Zweckmäßigkeit wird ebenso wie die Schönheiten, die Kausalität zu den Dingen hinzugebracht, hinzugedacht, aber zwingend: durch die Struktur unserer Apperzeption. Die Formel für Frage und Antwort dieses Kapitels der kantischen Kritik würde demnach etwa lauten: wie ist Biologie möglich? durch unsere Zwecke setzende teleologische Urteilskraft.
Die historische Urteilskraft
Es ließe sich nun sehr wohl denken, daß Kant auch eine »Kritik der historischen Urteilskraft« verfaßt hätte. Wie seine »transzendentale Analytik« die Frage untersucht: wie ist Natur, oder auch: wie ist Naturwissenschaft möglich?, so hätte es sich hier um die Frage gehandelt: wie ist Geschichte, wie ist Geschichtswissenschaft möglich? Nach Kant ist, was wir Erfahrung nennen, ein Produkt unseres Verstandes und seiner Verknüpfungsbegriffe, Sittlichkeit ein Produkt unserer praktischen Vernunft (denn auch der kategorische Imperativ ist apriorisch), Schönheit ein Produkt unserer ästhetischen Urteilskraft und Zweckmäßigkeit ein Produkt unserer teleologischen Urteilskraft. Und ebenso ist Geschichte ein Produkt unserer historischen Urteilskraft.
Die historische Urteilskraft hat darin Ähnlichkeit mit der ästhetischen Urteilskraft, daß sie auch eine bestimmte Betrachtungsart ist, die die Erscheinungen erst zu historischen macht. Auch sie wurzelt in einem Gefühl, das universell und ebendarum auch allgemein mitteilbar ist. Das ästhetische Urteil ist, wie jedermann weiß, wandelbar, aber dennoch für das jeweilige Zeitalter oder Geschlecht, aus dem es geboren ist, stabil; ebenso verhält es sich mit dem historischen Urteil: Es gibt eine Art »historischen Geschmack«, der, obschon zeitgebunden, das Gepräge der Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit trägt, es gibt einen »historischen Gemeinsinn«. »In jeder Geistesperiode«, sagt der holländische Kulturhistoriker Huizinga, »besteht eine tatsächliche Homogenität des historischen Wissens … eine gewisse Katholizität der Erkenntnis«. Es herrscht in jedem einzelnen Kulturzeitalter ein unterirdischer Konsensus über den ganzen Vorstellungskomplex »Weltgeschichte«: seine Hauptprobleme, seine Entwicklungslinien, seine großen Etappen, seine repräsentativen Gestalten. Im ganzen achtzehnten Jahrhundert regierte das Schlagwort vom »finsteren Mittelalter«: selbst Herder spricht von der »Nacht der mittleren Zeiten«, und Robertson gebraucht »Dark Ages« geradezu als Synonym für Mittelalter. Um den Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wird das Mittelalter romantisch, und zu Anfang des zwanzigsten wird es expressionistisch. Es war natürlich nichts von alledem; aber für die Zeitgenossen dieser Stichwörter war dies seine unleugbare Realität. Die Adjektive »barock« und »gotisch« waren lange Zeit allgemein gebrauchte Schimpfnamen: wir sprechen ja auch heute noch von einem »barocken Stil« und meinen damit, daß er schrullenhaft, bizarr, verschnörkelt ist, und der junge Goethe bekennt: »Unter die Rubrik gotisch häufte ich alle synonymischen Mißverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Untergeordnetem, Unnatürlichem, Zusammengestoppeltem, Aufgeflicktem, Überladenem jemals durch den Kopf gegangen waren«: gotisch bedeutete damals noch dasselbe wie barbarisch. Johannes Duns Scotus, das Schulhaupt der Scotisten, wegen der Feinheit und Schärfe seiner Distinktionen doctor subtilis genannt, war einer der originellsten und geistvollsten Denker des ausgehenden Mittelalters; er wurde aber von der orthodoxen Scholastik wegen seines Nominalismus bekämpft, und infolgedessen war in Deutschland lange Zeit Duns der Spitzname für einen einfältigen, aufgeblasenen Menschen, und in England ist dunce noch jetzt ein Wort für Dummkopf. »Shakespearisch« ist heute wohl der lobendste Ehrenname, den man einem dramatischen Produkt erteilen kann, aber vor zweihundert Jahren war es noch ein sehr bedenkliches Prädikat: es bedeutete soviel wie roh, chaotisch, kunstlos; ein Pavian, sagte ein angesehener englischer Kunstkritiker aus der Zeit der Königin Anna, besitze mehr Geschmack als Shakespeare, und noch Voltaire nannte ihn einen trunkenen Wilden und gotischen Koloß, wobei gotisch natürlich wiederum im herabsetzenden Sinne gemeint ist. »Sophistes« heißt der »Weisemacher«, also soviel wie der Weise, und dafür galten auch ursprünglich die Lehrer der Sophistik, während »Philosoph« bloß der »Weisheitliebende« war; aber unter dem Einfluß des Platonismus haben diese beiden Vokabeln ihre Rangordnung getauscht: Sophistik bedeutet später geradezu das Gegenteil von Weisheit. »Liberalismus« war im neunzehnten Jahrhundert das edle Bekenntnis zu Fortschritt und Freiheit; heute befindet sich das Wort schon ganz merklich auf dem Wege zur Ehrenbeleidigung. »Jesuit« bezeichnet das höchste Ideal, das überhaupt einem Irdischen vorzuschweben vermag, nämlich Genosse Jesu; aber diesen Wortsinn fühlt heute niemand mehr, vielmehr muß man, wenn man den Ausdruck nicht als Kränkung gebraucht wissen will, dies ausdrücklich hinzu bemerken.
Der Autor der Geschichte
Es handelt sich aber in diesen und zahllosen anderen Fällen nicht um Privaturteile, austauschbare Gesichtswinkel, Wahlansichten, auch nicht um die Anschauungen gewisser Gruppen, die etwa durch tiefere Geschichtserkenntnis oder umfassenderes Geschichtswissen zu neuen Ergebnissen gelangt wären, sondern um die Meinung des Zeitalters selber. Sie kommt und geht; aber wodurch sie sich verändert, warum sie sich überhaupt verändert, das wissen wir nicht. Die Verwandlung ihres Antlitzes ist ein ebenso großes Rätsel wie das Verschwinden der Saurier, die Geburt der Sprache, das Aufleuchten eines neuen Sterns.