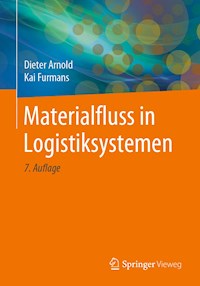Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vorbei. Zweitausend Jahre auf fast zweitausend Meter. Welt im Gebirge, in einem abgelegenen Tal südlich der Alpen. Grenzbereich von Tier und Mensch. Erzählt von Hund und Katz, von Bauern und Kühen, den Hühnern, von Arbeit und Erschöpfung, von Geburt und Tod, von hartem Brot und saurem Wein, von Winden und Wettern, von den Steinen der Berge und den Leuten vom Tal. Von der rettungslosen Liebe eines Mannes und einer Frau. Ihr Leben, noch ehe es vergeht. Alltäglich und einzigartig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorbei. Zweitausend Jahre auf fast zweitausend Meter. Welt im Gebirge, in einem abgelegenen Tal südlich der Alpen. Grenzbereich von Tier und Mensch. Erzählt von Hund und Katz, von Bauern und Kühen, den Hühnern, von Arbeit und Erschöpfung, von Geburt und Tod, von hartem Brot und saurem Wein, von Winden und Wettern, von den Steinen der Berge und den Leuten vom Tal. Von der rettungslosen Liebe eines Mannes und einer Frau. Ihr Leben, noch ehe es vergeht. Alltäglich und einzigartig.
Dieter Arnold, geboren 1952, lebt im Südwesten, verbrachte über die Jahre 1990–2004 viele Wochen bei den Menschen dort oben. Ihnen gilt seine tiefe Bewunderung.
Eine Erzählung
für R.
Vorbemerkung
Alle Charaktere und Orte sind Fiktion und Wirklichkeit. Indem wir uns ihre Ähnlichkeit aneignen und mit ihnen verschmelzen, macht ihre Verschiedenheit unsere Gleichheit mit ihnen nur um so wirklicher.
… eine ungeheure Entdeckung: sofort betrachtete ich den Felsblock als einen Freund, als ein beseeltes Wesen, das im Hinblick auf uns die besten Absichten hegte, uns rief und anlächelte, das ich früher schon gekannt und geliebt hatte, und das ich nun zu meiner Überraschung und meiner unendlichen Freude wiederfand…
Alberto Giacometti
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Epilog
I
Lebenszeichen. Zeichen für Krieger und Zeichen für Liebende. Zeichen für Männer und Zeichen für Frauen. Männerzeichen für Männer, die sich das Leben ausrechnen wollen. Frauenzeichen für Frauen, die hoffen, noch immer. Er versteht sie nicht. Was sind das für Zeichen? Er weiß, sie bestimmen sein Leben. Aber er kann sie nicht lesen. Wer hat sie gemacht und für welches Leben? Er wirft weiter Pfennigstücke. Der Baum und die Zahl. Drei Minuten und eine Minute. Manchmal teilt er sich den Tag danach ein. Morgens, mittags, abends. Das Fenster, der Tisch, und was gerade draufsteht. Geräusche, Zufall, Zeit. Zeichen des Anfangs sind schon Zeichen des Endes.
Es ist heiß. Staub auf der Straße ins Tal. Tief herab noch der Schnee vom Winter. Weit oben unter den Lärchen dunkle Kuhleiber. Ihr Geläut. Im Matsch am Bach entlang nach ihnen suchend, ist er bald durchnässt. Schnitzt sich einen Haselstecken zurecht, um in dem rutschigen Boden besser Halt zu finden, wird später am von der Morgenglut noch warmen Ofen seine Kleider trocknen. Nebel von Süden, das Tal herauf die Bäume umstreifend. Das Holz in der Stube knackt. Was wird er essen die nächsten Tage?
Dreiviertelsechs. Ein kalter Morgenwind weht das Tal hinunter, aus seinem Rücken kommend, leicht die immer noch nicht gemähten Grashalme krümmend. Er treibt die letzten grauen Wolken an die Berge gegenüber. Nur schwer dringt die Sonne durch den kalten Dunst und färbt die zwischen die Hänge gepressten Schneereste an den Ostflanken rot. Sein Hahn kräht wie immer um diese Zeit, die Glocken vom Dorf weit unten dringen zu ihm herauf, nur manchmal will er sie hören. Er geht, um seine Kuh, ein Stück weg auf, zu melken. Wie ein Ei aus der Suppe schimmert die Sonne durch die Wolken hindurch, ganz zart jetzt entlang zackiger Bergkämme über noch dunklen Höfen an den Hängen ins Tal. Immer höher entweichen die Wolken durch ihre eigene Wärme über die Baumwipfel in ein noch dunkles Blau. Noch immer ist alles still, kein Menschenlaut. Es ist kalt und er hat klamme Finger. Die Fenster der Stube, in der er die Nacht schlief, waren am Morgen beschlagen. Im Tal rührt sich noch immer nichts, vielleicht haben sie verschlafen heute, denkt er, für immer. Die Sonne durch die Wolkenschichten, so rund, so fahl, wie der Mond am Abend, ganz hell jetzt das Blau über fast weißen Wolken. Strahlenbündel fallen die Hänge entlang, die erste Wiese bekommt Licht.
Der Mann geht zum Mähen, hinter ihm der Hund, beide in schnellem Schritt, zu schnell für hier eigentlich, dahinter die zwei Katzen, später noch die dunkelgefleckte dritte, danach die Hühner der Frau, zwei und ein Hahn. Steil ist der Hang und nass und rutschig, den er hinuntergeht, auf zwei Sensen gestützt. Stunden allein wird er mähen, jeden Tag in der Woche. Bis am Wochenende der Bruder kommt aus dem Tal, um das Heu aufzuladen und den Traktor zu fahren, denn der Mann hat Angst vor Maschinen.
Der Vater ist, wie die Mutter des Nachbarn schon vor Jahren, vom Weg gestürzt, im vorletzten Winter. Einfach eingeknickt, vom Alter. In den Bach, ganz unten. Zäh, noch Tage überlebt, ohne Chance zurückzukommen, von dort unten im Tal noch einmal herauf. Warum erst dorthin, auch noch mit dem Hubschrauber. Ganz hell und grell im Osten die Wolkensuppe, ganz anders die Stimmen der Vögel jetzt, alles wird lauter, weg ist die Stille und eine andere ist in ihm.
Müde. Den ganzen Tag. Er arbeitet hart, um in Ruhe schlafen zu können. Gedanken über das Dableiben und so, wieviel Geld und ob er ganz verblöde. Die Sonne quält ihn. Ob er noch an Sex denke, Gefühle in der Sonne habe? Manchmal denkt er an das Geschlecht, von Sonne und Mond.
Die Sonne ist für ihn Frau, weil sie ihm zusieht, wie er täglich in der Erde nach ihr sucht. Das erregt ihn so sehr, daß er kaum Worte finden kann. Nur die Nacht bringt ihm Ruhe, dem Mann auf dem Diwan, nah beim warmen Ofen in der Stube, nur im Schlaf findet er seine Identität, männlich. Sie will vielleicht kommen. Er glaubt, das hier oben sei immer noch gut für Kinder, seine, ihre. Es regnet am Abend, gewittert ein wenig. Er hört kaum noch die Vögel, sie hört sie und erzählt ihm davon. Vielleicht lenken ihn seine Augen zu sehr ab. Er will sie öfter schließen, wie heute morgen, nach der Kälte, draußen als die Sonne aufging, am noch vom Abend warmen Kachelofen drinnen, mit dem Rücken angelehnt. Mittags würde er gerne frei sein, offen, luftig, raus aus seinem Käfig. Die Katzen kommen zum Fenster herein.
Er geht den oberen Weg. Manchmal ging sie ein Stück mit ihm, zum Kuhstall, um zu melken. Sie hat einfach eine Art für Tiere. Steil, im feuchten, von den Kühen niedergetretenen Gras, auf einem fast zugewachsenen Steig entlang, oberhalb der Lawinenverbauungen, an denen er die letzten Sommer gearbeitet hatte, immer wieder zu dem großen Berg hinüberblickend. Komisch, diese Blumen, diese Berge, wie fremd sie ihm sind, die Schutthalde, der Gletscher, der Felssturz dort drüben, und gleichzeitig spürt er dieses komische Gefühl von Verwandtschaft damit, gerade eben. Seit seiner Geburt erzählt der Mann ihm seine Geschichte.
Geburtsland. Unerklärlich. Nicht so sehr ein Raum, der Ort, das Tal, sondern Materie, ihm seit seines Lebens gegenüber, Stein, Eis, Erde, Wind, selbst das Licht, aber vor allem der Stein, gegenüber. Seine Vorstellungen gewinnen Substanz, werden fast selbst zu eben all dieser Materie, sie zieht ihm die Haut ab, dringt in ihn ein, verformt ihn, gibt ihm das Gefühl, dass alles nur ein Traum sei, löst sich auf in dieser Materie, wird wie sie, wird zu ihr. Drama der Geburt. Manchmal kann auch er sie verformen, fast mit Gewalt, er nimmt dann den Stein wieder in die Hand, wie das so viele Männer vor ihm schon getan hatten, spürt im Aufheben die alte Verwandtschaft, sowohl mit dem Stein wie mit den Männern, spürt die bedrohliche Unruhe in sich, alles war wieder da, seine vergebliche Abwehr, nicht wissend gegen welche Seite, spürt in seinen zitternden Muskeln, was die Männer mit dem Stein gemacht hatten, all das Erschlagene aus Angst. Angst, je wieder mit dieser Materie zu verschmelzen, all das spürte er dann plötzlich in seiner Hand, als er die Schwere des Steines von der Erde weg zu sich hoch zog.
Geburtsland. In diesem Moment sehnte sich etwas in ihm wieder nach allem, nach dem Ganzen, er wusste nicht was, er konnte die Worte, die Sprache nicht finden, stammelte in diesen Momenten, hing weiter auf dieser Schwelle zum Leben, nur halb geboren.
Geburtsland. Nur der Schrei hätte ihn erlöst, nur der Schrei hätte in dem Moment die alles erdrückende Schwere des Steines in seiner Hand verwandeln können, doch sie hätten ihn noch im Tal gehört und ihn für einen Wahnsinnigen gehalten. Sein Schrei starb auf der Schwelle, unausgesprochene Worte formten verworrene Bilder, und er spürte, wie sich ihre Partikel in ihm zu Organen verschmolzen.
Geburtsland. Weil er in dem Moment nicht schreien konnte, gerann seine Nervosität in seinen Muskeln, wurde zu seinen Muskeln und zu seiner Arbeit, zwischen den Beinen nicht sehr weit über der Erde.
Nichts hatte er vergessen, alles war in ihm gespeichert, alles musste er bewahren, wenn auch in einem ganz anderen Sinn, als sie es ihm beibringen wollten hier. Wusste, dass hinter dem Opfer die Frau stand, ihr Fleisch, das man ihm verwehrte anzuschauen, wusste, wie oft sie sie erschlagen hatten, die Frau, um ihr Fleisch zu opfern, um ihre Allmacht in sich aufzunehmen und um mit ihr wieder eins zu sein.
Später nahmen sie Tiere dafür, erschlugen sie mit der Axt, wie er es noch vom Vater gelernt hatte, noch genau das Gefühl kannte, in der Hand, im Arm und später in den Eingeweiden, wie er zuschlug und Leben auslöschte, das eine von ihnen geboren hatte, weil es krank war oder weil es zu viel war, heute waren es nur noch Tiere, denen er so etwas antat, früher waren es auch Kinder, ihre Mütter, seine Hand wusste es noch und zuckte jedesmal kurz davor zurück. Sie hielten das Fleisch kurz vor dem Opferaltar noch einmal hoch, wie damals die wenigen, die den Krieg überlebten, noch immer ihre Hände hochhielten, obwohl auch sie nichts mehr zu verlieren hatten. Immer muss er daran denken, wenn er die Axt vom Boden aufhebt, daran denken, dass es ein erschlagener Körper sein könnte, er mag deswegen auch keine Instrumente, keine Maschinen vor allem, wo sie ihm doch sein Leben so sehr erleichtern könnten. Er mag auch nicht die Geschäfte, die sie mit den Maschinen machen, weil ihn alles daran erinnert. Ihr Geld bewahrt dies alles auf, die Geschichte des Fleisches wurde zur Wahrheit des Geldes. Und wenn sie es in der Hand halten, werden sie wieder zu Bestien längst vergangener Tage.
Er spürte das alles in einem Augenblick, alles war unmittelbar in ihm, nicht in seinem Bewusstsein, aber um so stärker in jeder Faser seines Körpers.
Er hielt den Stein wie einen Bruder noch immer in der Hand, atmete kaum, kein Laut kam aus ihm, still spürte er diese erdgebundene Schwere, bis ein seltsames Gefühl von Gelassenheit ihn durchströmte.
Nein, er wusste in dem Moment, dass sie sich nicht erleichtern konnten, dass nichts leicht war, dass alles nach unten zog und ins je eigene Innere zeigte.
Drei. Der Bus ging erst viertel nach vier. Sie saßen an die Friedhofsmauer gelehnt. Einige erste Tropfen des nahenden Gewitters fielen auf sie herab. Aber noch immer schien auch die Sonne und es war warm. Dunkle Wolken hingen seit dem Morgen um die Berge im Süden. Zweidreimal hatte es gedonnert. Tranken Kaffee und Milch vor dem alten Hotel oben im Dorf. Ein Mann aus einer Stadt im Norden fuhr mit seinem schwarzen Porsche vor und sie sahen ihm zu. Hinter dem Hotel gab es einen alten Garten mit zwei im April 1884 gepflanzten Lebensbäumen. Sie waren hierhergekommen, weil der, von dem er am liebsten las und dessen kurze und klare Sätze er bewunderte, auch einmal hier gewesen sein soll.
Zwei Schafe unterhalb der Friedhofsmauer. Das helle Geläut ihrer Glocken. Die Kirchturmuhr schlug Viertel. Der Hund lag auf dem warmen Steinweg und döste vor sich hin und irgendwo kreischte eine Holzsäge. Schwüle, kaum ein Luftzug, aber die Regentropfen wurden schwerer. Mücken krabbelten über ihre salzige Haut. Von weit oben aus den Bergen waren sie hierher gekommen und lange unterwegs gewesen. Sie hatten noch eine Stunde für sich bis der Bus ins Tal zurück fuhr.
Der Boden sinkt hier etwas ein, ein alter Bachlauf, ganz andere Blumen als auf den übrigen Wiesen, kleine Orchideen. Schwüle, dann wieder Wind, langsam aufziehende Wolken. Er bemerkt sie nicht, pflückt einige Blumen und legt sie in sein kleines schwarzes Notizbuch, den Rest in die Rucksacktasche zum Trocknen. Kurz vor der Alm beginnt es zu regnen. Weiter unten will er noch eine Kraxe voll Reisig sammeln und kehrt um. Unten angekommen scheint wieder die Sonne. Er ärgert sich, doch wieder dem Nützlichen den Vorzug gegeben zu haben. Morgens arbeiten, mittags für sich allein sein. So will er es, eigentlich.
Träumt vom Steckenbleiben. Er haust in einem Unterdererdezimmer, muss durch ein Fenster aus- und einsteigen, genauer, er schiebt seinen Körper durch die Öffnung, schaut ebenerdig genau auf eine Fahrstraße, ihren Asphalt, und er spürt in dem Moment seine alles erdrückende Abhängigkeit, Abhängigkeit von einer Frau über ihm, die ihm Aufträge erteilt, immer wieder, und ihn an deren Erfüllung erinnert, ständig.
Er beschwert sich bei ihr, sie solle was ändern, sie fährt ihn an, ihr stinke das auch, und geht davon, einfach darüber weg, über ihn hinweg.
Nein, er kann es einfach nicht akzeptieren, ihr Tun, obwohl er es auch tut, ohne Besinnung. Ohne Wille, oder auch um von ihm frei zu sein, tun sie es, einzige Freiheit, die sie noch haben, denkt er.
Frägt sie dennoch, sie gibt ihm keine Antwort, warum stellt er sie nicht vor die Wahl, denkt er, auch schämt er sich, so wie er sich schämte damals, wenn die Mutter zum Fenster raus sah, sie sich als Kinder vor dem Haus gestritten haben, sie Angst um ihn hatte, wenn er von den andern bedroht wurde, er das nicht wollte, dass sie Angst um ihn hatte und deshalb das Fenster öffnete und heruntersah, alle konnten es sehen, was sie dachte, was er dachte, in dem Moment, er schämte sich für sie, für sich, mit ihr, schämen sich zusammen, aus Angst vor ihrer eigenen Freiheit.
Mütter betäuben ihre Kinder. Mit Arbeit, mit Alkohol, Nikotin oder mit Geld. Alles ist dasselbe. Sie tun alles, aus Angst vor ihrer Schuld, dich in diese Welt geboren zu haben, denkt er. Sie tun alles und noch mehr, und sie betäuben dein Schreien mit ihrem Lächeln und mit ihrem roten Mund.
Alles, all diese scheinbaren Wichtigkeiten. Sie mag lieber das Feuer in ihren Öfen, die Erde auf den Feldern, das Konkrete eben, er dagegen ist nie ganz da, mehr in der Luft, oder im Wasser vielleicht.
Lieber hätte er seinen Hof und seine Schafe in Schottland gehabt. Bilder von dort hatte ihm der Fremde einmal gezeigt und ihm erzählt, vom Meer und vom Wind, der über nicht sehr hohe Berge streicht.
Sie hat viel Männliches, vermisst ihren Vater, er mehr Weibliches, versteht sich besser mit Frauen, sie sagen, er habe halt Angst vor Männern. Das stimmt. In ihrer Nähe fühlt er sich unterlegen, muss immer zu ihnen aufsehen, lieber bleibt er ihnen fern und verachtet sie, so wie sie die Frauen verachtet.
Frauen sind ihm näher, zerbrechlich wie er, schwankend, unsicher, auf diesen steilen Hängen. Und oft hat er das Gefühl, bei der Arbeit oder wenn er in den Bergen unterwegs ist, dass er nur die eine sucht, die, die er nie finden wird, die es nirgends gibt, die dennoch allgegenwärtig scheint.
Steckengeblieben in diesem Tal, der Mann und die Frau, in dieser Schlucht, weder raus noch rein, noch immer haben sie diese idiotische Hoffnung, noch immer machen sie sich manchmal Mut, unsinnig, sie werden hier, hier drinnen, zugrunde gehn, weil sie nicht rauskommen, weil sie festsitzen, weil sie ihre schmerzliche Lage betäuben, am Abend mit Worten, mit Schweigen, im Wein, im vergifteten Rauch ihres keuchenden Atems, rauszukommen und zu überleben erscheint ihnen übermenschlich, nahezu unwahrscheinlich, dass es gelingen könnte. Das Leben hatte sie sich ausgesucht und sie passten zusammen, wie eben Feuer und Wasser zusammen passen.
Freunde aus der Stadt, sie stören, sie stehen wie Fremdkörper zwischen dem Mann und der Frau, vergiften ihre Atmosphäre und er kommt sich ausgeschlossen vor. Es würde zu lange dauern, ihnen ihre Geschichten zu erzählen, zu lange, um auch ihnen zu vertrauen. Der Freund kann es mit ihr. Gespräche über Mark und Pfennig, die Ware und den Handel, das Alltagsgeschäft der Schnäppchen. Sie sparen an einem Ding drei Pfennig und und geben mit der Linken ohne es zu merken das Zehnfache aus. Der Freund, zu unsensibel, zu sehr von sich und seinen Hoffnungen eingenommen, steht gern im Mittelpunkt. Alle bleiben sitzen, warten auf ihn, bis er kommt, bis er fertig ist, er bestimmt die Zeit für alle mit und merkt es nicht, er schleicht langsam um dich herum und in dich hinein.
Später, als sie wieder allein sind, frägt er sie nach dem Leben, doch sie gibt ihm keine Antwort.
Der Freund braucht Platz, nimmt sehr viel Raum für sich ein und verdrängt ihn. Er kann hier nur sein mit denen, die er ganz gut kennt, die ihn in Ruhe lassen, Distanz zu ihm halten und ihre eigenen Wege gehn. Er will hier ein gutes Stück des Tages allein sein. Es ist halt so.
Eine Motorsäge weit unten im Tal. Die Vögel. Es müssen Tage vergehen, bis er sie hört. Sehen wird er sie noch lange nicht, während er noch immer in die Wolken starrt, die über den Tälern im Osten zwischen den Bergen hängen. Es ist jetzt die Zeit der Blumen und der Schmetterlinge. Sie sind füreinander geschaffen wie Geschwister, besser jedenfalls als der Mann und die Frau, freier, sich nicht so lange quälend. Die Gerüche sind intensiver noch als die Geräusche. Sie beherrschen alles hier.
Das Gebälk knackt so träge wie der Hahn kräht am Nachmittag. Er will die Regenrinne über der Eingangstür morgen erneuern, aus der das Wasser tropft und im Winter am Boden darunter zu Eis gefriert. Auch die dunkle Ecke gleich rechts im Stall gehört neu abgestützt. Die Balken sind feucht und vermodert und drohen zu brechen. Die Bienen summen und er ist müde, schaut ins Tal, weiß nichts mit sich anzufangen, ist in Gedanken mal da und dort, ist nicht bei sich, ist eigentlich nirgendwo, der Bach in der Nähe rauscht an ihm vorbei ins Tal, irgendwohin, ständig, ohne sich je umzudrehn.
Die Stuben, vor allem die Küche, sind voll mit Fliegen. Auf den hellen Außenwänden der Häuser bilden sie schwarze Flecken. Seit langem sind es nicht mehr so viele gewesen. Es läge an den Vögeln. Es gäbe deutlich weniger dieses Jahr. Auch den Kuckuck würden sie nicht mehr so häufig hören. Vögel und Fliegen, sie gehören zusammen, gehören dazu, denkt er, ja, auch sie.
Die Wiesen sind noch unberührt. Erst Ende der Woche werden sie zu mähen anfangen. Bienenschwärme brummen um die Blüten. Die Luft steht, vibriert nicht wie sonst. Schmetterlinge in allen Farben, er mag besonders die hellen blauen.
Wie überhaupt. Wie konnten wir zu so was werden, denkt er weiter, so ganz anders als alles um uns herum. Manche sagen, wir gehörten auch dazu, zu dem großen Ganzen da draußen. Wie sie darauf kommen. Er lebe auf seinem Boden, seiner Erde. Aber er und seine Erde gehörten noch nie dazu, sie waren schon immer etwas ganz anderes, eigentlich gar nicht richtig da, unzugehörig.
Zwischenzeit. Da singen die Vögel, kriegen Junge, blühen Blumen, deren Namen er sich nicht merken kann, weil letztlich sinnlos, und verwelken wieder oder werden von seiner Sense enthauptet.
Er fühlt sich müde, leer, geht trotzdem auf einen Stecken gestützt des Weges, irgendwo in die Berge. Ein dunkelblauer Enzian weckt ihn aus seinen trüben Gedanken, der Tag, der Ort, war ihm eintönig geworden. Ihm ist, als flössen ihm Tränen aus allen Poren. Weiß aber nicht warum und fühlt eine bedrückende Stimmung um sich.
Wollgras und Knabenkraut. Ein Schmetterling setzt sich auf seinen rechten Unterarm, der den Stecken hält und spielt mit seinen Haaren. Zugehörig, bleiben sich dennoch fremd, aber auch sie flattern in Pärchen.
Bläulinge
dunkelbraune mit roten Punkten
große weiß-gelbe
kleine getigerte
Zitronenfalter
noch kleinere
orange mit dunklen Punkten…
Die Alp ist still, die Kühe stehen noch um die Häuser.
… ganz weiße kleine
die ständig flattern und
nie ruhig sitzen - doch
da im Schatten.
Wenn Wind geht, ist alles besser.
Er nießt mehrmals. Die Murmeltiere sind wach und warten, bis er vorüber gegangen ist. Mehrmals schneuzt er sich noch die Nase.
Weiße Wolken. Lass' sie ziehn. Geh weiter. Es kommt kein Gewitter. Noch ist es nicht Zeit.
Murmeltiere in ihrem Winterspeck - ja! Die Wunden der Schafe heilen gut davon - ja! Aber es stinkt zum Himmel, wenn du dir Eier darin brätst - ja!
Ja - lass sie ziehn die weißen Wolken, und das Windrad an der Hütte dreht sich wild.
Und ich gehe, und ich schreibe, bleibe stehn, und ich schreibe und ganz langsam, wenn ich gehe, geht‘s mir gut.
Die Finken. Ob er es ist? Mich noch kennt, vom Winter? Hah! - Geh' weiter!
Noch nicht lange ist der Schnee hier geschmolzen, das Gras ist ganz grau und flachgedrückt. Die ersten Schneefelder. Noch nicht viele sind hier gegangen. Vom Wind in die Mulden verblasene Alpenrosenblätter.
Einzelne kleine lilafarbene Alpennelken, und der Hund wälzt sich im Schnee.
Es wird immer höhere Berge geben, und geht weiter durch die Alpenrosen.
Unten liegt der Hof. Er hat die große Wiese hinter dem Stadel fast fertig gemäht in seinem türkisenen Hemd.
Endlich der Kuckuck!
Also doch!
Bleibt stehen - da ist er still.
Oben am Joch Sommerski, verrückt. Fünf Milligramm Blei pro Liter Schneemasse. Aus der Ferne und von oben grüßen die großen Städte. Es ist drückend heiß, der Hund sitzt im Schatten, wieder Fliegen überall.
Donner kommt näher, der Wind ist schon stark, geh' ins Tal zurück!
Schlagend, gackernd, schimpfend, drosselähnlich, mit einem weißen Halsring, geh' weiter, sie haben Junge!
Wolken werden höher, kommen auch von Norden, zingeln ihn ein, weiter!
Ein Brief, sie hat ihn zuerst gelesen. Er weiß nicht was er antworten soll. Er frägt sie, und sie zieht sich zurück. Scheu und Angst, das Tiefste zu berühren.
Die Alltagsgeschäfte laufen gut, und auch der Sex. Sie kann sich stundenlang mit dem Freund übers Einkaufen, die Müllentsorgung und ähnlich Unverfängliches unterhalten.
Er geht raus, klinkt sich aus und schaut sich die Sterne am Nachthimmel an.
Sie versteht überhaupt nicht, was er von ihr will. Sind an eine Grenze gekommen. Es gehe da einfach nicht weiter. Sie sei die falsche Frau für ihn und er der falsche Mann für sie. Sie müssen es langsam kapieren, Feuer und Wasser passen eben doch nicht zueinander, und zu all dem bringe er die Füße nicht auf die Erde, und wenn sie sich solche Fragen nicht stellen könnten, er solche Fragen nicht äußern dürfe, sie das nicht aushalte, könnten sie hier oben niemals leben. Und wenn sie hier nicht leben können, würden sie es auch anderswo nicht miteinander aushalten. So denkt er in die Nacht und weiter in den Morgen.
Der Himmel ist Vater und Mutter. Mann und Frau. Die Erdkräfte stehen außer Beziehung. Niedergang für die Monate August und September. Schlecht für die Ernte, denkt er. Andere Menschen sind nicht förderlich für die eigene Beharrlichkeit, bringen nur Verwirrung und Unordnung. Innen Schwäche, außen Härte und seine Art sei im Abnehmen. Er spürt es von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, vor allem im Winter, wenn er zur Besinnung kommt. Nicht beirren lassen, den Grundsätzen treu bleiben. Rückzug in die Verborgenheit, Rückzug, um den Schwierigkeiten zu entgehen. Seine Einkünfte gereichen ihm eh nicht zur Ehre. Das öffentliche Leben sei gemein, eine fruchtbare Wirksamkeit dort unmöglich, das ist ihm klar, weil die Grundlagen falsch dort sind, auch ist er hier oben außer Gefahr, sich durch glänzende Angebote verlocken zu lassen. Immer wieder Beharrlichkeit, schießt ihm durch den Kopf, wie die Kugel eines Selbstmörders, nur unendlich langsamer. Jahrtausende, denkt er, nicht Heil ist gekommen, und nichts will gelingen, nur tragen und dulden.
Deine Möglichkeiten, hier zu wirken, sind nicht mehr da, zieh dich zurück, schäm dich du unrechtmäßig hier Emporgekommener. Nein, du kannst nichts dafür. Du trägst nicht die Verantwortung für die paar Fuder Heu, um zwei Kühe über den Winter zu kriegen. Aber du bist ein Idiot gewesen, zu bleiben, immer wieder zu bleiben.
Ja, ein Berufener könntest du sein. Deine Dinge neu ordnen. Nein, wenn es misslänge, wenn es… Deine Besorgtheit, die dauernd dich denkt. Doch nur dadurch kannst du Erfolg haben. Zittern und Furcht sind eben nötig.
Und Abschneiden, macht feste Sprösslinge. Die Stockung hört nicht von selber auf, aber auf Stockung folge Heil, sagen sie, aber es bedürfe des rechten Mannes, um der Stockung ein Ende zu bereiten. Die Sieben, sein Geburtsmonat, eine schöpferische Zahl, eine Lösung. Das Bild der Staude gefällt ihm, viele Zweige, zu viel Altholz. Schnitt. Und mal sehn, was nachwächst.