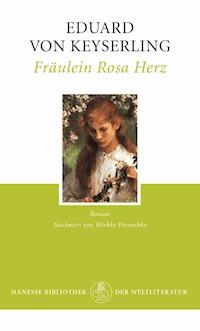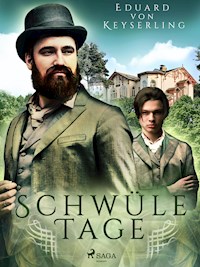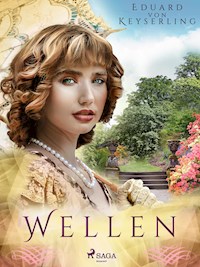19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schwabinger Ausgabe
- Sprache: Deutsch
«Die Lektüre Eduard von Keyserlings macht süchtig.» Andreas Isenschmid, NZZ am Sonntag
Er ist der Meister der sinnlichen Erzählkunst, ein begnadeter Impressionist und Stimmungsmagier, und sein Werk gehört zum Stilvollsten, was die deutschsprachige Literatur hervorgebracht hat. Zu seinem 100. Todestag würdigt Manesse Eduard von Keyserling mit einem bibliophilen Liebhaberband, in dem erstmals sämtliche Erzählungen vereint sind. Seinerzeit zählten Thomas Mann, Lion Feuchtwanger und Herman Bang zu seinen Bewunderern. Und bis heute kommen Kritiker nicht aus dem Schwärmen heraus: «Besser als Fontane!» (Michael Maar), «Nicht lesen, schlürfen!» (Tilman Krause), oder: «Houellebecq minus Zynismus» (Iris Radisch). Zeitgemäß im besten Sinne, ist dieser Klassiker mehr denn je der Entdeckung wert.
In dem Band enthaltene Erzählungen: Nur zwei Tränen (1882) / Mit vierzehn Tagen Kündigung (1882) / Das Sterben (1885) / Grüß Gott, Sonne! (1896) / Grüne Chartreuse (1897) / Die Soldaten-Kersta (1901) / Der Beruf (1903) / Schwüle Tage (1904) / Harmonie (1905) / Sentimentale Wandlungen (1905) / Im Rahmen (1906) / Seine Liebeserfahrung (1906) / Gebärden (1906) / Die sentimentale Forderung (1906) / Osterwetter (1907) / Die Verlobung (1907) / Geschlossene Weihnachtstüren (1907) / Frühlingsnacht (1908) / Landpartie (1908) / Bunte Herzen (1908) / Föhn (1909) / Winterwege (1909) / Prinzessin Gundas Erfahrungen (1910) / Am Südhang (1911) / Nachbarn (1911) / Die Kluft (1911) / Das Landhaus (1913) / Vollmond (1914) / Schützengrabenträume (1914) / Nicky (1915) / Verwundet (1915) / Der Erbwein (1916) / Pfingstrausch im Krieg (1916) / Das Kindermädchen (1916) / Das Vergessen (1917) / Die Feuertaufe (1917) / Im stillen Winkel (1918)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1152
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Eduard von KeyserlingLandpartie
Eduard von KeyserlingSchwabinger Ausgabe
Eduard von Keyserling
Landpartie
Gesammelte Erzählungen
Herausgegeben undkommentiertvon Horst Lauinger
Nachwortvon Florian Illies
MANESSE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Manesse Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Copyright © des textkritischen und editorischen Apparats Horst Lauinger, Schwabing Copyright der Porträts und Abbildungen siehe Bildnachweis
Satz von Andrea Mogwitz, München, aus der Albertina.
Den Umschlag gestaltete Katja von Ruville unter Verwendung des Motivs von Heinrich Kühn (1866–1944), «Kühns Kinder und Miss Mary im Grünen» (Autochrome), nach 1907. © ÖNB Wien, Pk 3900, 34 ISBN 978-3-641-22989-4
Nur zwei Tränen
Motto: «Θάλαττα, θάλαττα»
Der Lehrer der griechischen Sprache hatte die üble Angewohnheit, seine Schüler «Esel» zu nennen, machten sie ihre Sache nicht recht. Wir zeigten dann stets sehr entrüstete Mienen, allzu tief aber empfanden wir diese Beleidigung eigentlich nicht. Nun behaupteten meine Kameraden, ich hätte einmal über solch einen «Esel» geweint.
Weinen gilt in der Schule ohnehin für eine Schande, und noch dazu über so etwas! Die Kameraden waren unerschöpflich in ihrem Spott. Mich schmerzte das empfindlich; ich vermochte mich aber nicht zu verteidigen. Es waren nur zwei armselige Tränen gewesen, nicht der Rede wert, diese ließen sich jedoch nicht fortleugnen, und sie hatten ihre wunderliche Ursache, die ich damals nicht erörtern mochte.
An einem ganz gewöhnlichen ledernen Montage, in einer ganz gewöhnlichen ledernen Unterrichtsstunde trug sich der Vorfall zu. Ja! Diese Unterrichtsstunde versprach besonders trübe und eintönig zu werden, denn draußen lag dichter Herbstnebel über den Dächern. Wir durften also nicht einmal auf den lustigen Sonnenstrahl rechnen, der durch die Fensterscheiben in die Schulstube zu schlüpfen pflegte, um plötzlich dem gestrengen Lehrer über die faltige Stirn zu huschen, sodass er die mürrischen Augen zukneifen musste und wir kichernd die Nasen tiefer in die Bücher steckten. Solche Streiche liebte der Sonnenstrahl; er hielt es stets mit uns Schülern. Auch auf diese kleine Zerstreuung durften wir an jenem Montage nicht zählen. Tripp – tripp – fielen die Tropfen aus der Dachtraufe auf das Pflaster; eine frostige, verstimmende Musik. Einige verdrossene Spatzen hüpften über das Fensterbrett, und die kleinen, grauen Köpfe auf die Seite neigend, blinzelten sie mit den blanken Augenpünktchen gelangweilt zu uns herüber. Rings um mich saßen die Kameraden mit missmutigen Gesichtern. Die schwarzen Schulbänke mit ihren zahllosen Schnittwunden, der Lehrer mit seinem alten Rock, auf dem ich jeden Streifen des Musters kannte, mit seinem bleichen, sorgenvollen Gesichte, seinem tadellos geglätteten Haar, alles, alles war dazu angetan, ein Knabenherz trüb zu stimmen. Dazu noch der dumpfe Geruch nach alten Büchern und nassen Überröcken, der im Gemache waltete, das unbehagliche Gefühl, die Finger voller Tinte zu haben und mit dem Rockärmel den Staub vom Tische zu fegen, endlich das abgegriffene, befleckte Buch, in das man hineinschauen sollte, die Aussicht auf endlose Fragen nach e verbo, nach consecutio temporum – was weiß ich! Gewiss ist es, dass an jenem Montage eine sehr melancholische Lebensanschauung in den meisten Schülerherzen wohnte.
Xenophon wurde gelesen. Nun wissen wir, dass der weise Schüler des Sokrates wenig Ansehen in Schülerkreisen genießt. Weil er der erste griechische Autor ist, den wir lesen, so nennen wir anfangs zwar seinen Namen mit einigem Stolz: «Wir lesen Xenophons ‹Anabasis›» ist ein Satz, den man nicht ungern ausspricht, dazu ist «Anabasis» ein schönes, volltönendes Wort und klingt gar so griechisch. Auf die Dauer aber verstehen die Leiden der Zehntausend die Knabenfantasie nicht anzuregen, und sind wir erst zu anderen Autoren vorgeschritten, dann blicken wir mit entschiedener Verachtung auf die «attische Biene» nieder: «Er liest noch Xenophon» heißt so viel als: Er steht tief unter mir.
Meinem Nachbar auf der Schulbank war die Aufgabe zugefallen, das berühmte 7. Kapitel des IV. Buches der «Anabasis» zu übersetzen. – Mit eintöniger, schläfriger Stimme, mit vielem Räuspern und häufigen Pausen trug er uns die schöne Erzählung vor, wie die Zehntausend, auf den Berg Teches gelangt, plötzlich das Meer vor sich sahen und in lauten Jubel ausbrachen.
Ich war entschlossen, nicht zuzuhören, mich um die ganze Geschichte gar nicht zu kümmern. Meine Aufmerksamkeit richtete sich ausschließlich auf einen Regentropfen, der langsam die Fensterscheibe hinabrann. Wird er unten ankommen oder nicht? Das schien mir eine wichtige Frage. Plötzlich schreckte mich ein Wort im Vortrage meines Kameraden aus meinen Beobachtungen auf.
«Sie hörten nun, wie die Soldaten: ‹Das Meer, das Meer!› riefen.» Ich schaute in das Buch. Ja! Da stand es, halb von einem Tintenfleck verdeckt, daneben der misslungene Versuch, das Profil des Lehrers mit stark verlängerter Nase zu skizzieren, da stand es, wie sie jubeln, «Thálatta, Thálatta!» rufen, wie sie sich umarmen, wie sie weinen. – Seltsam! Das gefiel mir, das schien nichts von dem Staub der Schulbank an sich zu haben. Es machte mir das Knabenherz weit. Thálatta, Thálatta! Welch ein würziger, lösender Hauch wehte mir aus diesem Worte entgegen! Das war Ferienlust! Das trug mich weit, weit aus der schläfrigen Schulstunde fort! …
Da stand ich auf der Düne. Unter meinen nackten Füßen fühlte ich den warmen Sand; in meinen Haaren wühlte der Seewind, und vor mir lag das Meer, die weite blaue Fläche, ganz mit goldenen Sonnenflittern überstreut. Große, durchsichtige Wellen stiegen auf, warfen ihre weißen Schaummützen empor, und ein Jauchzen und Rauschen scholl herüber, dem ich schweigend, lächelnd, mit klopfendem Herzen lauschen musste. Hoch im lichtvollen Himmelsblau hing eine Möwe, eine zitternde weiße Flocke: «Gib Acht! Die sieht etwas. Gleich ist sie unten», sprach es neben mir mit heiserer Kinderstimme. Ja! Da stand des Strandwächters Lotte und schaute empor mit ihrem verständigen Bubengesichte, die runden, grünlichen Augen weit dem Sonnenstrahl geöffnet, das kurze, rote Haar im Winde flatternd. Jetzt schoss die Möwe pfeilschnell nieder, da – mitten in eine große Welle hinein, und Lotte stieß einen gellenden Freudenschrei aus, den sie von den Möwen gelernt haben mochte.
«Die See ist gleich wieder da», sagte Lotte dann und deutete mit dem Mittelfinger auf das Meer hinab: «Wir müssen eilen, wenn wir noch hinauswollen.»
Hinaus mussten wir. Es war die tägliche Ferienarbeit, zu suchen und zu sammeln, was das Meer zurückließ; und endlich, welche Lust, sich langsam von der Flut an das Ufer zurückdrängen zu lassen – mühsam, den halben Leib im Wasser, mit den Wellen kämpfend.
«Fort!», rief Lotte und stürmte voran.
Es lief sich gut über den feuchten Sand. Der Boden wiegte sich sachte unter den Füßen; jeder Tritt verursachte ein kleines plätscherndes Geräusch und ließ eine Spur zurück, die sich mit Wasser füllte. Dort lagen die trägen Seesterne, zart gefärbt und glänzend, wie die Zuckerblume beim Bäcker oben im Städtchen; und Seegras – breite, kühle Bänder, die wir nur behutsam angriffen, denn die weichen, fetten Halme schienen etwas rätselhaft Lebendes. Rückten wir einen Stein von seiner Stelle, dann huschten die Seespinnen hervor, grünliche, durchsichtige Schattenwesen. Wir blieben stehen und lachten laut auf über diese seltsamen Ungeheuer, die so eilfertig seitwärts dahinschlüpften.
«Ins Wasser!», kommandierte Lotte.
Da waren die Wellen schon! Da überstürzten sie sich zischend und bedeckten den Sand mit ihrem Schaum, wie mit großen weißen Tüchern.
Anfangs stiegen wir nur zögernd in das rege Durcheinanderwogen. Das Wasser schlug kühl um unsere Füße, bedrückte ein wenig den Atem, und in das laute Rufen der Wellen mischten wir die hohen Noten unseres ausgelassenen Kinderlachens.
Das tolle Rennen und Springen der Wogen riss uns in seine Lust mit fort.
«Weiter, weiter!»
Lotte war stets die Verwegenere und mir ein gutes Stück voraus. Sie achtete nicht mehr auf ihr schlichtes Leinwandröckchen, sie ließ sich ganz von den Wellen überdecken, sie schlug sich mit ihnen herum und stieß herbe, gellende Rufe aus, wie ein Seevogel.
Mit Vorliebe gingen wir in dem breiten Lichtwege einher, den die Sonne über das Wasser warf. Dort flatterte es glänzend an uns hinauf, ganz goldene Wellen kamen, um mit lustigem Funkeln über unseren Köpfen einzustürzen. Blieb ich einen Augenblick atemlos stehen, ein wenig auszuruhen, schaute ich hinaus auf das endlose Ineinanderspielen von Blau, Gold, Silber, dann legte es sich wie Bangigkeit auf das Kinderherz, eine Bangigkeit, die die Augen groß und ernst macht und die Lippen lächeln lässt. – «Sie kommt!», jubelte Lotte. – In der Tat, die Flut machte merkliche Fortschritte. Die Wellen wurden höher und rissen uns mächtig nach Osten hin.
«Halte dich tüchtig nach rechts», warnte ich.
«Wir haben noch Zeit!», meinte Lotte.
Die Schulbänke machen uns vorsichtig; so zog ich mich denn langsam zum Ufer zurück. Das Wasser trieb mich vor sich her. Die Wellen gaben mir kräftige Stöße in den Rücken. «Geschwind, ge–schwind!», schienen sie zu rufen und überspritzten mich mit Schaum. Sie erlaubten mir nicht, stille zu stehen. Geschwind, geschwind! Ich lief. – Ein wenig Furcht packte mich, so wild war die Jagd noch nie gewesen!
Jetzt war ich am Ufer! «Heute war es lustig», sagte ich mir und schöpfte tief Atem. Ich wandte mich um: «O! Lotte ist weit» – – – –
Die Gestalt des Mädchens schwankte noch zwischen den Wellen einher; jetzt ward sie hoch emporgehoben, sie streckte die Arme aus; ich glaubte ihr Lachen zu hören. Ich legte die Hand vor die Augen und schaute in den Glanz hinaus. Das rote Köpfchen tanzte lustig die Wellen entlang; es schien selbst ein Stück des regen Sonnengoldes zu sein, das allerort über das Wasser hinflirrte. Immer weiter zog es fort. Nur noch einen roten Punkt konnte ich sehen. Jetzt war auch dieser verschwunden. Da war er wieder! Dort auf der großen Welle! Nein, nur der Sonnenglanz! Aber hier – hier! Allerwärts tauchte Lottens Köpfchen auf, und immer wieder war es der Sonnenschein, das endlose Flimmern. Ein heller, durchdringender Ton schlug an mein Ohr. «Lotte!», rief ich. Eine Möwe antwortete mir aus der Höhe.
Wild und blank tummelten sich die Wellen durch einander, immer schneller und schneller. «Ge–schwind, ge–schwind!», riefen sie. Alles wogte, blitzte, tanzte vor meinen Augen. «Lotte!», rief ich noch einmal und sank dann still auf den Sand nieder.
Am anderen Tage fand man die Leiche des Mädchens, ich habe aber den Anblick nicht ertragen können; das war meine lustige Gespielin nicht mehr. Die Strandwächterin breitete ihre blaue Schürze über das arme, entstellte Gesicht. Sie hatte sich nicht genug nach rechts gehalten, sagte der Strandwächter, und damals habe ich ihn zum ersten Male weinen gesehen.
Xenophon mit seinem «Thálatta» hatte in mir all diese Erinnerungen wachgerufen, hatte mir schnell wieder die ganze traurige Geschichte von der Strandwächter-Lotte erzählt, und – nun ja – da kamen die zwei Tränen.
«Esel! Wie lange soll ich fragen?!», rief der Lehrer. Meine Kameraden schauten mich spöttisch an – und ich – schämte mich. Heute aber können sie es mir wohl glauben: Die zwei Tränen wurden nicht um den «Esel», sie wurden um die arme Lotte geweint!
Mit vierzehn Tagen Kündigung
«Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.» Der arme Prinz Hamlet hatte recht! Wir brauchen oft nur in die Kammer unseres Nachbars hinüberzuspähen, um Dinge zu finden, über die wir im Kreise unserer aufgeklärten Freunde ungläubig die Achseln zucken. Wir sind heutzutage so klug, dass wir nicht gern von Erscheinungen reden, deren ausführliche Erklärung wir nicht zu geben vermögen. Dennoch gehört ein wenig romantischer Glaube dazu, um die Wirklichkeit ganz zu verstehen.
So ist es auch wahr, obgleich ich mit meinen skeptischen Café-Genossen nicht gern davon spreche – so ist es auch wahr, dass die gute Frau Pinapel ihren Tod um vierzehn Tage vorausgeahnt hat.
Mir gegenüber, dort jenseits des breiten, stillen Hofes, wohnte sie. Von meinem Schreibtische aus konnte ich ihr Fenster sehen, die weißen Spitzenvorhänge, die Geraniumbüsche und Rosenstöcke, die hohe Lehne ihres Sessels mit der Schlummerrolle aus bunter Seide und das friedliche, weiße Gesicht. Frau Pinapel pflegte beständig zu stricken, aber ihre Blicke schweiften über die krausen Blätter der Geranien zum Fenster hinaus und überwachten die gegenüberliegende Seite des Hauses. Mir schien es, als hätte sie den Sonnenschein gepachtet, denn die große weiße Haube hinter den Blumenstöcken schwebt mir stets überflutet von hellen Sonnenstrahlen vor. An Tagen, an denen wir anderen vergeblich auf einen Lichtblick warteten, hing an der Hauben-Ruche der Frau Pinapel gewiss ein goldener Sonnenflitter. Ihr hat es aber keiner missgönnt; selbst Hausbewohner, die es sich sonst zur Ehre anrechneten, mit jedem ihrer Hausgenossen wenigstens einen Streit gehabt zu haben, sprachen mit Wohlwollen von der alten Frau im dritten Stock, und wer, an seinem Fenster stehend, dem Blick ihrer milden grauen Augen begegnete, nickte einen höflichen Gruß hinüber.
Sonst hatte ich Frau Pinapel nie auf der Stiege, im Hof oder gar auf der Straße gesehen; da traf ich sie eines Tages vor der Wohnung des Hausmeisters. Ihre Kleidung war äußerst festtäglich: Sie trug einen großen Hut, auf dem wunderlich vergilbte Rosen und welke Atlasmaschen saßen, und einen persischen Shawl, einen jener schönen Shawls aus der guten alten Zeit, die nie untergehen, mit einem großen Aufwand an türkischem Pfeffer und Moschus vor den Motten bewahrt werden und, wenn sie an einem Festtage ihren Kasten verlassen, einen scharfen Duft um sich verbreiten und mit ihren eingelegenen Falten, ihren verblichenen Arabesken, ihren längst vergessenen Mustern ein rührend verschollenes Aussehen im grellen Tageslichte annehmen. Frau Pinapel war in eifrigem Gespräch mit dem Hausmeister begriffen.
Als ich mich näherte, schwiegen beide. Indem Frau Pinapel meinen Gruß erwiderte, lächelte sie befangen; ein flüchtiges Erröten ergoss sich über das gute, alte Gesicht. Sie blickte unsicher zum Hausmeister hinüber. «Oh, Frau Pinapel», begann ich, «es ist das erste Mal, dass ich Sie zu einem Spaziergang gerüstet sehe.»
«Ja, heute wollte ich einen Gang tun. Sonst gehe ich nicht aus, aber heute …» Sie schwieg und glättete liebevoll die Fransen ihres Shawls.
«Die Frau Pinapel will uns kündigen», versetzte der Hausmeister und kniff schalkhaft ein Auge ein.
«Nein, nein! Das hab ich nicht gesagt! Ich zieh nicht fort. Warum sollte ich!»
Seltsam war es, wie hilflos und verlegen uns die alte Frau ansah; wie ein Kind, das fürchtet, von den Erwachsenen verlacht zu werden. «Der Hausmeister versteht mich wohl; er tut nur so», fuhr sie fort und blickte auf den Griff ihres Sonnenschirmes nieder, «ich habe es ihm gesagt, damit das hübsche Zimmer nicht leer stehe. Er soll sich ein wenig nach einer neuen Partei umtun. Mein Gott!, etwas Unrechtes ist nicht dabei.»
«Ach was!», meinte der Hausmeister, «Frau Pinapel bleiben noch lange bei uns. Mit dem Sterben ist’s nicht wie mit dem Ausziehen, das man nur so mit vierzehn Tagen kündigen kann. Das kommt über einen jeden, heute oder morgen, aber vorher wissen, das gibt’s nicht.»
«Doch, das gibt’s» – Frau Pinapel nickte ernst – «mir ist es», fügte sie zögernd hinzu, «als müsste es in vierzehn Tagen geschehen, darum habe ich mit dem Hausmeister gesprochen. Ich weiß es wohl, steht ein gutes Zimmer leer, so verdrießt das. Um diese Zeit findet sich auch nicht leicht eine Partei; es ist besser, man sieht sich früher danach um. Nicht wahr? Kommt es dann über mich, nun, so ist nicht viel Aufenthalts. Die Leni lüftet das Zimmer, und die neue Partei kann gleich einziehen.»
Sie hielt inne. Da wir beide stumm und nachdenklich vor uns hinsahen, blickte sie uns ruhig und verwundert an. Es machte sie befangen, dass wir nichts sagten; sie rückte ihre Hutbänder zurecht, zog den Shawl über die Brust zusammen und lächelte: «Das ist’s, das wollte ich gesagt haben. Ich gehe jetzt zur ‹roten Birne› hinaus. Mit meinem Seligen sind wir dort oft gesessen, das ist nun schon lange her. Einmal wollte ich noch hinausschauen. Suchen Sie eine ordentliche Partei, Hausmeister. Guten Tag.» Freundlich nickend, ging sie auf die Straße hinaus.
Der Hausmeister zuckte die Achseln: «Sie wird in vierzehn Tagen sterben, sie wird, sie tut’s nicht anders; da kann man reden, was man will; sie weiß es.» Lachend ging er in seine Wohnung zurück. «Sie tut’s nicht anders; sie weiß es», wiederholte er vor sich hin. In mir aber war plötzlich ein reges Interesse für die «rote Birne» erwacht; ich musste der alten Frau folgen.
Da ging sie vor mir her, die breite, leere Straße entlang, durch den grellen Nachmittags-Sonnenschein. Ein wenig schwankend und mühevoll war ihr Gang. Die blanken Atlasbänder des Hutes flatterten matt, und die ganze Gestalt sah wunderlich zerknittert und altmodisch aus, wie eine Puppe, mit der noch die Großmutter als Kind gespielt hat und die plötzlich aus dem vergessenen Winkel der Rumpelkammer in das helle Licht der Wohnstube gebracht wird. Der kleine Schusterbube, der an Frau Pinapel träge mit seinen Holzschuhen vorüberklapperte, musste etwas Ähnliches empfunden haben, denn er blieb stehen und sandte ihr das laute, unbarmherzige Kinderlachen nach.
Dort an der Ecke geriet sie mit dem Winde in Kampf, mit jenem tückischen Wiener Gesellen, der uns stets an irgendeiner Ecke auflauert, um an uns zu zerren und zu zupfen. Der persische Shawl blähte sich, der große Hut begann zu schwanken, und die kleine, gebrechliche Frau schien fortgetrieben zu werden und dahinzuflattern wie ein armer, kranker Vogel.
Die «rote Birne» machte keinen allzu günstigen Eindruck auf mich. Sie befand sich in einer entlegenen, engen Gasse. Auf dem unregelmäßigen Pflaster sonnten sich alte Schuhsohlen und Orangenschalen. Vor den Häusern saßen bleiche Kinder; die kleinen, unreinlichen Hände lässig über den Knien gefaltet, gaben sie sich melancholisch der Trägheit des schwülen Sommernachmittags hin. Die Glastür des Wirtshauses war offen. Auf der Schwelle stand der dicke Zahlkellner; die Hände in den Hosentaschen, die Beine auseinandergespreizt, das Haar, von dem eben beendeten Mittagsschlaf auf einem Gasthaustisch wirr an die eine Seite der Stirn geklebt, schaute er mit zusammengekniffenen Augen die Straße hinab. Als ich Anstalten machte, in das Gasthaus einzutreten, blickte er mich verächtlich an, rückte ein wenig zur Seite, um mir den Durchgang zu gestatten, und mir war es, als wollte er mich grüßen, die Faulheit übermannte ihn aber, und er brachte es nur zu einem matten: «Hab!» Drinnen im Gastzimmer waltete eine heiße, dumpfe Luft und der widrige Geruch nach kaltem Fett. Die gelben Vorhänge an den Fenstern waren geschlossen und gönnten dem Gemach nur ein fahles, ärmliches Licht. Hie und da drang ein dicker, rotgoldener Sonnenstreifen durch eine Spalte und flimmerte auf der braunen Tapete und auf den rotgeblümten Tischtüchern. Dort in der Ecke schlief der kleine Bierkellner, die Arme auf den Tisch und den Kopf in die Arme gestützt. Am Tische nebenan saß ein alter Herr und schlief ebenfalls, die Zigarre schief in einem Mundwinkel, den Kopf an die Wand gelehnt, und im Hintergrunde, auf dem Buffet, mitten unter den Tellern und Gläsern, lag ein brauner Kopf mit glatten, stark geölten Locken, und wunderlich verschlafene Laute tönten herüber. Dafür trieben aber die Fliegen ein besonders reges Wesen. Sie summten eifrig durcheinander, bald ärgerlich, bald eintönig forterzählend, sie stießen brummend an die Fensterscheiben, jagten sich durch die Luft, stritten um die Nase des schlafenden alten Herrn und feierten tolle Orgien in den Biergläsern und auf den Fettflecken der Tischtücher.
Ich setzte mich still an den nächsten Tisch. Diese schläfrige, unreinliche Umgebung bedrückte und verstimmte mich. Hier eine liebe Erinnerung aufzusuchen muss hart sein, sagte ich mir. Ich spähte umher. Wo war Frau Pinapel? Oh, dort in der Fensternische! Sie saß ganz gerade auf ihrem Stuhl; vor ihr stand ein Glas Bier, daneben lag der Geldbeutel aus blauer Seide. Ihre Blicke machten langsam die Runde durch das Gemach; sie ruhten auf dem angerauchten Papier der Tapete, auf den Tischen, den gelben Vorhängen; es lag in ihnen wie Liebkosung und Rührung. Dabei lächelte sie ein ernstes, feierliches Lächeln. Zuweilen nickte sie leise; dann sah sie wieder nachdenklich vor sich hin. Die grauen Augen waren feucht – feucht von den Tränen, die so bald die Augen alter Leute überfluten und sie mild und friedlich glänzen lassen. Ein Sonnenstrahl glitt über ihre bleiche Wange und lieh dem alten, faltigen Gesicht etwas von dem blonden Glanze der Jugend. Sie tat einen langen Zug aus dem Glase, langsam und sorgfältig, und als sie es niedergesetzt, lächelte sie wieder und blickte freundlich auf den leeren Stuhl ihr gegenüber. Jetzt, da das Bier ausgetrunken war, glaubte sie gehen zu müssen. Sie sah ängstlich zum schlafenden Kellner hinüber. Würde er es nicht übel nehmen, wenn sie noch bliebe? Sie wollte gern noch bleiben, noch stille dasitzen und der hellen, längst vergangenen Liebes- und Jugendgeschichte nachträumen, die ihr dieses enge, dumpfe Gelass erzählte. Nun war es nicht mehr möglich. Der Zahlkellner trat in das Zimmer und betrachtete sie unzufrieden. Sie musste gehen! «Ich bitte, zahlen», flüsterte sie höflich.
«Zahlen!», schnarrte der Kellner und klapperte mit seinem Geldsack.
Frau Pinapel erkundigte sich gespannt nach dem Preise des Bieres und zählte das Geld aufmerksam auf den Tisch. Zwei Kreuzer Trinkgeld schob sie dem Kellner zu mit einem zufriedenen Lächeln, als wollte sie ihm eine besonders angenehme Überraschung bereiten; als aber die zwei Kreuzer ohne Dank im Geldsacke verschwanden, machte sie ein enttäuschtes, ein wenig erschrockenes Gesicht: «Jetzt muss ich gehen», sagte sie und ordnete ihren Shawl. Sie hatte noch etwas auf dem Herzen. Der Kellner jedoch kam ihr so wenig entgegen; er stand vor ihr und sah sie mit seinen Fischaugen gleichgültig an. Es fiel ihr schwer: «Bitte, ich wollte nur fragen», begann sie, «stand früher nicht dort in jener Ecke auch ein Tisch?»
«Ja wohl», erwiderte der Kellner.
«Nicht wahr? Ich wusste es wohl, dort stand er. Ich danke.»
Der Kellner ließ sich zu der Erklärung herbei: «Wir haben ihn fortgetan; die Gäste klagten über Zugwind.»
Frau Pinapel schüttelte den Kopf: «Damals zog es nicht; nein! nicht im Geringsten.» Sie verneigte sich tief und flatterte fort.
Der Kellnerbube rief ihr halb im Schlaf ein: «Empfehl mich!» nach. Sie wandte sich um, nickte ihm zu: «Grüß dich Gott, mein Kind.» Dann sah sie noch einmal auf das Gemach zurück, ernst und innig, wie fromme Leute beim Verlassen der Kirche noch einen Blick auf den Altar werfen, um ein Stück Andacht auf die Straße mit hinaus zu nehmen.
Als sie an mir vorüberging, erkannte sie mich. Sie grüßte betroffen, und ihre eingefallenen Wangen erröteten, wie die Wangen eines Mädchens, das ihr Liebesgeheimnis entdeckt sieht.
Ich weiß es nicht, ob Frau Pinapel die vierzehn Tage genau eingehalten hat; um vieles hat sie sich aber nicht verrechnet. Auf ihrem Fenster liegt auch heute voller, lustiger Sonnenschein, es ist weit geöffnet. Die Leni lüftet das Zimmer. Die neue Partei kann gleich einziehen.
Das Sterben. Ein Sommerbild
Die alte Lise konnte heuer bei der Ernte nicht mittun; seit siebzig Jahren zum ersten Male, denn sie war schon mit acht Jahren eine Arbeiterin gewesen, die mitzählte; noch voriges Jahr hatte sie mehr Garben gebunden als die anderen, die jungen Weiber. Wenn alle anderen über die große Hitze klagten, hatte die alte Lise behaglich mit den knochigen Schultern gezuckt und gemeint: «Mir ist grade recht. Für einen alten Menschen ist’s nie warm genug.» Dabei ging ihr die Arbeit um Mittagszeit so gut vonstatten wie um Sonnenaufgang.
Der letzte Winter jedoch hatte der zähen Kraft der Greisin hart zugesetzt. Sie wollte es anfangs nicht zugeben, dass ihr Körper sie im Stich ließ, dass sie es den Jungen nicht mehr gleich oder gar zuvortun konnte.
«Sitzen Sie ruhig zu Hause, Mutter», sagte der Bauer, wenn die Alte klagte, dass es mit dem Holzauflesen nicht mehr gehen wolle. «Der Mensch dauert ja nicht ewig. Mit achtundsiebzig Jahren geht es eben zu Ende. Man kann nicht immer so fortarbeiten.»
Die Alte schüttelte den Kopf. «Nein, nein! Meine Mutter hat bis zu ihrem fünfundachtzigsten Jahre gearbeitet.»
«Ja», meinte der Bauer, «was kann man da sagen! Der eine hält längere, der andere kürzere Zeit aus. Wie’s kommt! Und wir sind, Gott sei Dank, nicht so gestellt, dass wir ohne Ihre Arbeit darben müssten»; dabei lachte er, die Pfeife fest zwischen die Zähne geklemmt, wohlig in sich hinein, stolz auf seine Wohlhabenheit. Mit solch einem Bauernhof kann man es schon verlangen, dass die Alte die Hände in den Schoß legt und ruhig auf den Tod wartet; nicht wahr?
Sterben – gut. Das versteht sich von selbst. Man legt sich auf sein Bett und stirbt; das ist in der Ordnung: aber auf den Tod warten, müßig sein, husten, bei jedem zehnten Schritt nach Luft schnappen müssen, wozu ist das gut? Das fiel der alten Lise sehr schwer. Während die anderen die Frühjahrsarbeit besorgten, musste sie zu Hause bleiben, als ginge sie all das nichts mehr an. Vom Sommer hatte sie sich Besserung versprochen; bei der Ernte wollte sie wieder dabei sein, dachte sie sich, obgleich sie es sich nicht auszusprechen getraute; sie schämte sich vor den anderen, weil sie an ihren Tod nicht glauben mochte.
Aber auch der Sommer brachte die erhoffte Stärkung nicht. Die Alte saß in ihrem Winkel, ließ sich von der Sonne wärmen, und ihre einzige Arbeit war das Atmen, eine schwere, mühsame Arbeit. Wie müde das den alten Körper macht, sich das bisschen Luft zu verschaffen! Für die Hausgenossen war die Mutter nun die alte, unnütze Sache geworden, der man einige Pflege angedeihen ließ, wenn man gerade Zeit dazu hatte, die man sonst aber in ihre Ecke stellte, ohne sie viel zu beachten, wartend, dass die Zeit käme, sie ganz fortzustellen.
Wer kann sich während der Ernte viel um alte Leute kümmern! Am Morgen stellt die Bäuerin Wasser und Essen an das Bett der Mutter, ein Kranker isst ja ohnehin nicht viel, und dann ging alles auf das Feld hinaus. Dem jüngsten, der kleinen Grethe, wurde aufgetragen, achtzugeben, ob die Mutter nicht rufen würde.
Da lag die alte Lise auf ihrem Bett in der niederen Bauernstube, das Kopftuch tief in die Stirne gezogen, die Arme gerade am Körper anliegend, die Decke bis zum Kinn emporgezogen, und schlief, gelb und regungslos wie eine Tote. Als sie erwachte, drehte sie sich ein wenig auf die Seite und schaute nach den Sonnenstrahlen auf der Wand: «Es muss sieben Uhr sein», sagte sie sich. Die Außentür stand offen. Draußen, auf dem Sandhaufen vor dem Hause, saß die kleine Grethe, trommelte mit einem Stöckchen auf einem umgestülpten Wasserkübel und sang, den blonden Kopf zurückgeworfen, aus Leibeskräften. «Rei-rai-raa, tai-tai-taa.» Auf der Türschwelle stand die gelbe Henne, bog den Kopf zur Seite und gluckste leise, während hinter ihr her die Küchlein, eine Schar gelber Kugeln, in das Zimmer rollten. Von der anderen Seite des Hauses aber kam ein helles, regelmäßiges Tönen herüber. Die Alte hob den Kopf und horchte. Das war das Mähen. Der Ton sagte ihr ganz genau, wo gearbeitet ward: «Jetzt sind sie hinter dem Hause auf dem Hügel; bis zu Mittag werden sie bis zur Eiche unten am Abhange kommen. Ja, ja! Gut soll die Ernte heuer sein, hat der Bauer gestern noch gesagt.» Müde ließ sie den Kopf auf das Kissen zurücksinken und schloss die Augen. Im Halbschlummer sah sie genau das Feld vor sich, auf welchem gearbeitet wurde, den niedrigen, sonnbeschienenen Hügel, den Bauer in seiner weißen Leinwandhose, vormähend, die Arbeiter hinter ihm, weiter fort die Weiber mit den Rechen, am Abhange unten die Eiche, deren abgestorbener Wipfel wie ein grauer Spieß in das Himmelsblau hineinsticht, und unten im Schatten, auf dem Rasen, die gelben Holznäpfe mit dem Mittagsmahl und das Brot, in weiße Tücher eingeschlagen. Die alte Lise sah das alles ganz deutlich, im Traume war sie mit dabei.
Ein Hustenanfall weckte sie wieder. Sie griff nach dem Wasserkrug und trank. Dann hüllte sie sich fester in die Bettdecke; es fror sie, Hände und Füße waren wie erstarrt. Jetzt musste es Mittag sein, das sah sie an dem grellen Licht, das auf den Fliesen des Fußbodens lag. Die Henne hat sich vor der Mittagsonne in den Schatten unter die Ofenbank geflüchtet; man hörte nur zuweilen das Rascheln ihrer Flügel, wenn die Küchlein unter denselben unruhig wurden. Fliegen schwirrten hart unter der Zimmerdecke hin und her; ihnen tat der Sonnenschein wohl, und ihr stetiges Summen klang wie das Sieden und Kochen dieser heißen Stunde.
Draußen war es still geworden; die Arbeiter hielten wohl unter der Eiche ihre Mittagsruhe. Auch Grethe saß nicht mehr auf ihrem Sandhaufen. Mein Gott, so ein Kind! Das will auch nicht zu Hause sitzen, noch dazu um die Erntezeit, da am Feldrain unbeaufsichtigte Grützeimer und Butternäpfe stehen. Die Alte richtete sich auf. Sie hatte im Traum so eifrig mitgearbeitet, und etwas von der langgewohnten, rüstigen Lebensempfindung, die der Traum gebracht, dauerte noch fort in dem frierenden, zitternden Körper der Sterbenden: «Draußen muss es wärmer sein», sagte sie sich. «Es ist ja auch gleichgültig, wo man liegt. Ich habe oft genug unter der Eiche geschlafen. Ja, ja! Dort muss es wärmer sein.» Aber es war die plötzlich erwachende Sehnsucht, noch am Leben teilzunehmen, von der die Alte hinausgetrieben ward, denn wo war denn sonst Leben, wenn nicht auf dem Felde, dort, wo man arbeitet?
Das Aufstehen war schwer, das Gehen noch schwerer. Auf einen Stock gestützt, kroch die Alte stöhnend zur Tür. Die Henne unter der Ofenbank stieß einen gedehnten schläfrigen Laut aus und verdrehte gelangweilt die rotgoldenen Augen, als dächte auch sie: «Alte Menschen sollen ruhig im Bett liegen. Der Mensch dauert nicht ewig.» Die alte Lise wusste das wohl, sie wollte ja auch nicht ewig dauern; nur ein wenig wollte sie noch das Feld sehen, die Sensen hören. Vor der Haustür blieb sie stehen und keuchte, dabei schloss sie die Augen, denn das Licht tat ihr weh. Aber sie erholte sich wieder und ging weiter – am Schweinestall – an den Salatbeeten vorüber – jetzt war sie auf dem Felde; da standen die Korngarben schon vor ihr. Es schwindelte ihr – der Husten schüttelte sie – sie konnte nicht weiter und fiel stöhnend auf eine der Garben nieder.
Die Halme waren heiß von der Sonne und dufteten stark; die Alte streckte sich auf ihnen aus. Die Anstrengung hatte sie ganz niedergeworfen; sie röchelte, Schweiß auf der Stirne, und rang nach Luft: «Der Tod, der Tod!», stöhnte sie. Die Mittagssonne jedoch tat ihr für einen Augenblick gut. Sie wurde ruhiger, öffnete die Augen; sie erkannte wieder alles um sie her. Dieses war das Feld, das sie vorgestern abgemäht hatten. Dort drüben waren die Felder des Gutsherrn. Diese weiten blonden Flächen glänzten und sprühten wie Atlas. Auf dem Hügel die grüne Insel war der Friedhof; die Augen der Sterbenden unterschieden deutlich zwischen den Bäumen das graue Schindeldach des Glockenhäuschens. Weiter fort die Birkenallee, wie ein langer, grüner Schleier auf weißen Stäben ruhend. Ja, die alte Lise kannte dort überall jeden Stein und jeden Strauch, und kam nun der Tod wirklich, dann musste sie fort, sah all das nicht mehr. Das ging ihr nicht in den Kopf. Ja, was dann? Ein Toter ist fort. Aber wo ist er? Ein Frost schüttelte ihr die Glieder. Sie drückte sich fester in die Halme. Sie war stets eine gute Christin gewesen, Gott wird sie wohl annehmen; aber – wenn auch! Hier kannte sie alles von Jugend auf, und dort ist man doch fremd, es ist doch nicht wie zu Hause. Sie seufzte. Es war da nichts zu machen, aber das Herz war ihr sehr schwer. Achtundsiebzig Jahre war sie hier hin und her gegangen, hatte sie diese Bäume, diese Plätze gesehen, diese Felder gepflegt, ohne besonders an sie zu denken, und heute stellten sie sich alle so gegenständlich und selbständig vor sie hin, wie etwas, das bleibt, wenn auch die alte Lise nicht mehr ist. Ach Gott! Die durften leben – und sie? Was ist denn ein Toter? Nichts. Man ist bei Gott. Ja, ja! Aber doch nichts, wenigstens für die auf der Erde. Es war, als schämte sich die Alte der lebensfrohen Natur gegenüber ihres Sterbens. Was da lebt, bekümmert sich nicht um die Alte, die fort muss. Das besorgt seine Ernten, das grünt, das singt. Das Lärmen der Feldgrillen und Lerchen ringsum schrillte ihr wie ein hochmütiges Prahlen mit Leben in die Ohren. Sie gehörte nicht mehr dazu. Sie wollte beten. Mühsam faltete sie die steifen, kalten Finger ineinander und bewegte die Lippen: «Vater unser, der du bist im Himmel»; aber die Gedanken vergingen ihr, sie meinte, sie werde einschlafen, und davor fürchtete sie sich. Auf ihrem Rocke saß eine Heuschrecke, eines jener grünen Ungeheuer, wie die Alte sie oft während der Mittagsrast zwischen ihre harten Finger genommen hatte, um zu sehen, wie das Tier mit den langen Beinen zappelt. Heute saß die Heuschrecke ungestört auf dem Rock der alten Lise und bewegte den abenteuerlichen, grünen Kopf. Die Sterbende blickte das Tier misstrauisch und ärgerlich an; plötzlich fuhr sie mit der Hand nach ihm und überdeckte es. Es sollte spüren, dass sie noch nicht so tot sei, dass man auf ihr umherhüpfen durfte. Dann aber legte sich ein dunkler Schleier über ihre Augen, und ihr ward, als müsse sie mit aller Kraft gegen etwas ankämpfen. Sie rang nach Luft; der dürre, sehnige Körper zuckte; die trübblauen Augen starrten regungslos in die Sonne. Einmal bewegten sich noch die Lippen und flüsterten: «Was zu schwer ist, ist zu schwer», wie ein Arbeiter, der sich vergebens abmüht, eine große Last zu heben, und endlich mutlos davon absteht. Dann streckten sich die Glieder, dass die Halme raschelten.
Als die Leute von der Arbeit heimkamen, fanden sie die Alte tot auf einer Korngarbe liegen: «Hat die hier heraus müssen, um zu sterben», meinte der Bauer und lachte gerührt. Die Arbeiter hoben die Leiche auf, um sie fortzutragen. Die rechte Hand der Toten, die flach auf ihrem Beine ruhte, glitt dabei herab, und eine Heuschrecke sprang unter ihr hervor. «Seht doch», sagte einer der Knechte, «was die Alte noch im Sterben erwischt hat!» Die kleine Grethe wollte das Tier fangen, aber die Bäuerin wehrte ihr: «Lass!», sagte sie ernst und geheimnisvoll. So trugen sie die alte Lise in das Haus. Der Bauer blieb zurück und schüttelte die zerdrückte Garbe wieder zurecht; dann schritt er quer über die Stoppelfelder zum Friedhof hinauf, um für die Alte die Totenglocke zu ziehen.
Grüß Gott, Sonne!
Die Vroni hatte beschlossen zu sterben. Während sie im Geschäft die Federn und Blumen in die Pappschachtel packte, um heimzugehen, war es ihr klar geworden. Wenn ein armes Mädchen einen Schatz hat, und der verlässt es und geht schon den dritten Sonntag mit der schwarzen Lena ins Wirtshaus, dann bleibt eben nichts übrig als der Tod, nicht wahr? Das Weinen und Sich-Härmen hatte Vroni satt. Mit der Eifersucht, die ihr wie eine Krankheit am Herzen fraß, weiterleben, war nicht möglich. Ernst band Vroni die Schnur um die Schachtel, nickte der Dame an der Kasse einen «Guten Abend» zu und ging in den Frühlingsabend hinaus. Fest in die helle Sommerjacke geknöpft, blonde, flatternde Löckchen auf der Stirn, wand sie sich flink durch das Gedränge. Auf dem Weg in die Vorstadt hinaus dachte sie über ihren Entschluss nicht nach; wozu auch? Der stand fest, und damit war’s gut! Fleißig schaute sie nach rechts und links; ab und zu grüßte sie mit dem kurzen, lustigen Nicken der Münchner Mädchen, und als ein Berauschter an ihr vorübertaumelte, sandte sie ihm das rücksichtslose Lachen des Vorstadtkindes nach.
Jetzt war sie zu Hause und sprang leicht die vier Treppen zu ihrer Wohnung hinauf. Ihrer Zimmerfrau rief sie ein helles «Grüß Gott, Frau Nestelmeyer!» zu, dann verschloss sie sich in ihrem Stübchen. Nachdem sie ordentlich, wie jeden Abend, Hut und Jacke beiseitegelegt, holte sie ein Fläschchen aus dem Kasten und setzte es auf den Tisch. Das hatte Frau Nestelmeyer ihr gegen Zahnweh gegeben. Viel war nicht darin, aber es trug einen Zettel mit einem Kreuz, einen Totenkopf unter dem Worte: «Gift» – da mussten wenige Tropfen genügen. So! Nun war sie fertig. Sie sann einen Augenblick: «Nachtessen!» Nein, wenn einer stirbt, braucht er kein Nachtessen. Das war selbstverständlich; allein es überlief Vroni bei diesem Gedanken doch so kalt. Sie fand es nun dumpf im Stübchen und öffnete das Fenster. Die Abendluft tat wohl. Vroni legte sich in das Fenster und schaute hinaus; sie hatte ja noch Zeit. Die Frühlingsdämmerung lag grau über den Dächern, auf der Straße erwachten die Gasflammen, eine Reihe gelber Lichtpünktchen, und oben, am bleichen Himmel, blinkte ein Stern mit weißem, unruhigem Glanz. Ein feuchtes Wehen kam aus der Ferne, die, von Nebel und Zwielicht verhangen, so unendlich und geheimnisvoll erschien. Und Vroni war es, als weitete sich auch ihre Seele, die enge, heiße Mädchenseele, in der die törichten Liebesschmerzen summten, wie Sommerfliegen, die sich in einer Tulpe gefangen haben. Sie fühlte sich so ganz allein diesem großen Schweigen und dem im Blau verlorenen Sterne gegenüber. Ja! So muss der Tod sein – so einsam und still und unendlich! Tiefes Mitleid mit sich selbst stieg in Vroni auf. Bleich und regungslos würden sie sie morgen finden; sie würden Blumen bringen und weinen, und er würde wohl wissen, wer sie da hineingetrieben.
Von unten aus der Finsternis stieg jetzt ein süßer, schwüler Duft auf. Dort musste wohl in der Nacht etwas erblüht sein. Dieses Duften brachte Vroni wieder zur Erde und ihrem Kummer zurück. Sie dachte an Lena, an den Verrat ihrer Liebe und schluchzte vor Zorn und Eifersucht. Das müsste ein Ende nehmen; sie war zu unglücklich! Sie griff nach dem Fläschchen und leerte es auf einen Zug. Eine Weile stand sie regungslos da und wartete: «Der Tod kommt nicht so schnell», sagte sie sich, sie hatte noch Zeit, sich niederzulegen.
Vroni lag nun auf ihrem Bette und horchte in sich hinein, ob die unheimliche, rätselhafte Arbeit des Sterbens in ihr beginne. Es war doch wunderbar, so still dazuliegen und zu warten. Was wird geschehen? Sie werden sie aufbahren und zum Friedhof hinaustragen; gut! Das war denkbar. Aber wo war sie, die Vroni, dann? Nicht leben – nicht mehr sein – wie ist das? Das arme Mädchen, allein in der stillen, finstern Stube vor dieses furchtbare Rätsel gestellt, ihm anheimgegeben, ward von entsetztem Bangen erfasst. Die Jugend in Vroni bäumte sich dagegen auf. Geängstigt wollte Vroni aufspringen, Frau Nestelmeyer rufen, doch dann kam es wie müde Mutlosigkeit über sie; die Glieder waren so schwer, die Augen fielen ihr zu: «Es hilft nichts, da kommt er schon, der Tod; da kommt er!», wiederholte sie matt, und es war ihr, als würde sie fortgetragen von einem grauen, weichen Nebelstrom, fort in farblose Dämmerung. Häuser, Straßen zogen vorüber, aber lichtlos und zerfließend; eine Welt von Nebel und Spinnweb. Vroni kämpfte dagegen an; sie wollte nicht mit; sie öffnete halb die Augen. Ja! Da war noch ihr Stübchen, aber auch dieses schien fremd und wesenlos. Vroni seufzte: «Also das war das Sterben!» Oder war sie schon gestorben? Eine widerstandslose Schlaffheit kam über sie, und die tat wohl. «Heilige Maria, bitt für uns!», betete sie. Über ihr, über der grauen Welt stand der Stern, und – da war auch die Muttergottes im blauen Mantel drüben von der Kirche, zu der Vroni das Wachsherz hinausgetragen hatte. Licht und rosig stand sie unter dem Stern, jetzt aber sank Vroni; schnell ging es abwärts. Der Stern und die Muttergottes wurden ganz klein, – hinab – hinab – und es wurde so finster und kühl; das war der Tod.
Vroni schauerte in sich zusammen, sie fühlte es kalt über Arme und Brust hinstreichen und erwachte. Grelles, rotes Licht umflimmerte sie. Sie schloss die Augen wieder und lag regungslos da. Der Kopf schmerzte, und die Glieder waren wie zerschlagen, als hätte sie einen weiten Weg gemacht. Es schien ihr auch, als wäre sie weit fortgewesen und als könnte sie sich nicht mehr zurechtfinden. Etwas Trauriges war geschehen; was war es? Vroni schlug wieder die Augen auf. Allenthalben noch das rote Licht, auf den Wänden, auf der Bettdecke, auf dem Polster neben ihr, und dort auf dem Tische blinkte etwas wie ein Rubin – ein leeres Fläschchen. – Oh! Jetzt wusste Vroni alles! Sie hatte sterben wollen. War sie nicht tot? Warum lebte sie noch? Es war ihr doch, als ob alles aus gewesen wäre. Sinnend blinzelte sie in die Morgensonne und wusste nicht, wie ihr ward. Doch plötzlich erfasste sie eine köstliche Unruhe, wie eine warme Welle jungen Blutes ergoss es sich über ihr Herz: «Ich lebe!», jauchzte sie auf, sprang aus dem Bette und stürzte an das Fenster. Da stand die Sonne, eine mächtige purpurne Kugel, und um sie her, hoch am klaren Himmel, hingen verstreute Wölkchen, rosig angeleuchtet, dass sie wie ausgelassene Engelkinder ausschauten, welche im glashellen Blau schwimmen. Der Morgenwind kam und brachte die Düfte all der tauigen Gärten mit, über die er hingestrichen. Unter dem Fenster aber hatte sich über Nacht ein kleiner, im Gemäuer verlorener Fliederstrauch über und über mit blauen Blüten bedeckt. Vroni hob ihre nackten Arme in den Sonnenschein hinauf; sie lachte über das ganze Gesicht und rief: «Grüß Gott, Sonne!»
Von der Straße schaute ein Vorübergehender verwundert zu dem Mädchen hinauf, das ganz in Morgenlicht gebadet, lachend der Sonne die Arme entgegenstreckte; er musste auch lachen und antwortete: «Grüß Gott!»
Grüne Chartreuse
Das Nachtmahl war beendet. Der lange Fritz, mit dem blassen, diskreten Gesichte, servierte den Kaffee und die Liqueurflasche; dann schloss er lautlos hinter sich die Türe.
Miezi und Egon, in ihre Sessel zurückgelehnt, schwiegen beide. Egon blies nachdenklich den Rauch seiner Zigarette vor sich hin. Er fand, dass sich plötzlich etwas wie Müdigkeit, fast wie Traurigkeit, über dieses Restaurationskabinett breitete, mit seinen fest zugezogenen gelben Vorhängen, hinter denen der Regen an die Scheiben klopfte, mit seiner vornehmen Stille und der schwülen Luft, die nach Zigaretten und New-mown-hay roch. Seltsam! Vor wenig Wochen noch hätte der Gedanke, mit Miezi hier so vertraut und allein zu sitzen, ihn eine Seligkeit gedünkt. Gott! Wie krank vor Liebe war er damals gewesen! Und nun, da diese gefeierte, vielbegehrte, grausame Miezi sein war, nun diese Stimmung! Sinnend schaute er das Bild an, das der große Spiegel dort an der Wand ihm zeigte. Da lag er selbst im Sessel. Wie schmal er in dem schwarzen Gesellschaftsanzuge ausschaute! Wie bleich und müde das regelmäßige Gesicht sich gegen die Stuhllehne stützte. Das Leben genießen ist nicht immer eine leichte Arbeit, das, fand Egon, sah man ihm an. Und neben ihm Miezi; die Arme lagen schlaff auf den Seitenlehnen des Sessels. Den Kopf hatte sie ein wenig zurückgebogen; die Lampen des Kronleuchters badeten ihr Gesicht in grellem Lichte, das es wunderbar weiß erscheinen ließ und der Haut einen matten Schmelz, etwas Überzartes verlieh unter dem sanften Flimmern der aschblonden Haare. Miezi schaute aus wie etwas sehr Kostbares und sehr Zerbrechliches; wie eine fremde, weiße Treibhausblume. Ihre Augen blickten starr empor, wie in tiefe und nicht lästige Gedanken versunken: «Was ihr nur heute sein mag?», sagte sich Egon. «Oh! Ich sehe! Sie wird gefühlvoll, und dann kommt die Lebensgeschichte!» Er kannte sie, diese oft erzählte, wunderliche Geschichte, voll großer Namen und großer Geldsummen, und die jedes Mal ein wenig anders lautete. Da kam ein Schloss vor, auf dem Miezi geboren war; eine Kindheit voll vornehmer Unschuld; endlich ein russischer oder serbischer Fürst, der Miezi entführte, eine Geldkatastrophe in Monte-Carlo … Dann schob Miezi wohl gerne am linken Arm das Armband ein wenig hinauf und zeigte eine kleine, rote Narbe. Da hatte sie mit der Schere hineingestochen, als er sie verließ und sie sterben wollte. Ach ja! Wenn Miezi das erzählte, sah sie stets so hübsch sentimental aus, … aber – Egon hatte die Geschichte schon so oft gehört und sie blieb doch so nebelhaft!
Miezi beugte sich jetzt vor, ergriff ihr Liqueurglas und nippte daran mit gespitzten Lippen; dann, Egon über das Glas hin anschauend, sagte sie ernst: «Das schmeckt nach Wald!»
«Ach ja, der Wald!», rief Egon gefühlvoll und trank sein Glas langsam aus: «Wer jetzt dort sein könnte – tief drinnen – allein mit ihm!»
Miezi sah Egon scharf an, dabei lag es wie Spott um ihre Lippen und in ihren Augen: «Geh! Was weiß so einer wie du vom Walde!»
«Ich!», erwiderte Egon und lächelte wehmütig. «Der Wald bedeutet für mich die Kindheit – die Jugend – Glück; ja, das einzige, ungetrübte Glück! Wenn ich so von Hause durchbrennen konnte und von der Chaussee ab in den Wald bog, immer geradeaus über die glatten, braunen Tannennadeln, zwischen den Tannen durch, die mir das Gesicht wie mit kleinen, kühlen Nägeln zerkratzten, das war Glück. Das verstehst du natürlich nicht; aber so ist es. Auf der kleinen Lichtung, die gelb vom Sonnenschein dalag, warf ich mich in das Moos, glatt auf den Bauch und trank den Duft der sonnenwarmen Tage und dachte an nichts und fühlte mich unbändig wohl. Wenn dann die Libellen sich auf meine Brust setzten und die Hummel dicht über mein Gesicht hinläutete, dann fühlte ich, dass ich zu ihm, dem Walde, gehörte – zu der Gesellschaft der Tannen und Hasen, und das machte mich stolz.»
Egon schwieg eine Weile, in seine Waldvision versunken, bis Miezi ihn mit einem scharfen: «Nun, und dann?» weckte.
«Ja, das war Leben!», fuhr Egon fort. «Alles, was später kam, war doch nur so zusammengedacht und nachgebildet; ja alles – selbst du, Miezi; denn auch die Liebe versteht der Wald besser. Im Frühling weht im Walde eine so mächtige Liebeslust, da muss ein jeder das Lieben lernen. Hier lockt der Haselhahn, auf dem trockenen Eichenwipfel girrt der Täuberich, von der Wiese klingt das tolle Lied des Birkhahns herüber; und erst des Abends, wenn der Himmel blass und silbern wird und es weiß aus dem Sumpfe aufsteigt, dann kommt es über die Waldwipfel einsam und schwarz mit feuchtem, wohligem Quarren herangeflogen, die Waldschnepfe, die in der Dämmerung auf Liebesabenteuer ausgeht. Siehst du, da kann keiner allein bleiben; ein jeder muss mittun und sich nach einer umsehen.»
«Nun und?», fragte Miezi wieder spöttisch.
Egon lächelte seiner Erinnerung zu: «Nun ja, natürlich; ich sah mich um und fand die Lisei. Sie stand gerade mit hochgeschürztem Röckchen im Bach und fing Forellen. Die gelben Haare fielen ihr in Strähnen in das schmale, wilde Gesichtchen – und alles war so blank in der Abendsonne – das Wasser und das Haar und die braunen Arme der Lisei; das Gold floss nur so an dem Mädel nieder. Da sprang ich denn zu ihr in das Wasser, mitten in all den Glanz hinein. Ja, das ist nun alles vorüber!», schloss Egon melancholisch. »Die Lisei hat wohl ihren langen Waldhüter genommen. Ich habe sie nicht mehr wiedergesehen. Wozu? Es ist doch alles vorüber.»
«Oh! recht hat sie gehabt, die Lisei», sagte Miezi und lachte dabei höhnisch und böse.
«Du spottest darüber», meinte Egon, «natürlich. Für dich ist der Wald ja nur eine Dekoration; etwas, das keine Seele hat. Du kennst ihn nicht.»
Wieder lachte Miezi erregt: «Ich kann mir’s denken, wie der Wald und die Lisei sich über so ’n junges Herrchen gefreut haben werden, das einmal seinem Hofmeister durchgeht, um die Nase ins Grüne hinauszustecken! Was so einer vom Walde weiß! – Da muss einer frühmorgens, wenn der Himmel noch rot ist, mit den Schafen in den Wald. Kalt ist’s dann freilich. Das Moos ist noch steif von Reif und knistert wie Seide. Ja, und dann den ganzen Tag im Walde, jahraus, jahrein; da kann einer den Wald verstehen. Ich war so klein, als ich anfing, die Schafe in den Wald zu treiben, dass ich in der großen, rundgebogenen Wurzel meiner alten Tanne ausgestreckt liegen konnte wie in einem Bett. Später, da ging das nicht mehr. Der Friedel wollte die Wurzel durchhauen, damit ich darin sitzen könnte; das litt ich aber nicht. An meine Tanne durfte keiner rühren.»
«Ein Friedel war da auch!», warf Egon verwundert ein.
«Ja, der Friedel vom Steinhofbauern», sagte Miezi, als müsste das ein jeder wissen: «Der Wald war meine Stube. Am Morgen sprachen die Bäume alle durcheinander. Die großen hatten ruhige, tiefe Stimmen, aber das Unterholz wisperte so fahrig drein. Um Mittagszeit schliefen wir, die Bäume und ich. Am Abend aber, wenn der Himmel blank durch die Stämme leuchtete, dann fingen sie wieder an, aber anders als am Morgen, größer, heiliger war dann das Rauschen. Ich vergaß mit dem Zuhören das Heimtreiben; erst wenn der Igel auf der Mäusejagd an mir vorüberging, besann ich mich darauf, dass es spät war. Unseren Gendarm nannte der Friedel ‹den Igel›.» Miezi lachte ein frohes, kindliches Lachen. «Jesus!», fuhr sie fort, langsam, wie im Traume, sprechend: «War der Friedel ein närrischer Bub! Eines Abends, es war das letzte Jahr, als wir die Schafe heimtrieben, fasste er mich um, hob mich auf und wollte mich bis an unseren Gartenzaun tragen. Ich hab mich gewehrt; ich hab ihn gebissen und gekratzt; der Friedel aber war stark. Er trug mich bis an den Gartenzaun und setzte mich mitten in das Mohnbeet hinein, dass ich ganz nass vom Tau wurde … Und dann, weil ich den Wald gern bei Nacht sehen wollte, sagte der Friedel, ich solle nur kommen, er wolle mich dort erwarten. So bin ich denn fort, als die anderen schliefen. Zwischen den Äckern und in der Birkenschonung, da ging es, da war es hell; aber im Walde wurde es ganz finster, und die Tannen sahen schwarz und fremd aus und fassten sich feucht und kalt an, so dass ich sie nicht mehr kannte. Und auf den Zweigen saßen die Nachtraben und schnarrten und klatschten mit den Flügeln, als wollten sie mich foppen. Gott, die Angst! Und als die Eule zu rufen begann, so traurig, als geschähe ihr ein großes Leid, da lief ich – ich wusste nicht wohin –, ich lief, bis ich über eine Wurzel stolperte und niederfiel. Da lag ich nun und wagte nicht, mich zu regen. Plötzlich hörte ich es über mir rauschen – ganz tief und ernst; das klang wie: ‹ruhig, ruhig, ruhig›. Die Stimme kannte ich; das war ja meine alte Tanne. Ich drückte mich an ihren Stamm, ich griff nach einem niederhängenden Zweige wie nach einer lieben Hand und sagte: ‹Du bist’s, nun ist’s gut!› Da lachte der Friedel hinter mir im Dunkeln und sagte: ‹Und so ist’s besser!› und hob mich zu sich auf, der schlimme Bub.» Miezi schwieg und schaute vor sich hin, als blickte sie auf etwas, das sehr weit fort läge.
«Ich wollte, ich wäre damals bei dir gewesen», sagte Egon zärtlich.
«Du!», erwiderte Miezi und sah ihn feindselig an. «Dich konnte ich damals nicht brauchen!»
«Aber das Schloss, Miezi, und der russische Fürst!», wandte Egon erstaunt ein.
«Geh!», sagte Miezi. «Was gehen mich deine dummen Schlösser und Fürsten an!» Dabei legte sie die Hand über die Augen und weinte.
Die Soldaten-Kersta
Es hatte angefangen ein wenig zu tauen. Der Novemberschnee auf dem Kirchenwege war nass, und der schwere Schlitten bewegte sich springend und rüttelnd vorwärts. Vier Rekrutenweiber saßen in ihm: Marri, Katte, Ilse und Kersta, die Tochter der Häuslerin Annlise. Sie kamen von der Trauung in der Kirche. Morgen sollten ihre Männer fort unter die Soldaten. Über die Brautkronen hatten sie große blaue Tücher gelegt; so saßen sie wie vier spitze, blaue Zuckerhüte in dem Schlitten und wackelten bei jedem Stoß. Der Rüben-Jehze kutschte sie. Sehr betrunken, peitschte er unbarmherzig auf die kleinen, zottigen Pferde ein. Die Männer kamen hinterdrein gefahren, je zwei in einem Schlitten. Es war viel getrunken worden, und sie sangen mit lauten, heiseren Stimmen. Die Frauen schwiegen und wackelten geduldig in ihren blauen Tüchern hin und her. Kersta war die Kleinste von ihnen. Mit einem runden, rosa Gesichte, runden, hellblauen Augen, einer runden Nase, sah sie wie ein Kind aus. Nur der Mund mit den herabgezognen Mundwinkeln war der ein wenig harte und sorgenvolle Mund der litauischen Bauerfrau. Unverwandt starrte sie in den grauen Nebel hinaus, der über dem flachen Lande lag. Wunderlich schwarz nahmen sich die Wacholderbüsche und die Saatkrähen in all dem Grau aus, während die entlaubten Ellern wesenlos wie kleine rötliche Wolken auf der Heide standen. Vor Kerstas Augen schwankte dieses ganze farblose Bild sachte, sachte, als säße sie auf einer Osterschaukel und würde langsam hin und her gewiegt. An jedem Kruge hatten sie Halt gemacht, und Kerstas langer blonder Thome war an den Schlitten der Frauen herangetaumelt mit der Branntweinflasche: «No, is die junge Frau totgefroren, was?» Dabei reichte er ihr die Flasche. Kersta lächelte dann ein wenig mühsam, denn die Lippen waren steif von der Kälte, und trank. Der Branntwein machte die Glieder angenehm warm und schwer, dazu nahm er die Gedanken fort, und das ist auch gut. Immer wesenloser wurde die graue Nebelwelt vor Kerstas Augen; selbst Jehzes breiter Rücken schien immer weiter fortzurücken. Dafür kamen aber die Eindrücke des Tages ihr mit einer bildlichen Deutlichkeit in den Sinn, wie Träume; immer wieder, immer dieselben, wie Menschen, die auf dem Karussell auf dem Jahrmarkte in Schoden an einem vorbeifliegen: Hochzeit – Hochzeit. – Am Morgen das Überwerfen des feinen, weißen Brauthemdes, fein und kalt, dass es Kersta bis in die Fußspitzen erschauern ließ; die Brautkrone, die so fest auf die Stirn gedrückt worden war, dass es schmerzte. Jetzt musste ein roter Streif auf der Stirne sein. Dann die Kirche. Feierlich kalt war’s dadrin. Kerstas neue Schuhe klapperten hübsch auf den Steinfliesen des Fußbodens. Sie musste achtgeben, nicht auszugleiten wie auf dem Eise. Der Pastor hatte ein rundes, rotes Gesicht, und er schmatzte im Sprechen mit den Lippen, als schmeckte ihm etwas gut. Aber schön hatte er gesprochen; von dem Fortgehn der Männer und vom Treubleiben und von Gottes Wort. Kersta hatte geweint, natürlich! Soldatenfrauen weinen immer bei der Trauung, das weiß man. Weinen tut auch gut, weinen, sodass das Gesicht warm und nass wird, und dazu ganz tief seufzen, sodass die Haken am Mieder krachen. Sie hatte stärker geweint als die anderen Frauen, das konnte sie wohl sagen, wenn später darüber gestritten wurde: Nachher im Kirchenkruge war getrunken worden, und die Männer hatten untereinander Streit angefangen. Alles war gewesen, wie es auf einer Hochzeit sein muss. «Hochzeit-Hochzeit» bimmelten die Schellen an Jehzens kleinen Pferden, und Kersta begann ihren Traum wieder mit dem feinen, kalten Brauthemde. Die drei anderen Frauen schwiegen auch und schauten mit demselben stätigen Blick, der nichts zu sehen schien, in den Nebel. Nur als ein Hase vom Felde quer über den Weg setzte – da riefen alle vier: «Sieh – ein Hase» – und sie lächelten mühsam mit den steif gefrorenen Lippen.
Im Dorfe hielten sie vor dem Kruge. Dort standen schon die Hochzeitsgäste in ihren Festkleidern und schrien. An die blinden Fensterscheiben der Dorfhütten drückten sich bleiche Frauen- und Kindergesichter. Alle wollten die Bräute sehn. Das gab Kersta wieder ein starkes Festgefühl. Eine junge Frau sein, die von der Trauung kommt, ist eine Ehre, und der Hochzeitstag der schönste Tag des Lebens. Vor der Krugstüre wartete Kersta auf Thome, denn sie musste mit ihm zusammen in das Haus gehn. Sehr ernst stand sie da und sprach mit den alten Frauen über den Weg; selbst der Gemeindeälteste redete sie an, und die Mädchen starrten neugierig auf ihre Brautkrone. Kersta, die Tochter der Häuslerin Annlise, war es nicht gewohnt, von allen achtungsvoll und freundlich angesehen zu werden, sie war klein, arm, hatte nur eine Ziege und zählte bisher nicht mit. Aber wenn eine Hochzeit hält, dann ist sie schon was. Kerstas rundes Kindergesicht wurde rot und blank wie ein Apfel vor Stolz. Nun fuhren auch die Männer singend und schreiend vor. Thome kam mit unsicheren Schritten auf Kersta zu, fasste sie um den Leib und hob sie in die Höhe. «Klein is sie», sagte er, «aber schwer wie ’n Mehlsack.» Alle lachten. Kersta errötete vor Freude und war Thome sehr dankbar.
In der großen Krugsstube setzte sich die Hochzeitsgesellschaft an die weißen Brettertische. Alle wurden still und ernst und machten sich über die Milchsuppe mit Nudeln her. Ein lautes, gleichmäßiges Schlürfen war eine Weile der einzige Ton im Gemache. Dann kam das Schweinefleisch, dann das Schaffleisch, dann wieder Schweinefleisch. Der Dampf der Speisen erfüllte die Luft wie mit einem dichten, heißen Nebel. Kersta aß eifrig, aß so viel, dass sie sich endlich erschöpft zurücklehnte und die untersten Haken ihres Mieders aufspringen ließ. «Das ist nun die Hochzeit. Ja, schön ist sie!», sagte sie sich. Leicht strich sie mit der Hand über Thomes Rockärmel. Der war nun ihr Mann, der gehörte ihr. Gut ist es, wenn man einen Mann hat. «Trink, junge Frau, trink!», sagte Thome.
Draußen begann es zu dämmern; es wurde Licht in die Stube gebracht, Talgkerzen, die in Bierflaschen steckten. Im dunstigen Zimmer bekamen die kleinen, gelben Flammen bunt schillernde Lichthöfe. Die Musik – eine Geige, eine Klarinette und eine Ziehharmonika – spielte eine Polka. «Ja – tanzen!» Kersta seufzte ganz tief vor Behagen. Sie trat einen Augenblick vor die Haustüre hinaus. Der Abend war dunkel, ein feuchter Wind fegte über den Schnee hin, die Wolken, grau wie ungebleichte Leinwand, hingen ganz niedrig am Himmel. «Morgen gibt es Schnee», dachte Kersta. An der stillen Dorfstraße entlang kauerten die Hütten: Hie und da blinzelte ein schläfriges Licht hinter einer Fensterscheibe, ein Kind weinte, eine Frau sang ein Wiegenlied, immer dieselbe müde, langgezogene Notenfolge. Und dort unten, am Ende der Straße, das kleine, schwarze, stille Ungeheuer, das war die Hütte der Mutter Annlise. Morgen wird alles vorüber sein, als sei nichts gewesen. Kersta wird wieder dort unten mit der Mutter hausen und … Sie fuhr sich mit dem Ärmel über die Augen. Warum ihr das Weinen kam? Dazu war morgen Zeit genug!
Sie ging hinein und tanzte. Das war gut. Wenn man beständig und gewaltsam von einem rücksichtslosen Männerarm gedreht wird, wobei einem die große, heiße Männerhand auf dem Rücken brennt, das nimmt die unnützen Gedanken weg. Nur der Körper bleibt, mit dem warmen Rinnen des Blutes und dem Pochen des Herzens. Die Welt ringsum wurde für Kersta immer undeutlicher und traumhafter. Ernst und eifrig drehten sich die schweren Gestalten in dem dichten Tabaksqualm, die Männer schlugen im Takte mit den Absätzen auf, es klang wie fleißiges Dreschen auf der Tenne. So muss es sein! Das ist das große Vergnügen des Lebens!, fühlte Kersta. Später bekamen die Männer Streit, es wurde gerauft. Kersta griff ein wie die anderen Frauen, aber dieses Mal mit dem stolzen Gefühle, für ihren eignen Mann zu schreien und den anderen Männern in die Haare zu fahren. Endlich führten die Burschen und Mädchen singend das Paar die Dorfstraße hinab, zu der Hütte der Annlise, wo das Brautbett aufgeschlagen war.
Während Kersta in der kleinen Stube das Licht ansteckte, warf Thome sich schwer auf das Bett. Er war sehr betrunken und schlief sofort ein. Kersta zog ihm die Stiefel aus, rückte das Kopfkissen zurecht, dann legte auch sie sich nieder. Die Glieder waren ihr wie zerschlagen. Wenn sie die Augen schloss, war es ihr, als schwankte das Bett hin und her wie ein Kahn. Wirklich schlafen jedoch konnte sie nicht. Wenn der Traum anfing, wenn sie wieder in der Kirche stand oder im Kruge sich drehte, dass die Bänder der Brautkrone wie Peitschenschnüre schwirrten, dann ließ etwas sie auffahren, als schüttele sie jemand. Sie starrte in die Dunkelheit hinein und sann: Etwas Schlechtes wartete auf sie; was war das doch? Ja so! morgen geht der Mann fort – und das alte Leben geht weiter – die Hochzeit ist vorüber und nichts – nichts Gutes mehr für lange Zeit? Draußen dämmerte der Morgen. Die Fensterscheiben wurden blau. Kersta richtete sich auf und betrachtete Thome. Er lag in schwerem Schlaf; das blonde Haar hing ihm wirr und feucht um die Stirn, das Gesicht war sehr rot, aus dem halb geöffneten Munde kam ein tiefes, regelmäßiges Schnarchen. Langsam strich Kersta mit der Hand über seine Brust, seine Arme. «Schlaf, schlaf!», sagte sie wie zu einem Kinde. Ihr Mann, der gehörte ihr wie ihr Hemd, ihr Garn, ihre Ziege, mehr als die Ziege, denn die gehörte auch der Mutter. Das war gut! Nun hatte sie das, was alle Mädchen wollten, um was sie alle beteten – einen Mann; und groß war er und stark. Aber was hatte sie davon, wenn sie ihn gleich wieder fortgeben musste? Gott, es war besser, über solch eine Schweinerei gar nicht nachzudenken! Kersta stieg aus dem Bette und nahm den Melkeimer. Sie wollte die Ziege melken.