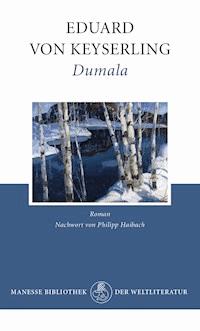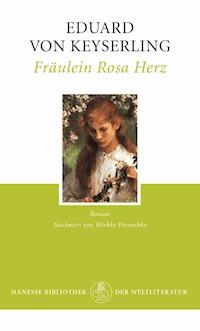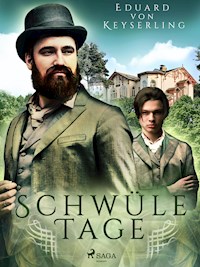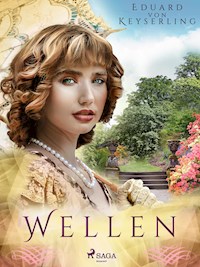22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schwabinger Ausgabe
- Sprache: Deutsch
Er schrieb über die Unentbehrlichkeit der Kultur, über himmlische und irdische Liebe, über Interieurs, großen Stil und über die Kostbarkeiten des Lebens. Er ergründete die Kunst des Traums, dramatisches und episches Sterben, die Lichtmalereien der Avantgarde und die Psychologie des Komforts. Aus seinen Kunstkritiken, Feuilletons und Briefen spricht – nicht minder wie aus seinem erzählerischen Werk – ein Mensch von hoher Bildung und Sinnesart.
Eduard von Keyserling ist als Feuilletonist und Kritiker nicht annähernd so bekannt, wie er es verdient. Daraus resultiert das Glück, ihn mit Band 3 der großen Schwabinger Werkausgabe nun als vielseitig interessierten Kunst- und Literaturliebhaber, Theatergänger und Zeitdiagnostiker entdecken zu können. In seinen nichtliterarischen Prosatexten spiegeln sich die Dekors der Prinzregentenzeit, das bunt schillernde Geistes- und Kulturleben um 1900, Impressionismus, Symbolismus, Jugendstil und die Feuergarben der Avantgarde. Ob er die Goldgeschmeide Carl Strathmanns würdigt, die gleißenden Farbenspiele des frühen Kandinsky oder Alfred Kubins «Kalligraphie des Gespenstischen», Keyserlings ästhetisches Sensorium für die Modernen steht dem für die alten Meister – allen voran Tizian und Dürer – in nichts nach. Die Kritiken, selbst oft kleine Prosakunststücke, zielen weit übers bloß Ästhetische hinaus ins Seelenkundliche, Weltanschauliche, mitunter Politische. Mit luzidem Blick zeichnen sie die geistige Physiognomik einer bewegten Epoche.
Neben den Feuilletons enthält dieser mit 35 Bildtafeln bestückte Band noch weitere Funde: fünf verschollene Erzählungen Keyserlings, ein umfassendes Korpus an Briefen sowie die erste ausführliche Chronik zu Leben und Werk. Dank der Fülle an erstmals zusammengetragenen Selbst- und Fremdzeugnissen nimmt der Schriftsteller, der sich zeitlebens in nobler Diskretion übte, auch als Privat- und Gesellschaftsmensch Konturen an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1326
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Er schrieb über die Unentbehrlichkeit der Kultur, über himmlische und irdische Liebe, über Interieurs, großen Stil und über die Kostbarkeiten des Lebens. Er ergründete die Kunst des Traums, dramatisches und episches Sterben, die Lichtmalereien der Avantgarde und die Psychologie des Komforts. Aus seinen Kunstkritiken, Feuilletons und Briefen spricht – nicht minder wie aus seinem erzählerischen Werk – ein Mensch von hoher Bildung und Sinnesart.
Eduard von Keyserling ist als Feuilletonist und Kritiker nicht annähernd so bekannt, wie er es verdient. Daraus resultiert das Glück, ihn mit Band 3 der großen Schwabinger Werkausgabe nun als vielseitig interessierten Kunst- und Literaturliebhaber, Theatergänger und Zeitdiagnostiker entdecken zu können. In seinen nichtliterarischen Prosatexten spiegeln sich die Dekors der Prinzregentenzeit, das bunt schillernde Geistes- und Kulturleben um 1900, Impressionismus, Symbolismus, Jugendstil und die Feuergarben der Avantgarde.
Autor
Eduard von Keyserling (1855–1918) stammt aus altem kurländischem Geschlecht und studierte Jura und Kunst. Er lebte zunächst in Wien, ehe er sich nach einer ausgedehnten Italienreise als Autor in München niederließ und in der Schwabinger Boheme verkehrte. In seinem Erzählwerk, das zum Stilvollsten gehört, was die deutschsprachige Literatur zu bieten hat, setzte er der Welt von gestern ironisch funkelnde Denkmale.
Eduard von Keyserling
Kostbarkeiten des Lebens
Gesammelte Feuilletons und Prosa
Mit fünf neu entdeckten Erzählungen, den versammelten Briefen und Widmungen, einer Chronik samt genealogischem Abriss sowie Bildtafeln mit 35 farbigen Abbildungen
Herausgegeben und kommentiert von Klaus Gräbner und Horst Lauinger
Unter Mitarbeit von Reinhard Oestreich und Jochen Reichel
Nachwort von Lothar Müller
MANESSE
Kunst und Ästhetik
[Unveröffentlichter Autograf]
Die Kunst des Traumes und der Traum der Kunst
Das Laienurteil
Dürers kleine Holzschnittpassion
Das Nackte in der Kunst und Constantin Meunier
M. Schongauer und die Nürnberger Skulptur
Eindrücke von der Frühjahrsausstellung der Münchner Secession
Tizians himmlische und irdische Liebe und der Platonismus
Moderne Grabmäler
Festwiesen-Kunst
Phalanx-Ausstellung
Martin Buber, Jüdische Künstler
Phalanx-Ausstellung
Die Schwind-Ausstellung in München
Frühjahrsausstellung der Münchner Secession
Ausstellung der Phalanx
Ausstellung der Münchener Secession
Ein Erbbegräbnis
Heinrich Zügel
Albert von Keller-Ausstellung im Münchener Kunstverein
Fritz von Uhde
Frühjahrsausstellung der Münchener Secession
Aus München
Alfred Kubin
Karl Haider
Feigenblätter
Wunder-Darstellungen
[Unveröffentlichter Autograf]
Es ist die Sehnsucht nach einem Echo, was uns treibt, ein Stück Kunst in die Öffentlichkeit hinauszustellen.
10. Mai 1905
Die Kunst des Traumes und der Traum der Kunst
Der Traum gibt uns ein Stück Leben, gibt alles, was zum Leben gehört; den vollen Glauben an die Wirklichkeit der Ereignisse, ursächlichen Zusammenhang, Empfindungen, Gedanken – alles. Wenn der Traum uns oft unklar und verworren erscheint, so kommt das entweder daher, dass wir uns noch nicht ganz von der Welt des Wachens losgesagt haben, dass wir – sozusagen – nur mit einem Fuß im Traumlande stehen, oder die Erinnerung an den Traum ist nicht treu, und sie verwirrt, was im Traume Sinn und Ordnung hatte.
Dieses Stück Leben jedoch passt in unser übriges Leben nicht hinein; und dadurch wird der Traum zum Traum. Oft hört man Menschen sagen: «Ich weiß nicht, habe ich’s erlebt, oder hat es mir bloß geträumt?» – Bei zurückliegenden Ereignissen entfällt dem Gedächtnisse häufig der Zusammenhang, und ein Traum reiht sich als Glied in die Kette des Erlebten ein.
Eine alte Frau, die ich kannte, pflegte ihre Träume stets als etwas wirklich Geschehenes zu erzählen, ja, sie setzte ihre Träume im Gespräch als bekannt voraus, als hätte ihre Umgebung sie miterlebt. Sie war gelähmt, verließ ihr Zimmer nicht, sah stets dieselben Personen, und ein Tag glich dem anderen. Auf dem Sessel einschlummernd, träumt ihr; die Magd kommt und teilt ihr eine Nachricht mit. Erwacht, spricht sie von dem Geträumten mit der Magd wie von etwas Bekanntem, setzt ein Gespräch fort, das sie im Traume begonnen hat. Auch bei Kindern findet man es häufig, dass sie ihre Träume für Wirklichkeit halten, denn ihnen fehlt noch die Übung, den Zusammenhang des Lebens zu übersehen.
Das Bruchstückhafte ist es, was den Traum vom Leben unterscheidet. Wir brechen unser wirkliches Leben ab und geben uns, für eine Weile, einem Lebensfragment hin, um, beim Erwachen, wieder dort an unser Leben anzuknüpfen, wo wir es unterbrochen haben. Dieses Lebensfragment ist nichtsdestoweniger – erlebt – ganz und voll; und beim Erwachen fühlen wir oft noch die Traumleidenschaft in uns nachzittern. Ich habe gefunden, dass der Traum mir oft ebenso vollwertige Belehrung und Bereicherung gegeben hat wie die Wirklichkeit. In einzelnen Zügen ist der Traum oft unzuverlässig, im Gefühl nie; und wenn er mir ein Ereignis bietet, zu dem das Leben mich nicht zugelassen hat, so erregt er in mir Gefühle, die ich, unter denselben Verhältnissen, in der Wirklichkeit auch gehabt hätte; ich bin um diese Betätigung meines Wesens reicher, und der Traum vermehrte meinen Schatz des Erlebten um ein bedeutsames Stück.
Die Gestaltungskraft der Traumphantasie ist mit der des Künstlers verglichen worden, und man hat auf ihre gemeinsame Quelle hingewiesen (so: du Prel: Psychologie der Lyrik). Die Gleichartigkeit der Wirkung eines Kunstwerkes mit dem Traume aber erscheint mir mindestens ebenso auffällig. Hier wie dort unterbrechen wir den Faden unseres Lebens, den ursächlichen Zusammenhang, durch den wir die Einheit unserer Persönlichkeit erlangen, und geben uns einer unabhängig und unvermittelt beginnenden Reihe von Ereignissen und Stimmungen hin; nur dass wir beim Nachempfinden eines Kunstwerkes ein fremdes Wesen in uns aufnehmen, während unser Ich im Traume meist die Hauptrolle spielt.
Wenn ein Kunstwerk über uns Macht gewinnt, erheben wir uns über unsere Persönlichkeit, wir erfüllen unser ganzes Empfinden mit dem Gegenstande des Kunstwerkes: wir leben ein fremdes Leben. Dieses muss die höchste Wirkung eines jeden Kunstwerkes sein. Das Schöne erlaubt uns, über unser Ich hinauszugehen und an einem anderen Wesen teilzuhaben; es gibt uns einen Überschuss an Leben.
Das Schicksal bestimmt mir ein Los, in dem sich notwendig und logisch der Augenblick aus dem Augenblick entwickelt. An diese Kette von Ursache und Wirkung bin ich gefesselt, wenn ich mich selbst nicht verlieren will. Auf eine Weile darf ich diese Kette jedoch zerreißen, um fremdes Leben, ein Los, das mir nicht beschieden war, hineinzuschieben. Auf Augenblicke darf ich mehr als nur ich selbst sein.
Die Ähnlichkeit des Kunstgenusses mit dem Traume lässt sich bis in die feinsten Einzelheiten verfolgen. Wenn ich vor ein Bild hintrete und dieses Bild Eindruck auf mich macht, mich gefangen nimmt, dann glaube ich es physisch zu empfinden, wie meine Person in mir von der Seele des Bildes verdrängt wird, denn bei einem Bilde ist der Übergang vom gewöhnlichen Leben zum Nachempfinden des Kunstwerkes am unvermitteltsten und gewaltsamsten. Nun, dieses Gefühl des Brechens mit der Gegenwart ist genau dasselbe, welches uns überkommt, wenn wir einschlafend spüren, dass wir zu träumen beginnen. Wir sind uns noch des Abstandes von Wirklichkeit und Traum bewusst und fühlen, dass wir an etwas zu glauben beginnen, das sich nicht logisch an den vorhergehenden Augenblick anschließt.
Endlich sind es auch dieselben Ursachen, die uns einen Traum zerstören und eines Kunstwerkes nicht froh werden lassen. Ein zu starker Reiz, Schmerz, Ekel, Unbehagen erinnern uns an unseren Körper, an die ursächliche Reihe von Ereignissen, die unsere Person, unser Leben ausmachen – wir erwachen. Oder wenn der Traum es zu toll treibt, wenn er sich zu weit vom Wahrscheinlichen entfernt, wer kennt da nicht das wunderliche Misstrauen, das wir träumend gegen den Traum empfinden? «Ich träume nur», sagen wir uns, wie wir von einem Kunstwerk, das gegen die Wahrheit sündigt, sagen: «Es ist nur gemacht.»
Der Traum also war der Erste, der uns lehrte: «Ihr könnt für eine Weile das Leben, welches das Schicksal Euch zugedacht hat, beiseitelegen und ein Ausnahmeleben führen. Ich gebe Euch viele Lebensfragmente, damit Ihr nicht ermüdet, stets an dem alten Leitseil fortzugehen.»
Da kam jedoch die Kunst und sprach: «Ich gebe Euch als Zugabe zu Euerem Los noch das Leben aller anderen Wesen, damit Ihr nicht müde werdet, immer nur das eine Ich mit Euch herumzutragen.»
Die Kunst befolgt die Methode des Traumes, um auf uns zu wirken; sie bietet aber mehr: sie gibt uns einen erweiterten, geordneten und geläuterten Traum.
Das Laienurteil
Die ästhetische Wirkung eines Kunstwerkes ist auf den ausübenden Künstler in der Hauptsache dieselbe wie auf den empfänglichen Nichtkünstler, denn die Kunst wendet sich an den Menschen. Der Künstler mag die Lösung der technischen Aufgabe besser zu würdigen wissen, er dringt vielleicht schneller in die Feinheiten seiner Kunst ein; was jedoch ein Kunstwerk zu sagen und zu geben hat, muss von dem Nichtkünstler ebenso empfunden werden wie von dem Künstler, sonst ist der Gedanke in dem Kunstwerk nicht zu voller, künstlerischer Klarheit gekommen.
Auf das farben- und formgeübte Auge eines Malers wirken Farben und Formen eines Bildes schneller, intensiver; der Maler erkennt sicherer jede Neuheit der Mittel, jede technische Kühnheit, und dieses nähere Verhältnis zu der Kunst mag ihm Quellen des Genusses erschließen, die dem Nichtkünstler verschlossen bleiben. Der Nichtkünstler ist mehr für die Gesamtwirkung des Kunstwerkes empfänglich. Technische Vorzüge erhöhen diese Wirkung, Fehler stören oder vernichten sie, ohne dass Vorzug und Fehler als solche vielleicht erkannt werden. Der Laie gibt sich eben dem Eindruck des Kunstwerks hin, meist ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, durch welche Mittel die Wirkung erzielt wird. Diese Wirkung aber ist die vornehmste Aufgabe der Kunst, und ihr dienen die technischen Mittel. Das Übergehen des vom Künstler dargestellten Lebens auf den Beschauer, darin besteht die Aufgabe und das Genießen der Kunst.
Jeder Kritik, lehrt Th. F. Vischer, soll das ruhige Genießen des Kunstwerks vorhergehen, und in dem unbefangenen, sozusagen untätigen Genießen, ist der Nichtkünstler dem Künstler gegenüber im Vorteil; er vermag meist länger vor dem Kunstwerk stille zu halten, die eigne Persönlichkeit zurückzudrängen, um nur die durch das Kunstwerk vermittelte Empfindung in sich walten zu lassen, ohne dass die Frage nach den Mitteln, nach dem Wie der Mache, nach Fehlern und Vorzügen sich regt. Je länger vor einem Bilde, einer Statue dieser Zustand des ganz passiven Aufsichwirkenlassens dauert, je ungestörter der Beschauer das dargestellte Leben in sich warm werden und Macht gewinnen lassen kann, umso vollkommener ist das Kunstwerk. Am frühesten stellt die Kritik sich da ein, wo etwas Misslungenes dieses Sichversenken stört. Wo uns etwas missfällt, suchen wir nach dem Grunde unseres Missfallens; wo wir befriedigt werden, genießen wir möglichst lange, ehe wir daran gehen, uns Rechenschaft darüber abzulegen, warum wir genießen. Der Nichtkünstler geht eben in seinem Urteil von einem anderen Standpunkt aus als der Künstler; er lässt vielleicht manches Verdienst und manchen Fehler unbeachtet; aber gerade weil er das Kunstwerk als etwas fertig Gegebenes ansieht und nach seiner Gesamtwirkung abschätzt, ist sein Urteil eine wichtige Ergänzung des Urteils der Künstler, die das Werden des Kunstwerks stets im Auge behalten.
In neuerer Zeit jedoch scheint dem «Laienurteil» von den Künstlern jede Kompetenz abgesprochen zu werden. Die Künstler betonen, dass sie nur um der Kunst willen schaffen, und als einzig verständnisvolles Publikum wird nur der Mitkünstler anerkannt; auf Verständnis vonseiten des Nichtkünstlers wird nicht gerechnet. Die Kunst für die Künstler ist die Losung. Und das Bedenkliche dabei ist, dass das Publikum diese Lehre anzuerkennen scheint. In der Menge, die sich täglich durch unsere großen Kunstausstellungen drängt, lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. Die einen begegnen allen neuen Kunstbestrebungen mit unbedingter, gereizter Ablehnung, als verlohne es sich nicht einmal der Mühe, vor solch einem «modernen» Bilde stehen zu bleiben und zuzusehen, ob es doch nicht vielleicht wirkt. Die anderen kassieren vor solchen Bildern von vornherein ihr Urteil und gehen an ihnen vorüber, als an etwas, das nicht verstanden werden kann. Und doch ist dieses Laienurteil zur Wertbestimmung einer neuen Kunstrichtung nötig.
Der Geist, der neue Kunstrichtungen schafft, wird nicht in den Ateliers geboren, sondern er ist der Geist der Zeit und des Volkes, in dem der Künstler steht; er ist das Band, das die Kunst mit dem Volke verbindet, dessen schönste Blüte sie ist. Wenn die moderne Malerei uns keine Novellen und Anekdoten mehr erzählt, wenn sie sich vom dramatischen Historienbilde abgewandt hat, so ist es, weil das Lyrische im Volksgeiste wieder eine Rolle zu spielen beginnt. Die Malerei wird lyrisch, wie die andern Künste. Das moderne Drama verzichtet auf Intriguen, auf bunte Verwickelungen, um uns Seelenzustände, Stimmungen zu geben. Der moderne Roman sucht nicht nach spannender Handlung, sondern schildert psychologische Zustände, strebt darnach, Stimmungen zu geben. Schlagen wir endlich eine der Zeitschriften auf, die ihre Spalten der Lyrik der jungen Generation öffnen, so erstaunen wir über die Fülle frischen, dichterischen Geistes. Aus diesem allgemeinen Bedürfnis nach lyrischem Ausdruck, lässt sich auch die moderne Malerei erklären.
Jede technische Neuerung aber, jede tiefere Einsicht, jedes technisch gelungene Problem wird für den Genießenden Ausdruck einer Stimmung, einer Lebensäußerung. Valeurs, Linienführung, Farbenkombination, Pinselführung, die ganze Mystik der Ateliers setzt sich für den Beschauer in Empfindungen um; und gerade diese Wirkung auf den Beschauer, der die Mittel nicht kennt, ist ein fruchtbares Kriterium für den Wert der künstlerischen Errungenschaft; denn eine technische Neuerung, die im Gefühle des Genießenden keinerlei Widerhall weckt, hat ästhetisch kein Interesse.
«Ein ruhender menschlicher Körper», sagt Klinger, «an dem das Licht in irgendeinem Sinne hingleitet, in dem nur Ruhe und keinerlei Gemütsbewegung ausgedrückt sein soll, ist, vollendet gemalt, schon ein Bild – ein Kunstwerk. Die‹Idee› liegt für den Künstler in der der Stellung des Körpers entsprechenden Formentwicklung, in seinem Verhältnis zum Raum, in seinen Farbenkombinationen, und es ist ihm völlig gleichgültig, ob dieses Endymyon oder Peter ist. Für den Künstler reicht diese Idee aus.» – Gewiss! sie reicht auch für die Nichtkünstler aus, nur dass für diesen «die der Stellung des Körpers entsprechende Formentwicklung» Ausdruck eines Lebens wird. Farbenkombination, die Linien, das am Körper hinfließende Licht bedeuten dem Beschauer ein individuelles Sein, eine Stimmung, eine Seele – sie bedeuten einen Lebensmoment, den nachzuempfinden eben das Genießen des Schönen ausmacht. Ohne diese Beseelung hätten das Verhältnis des Körpers zum Raum und Farbenkombinationen wenig Interesse.
Das «Laienurteil» geht nun meist direkt auf diese Endwirkung, da das Kunstwerk aber dieser Wirkung wegen geschaffen wurde, so mag das Laienurteil sich ruhig neben das Künstlerurteil stellen als berechtigter Maßstab, an dem ein Kunstwerk gemessen werden soll.
Dürers kleine Holzschnittpassion
Dürers kleine Holzschnittpassion nimmt nicht nur in seinen Passionsdarstellungen, sondern in seinem ganzen Werk eine besondere Stelle ein. Neben einigen in Venedig entstandenen Tafelbildern ist es diese Passionsfolge, die in einer Reihe ihrer Blätter1 den Einfluss venezianischer Kunst auf Dürer am deutlichsten zeigt; ja manche dieser Blätter muten uns geradezu wie Übungen in italienischer Kompositionsweise an, wie Proben, die es dem Künstler selbst klarmachen sollten, wie nahe er dieser fremden Kunst kommen konnte. Statt des intensiven seelischen Ausdruckes, auf den Dürer sonst das Hauptgewicht zu legen pflegt, statt der sorgfältigen Charakterisierung der Köpfe, der Bewegtheit, die oft bis zur Härte geht, finden wir hier ein mehr formales Bestreben. Die Klarheit der Komposition, die wohlgegliederte Gruppierung, das richtige Hineinstellen der Figuren in den Raum, der Wohllaut der Linien, die geschlossene, abgerundete Haltung des Bildes, das sind die Probleme, denen der Künstler hier nachgeht und die er in der italienischen Kunst so hervorragend gelöst fand. Nirgends hat Dürer so wie hier seinen unerschöpflichen Gedankenreichtum, seine Liebe zum Detail, zum psychologischen Aperçu einem strengen Stilgesetz untergeordnet. Die Zahl der handelnden Personen wird auf das Nötigste beschränkt; und dabei wird von den traditionellen, populären Figuren abgesehen, die sonst auf deutschen Passionsdarstellungen nicht fehlen durften, wie z. B. der Kriegsknecht, der die frischen Ruten bindet, eine Gestalt, die wir schon auf den Gravierungen des Kronleuchters im Aachener Münster finden, oder das spottende Kind. Statt der gedrängten, reihenweisen Aufstellung, wie wir sie noch in der «grünen Passion» finden und die an das deutsche Relief erinnert, in dem die Figuren nicht recht voneinander loskommen, werden die Gruppen hier streng symmetrisch gegliedert; durch ihre Beziehung zum Raum miteinander verbunden, ist eine jede in sich fest geschlossen, wie wir das schon auf Mantegnas Stichen finden. Einer jeden Figur wird durch die Umgebung, durch Stufen, Nischen, Säulen ihr deutlich perspektivisch bestimmter Platz angewiesen. Wenn auf den Ausdruck der Köpfe weniger Gewicht gelegt ist, so fällt hier eine bei Dürer nicht häufige Eleganz der Linien auf. Der Ausdruck des Schmerzes, der Erniedrigung, der Grausamkeit, den Dürer sonst seinen Gestalten mit rücksichtslosem Realismus verleiht, ist hier gemildert. Man vergleiche den Christustypus hier mit dem der frühen Blätter der großen Passion. Der Christus auf der Vertreibung der Händler aus dem Tempel (B 23) mutet uns in seiner schwungvollen Größe wie eine tizianische Gestalt an. Vor allem jedoch sind es die architektonischen Hintergründe, die diesen Blättern ihr besonderes Gepräge verleihen und sie in die Nähe der Kunstweise der Mantegna, Vivarini, Carpaccio rücken. Die Art, ihre Gestalten plastisch vor ruhig und dunkel gehaltene, architektonische Hintergründe zu stellen, ist der venezianischen Kunst eigen. Die deutsche wie die flämische Kunst pflegten ihre Hintergründe mit einer bunten Fülle von Details zu füllen. Die ganze Regsamkeit des Lebens und die Farbigkeit der Natur musste hinter ihren Gestalten stehen. So finden wir es auch bei Dürer. Jetzt, in der kleinen Holzschnittpassion, heben die Figuren sich von einfachen, dunklen Hintergründen ab; Architekturen, streng perspektivisch gehalten und ganz in den Dienst der Hauptgruppe gestellt. Die freien Ausblicke auf die Landschaft, wie sie die «grüne Passion» noch hat, fehlen fast ganz. Die von Säulen, Pfeilern und Nischen gegliederten Wände haben die Aufgabe, alles Licht und alle Aufmerksamkeit auf die Handlung zu konzentrieren. A. Springer sagt in seiner Dürer-Biographie (S. 117) von Dürers architektonischen Hintergründen: «Man kann sich die Hallen und Gemächer selten in Stein verwirklicht denken, sie erscheinen wesentlich vom malerischen Standpunkt aufgefasst. Die einzelnen Bauglieder, wie Kapitäle, Gesimse, mangeln jeglichen Schmuckes, oder wenn sie solchen zeigen, erscheint er nicht von der italienischen Renaissance eingegeben.» Diese Charakteristik stimmt gut zu den Baulichkeiten des Marienlebens, der großen Passion, der grünen Passion, ja auch zu späteren Werken, wie der Kupferstichpassion; die kleine Holzschnittpassion widerspricht ihr. Mit welch schöner Anschaulichkeit ist das Kirchenschiff mit seiner perspektivisch geordneten Säulenreihe in der Vertreibung der Verkäufer aus dem Tempel gegeben (B 23); der Thron des Hohenpriesters auf B 29 wird von einer ionischen Säule gestützt; die Dornkrönung (B 34) geht in einer von korinthischen Säulen getragenen Bogenhalle vor sich; die Loggia, in der Pilatus sich die Hände wäscht, ruht ebenfalls auf korinthisierenden Säulen (B36); Pilatus empfängt Christus auf der Freitreppe eines schönen, säulengetragenen Renaissancebaues, wie Carpaccio sie darzustellen liebt. Enger als in seinem ganzen sonstigen Werk schließt Dürer sich hier an die Formen der italienischen Renaissance an.
So groß nun die Vorteile dieser Kompositionsweise auch sind, die damalige Technik des Holzschnittes konnte sie nicht zu voller Geltung bringen; sie entfernte sich zu sehr von dem bisherigen Holzschnittstil und stellte dem Formschneider zu ungewohnte Aufgaben. Wie die Ausführung dieser Blätter einen großen Teil der Absichten des Künstlers verloren gehen lässt, sehen wir deutlich, wenn wir unsre Folge mit der Kupferstichpassion vergleichen, die sich offenbar aus der kleinen Holzschnittpassion entwickelt hat, gleichsam eine Fortbildung des dort niedergelegten Gedankens ist. Die meisten Blätter unsrer Folge muten uns wie für den Kupferstich gedacht an, und erst in den Stichen kommen die dunkeln Hintergründe, die Lichteffekte, die Valeurs zur Geltung. Daher ist die Ausführung der kleinen Holzschnittpassion zum größten Teil so wenig befriedigend. Aber nicht das Schneidemesser allein trägt hier die Schuld; in der Zeichnung selbst finden wir Schwächen und Ungleichheiten, die wir nur dadurch erklären können, dass Dürer für das Übertragen seiner Zeichnungen auf den Holzstock Schüler- und Gehilfenhände benutzte. Ich weise nur auf die verfehlte Gestalt des Auferstandenen hin, auf das so unlogische Gefältel der Gewänder, auf die vielen gleichgültigen Köpfe, auf die verunglückten Gestalten links auf der Schaustellung. Ein Vergleich mit den schönen 1510 datierten Blättern der großen Passion lehrt uns den Unterschied zwischen Dürers Hand und den auf der kleinen Passion beschäftigten Schülerhänden erkennen. Die Schwächen der Zeichnung sind mit ein Erklärungsgrund für den geringen Schnitt, denn die Gehilfen verstanden es eben nicht wie der Meister, dem Formschneider in die Hände zu arbeiten.
Von Dürers Studien und Zeichnungen zur kleinen Holzschnittpassion, die uns willkommene Fingerzeige für ihre Entstehungsgeschichte geben könnten, ist so gut wie nichts erhalten. Die Zeichnung der Albertina: Adam und Eva vor dem Baume der Erkenntnis, arg übergangen und mit später darauf gesetztem Datum und Monogramm, scheint mir eine Schulstudie mit Benutzung der beiden ersten Blätter unsrer Folge zu sein. In einer flüchtigen Federzeichnung des Berliner Kabinetts (Lipp. 12): ein männlicher Akt ohne Kopf, ein Dachs und eine Gewandstudie, sehe ich eine Studie zum Adam v. B. 17; die Himmelfahrt (B. 50) benutzt Studien zum Helleraltar; das Jüngste Gericht (B. 53) gibt den oberen Teil der Zeichnung für das Allerheiligenbild der Sammlung Aumale (Lipp. 334) wieder.
Auf obige Bemerkungen gestützt, ließe sich annähernd eine Entstehungsgeschichte unsrer Folge versuchen. Der Plan einer Kupferstichpassion hat Dürer gewiss schon früh beschäftigt. Das Leiden Christi war das Thema, das ihn seine ganze Künstlerlaufbahn hindurch beschäftigt hat, und der Kupferstich war die seinem Genius genehmste Ausdrucksweise. Die «grüne Passion» von 1504 ist sicher der Entwurf für solch eine Folge, und die italienische Reise mag die Ausführung verhindert haben. Unter dem frischen Eindruck der italienischen Kunst, vielleicht in Venedig selbst, wird er den Plan neu aufgenommen haben. Da sind dann jene Blätter unsrer Folge entstanden, die sowohl den Kupferstichcharakter als auch den italienischen Einfluss so deutlich zeigen. Als er zu Hause die Kupferstichpassion schuf, stand er nicht mehr unter dem frischen Eindruck der fremden Kunst, und er arbeitete die Entwürfe um, vertiefte, beseelte und belebte sie, so dass, trotz aller Verwandtschaft, etwas anderes entstand. Bei der großartigen Produktivität, die Dürers Werkstatt in den Jahren von 1507 bis 1513 entfaltete, wohl um die Verluste einzuholen, die, wie Dürer Pirkheimer und Heller klagt, die Reise und die Beschäftigung mit den großen Tafelbildern verursacht hatten, sollten auch diese Entwürfe ausgenutzt werden. Durch ältere2 und spätere3 Zeichnungen ergänzt, von den Versen des Chelidonius begleitet, entstand ein Erbauungsbuch, wie es in diesem Format und in dieser Form gerade besonders beliebt und gangbar war.
Das Nackte in der Kunst und Constantin Meunier
Das Nackte in der Kunst unbefangen und selbstverständlich darzustellen, gelang doch nur den Griechen. Das Nackte stand bei ihnen mitten im Leben. Die Sprache des menschlichen Körpers war dem Griechen anders vertraut als uns; aber der Leib des Griechen war auch anders ausdrucksvoll, denn er wusste, dass er angeschaut und verstanden werde. An den Kämpfern des äginetischen Frieses sehen wir, dass dem Griechen die Beredsamkeit des Körpers sogar früher einleuchtete als die des Kopfes; aber auch in den spätern Werken steigert der griechische Künstler den Ausdruck seiner Köpfe nie zu so intensiver Kraft, wie die heutige Kunst. Der seelische Ausdruck hatte sich eben über den ganzen Menschen zu verteilen; jede Linie des Körpers hatte mitzusprechen, und dadurch kam die stille und doch so lebensvolle Harmonie in diese Gestalten.
Einer Kunst späterer Zeit, in welcher die Menschen nicht nackt kämpften, ruhten, miteinander verkehrten, konnte diese Auffassung des menschlichen Leibes nicht mehr gelingen. Jene wunderlichen Barbaren, von denen Herodot gehört zu haben berichtet, «die es für eine Schmach halten, sich nackt zu zeigen», beherrschten die Welt. Der menschliche Körper, beständig verhüllt, wurde stumm. Zu wem sollte er sprechen? Es sah und verstand ihn ja keiner mehr!
Die italienische Renaissance brachte zwar den menschlichen Leib wieder zu Ehren; war doch die Zeit angebrochen, von der ein alter Bußprediger sagte: «Die Menschen haben die einzige Tugend, die der Sündenfall sie lehrte, die Scham – in unserer Zeit verloren.» Die Renaissancekünstler schwelgten in der Darstellung der Schönheit des menschlichen Leibes; aber die Nacktheit, die sie darstellten, ist von der der Griechen verschieden, wie das Sonntagskleid von dem Kleide, das der Gefährte des Lebens ist. Es ist eine Luxusnacktheit. All diese schönen Leiber rufen uns zu: «Wir haben euch einen Festtag bereitet und unsere Schönheit enthüllt.» Ein jeder ist sich seiner Nacktheit bewusst.
Je mehr wir nach Norden gehen, umso verschämter und gebundener steht der nackte Mensch im Kunstwerke da. Dürer versuchte es, dem menschlichen Körper theoretisch beizukommen; er wollte ihn konstruieren, wie eine mathematische Figur, und der große Meister, der seine Köpfe so wunderbar beseelte, hat den nackten Körper als Ausdrucksmittel nie beherrscht.
Dieses Fremde, diese Ausnahmsstellung, die der Darstellung des Nackten anhaftet, wir können sie bis auf den heutigen Tag verfolgen. Entweder belauschen wir die nackte Gestalt, oder es wird die von griechischer Tradition gesättigte Phantasie des Künstlers in das moderne, seiner Nacktheit ungewohnte Modell hineingelegt, und das gibt dann immer nur ein Leben aus zweiter Hand: «Die Anschauung des Nackten ist im modernen Leben der Öffentlichkeit entzogen», sagt C. Neumann im «Kampf um die moderne Kunst», «wie könnte also eine lebendige Kunst trachten, das Nackte als ein wesentliches Ziel der Darstellung zu erwerben?»
Eine Kunst nur, die nicht auf die Quellen an Schönheit und Ausdruck, die im menschlichen Körper verborgen liegen, verzichten will – und wie könnte das die Skulptur vor allen! –, solch eine Kunst muss den menschlichen Körper dort aufsuchen, wo er noch mitzureden hat, und das ist bei der Arbeit. Das nun tat Constantin Meunier. Hier steht der nackte Körper noch mitten im Leben; hier ist er verantwortlich und daher beredt. Die Arbeit zwingt den ganzen Willen, die Seele des Menschen in die Glieder, in die Sehnen und Muskeln, macht sie nicht nur stark, sie macht sie klug, verschlagen, stets zur Abwehr und zum Angriff bereit. Meunier zeigt uns den Menschen bei schwerer Arbeit, oder von schwerer Arbeit ruhend. Meist Gestalten mit nacktem Oberkörper: Wo Kleider den Körper verhüllen, sind es dünne, wie feuchte Stoffe, die ganz von den Formen des Körpers beherrscht werden. Hier, wo die Verantwortlichkeit des Lebens wieder auf dem Körper ruht, haben die Kleider ihre Selbstständigkeit verloren, sie haben nur zu dienen. Die breiten, von schweren Lasten gebogenen Rücken, die hageren Arme, mit ihren harten Muskelbergen, die langen, knorrigen Finger, sie haben alle ihre verständliche, pathetische Sprache; sie sind Träger und Geschöpfe einer Lebensgeschichte und daher so beredt. Die Freude an der Kraft, am festen Zugreifen, der Schmerz im Kampf mit der Materie, die Müdigkeit des unerbittlich verbrauchten Lebens, all das steht deutlich in den Linien dieser Leiber; das Epos des modernen Heldentumes. Meunier, der Maler, wurde in den Kohlenbezirken zum Bildhauer. Das ist wohl verständlich. Hier vernahm er zum ersten Male die lebendige Sprache des menschlichen Körpers, hier fand er Formen, die von Menschenschicksalen erzählten; jede Anlage zur Skulptur musste mächtig hervorbrechen, denn hier wurde sie sich ihres wirksamsten Ausdrucksmittels bewusst. Dieses gefunden zu haben, gehört aber zu den großen Taten der Kunstgeschichte, wie sie nur den ganz großen Künstlern gelingen. Dorthin, wo das Nackte sich zurückgezogen hat, dort wo der Körper noch verantwortlich ist – dorthin hat ihm die Skulptur zu folgen, will sie lebendige Kunst schaffen.
M. Schongauer und die Nürnberger Skulptur
I.
Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts hielt die Nürnberger Skulptur fester an ihren lokalen Traditionen, an ihrem lokalen Formideal, als es die gleichzeitige schwäbische und niederrheinische Kunst tat. Französische und niederländische Einflüsse stießen in Nürnberg auf spröderen Boden. Selbst als die Nürnberger Malerwerkstätten eifrig von der Kunst des Niederrheins zu lernen begannen, beharrte die Skulptur bei ihrer gewohnten Darstellungsart. Vorherrschend in den Dienst der Architektur gestellt, war sie mehr handwerklich gebunden; auch machte das schwieriger zu behandelnde Material sie weniger beweglich, weniger fremden Moden und Einflüssen zugänglich als es ihre Schwesterkunst war. Stellen wir die Gestalten, welche die Nürnberger Kirchen schmücken, neben die gleichzeitigen Skulpturen der schwäbischen, niederrheinischen, westfälischen Kunst, so werden sie sich deutlich als eine Gesellschaft von scharf ausgeprägtem, selbstständig lokalem Charakter unterscheiden. Weder die Empfindsamkeit der französischen Gotik, noch der feierliche Ernst der niederländischen Kunst fand hier rechten Boden. Dafür ist diesen Nürnberger Gestalten allen eine naive Lebenssicherheit eigen. Sie drücken eine ruhige Zufriedenheit mit der eigenen derben, gesunden Persönlichkeit aus, die daher auch keinerlei Anstrengung macht, den Ausdruck zu höherer Bedeutsamkeit zu zwingen und zu stilisieren.
Fest, ein wenig breit, stehen sie auf beiden Füßen. Die derbknochige Gestalt kommt auch unter der schwerfälligen Faltengebung der Gewänder zur Geltung. Die Gesichter der Apostel und Propheten werden wohl den strengen Meistern der Bauhütten und Zünfte sehr ähnlich gesehen haben: knochige, von ernster Arbeit gehärtete Züge, über denen eine gutbürgerliche Würde liegt. Ihre Andacht gleicht einer beschaulichen und behaglichen Feiertagsruhe. Charakteristisch ist eine besonders beliebte Gestalt, die wir öfters wiederholt finden: am Portal der Frauenkirche, an der Brauttüre von S. Sebald, am Hauptportal von S. Lorenz zweimal: als Prophet und als Schmerzensmann. Das herbe Gesicht mit den starken Backenknochen, der klobigen Nase, der vorspringenden Stirn, dem strengen Munde, dessen Oberlippe rasiert ist, während ein langer, struppiger Bart bis auf die Brust fällt, dieses Gesicht mutet uns wie der echte Typus jener klugen, zähen «Meister» an, welche die eigentlichen Schöpfer von Nürnbergs Größe und Reichtum waren.
Das Frauenideal der Nürnberger Skulptur war nicht weniger dem Leben und dem Bürgerhaus entnommen. Die vollen Gesichter mit den runden Augen, der breiten Nase, dem derben Kinn, lächeln ein lustiges, ganz irdisches Lächeln: so die Eva am Portal der Frauenkirche und am Hauptportal von S. Lorenz, die Madonna an der Brauttüre von S. Sebald und die klugen Jungfrauen ebenda. So handwerksmäßig und schematisch die Ausführung der Figuren meist noch ist, ein ehrliches Gefühl für Natur und Wahrheit gibt ihnen etwas Überzeugendes und Einleuchtendes, das sie beseelt und erwärmt. Die Bewegungen sind eckig, die Stellungen unfrei und oft hölzern, allein diese Mängel scheinen nicht nur aus ungenügendem künstlerischen Können hervorgegangen, sondern zugleich, wie etwas dem Wesen dieser Gestalten Zugehöriges, dem Wesen einer Rasse, die zu beschäftigt und zu naiv ist, um auf günstiges Präsentieren der eigenen Persönlichkeit Bedacht zu nehmen. Die törichten Jungfrauen an der Brauttüre von S. Sebald weinen über ihre leeren Lampen, sie weinen aber wie Kinder, wie Mädchen aus dem Volke. Jammervoll verziehen sie ihre Gesichter, geben sich rückhaltlos ihrem Schmerze hin, unbesorgt um die Verzerrung ihrer Züge. Vor solchen Werken wird es uns verständlich, warum das verzückte Lächeln, die mystische Eleganz der westlichen Kunst sich mit dem Typus der Nürnberger Skulptur schwer vereinigen ließen. Bode bemerkt (Gesch. d. deutsch. Plastik S. 92): die Gotik des ausgehenden 14. Jahrhunderts in Deutschland habe außerhalb Nürnbergs nur wenige Bildwerke aufzuweisen, in welchen die ausgeschwungene Stellung so wenig auffalle, wie hier. Der Nürnberger Künstler verstand es eben nicht, sich um der Mode oder der Stilisierung willen allzu weit von der Natur zu entfernen.
Eine Kunstübung aber, die eine so treue Schülerin der Natur war, schuf Voraussetzungen, bei denen es nur eines wahrhaft schöpferischen Talents bedurfte, um Werke von echt künstlerischer Wirkung entstehen zu lassen. Solch ein Kunstwerk ist die schöne, große Madonna an einem Pfeiler des Hauptschiffes von S. Sebald, die so heiter und liebevoll ihren kräftigen, unruhigen Knaben anlächelt. Auch der liebliche Katharinenaltar des Germanischen Museums (Kat. 271) gehört hieher.4
Freilich, wo es galt dramatische und epische Vorgänge darzustellen, da reichte das Können der alten Meister nicht aus. Die realistische Gewissenhaftigkeit drängte zu breitem, weitläufigem Erzählen, zum Verweilen bei Einzelheiten und Episoden, während die Kunst des Anordnens, des Zusammenfassens zu einem Bilde versagte. Das Widerstreben gegen das Stilisieren musste hier verhängnisvoll werden. So sind denn auch Reliefs, wie das am Hauptportal von S. Lorenz, nur lose Zusammenstellungen von Figürchen und Sächelchen, wie im Krippenspiel.
II.
In der Entwicklung der Nürnberger Kunst musste naturgemäß auch für sie der Augenblick kommen, da sie sich mit der neuen Kunstanschauung auseinanderzusetzen hatte, die, von den Niederlanden ausgehend, um die Mitte des 15. Jahrhunderts schon den ganzen Westen Deutschlands eroberte. Als der Vermittler zwischen niederländischer und Nürnberger Kunst ist Michel Wohlgemut anzusehen.5
Der Realismus der Brüder von Eyck und ihrer Nachfolger war eine Lehre, die der Nürnberger Kunst nicht neu war; allein der Realismus der flämischen Meister unterschied sich doch wesentlich von der Naturtreue, wie die Nürnberger Künstler sie verstanden. Der Realismus, den das Genter Altarwerk angebahnt hatte, wollte zugleich den ganzen Inhalt der vorhergehenden mystischen Kunst wahren, die Mystik sollte nur auf die Erde herabgeholt werden. Die religiösen Leidenschaften, mit ihrer Feierlichkeit und Gefühlsinnigkeit, sollten aus ihrem Goldgrundhimmel niedersteigen und in wirklichen Menschen und ihren Wohnstätten lebendig werden. Das gibt diesen Schöpfungen die innere Glut, die Tiefe, das feierliche, herbe Pathos. Sie vermenschlichten die religiösen Ideen und befriedigten zwei sich anscheinend widersprechende Forderungen, welche der Mensch der angehenden Renaissance an das Leben stellte: religiöse Mystik mit scharfem Naturgefühl.
Als Michel Wohlgemut, als Vertreter der neuen Kunstrichtung, in seiner Vaterstadt auftrat, muss er damit nicht geringen Anklang gefunden haben, denn seine Werkstatt scheint bald zu der beschäftigtsten und einflussreichsten der Stadt geworden zu sein. Wohlgemut hatte gewiss fleißig von seinen flämischen Vorbildern gelernt. Technik, Komposition, Farbe, Typen, er hatte alles, soweit seine Veranlagung es gestattete, in sich aufgenommen. Dennoch macht es den Eindruck, als müsste dieser Nürnberger sich Gewalt antun, um so ganz der flämischen Kunst zu folgen. Die Strenge der Niederländer wird bei Wohlgemut zur Trockenheit, die Schärfe zur Härte, das Pathos wird steif und die Würde schläfrig. Innige und gut empfundene Züge, an denen es in seinen Bildern nicht fehlt, werden durch Leeres und Anempfundenes gestört. Es ist, als bewegte sich dieses Talent in Formen, die es beengen.
Da bei den Altaraufsätzen, welche die Wohlgemut’sche Werkstatt zu liefern hatte, nach damaliger Sitte das Mittelstück meist aus einer plastischen Arbeit bestand, auch die Festseiten der Flügel häufig mit Reliefs geschmückt wurden, mussten zahlreiche Bildschnitzer beschäftigt werden, die dann wohl unter des Meisters Aufsicht, nach seinen Angaben oder Vorlagen, arbeiteten. Dadurch erstreckte sich Wohlgemuts Einfluss auch auf die Skulptur.
Vereinigte sich in den Bildern der Wohlgemut’schen Schule das niederländische mit dem Nürnberger Element schon nicht recht zu einheitlicher Wirkung, so gilt das mehr noch von den Skulpturen. Die Nürnberger Bildschnitzer verdankten dem niederländischen Einfluss gewiss viel. Jetzt erst lernten sie dramatische Vorgänge zu einem Bilde zusammenzufassen. Sie gewannen an Ernst und Tiefe. Allein, auch hier stört der Eindruck von einem erzwungenen Zusammengehen zweier heterogenen Kunstempfindungen, die einander beeinträchtigen. Das dramatische Leben, der Ernst der flämischen Kunstweise wird von der naiven Derbheit der Altnürnberger Kunst verflacht und veräußerlicht, während die frische Unmittelbarkeit der Nürnberger Skulptur durch das Streben nach der Tiefe und der leidenschaftlichen Bewegtheit der niederländischen Vorbilder gezwungen und unfrei wird. Wie schwer und mürrisch ist die Würde der großen Heiligen des Zwickauer Altars! Wie steif und konventionell benehmen sich die Gestalten auf der Anbetung der heiligen drei Könige des Heilsbronner Altars! Vor solchen Werken wird uns der günstige Einfluss der großen Niederländer auf die Nürnberger Kunst zweifelhaft. Zwischen beiden Kunstrichtungen lagen Gegensätze von Temperament und Lebensanschauung, die einer organischen Vereinigung widerstrebten. Wirklich fruchtbar für Nürnberg wurden die Errungenschaften der niederländischen Kunst erst, als ein deutscher Künstler sie in deutschem Geiste verarbeitet und umgewandelt hatte. Martin Schongauers Einfluss war es, der für die Nürnberger Kunst epochemachend wurde und sie zu ihren großen Erfolgen führte.
III.
Es scheint auch Wohlgemuts Werkstatt gewesen zu sein, von welcher der Einfluss des Colmarer Meisters ausging, so dass die beiden Kunstweisen: die niederländisch-Wohlgemut’sche und die des Schongauer in demselben Künstlerkreise miteinander in Konkurrenz traten. Eine Reihe von Bildern dieser Werkstatt erweisen sich als von Schongauers Kunst so abhängig, dass wir annehmen dürfen, ein Künstler, der am Oberrhein, vielleicht in Colmar selbst, gearbeitet hatte, sei Ende der 70er Jahre des 15. Jahrhunderts in Wohlgemuts Werkstatt eingetreten.6 Die Verkündigung des Zwickauer Altars zeigt uns in der Jungfrau und in der hübschen Jünglingsgestalt des Engels echt Schongauer’sche Typen. Ebenso vernehmlich spricht Schongauers Geist aus dem Peringsdörffer Altar des Germanischen Museums, obgleich hier schon von einem reifen Künstler selbstständig verarbeitet. Das Streben nach milder Schönheit selbst in den Schrecken des Martyrium, die hübschen Mädchen, welche den hl. Veit versuchen, ähnlich wie Schwestern, den klugen und törichten Jungfrauen auf Schongauers Stichen, die ernst und freundlich dastehenden Heiligen, alles weist auf einen Meister, der Schongauers Schönheitssinn voll in sich aufgenommen hat. Selbst in den Holzschnitten, welche Wohlgemuts Werkstatt für Kobergers Drucke lieferte, wie Schedels Weltchronik und der Schatzbehalter, finden sich neben echt Wohlgemut’schen Blättern, mit ihren flämischen Reminiszenzen, solche, die von Schongauers Stichen abhängig sind und bis zu direkter Entlehnung gehen.7
Dieser Einfluss erstreckte sich sofort auch auf die Skulpturen. Besonders lehrreich in dieser Hinsicht ist die Beweinung des Altars der hl. Kreuzkapelle in Nürnberg. Hier umstehen echt Wohlgemut’sche Gestalten mit ungelenkem Pathos und den zu umfangreichen Gewändern, wie R. v. d. Weyden sie liebt, den Leichnam Christi, der im Ausdruck des Gesichts, in der Bewegung des Körpers jene milde, rührende Anmut hat, wie sie damals nur Schongauers Schöpfungen eigen war, und erinnert an die Grablegung des Stiches B. 18.
Hiermit waren die Wege gewiesen, auf denen die Nürnberger Skulptur zu ihren höchsten Leistungen fortschreiten konnte. Der kernige Wahrheitssinn der Altnürnberger Kunst, von Schongauers Schönheitssinn gesänftigt und geläutert, ermöglichte erst die großen Schöpfungen eines Veit Stoß und Adam Krafft.
Veit Stoß’ Kunst wurzelte noch ganz in der Altnürnberger Formsprache. Ihre rücksichtslose, etwas schwere Naturtreue blieb immer der eigenste Grundzug seines Talents. Zugleich aber zeigte er sich den verschiedensten Einflüssen zugänglich. Das stürmische Pathos des Rogier v. d. Weyden und seiner Nachahmer wirkte auf ihn und entsprach wohl auch seiner leidenschaftlich unruhigen Natur. In späteren Jahren erfuhr er Einflüsse Dürer’scher Kunst. Allein, gerade Schongauer musste für diesen Künstlergeist bedeutsam werden und scheint ihn auch besonders angezogen zu haben. Stoß’ Tätigkeit als Kupferstecher mutet uns wie eine angestrengte Übung in Schongauers Formsprache an. Die Bekanntschaft mit den Werken des Colmarer Meisters zügelte in Stoß die Neigung zum Gewaltsamen, gab ihm das maßvoll Abgeklärte, dessen er bedurfte.
Schon die hübsche, dekorative Anordnung des Marienaltars der Krakauer Frauenkirche zeigt den Einfluss des Meisters, der vor allem auf künstlerische Ausführung des Raumes bedacht war. Dann die Art, wie die Apostelgestalten, alle echt Nürnberger Typen, beseelt und verfeinert sind, wie eine sanfte Andacht ihre Züge erhellt, endlich die knieende Maria mit dem zarten Profil, dem weichgewellten Haar, der jungfräulichen Haltung, die an die Maria der großen Geburt B. 4 denken lässt, all das sind Züge eines Meisters, der aufmerksam seinen Schongauer studiert hat. Auch noch in seinen späten Werken, als Dürer schon mächtig auf ihn gewirkt hatte, wie im Engelgruß von 1518 in S. Lorenz, wird er noch von Schongauers Kunst und Kompositionsweise beherrscht. Diese freundliche Kunst konnten ihn weder die Niederländer, noch Wohlgemut, noch Dürer lehren.
Adam Krafft war durch das Wesen seines Talents schon dem Geiste Schongauers verwandter als Stoß. Seine kompositionelle Begabung, seine Vorliebe für die schwungvolle Linie und für künstlerische Raumausfüllung wiesen ihn auf Schongauer als Vorbild hin und machten ihn für diesen Einfluss besonders empfänglich. Schongauers Stiche mit der Geschlossenheit ihrer Gruppierung und der Klarheit ihrer Komposition, die das Detail zurückdrängte, Hintergrund und Landschaft vereinfachte, mussten gerade auf den Bildner wirken. Gleich das früheste beglaubigte Werk des Adam Krafft, die sieben Kreuzstationen der Martin Ketzelschen Stiftung von1490, setzt Schongauers Passionsfolgen voraus. Auf den Zusammenhang von Kraffts Kreuzschleppung mit Schongauers Stichen B. 16 und 21 und mit dem Gemälde des Colmarer Museums ist mehrfach hingewiesen worden.8 Vor allem jedoch ist es die Auffassung der Gestalt Christi, in der Krafft Schongauer folgt. Nach Schongauer ist Krafft der erste nordische Künstler, der in der Gestalt Christi nicht die Erniedrigung, die Qual des Martyriums mit vollem Nachdruck betont, sondern die Hoheit und Schönheit im Dulden. Der herrliche, unter der Last des Kreuzes in die Kniee gesunkene Christus der dritten Station lässt sich im Ausdruck edler Gelassenheit, vornehmer Trauer nur mit dem Christus von Schongauers Stich der kleinen Kreuztragung vergleichen. In dem Relief des Schreyer’schen Grabdenkmals an der Sebalduskirche ist der Künstler zu seinem Christus in der Grablegung, im weichen Schwung der Linien und der melancholischen Anmut der Bewegung eine der schönsten Gestalten deutscher Kunst, sicher durch Schongauers Stich B. 18 angeregt worden. In der Madonna des Peringsdörffer Grabdenkmals der Frauenkirche in Nürnberg, mit den köstlich bewegten Engeln, in der Jungfrau der Rebek’schen Grabtafel ebenda, in den Aposteln und Heiligen des Sakramentshauses in S. Lorenz, überall begegnen wir einem Streben nach einer gewissen Eleganz in der Größe, die der Nürnberger Kunst nicht eigen war und für die Schongauer das Vorbild ist. Krafft war Schongauer gegenüber das stärkere Temperament. Er liebte die kräftigen Accente, die Bewegtheit der Leidenschaft. Eine Gestalt, so stürmisch im Ausdruck von Liebe und Trauer, wie die Magdalena des Schreyer’schen Grabmals, eine so kernige Figur, wie der vom Kreuze kommende Henker ebenda, ist Schongauer nicht gelungen. Kraffts starker, warmfühlender Künstlergeist vergaß die Traditionen der Altnürnberger Kunst nicht, während er von der feineren, geistigen Kunst Schongauers lernte und war gerade hiedurch imstande, Werke von so unmittelbarer und unvergänglicher Wirkung zu schaffen.
Die Altnürnberger Kunst, um das eben Gesagte zusammenzufassen, und der Einfluss des Martin Schongauer, das sind die Wurzeln, aus denen die Blüte der Nürnberger Kunst hervorgeht. Die niederländische Kunst bildet eine bedeutungsvolle Mittelstufe in dieser Entwicklung. Allein Schongauers Einfluss wurde gerade dadurch wichtig, dass er die Gegensätze zwischen niederländischer und Nürnberger Kunstweise ausglich, dass er den niederländischen Einfluss, wie die Werkstatt des Michel Wohlgemut ihn vertrat, überwand und ihn so erst für die Nürnberger Kunst fruchtbar machte.
Eindrücke von der Frühjahrsausstellung der Münchner Secession
Eine Schar junger Künstler steht, die Palette in der Hand, vor der Natur, eifrig, eigensinnig und mit starkem Talent, mit schönem Können bemüht, ein jeder sein besonderes Problem zu lösen, das ist der wohltuende Gesamteindruck, den ich von der Frühjahrsausstellung der Münchner Secession empfangen habe. Sie hat viel gelernt, diese Künstlerschar: von den eignen Meistern, von den Franzosen, den Engländern, den Schotten, und es ist hübsch zu sehen, wie die frischen Talente die fremden Einflüsse auf sich wirken lassen, sie in ihr Blut aufnehmen und zu Bestandteilen der eignen Persönlichkeit werden lassen. Bei Theodor Hummels in grünen Duft getauchten Seelandschaften denken wir an Waltons Nebelmalerei. Allein der Münchner Künstler legt in die Zartheit seiner Landschaften einen herberen Ton, etwas, das frisch wirkt, wie der bittere Duft feuchter Erlenblätter und das sie von der süßen Lyrik des Londoner Malers wesentlich unterscheidet. Bei Crodels und Kaisers Landschaften werden wir an die Schotten erinnert, aber unsere Münchner wandeln die elegante, ein wenig lautdekorative Naturdarstellung der Schotten in etwas Stilleres, Gehaltvolleres um, in eine vielleicht weniger glänzende, aber intimere Naturauslegung. Traulich ducken sich die kleinen roten Häuschen auf Crodels Dünenlandschaft in den Schatten der Bäume, während über sie hin große, sehr blanke Wolken ziehen. Oder die Dorfkirche, von durchsichtiger Dämmerung umflossen, das Bauernhaus, mit dem erleuchteten Fenster, im niedersinkenden Abend. Immer unten ruhevolle Dämmerung, oben bewegtes Treiben großer Wolken voller intensiven Lichtes. Melancholie ohne Sentimentalität. Kaiser ist mit den Jahren immer persönlicher geworden; er findet immer präziser und einfacher den Ausdruck für das, was er in der Natur sieht. In diesen Landschaften, wo ein sehr hoher, lichtblauer Himmel, in dem hie und da ein Wölkchen sich in Licht auflöst, über niedrige, sonnbeschienene Hügel, oder über gelbe Herbstbäume an birkenblanken Wassern ausgespannt ist, da atmen wir freier und leichter. Schramm-Zittau, der virtuose Tiermaler, ist auch mit einer Landschaft vertreten, einem Dämmerungsbilde, wie sie Israels liebt. An der Dorfstraße stehen die wunderlichen, alten Häuserindividuen mit den schwarzen Mauern und den großen, schweren Dächern schon im tiefen Schatten. Oben in den Wolken, die sich zerteilen, und unten auf der nassen Straße liegt noch viel feuchtes Licht. Großzügig, schlicht und schön eindringlich ist das gegeben. Muenkes Sägemühle ist klar und energisch gegen den hellen Himmel aufgebaut. Das Holz leuchtet kräftig am Rande des lustigbewegten, farbigen Mühlbaches. Eine etwas nüchterne Frische liegt über dem Bilde, während die «Birken» und der «Schleißheimer Kanal» desselben Künstlers nicht eben interessant sind. Pietzsch legt dieses Mal seine blühenden Weiden, die er gern malt, auf einen blaugrauen Gewitterhimmel. Die Bäume, wie große Büschel weißer Federn anzusehen, sind hübsch und duftig, aber sie kommen uns zu nah. In dem Bilde fehlt es wohl an Raum und Luft. Winternitz’ Quai in Brügge ist eine virtuose Brangwyn-Reminiszenz. Wenn Meyer-Basel uns den blassen Abendhimmel über einer flachen Herbstlandschaft und über den in der Dämmerung lichtlos werdenden Wassern zeigt, oder die unbelaubten Bäume unter einem ganz klaren Frühlingshimmel, dann klingt uns aus diesen Bildern eine angenehme, ruhige, heimatliche Lyrik entgegen. Auch erscheint der Künstler mir dieses Mal energischer, körniger in der Farbe als früher. Hayeks Garben im Sonnenschein überzeugen doch wohl nicht. Das viele Gelb wird hier durchaus nicht zu Glanz und Licht; während die Terrainstudie in der Abendsonne geistvoll hingestrichen ist, und der Wintertag mit dem grauen Fluss zwischen den weißen Ufern ein feines Bildchen gibt. Hagens Winterbilder sind hart wie Metall. Oh! die Natur hat zuweilen Augenblicke, in denen sie ausschaut, als sei sie ein Öldruck, aber der Maler sollte warten, bis diese Augenblicke vorüber sind.
Was all diesen Landschaften gemeinsam ist und ihnen eine merkwürdige Ähnlichkeit untereinander verleiht, ist die Naturauffassung. Hier ein wenig mehr Melancholie, dort mehr Fröhlichkeit, aber all diese Künstler schauen mit tief beruhigter Seele in die Natur hinein und malen sie mit kräftigem, sichern, tiefberuhigten Pinsel auf die Leinwand.
Und von Ruhen, von stillem, behaglichen Genießen der Existenz sprechen auch die Tiere, die uns hier gezeigt werden. Das Tier in ein Stück Natur gestellt, von den Lichtern, Schatten, Farben der Umgebung übergossen, mit ihr in eins verschmolzen, der wohlige, lebende Ausdruck dieser Natur, das ist das Problem, an dem unsere Maler, nach dem Beispiel ihres Meisters Zügel, immer wieder studieren. Nicht ein einziges Tier in starker Bewegung, im Affekt, in Not finden wir hier. Emanuel Hegenbarth gibt uns wieder seine schweren Ackergäule, im Schatten eines Baumes stehen ein Brauner und ein Schimmel und ruhen von der Arbeit aus. Der Künstler liebt es, uns seine Tiere verkürzt von hinten zu zeigen, und einleuchtender kann die schwere Kraft dieser Leiber nicht gemacht werden, sowie die schwerfällige Bewegung der Stellung, mit der die mächtigen Muskeln verschoben werden, um sie ausruhen zu lassen. In den «Pferden in Halbsonne» führt ein Bauer zwei Schimmel von der Arbeit über den Acker heim. Das gedämpfte Licht wirft auf die weißen Leiber blaue Schatten; die müden Glieder stolpern unwillig und träge, die Köpfe haben einen stumpfen, geduldigen Ausdruck. Hinter ihnen steht ein geistvoll hingestrichenes, sonniges Stück Landschaft. Oder auf goldbraunem, mit Sonnenflittern überstreuten Waldboden weiden Ziegen. Glänzende schwarz- und weißgescheckte Kühe warten mit schweren Gliedern und vollen Eutern schläfrig und geduldig vor der Stalltüre. All das mit der saftigen Kraft, der ruhigen Deutlichkeit, die wir an diesem Künstler gewohnt sind. Schramm-Zittau überstreut seine Hühner mit einem bewegten Spiel von Schatten und grellen Lichtern, um sie wie bunte Edelsteine glänzen zu lassen. Willi Geigers Pferde vor einem Karren sind vortrefflich individuell gesehen, und das Bild ist auf einen feinen, hellen Ton gestimmt. Die schönen Schimmel auf Eckenfelders «pflügendem Bauer» – gehen sehr farbig von dem schwerblauen Himmel und dem braunen Acker ab. Endlich Paul Junghanns «Ziegen im Mittagslichte» geben eine gute Studie voll blonden, blendenden Lichtes.
Auch dem Problem des Innenraumes gehen einige der Künstler aufmerksam nach, ohne, wie es mir scheint, der Lösung so nahe zu kommen wie in der Landschaft und dem Tierstück. Die malerische Darstellung des Innenraumes schließt die reichste Möglichkeit der Stimmungen in sich. Die Räume, in denen wir leben, eben weil sie beständig und stark auf unser Seelenleben wirken, werden für uns so recht kondensierte Stimmung. Ernst Stern gibt uns fünf Innenräume. Der geistvolle Künstler packt die Aufgabe von allen Seiten an. In der Metzgerei-Studie streicht er breit, ja mit brutaler Bravour einen Raum hin voll schwerer Dämmerung, in der die Gestalt eines Metzgerburschen und ein geschlachteter Ochse tiefe, fette Farben annehmen. Durch die angelehnte Türe sickert etwas grelles Licht in das Dunkel. Das alles ist verblüffend keck und nicht ganz überzeugend. In der Stube einer Büglerin gleitet helles, freundliches Licht über graue Wände. In der großen Wirtsstube mit dem einsam stehenden Bauern ist das Räumliche angenehm sicher aufgebaut. Alles steht fest und verständlich da. Wenn dieser Bauer uns dennoch gleichgültig lässt, so liegt das wohl daran, dass ihm seine eigne, individuelle Luft fehlt. Das Licht und die Luft sind die Seele eines Zimmers, sie erst beleben die toten Gegenstände und schließen sie zu einem Organismus zusammen. Das wussten die van der Meer van Delft, Terborg und Pieter de Hooch in ihren besten Bildern schon sehr wohl. Freilich, einige derbe Lichtflecken wie in Eugen Wolffs Interieur tun es nicht, und der Mangel an persönlicher Stimmung macht uns Pätzolds Bauernstube so uninteressant. In Burrmanns Schiffbauhütte gleitet die Sonne lustig über all das braune Holzwerk, lässt es hier weich glänzen wie Seide, dort blank wie Metall, legt eine stille Heiterkeit in diesen Raum, den der Künstler sicher und kräftig hinstellt.
Am wenigsten Interesse hat der Mensch unseren Künstlern abgewonnen. Das Figurenbild ist spärlich und nicht am günstigsten vertreten. Nissels impressionistischer Biergarten, mit den drei Skatspielern, über die Lichter und Farben des Sommernachmittages unruhig und bunt hinflirren, gehört noch mehr zu den Landschaften. Sein Mädchen vor dem Spiegel ist ein Bild von schöner Leuchtkraft. Leo Putzs weiblicher Halbakt ist saftig und lebensvoll modelliert, nur bringen die über das Bild hingestreuten großen Lichtflocken eine monotone Unruhe hinein. Putzs weiße, in helles Licht gestellte Damen kennen wir von früher. Dieses Mal geht die weiße Dame unter ihrem weißen Sonnenschirm über einen hellbeschienenen Weg. Haltung und Bewegung des Figürchens sind vortrefflich. Grelle Lichter und blaue Schatten rieseln an der hellen Gestalt nieder. Herrmann Pröben liebt es, seine Figuren gegen eine helle Wand, einen hellen Himmel zu stellen und sie mit durchsichtigen Schatten zu verschleiern, das gibt dann einen feinen, gedämpften und doch hellen Ton. Hübsch ist das kleine, rote Dienstmädchen in der grauen Türe. Wie in feine, blanke Schleier gehüllt sitzt eine Kaffeegesellschaft im Freien. Aber dieses durchsichtig Verschattete gibt all den Gestalten etwas alltäglich Beruhigtes, Wesenloses. So dünn und verblasen spiegeln sich in unseren Augen Menschen, die wir flüchtig mit dem Blicke streifen, weil sie uns gleichgültig sind. Und erst die Dame in der Türe von Magarethe Kurowski, Kargendorfers Porträtstudie, die tüchtigen Porträts von Adolfo Levier, sie haben uns alle nichts zu sagen.
Tiefe Beruhigtheit ist der Grundzug dieser Bilder: Landschaften, Tiere, Menschen. Wir sprechen so viel von unserer nervösen, fiebererregten Zeit. Hier ist nichts Nervöses. Alles kräftig, klar, oft derb. Die Frühjahrsausstellung der Secession pflegt auch die Skizze besonders zu berücksichtigen und gewinnt dadurch ihren eigenen Reiz. Die Skizze zeigt uns die Geistesgegenwart der Kunst dem kostbaren, malerischen Augenblick in und um den Künstler gegenüber und ist vor allem geeignet, uns das Temperament einer Künstlerpersönlichkeit nahezubringen. Hier werden die oft gesagten Dinge wieder gesagt, deutlich, eindringlich, überlegt. Den Schimmel studierte schon Cuyp, die Kühe Potter, die Hühner Hondecoeter, die Flussufer Salomon Ruysdael wie heute Hegenbarth, Schramm-Zittau und Hämmel. All das sind ewige Themata und die Kunst wird immer wieder zu ihnen zurückkehren. Aber hat denn unsere Zeit nichts, das ihr besonderes Eigentum wäre, und das gemalt werden will? Der Maler hat seine Zeit zu lehren, wie sie die neuen Dinge, die sie schafft, zu sehen hat, wie sie ihr eignes Temperament in Farben und Linien umsetzen soll. Der Maler ist doch das Auge seiner Zeit. In den Fabriken, in dem Gedränge der Großstädte, an den Orten, wo der moderne Mensch sich vergnügt, arbeitet, leidet, da liegen die Lichter, die Schatten, die Farben, die Linien unserer Zeit, deren Auslegung die Aufgabe des Künstlers ist. Wenn Rosenhagen den Impressionismus «einfach die gute Malerei unserer Zeit» nennt, so möchte ich das so allgemein nicht gelten lassen. Wir haben Stimmungen, in denen wir gerne stetig mit unserem Blick an den Gegenständen hängen, ihre feste Form, das still und deutliche Nebeneinander der Sachen, ihr Wesen in Farbe und Linie auf uns wirken lassen. Und dafür ist eine ruhige, besonnene, breite Malerei der Ausdruck. Allein meist ist uns heute eine gierige, hastige Art des Sehens eigen. Wir sehen schneller und mehr als früher, analysieren und verschmelzen momentaner Farben und Formen. Unsere Nerven sind empfindlicher geworden und reagieren auf Licht- und Farben-Werte, die früher unbemerkt blieben. Wir wollen aus dem Dargestellten unsere eigene Erregtheit herauslesen, etwas in ihm finden, das dem Vibrieren unserer Seele entspricht, und für diese eigenste Art des Sehens unserer Zeit wird der Impressionismus wohl der definitive malerische Ausdruck sein.
Tizians himmlische und irdische Liebe und der Platonismus
I.
Tizians schönes Jugendbild in der Galerie Borghese ist wohl zuerst von den Kommentatoren des Vasari als Darstellung der himmlischen und irdischen Liebe – amor celeste e terreno – bezeichnet worden. Ridolfi berichtet von einem Bilde bei dem Fürsten Borghese, auf dem zwei Mädchen an einem Brunnen zu sehen seien. Vasari schweigt über das Bild. Francucci, in einem Gedichte auf die Galerie Borghese von1613, spricht von: beltà ornata e beltà disornata. Lübke schlägt die Bezeichnung «Liebe und Keuschheit» vor, Crowe und Cavalcaselle: amor ingenuo e amor sazio; Dickhoff: Venus Medea zur Liebe überredend. Andere, wie Springer und Morelli, sehen in dem Bilde eines jener einfachen Zustands- und Stimmungsbilder, wie Giorgione sie zu malen liebte, unter dessen Einfluss Tizian hier so stark steht.
In jüngster Zeit hat J. M. Palmarini in der Nuova Antologia9 eine neue Deutung versucht. Danach ist Tizians Allegorie eine Darstellung von Merlins Liebesbrunnen, den Bojardo in Orlando innamorato beschreibt10. Von Alabaster und Gold kunstvoll gearbeitet, enthält dieser Brunnen ein Wasser, das jedem, der es trank, Liebe in Hass verwandelte. Nicht weit davon aber floss ein Bächlein, dessen Wasser die Kraft besaß, aus Hass Liebe zu machen. Nach Palmarini sehen wir auf dem Bilde in der Gestalt links die Frau ohne Liebe. Sie drückt ihr kaltes Herz an das Kohlenbecken, um es zu erwärmen. Die nackte Gestalt aber mit der brennenden Lampe soll dieselbe Frau sein, nachdem sie von dem liebeentzündenden Wasser getrunken hat. Gegen diese Deutung ist bereits eingewandt worden,11 dass Merlins Brunnen nur die Wirkung hatte, Liebe in Hass zu wandeln. Neben der nackten Schönen liegt noch die feuchte Schale, mit der sie aus dem Brunnen geschöpft hat. Das Liebesfeuer kann jedoch aus Merlins Brunnen nicht stammen. Wir sind hier auch in keinem Walde, wie Bojardo will. Links ist ein Kastell, rechts ein Weiler. Spaziergänger, Reiter, Jäger tummeln sich da. Endlich, macht diese so sanft und rührvoll vor sich hin sinnende Mädchengestalt den Eindruck, als sei sie von Hass erfüllt, als beseelten sie die harten Gefühle, die Renaldo voller Abscheu vor Angelica fliehen lassen?
Vor dem herrlichen Bilde empfinden wir freilich nichts von dem Lehrhaften, dem Moralisierenden, das in der Bezeichnung «himmlische und irdische Liebe» doch liegt. Der Künstler scheint uns für keine der schönen Mädchengestalten gegen die andere Partei zu nehmen.
Über die Landschaft ist jene wohlige Stunde des Tages gekommen, in der die untergehende Sonne den Himmel golden streift. Die Luft wird kühl und klar. In den Schatten der Bäume liegt es wie Purpur. Wiesen und Blumen werden feucht, die Farben tief und satt. Der runde Turm des Kastells, der spitze Kirchturm des Weilers sind noch hell beleuchtet, während unten am Hügel ein durchsichtiges Dämmern beginnt. Die Wasser werden still und blau. Hasen kommen auf den Klee heraus. Aus den Toren strömen Spaziergänger. Auf der Wiese umarmt der Hirt die Hirtin. Reiter tummeln ihre Pferde. Hunde jagen einen Hasen. Auf den Blumen flattern Schmetterlinge ineinander. Ein jedes geht seiner Lust nach. Im Vordergrunde, zu beiden Seiten eines antiken Sarkophages, sitzen zwei Mädchen. Die Schöne links ist reich gekleidet und sinnt ernst und still vor sich hin. Das weiße Kleid, der Gürtel sind mit Edelsteinen besetzt, an den Händen trägt sie graue Handschuhe, blondes Haar umflattert das anmutige Gesicht. Die rechte Hand hält eine Rose, der linke Arm ist um ein Kohlenbecken gelegt, an das sich die Brust leicht lehnt. Gegenüber, auf dem Rande des Sarkophages wiegt sich ein nacktes Mädchen. Der weißrote Mantel, um den linken Arm geschlungen, dient nur als Hintergrund für den herrlichen Leib. Die rechte Hand hebt triumphierend eine brennende Lampe empor. Vorne auf dem Sarkophag liegt eine flache Schale, aus der die Schöne eben getrunken haben mag. Leicht den Körper vorbeugend, schaut das Mädchen die Gefährtin eindringlich und überredend an. Zwischen beiden aber steht ein Amor und schöpft aus dem Brunnen.
Tizian ist hier schon ganz der Meister des Lichtes und der Farbe, des weisen Abwägens der Werte, um das wirkungsvollste Fortissimo des Leuchtens hervorzubringen. Allein die Farbe hat noch nicht das feierliche Glühen der späteren Werke, sie ist blumiger, naiver, der Akkord ist weniger geschlossen, sie steht der poetischen Farbenmelodie des Giorgione näher. Auch die Gestalten stehen noch nicht so streng im Dienste des Ausdrucks; die Geste ist noch nicht so dramatisch gespannt und gebunden, wie wir es schon in der Assunta finden.12 Eine jede Gestalt hat hier ihr schönes Fürsichsein, wie die Menschen auf Giorgiones Zingarella beim Fürsten Giovanelli und auf dem Konzert des Louvre. Unendlich süßes, sorgloses Genießen des Lebens, schöne, stille Lebenstrinker in einer schönen, freundlichen Natur. Dennoch wird es mit dem moralisierenden Titel «himmlische und irdische Liebe» seine Richtigkeit haben. Solche Entgegenstellungen von geistiger und leiblicher Liebe, von Keuschheit und Sinnlichkeit, waren das Lieblingsthema der damaligen Gesellschaft geworden. Isabella d’Este von Mantua bestellte bei Perugino den Kampf der Keuschheit mit der sinnlichen Liebe des Louvre. Lorenzo Lotto malte das hübsche Bildchen des Kasinos Rospigliosi in Rom, auf dem die Keuschheit in weißer Haube, das Hermelinchen, ihr Symbol, auf dem Busen, mit zorniger Gebärde die fliehende Venus und den weinenden Amor züchtigt. Luini malte seine Bescheidenheit und Eitelkeit der früheren Galerie Sciarra-Colonna.
II.
Mitten unter den blutigen Wirren des 15. und 16. Jahrhunderts, in dem rücksichtslosen Kampf um Herrschaft und Macht, mitten unter der wilden Soldateska der Borgia, Malatesta, Giovanni de’ Medici war in Italien eine Kultur erblüht, die nach der höchsten Verfeinerung des menschlichen Geistes strebte. Die bildenden Künste fanden für diese Ideale einen Ausdruck von bisher ungeahnter Schönheit. Das neuerwachte Studium der griechischen Literatur vermittelte die Schätze einer Kultur, die manche Verwandtschaft mit der damaligen Zeit aufzuweisen schien. Plato vor allem, mit seiner Religion des Guten und Schönen, war es, der das aussprach, wonach die feinen Geister der Renaissance sich sehnten. Zu seinem ästhetischen Idealismus flüchtete alles, was sich von dem gewaltsamen Realismus der Zeit erholen wollte. Wie der Minnedienst in harter, grausamer Zeit die Zuflucht aller Instinkte war, die sich im Menschen nach Schönheit, Sitte und Geistigkeit sehnen, so war es der Platonismus in der Renaissance. Und wie damals edle Frauen diese geistigen Güter verwalteten und hüteten, so stand auch die Frau im Mittelpunkte des neuen Platonismus.
Heil mir, dass stets sich mein Sinn zu ihr kehrte!
Ihr bringt’s nicht Schaden, mir aber Gewinn,
Weil ich zu Gott und zur Welt meinen Sinn
Ihrethalb nur umso voller umkehre …
singt Hartmann von Aue, und Castiglione sagt: «Nur durch die Frauen erkennen wir Gott.» Diotimas Lehre von dem Eros, dem Dämon, der Himmlisches und Irdisches verbindet, wurde Glaubensartikel der Renaissancegesellschaft. Gerade als Gegensatz zu den skrupellosen Appetiten der wilden Sinnlichkeit, die sich damals breitmachten, konnte die Gesellschaft ihre Ideale nicht hoch genug setzen. Die irdische Venus wurde geschmäht, die himmlische begeistert gepriesen. Die Frauen benützten die neue Lehre, um ihre Macht in einer Umgebung hochzuhalten, in der sie unter der Rücksichtslosigkeit männlicher Instinkte zu leiden in Gefahr stand. Die Männer feierten den Platonismus als ein Mittel, das ihnen den erlesenen Genuss wahrte, reine und edle Weiblichkeit zu feiern. Der Renaissancemensch wollte das Leben mit der ganzen Tonleiter der Empfindungen durchleben, vom Idealen, Reingeistigen, bis zum Derbsinnlichen und Gewaltsamen.
Kein Geringerer als Marsilio Ficino, der Plato-Kommentator und Übersetzer, der Mittelpunkt der mediceischen Akademie, war es, der es unternahm, die Lehren seines Lieblingsphilosophen, gemischt mit neuplatonischen und christlichen Elementen, zu einer Religion der Liebe und Schönheit für die feinen Geister seiner Zeit umzudichten.13
Das Mystische des Minnedienstes hatte sich mit dem Religiösen verschwistert. Noch bei Dante und Petrarca wird das persönliche Seelenerlebnis der Liebe zum mystischen Emporsteigen zu Gott verklärt. Die Renaissance war weltlich gesinnt, «wodurch», wie Burckhardt sagt, «sie zum Mittelalter einen ausgesprochenen Gegensatz zu bilden scheint». Sie beschaffte sich die Mittel, um ihren mystischen Bedürfnissen zu genügen, nicht mehr aus dem Religiösen, sondern aus dem Bildungsinteresse, das sie so leidenschaftlich ergriff. Sie schuf sich eine Mystik der Liebe, die zwar Dante und Petrarca direkt fortsetzte, sich jedoch dabei bewusst und voll auf Plato und die Neuplatoniker berief. Die irdische Liebe, lehrt Ficino, ist ein Zauber des Blickes. Die spiriti d’amore, die Geister der Liebe, gehen aus den Augen in die Augen. Die geistige Liebe ist ein Strahl der Schönheit, der in die Seele dringt und in ihr die Idee der ewigen Schönheit erweckt. Die Schönheit einer einzelnen Person vermittelt den Genuss der Schönheit an sich. Der Körper mit seiner Schönheit ist nur der Weg, auf dem die ewige Schönheit in die Seele dringt. So gibt es eine zweifache Liebe. Die eine ist Wollust und irdisch; die andere Betrachtung und himmlisch. Die eine hält sich an den Körper, die andere an die Seele.
Michelangelo folgt genau dem Meister, wenn er in einem Sonett sagt: «Die Schönheit, die du schaust, geht wohl von jener Frau aus, – Aber sie wächst und erhebt sich zu himmlischen Höhen, – Wenn sie durch die sterblichen Augen in die Seele dringt. – Dort wird sie göttlich, rein und sieghaft, – Wie es allem Göttlichen geziemt.» In der ereignisvollen Einsamkeit von Michelangelos großer Seele wurde die ideale Liebe zu Vittoria Colonna zum Symbol des Kampfes um Befreiung von niederer Leidenschaft, um Aufsteigen zu höherer Seelenharmonie. Ausdrücklich beruft Michelangelo sich dabei auf Plato. Sein Biograph Condivi