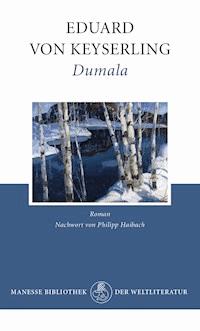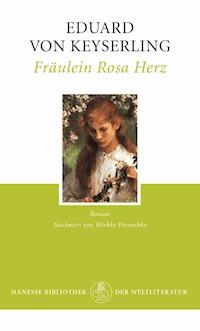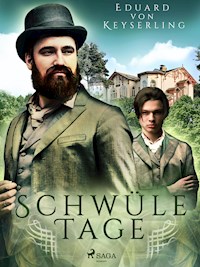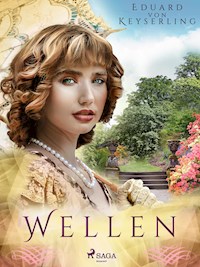15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie sind engelsgleiche Wesen, anmutig, graziös, sanft – Fürstinnen wissen, was sich schickt, und reifen in trägem Pathos ihrer exklusiven Bestimmung entgegen: der standesgemäßen Heirat. Wehe, ein adeliges Fräulein meint, dagegen aufbegehren zu müssen. Marie von Neustatt-Birkenstein ist so ein betrüblicher Fall. Sie ist nicht willens, wie ihre Schwestern Roxane und Eleonore den Prinz auf dem weißen Pferd erwarten. Ihre fixe Idee ist es vielmehr, «sich zu entwickeln». Mit zauberhafter Melancholie malt Eduard von Keyserling einmal mehr nuancenreiche Porträts einer dem Untergang geweihten Aristokratie, die sich gegen die Gebote der neuen Zeit mit moralischer Erstarrung wappnen.
«Fürstinnen ist wieder einer dieser so hinreißenden kleinen Romane, in denen Keyserling seine untergegangene Welt beschreibt: er beschreibt ihren Untergang, ihre große Schönheit, und er beschreibt sie eben im Tone und im Besitz jener Sensibilität, die mit ihr verlorengehen wird.» Rolf Vollmann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mit Fürstinnen ist ein Glanzstück deutscher Prosakunst zu entdecken. Wie kein anderer verbindet Eduard von Keyserling Sinnlichkeit und Stilbewusstsein mit adeliger Zeitkritik. In diesem Spätwerk entwirft der Stimmungsmagier betörende Frauen-Porträts aus einer untergehenden Epoche. «Keyserlings Romane gehören zum Aufregendsten, was seit 1900 in deutscher Sprache geschrieben wurde.» Hubert Winkels, Deutschlandfunk
Sie sind engelsgleiche Wesen, anmutig, graziös, sanft. Fürstinnen tun, was sich schickt, kultivieren ihren Liebreiz und reifen ihrer Bestimmung entgegen: der Heirat mit einem Edelmann, der schon wissen wird, was gut für sie ist. Wehe, so ein adeliges Fräulein bildet sich ein, gegen die Pflichtschuldigkeit ehelicher Beglückung aufbegehren zu müssen! Die kleine Marie von Neustatt-Birkenstein ist solch ein beklagenswerter Fall. Nicht willens, es ihren Schwestern Roxane und Eleonore gleichzutun und zu warten, bis der sprichwörtliche Prinz auf dem weißen Pferd angeritten kommt, fasst sie den eigensinnigen Beschluss, «sich zu entwickeln».
Dieser Roman erzählt von weiblicher Lebenslust und jugendlichem Aufbegehren, ebenso aber von weiser Abgeklärtheit und Entsagung. Denn in den schönen braunen Augen von Maries Mutter spiegelt sich «das träge Pathos byzantinischer Madonnen» – das ganze erfahrungssatte Wissen um die Kluft zwischen gelebten und ungelebten Empfindungen.
Mit virtuoser Beschreibungskunst malt Eduard Graf von Keyserling (1855–1918) lodernde Bilder einer sich selbst problematisch gewordenen Adelskaste, die sich gegen alle Forderungen der neuen Zeit mit Standesbewusstsein und geistig-moralischer Renitenz wappnet. Fürstinnen, 1917 erschienen, ist einer der letzten Romane des kurländischen Erzählers, dessen «süße, bittere, marktfremde, adelige Kunst» schon Lion Feuchtwanger über die Maßen bezauberte. Indem Keyserling uns in die sinnlich flirrende, betörende Idylle des fürstlichen Schlosses eintauchen lässt, evoziert er auf unvergleichliche Weise die Wehmut, die einen angesichts aller drohenden Verluste erfasst. Und doch ist seine Diktion meilenweit von Nostalgie und Vergangenheitspathos entfernt.
«Fürstinnen ist einer dieser so hinreißenden kleinen Romane, in denen Keyserling seine untergegangene Welt beschreibt: er beschreibt ihren Untergang, ihre große Schönheit, und er beschreibt sie eben im Tone und im Besitz jener Sensibilität, die mit ihr verlorengehen wird.» Rolf Vollmann
EDUARD VON KEYSERLING
Fürstinnen
Roman
Nachwort von Jens Malte Fischer
MANESSE VERLAGZÜRICH
Die verwitwete Fürstin Adelheid von Neustatt-Birkenstein ging um die Mittagstunde eines heißen Sommertages in das Büro hinüber, um mit dem Major a. D. von Bützow, dem Verwalter ihres Gutes, über ihre Finanzen zu sprechen. Der Fürst Ernst von Birkenstein war im besten Mannesalter gestorben. Eine tückische Lungenkrankheit hatte ihn schnell dahingerafft. Da der Fürst keinen männlichen Nachkommen hinterließ, folgte ihm in der Regierung des Fürstentums sein jüngerer Bruder, Fürst Konrad. Die Fürstinwitwe jedoch zog sich mit ihren drei Töchtern auf die Herrschaft Gutheiden zurück, die sie im Osten des Reiches besaß. Der verstorbene Fürst war ein lustiger Herr gewesen, und das Familienvermögen befand sich bei seinem Tode in ziemlich zerrütteter Verfassung. Die Witwenapanage war mager genug; so beschloss denn die hohe Frau, ihre Töchter in ländlicher Stille zu erziehen. Aber auch so gehörte viel Umsicht dazu, um die Mittel für ein standesmäßiges Leben zu beschaffen.
Diese Besuche im Büro, die langen Gespräche über Geld machten die Fürstin stets müde und traurig. Sie saß da in dem Korbsessel vor dem großen Schreibtisch, der ganz mit Kontobüchern bedeckt war. Ihr gegenüber saß der Major in seinem grauen Leinenanzuge, sehr erhitzt, das kleine, runde Gesicht war gerötet, selbst die Kopfhaut schimmerte rot durch das dünne, greise Haar, und die Enden des grauen Schnurrbartes hingen schlaff über die Mundwinkel. Leise und schnarrend gab er seinen Bericht ab, zuweilen hielt er inne und richtete die hervorstehenden blauen Augen auf die Fürstin, um zu sehen, welchen Eindruck sein Bericht mache. Die Fürstin jedoch lag regungslos in ihrem Stuhle und schaute durch das geöffnete Fenster auf den Hof hinaus, der jetzt in der Arbeitspause ganz still im Sonnenschein dalag, nur drüben bei den Stallungen regte es sich, ein Stallbursche, die Tressenmütze im Nacken, wusch einen großen, blanken Wagen.
«Etwas Hoffnungsloseres», dachte die Fürstin, «als die Stimme des Majors gibt es wohl nicht», und diese Zahlenreihen, diese Debets und Kredits und Saldos, wie feindlich das alles klang! Eine große Brummfliege hatte sich in das Zimmer verirrt und begann laut und ärgerlich zu summen, als wollte sie das traurige Knarren der Stimme des Majors übertönen. Die Fürstin war noch eine schöne Frau, wie sie in ihrem weißen Pikeekleid regungslos dasaß, das Haar sehr dunkel unter dem schwarzen Spitzenschleier. Die bräunliche Blässe des schmalen Gesichtes hatte etwas wie einen matten Bronzeglanz, die Züge waren von wunderbar ruhiger Regelmäßigkeit, und aus den großen braunen Augen schaute das träge Pathos byzantinischer Madonnen. Die kleinen Hände, schwer von Ringen, ruhten müde im Schoß. Jetzt war der Bericht zu Ende. Der Major schwieg, zog die weißen Haarbüschel seiner Augenbrauen in die Höhe und blickte seine Herrin erwartungsvoll an.
Die Fürstin schaute noch immer auf den Hof hinab, als sei sie mit ihren Gedanken sehr weit fort, aber sie begann zu sprechen, sprach langsam und ein wenig klagend: «Das ist alles nicht ermutigend, aber an den großen Ausgaben der letzten Zeit und den Ausgaben, die bevorstehen, lässt sich nichts ändern. Ich musste im Winter mit den Prinzessinnen nach Birkenstein reisen, um die Gesellschaften mitzumachen, nun, und dann kam die Verlobung der Prinzessin Roxane. Die Möbel im Saal, im grünen und im blauen Zimmer mussten vor dem Besuche des jungen Großfürsten neu bezogen werden. Und jetzt kommt die Aussteuer, und wenn die Hochzeit auch bei meinem Bruder, dem Großherzog, stattfindet, Ausgaben gibt es dabei genug. An alledem lässt sich nicht das Geringste ändern. Wenn es vorüber sein wird, kann man ja versuchen, wieder eine Weile krumm zu liegen und zu sparen.»
Es wurde an die Tür geklopft, und sie öffnete sich, ohne dass jemand «Herein!» rief. Der Graf Donalt von Streith trat ins Zimmer, lang und hager, in einem weißen Flanellanzuge. «Sie kommen gerade recht, lieber Graf», sagte die Fürstin, ohne sich umzuschauen, und streckte ihm die Hand hin, «wir sind hier gerade bei unseren Defiziten.»
Der Graf küsste die dargebotene Hand und meinte: «So, so! Unser Major hat wieder alle Taschen voller Sorgen.»
Der Major zuckte die Achseln, und die Fürstin klagte: «Ach ja, es ist wieder diese schreckliche Ziegelfabrik.»
Der Graf setzte sich weit vom Schreibtisch in einen Sessel, streckte die Beine von sich und rieb vorsichtig die Fingerspitzen aneinander. Seinen kleinen, länglichen Kopf bedeckte krauses, leicht ergrautes Haar. Seltsam dicht beieinander saßen im sonnengebräunten Gesicht die graublauen Augen. Was aber das Gesicht ganz beherrschte, war die mächtige, kühn gebogene Nase. Die Bartkommas auf der Oberlippe und am Kinn waren kohlschwarz. Die ganze Erscheinung hatte etwas von einem eleganten Don Quichotte1. Der Graf war zu Lebzeiten des Fürsten Ernst Hofmarschall in Birkenstein gewesen. Jetzt besaß er ein Waldgut in der Nähe von Gutheiden und lebte dort allein in seinem Jagdschlösschen. Seine Hauptbeschäftigung aber war, die Fürstin in der Verwaltung ihres Gutes zu beraten. Zu jeder Tageszeit konnte man sein kleines Automobil oder seinen Falben im Gutheidener Schlosshofe stehen sehen, und ein jeder auf dem Gute wusste, der eigentliche Herr hier, der zu entscheiden hatte, war doch der Graf Streith.
«Nun», begann der Graf, «wenn die Ziegelei uns im Stiche lässt, so muss der Wald herhalten.»
«Denken Sie?», sagte die Fürstin und sah den Grafen hoffnungsvoll an. «Ich wusste gleich, Sie würden sich etwas ausdenken.»
Der Major hatte seine Bücher geschlossen und erhob sich: «Darf ich jetzt zu den Arbeiten gehen?», murmelte er.
«Gewiss», erwiderte die Fürstin, «ich danke Ihnen, lieber Major», und sie reichte ihm ihre Hand hinüber, die er küsste. «Sie sehen, es findet sich immer ein Ausweg.»
Aber das Gesicht des Majors behielt seinen kummervollen Ausdruck, er verbeugte sich vor dem Grafen und verließ das Zimmer.
Die Fürstin schaute wieder nachdenklich zum Fenster hinaus, und der Graf rieb seine Fingerspitzen aneinander. Beide schwiegen eine Weile und lauschten dem leisen Klingen, das durch die heiße Mittagsluft irrte. Endlich begann die Fürstin, als spräche sie zu sich selbst: «Wenn der Major all diese unangenehmen Dinge vorträgt, klingt aus seiner Stimme etwas Vorwurfsvolles. Aber ich kann nichts dafür, dass die Ziegelei nichts trägt, deshalb werde ich doch nicht meine Töchter hier auf dem Lande verstecken. Ich muss mit ihnen die Gesellschaften in Birkenstein und in Karlstadt besuchen, sie sollen doch heiraten. Eine unverheiratete Prinzessin ist nirgends am Platz. Unverheiratete Prinzessinnen kommen mir vor wie diese Perlenarbeiten, die Gouvernanten zum Geburtstage schenken, Lampenuntersätze oder Federwische, man wusste nie, wo man diese Dinge lassen sollte.»
Das sonore Lachen des Grafen schreckte die Fürstin auf, sie schaute ihn einen Augenblick überrascht an, dann begann auch sie zu lachen. Gleich darauf wurde sie wieder ernst und seufzte: «Nein, nein», sagte sie, «mir ist nicht nach Lachen zumute.»
«Unsere Prinzessinnen werden heiraten», tröstete der Graf. «Der Anfang ist schon gemacht.»
«Nun ja», sagte die Fürstin zögernd, «mit Roxanes Verlobung kann ich zufrieden sein, der junge Mann ist sympathisch, aber diese Leute von drüben – was weiß man, das ist doch alles so fremd. Und ein Kind in diese unbekannte Ferne zu schicken, das ist schwer. Russland, mein Gott! Das ist so dunkel und unbekannt wie – wie das Jenseits. Nun, Roxane ist kühl und vernünftig, die wird sich überall zurechtfinden. Da wird es meine Eleonore schwerer haben, sie ist so weich und leicht verwundbar, sehen Sie, das darf unsereins nicht sein. Und dann meine Jüngste, die ist meine größte Sorge. Mit ihren bald sechzehn Jahren noch so kindisch. Sie hat viel von ihrem Vater, dieses Unruhige, Unberechenbare. Dazu wächst sie hier auf dem Lande auf –»
«Unsere Prinzessin Marie», meinte der Graf, «wird es schon machen, sie hat ihren Kopf für sich und wird ihren eigenen Weg gehen.»
«Aber Streith!», rief die Fürstin und schlug die Hände zusammen, sodass die Ringe leise aneinanderklirrten wie kleine Panzer. «Ihren eigenen Weg gehen? Wie kann eine Prinzessin ihren eigenen Weg gehen? Ihr Weg ist ihr vorgeschrieben, sie läuft wie auf Schienen, und kommt sie von denen ab, dann ist sie verloren.»
«Also kleine Lokomotiven», schlug der Graf vor und lächelte.
«Lokomotiven», wiederholte die Fürstin klagend, «wie wollen Sie, dass ich hier auf dem Lande Lokomotiven erziehe? Wenn ich als Mädchen einmal mit den anderen Mädchen lebhaft und amüsant sein wollte, dann sagte die Gräfin Breckdorff: ‹Lassen Sie das, Prinzessin Adelheid, bei den anderen jungen Damen ist das ja ganz nett, aber bei Ihnen ist das nicht angebracht.› Wie sollen die Mädchen hier auf dem Lande lernen, was alles nicht angebracht ist? Wie soll ich das machen? Wer hilft mir?»
Der Graf beugte sich ein wenig vor und sagte streng: «Und ich?»
«Ja, Sie, Streith», erwiderte die Fürstin, «natürlich Sie. Schon in Birkenstein, wenn es Unannehmlichkeiten gab, sagte ich immer: ‹Streith wird sich etwas ausdenken.› Und diese Gewohnheit habe ich noch immer.» Sie hatte ihn dabei freundlich angesehen, und der Blick ihrer Augen blieb träge und nachdenklich auf ihm ruhen.
Der Graf lehnte sich befriedigt in seinen Stuhl zurück und meinte: «Das will ich hoffen.» Dann erhob er sich. «Ich will in den Wald fahren», sagte er, «und sehen, was zu machen ist.»
«Kommen Sie zum Diner herüber?», fragte die Fürstin.
«Wenn ich darf», sagte der Graf.
«Ja, kommen Sie», erwiderte die Fürstin, «man unterhält sich dann, man braucht nicht an Geld zu denken, vielleicht kann man dann ein wenig zusammen lachen.»
Der Graf küsste die Hand der Fürstin und ging.
Die Fürstin saß noch einen Augenblick matt und mutlos da, obgleich dieser Raum mit seinem Geruch von Tinte und staubigen Kontobüchern, mit dem verstimmten Summen der großen Brummfliege ihr unendlich zuwider war. Endlich entschloss sie sich, das Zimmer zu verlassen. Sie ging die lange Zimmerflucht des Hauses hinab. Alles war still, denn um diese Zeit pflegten die Hausgenossen sich zur Mittagsruhe zurückzuziehen. Nur im großen Saal ging Böttinger, der alte Kammerdiener, mit dem weißen Haar und dem weißen, faltigen Gesichte, leise ab und zu, um zu sehen, ob die Vorhänge alle der Mittagssonne wegen herabgelassen waren. Die Fürstin blieb stehen und schaute nachdenklich die bronzefarbenen Atlasbezüge der Stühle an. «Böttinger», sagte sie, «ich denke, den neuen Möbeln lassen wir bis zum Nachmittage die leinenen Überzüge, ich fürchte, die Sonne schadet ihnen doch.»
«Wie Hoheit befehlen», murmelte Böttinger.
Die Fürstin ging weiter bis in ihr Boudoir, hier atmete sie auf, hier in dem kleinen Raume mit den niedergelassenen, gelbseidenen Vorhängen, in dem es süß nach den großen, welkenden Rosen in der Kristallschale duftete, hier wehte die Luft, die sie zu atmen gewohnt war, und die widerwärtigen Eindrücke des Büros fielen von ihr ab. Sie streckte sich auf ihre Couchette2 aus, griff nach dem englischen Roman, schlug ihn jedoch nicht gleich auf, sondern schloss die Augen, um eine Weile das Wohltuende der ruhevollen Lebenslage zu genießen. «Man muss doch», dachte sie, «aus seinem eigentlichen Leben sozusagen herausschlüpfen, um einen guten Augenblick zu genießen.»
*
Drüben im Obstgarten saßen die Prinzessinnen beieinander. Sie liebten es, um diese Stunde, in der die Erzieherinnen ihre Mittagsruhe hielten, sich dort zusammenzufinden. In einer viereckigen Einsenkung des Bodens standen hier die Stachelbeerbüsche, Johannisbeerbüsche, Himbeerbüsche und einige Obstbäume, prall schien die Mittagssonne auf sie nieder, es duftete nach heißen Blättern und heißen Früchten, und von dem höher gelegenen Gemüsegarten trug ein Windhauch zuweilen die strengen Gerüche der Sellerie und Porree herüber. Auf dem Abhang unter einem alten Pflaumenbaum hatten die drei Mädchen sich gelagert. Sie trugen alle drei weiß und rot gestreifte Batistkleider und kleine weiße Strohhüte. Roxane saß aufrecht, den Rücken gegen den Stamm des Baumes gelehnt, die Hände im Schoß gefaltet, und schaute gerade vor sich hin in das Flimmern des Mittags hinein. Sie hatte die feierliche Schönheit ihrer Mutter, die großen braunen Augen, doch nahm die strenge Reinheit der Züge in dem jugendlichen Gesichte eine fast ausdruckslose Beruhigtheit an. Eleonore lag im Schatten des Baumes und starrte zum Himmel hinauf. Ein blühendes, rundes Gesicht, in dem die Sphinxaugen der Mutter zu freundlichen, braunen Mädchenaugen geworden waren. Ganz im vollen Sonnenschein hatte sich Marie, die Jüngste, ausgestreckt. Sie lag auf dem Bauche, stützte den Kopf in die Hand, hämmerte mit den Spitzen ihrer gelben Schuhe Löcher in den Rasen und aß einige unreife Pflaumen, die vom Baum gefallen waren. Für ihre sechzehn Jahre war die Gestalt seltsam unentwickelt, schmächtig und eckig, und das Gesicht war ein breites Kindergesicht mit roten Backen und weit offenen, blauen Augen. Das krause, honiggelbe Haar fiel in die kurze Stirn hinein. Alle drei hatten eine Weile geschwiegen, das grelle Licht, der starke Duft machten die Köpfe schwer und gaben den Gedanken eine müde Stetigkeit, wie wir sie vor dem Einschlafen empfinden, wenn die Gedanken sich anschicken, Träume zu werden.
Plötzlich schaute Marie zu Roxane auf, spie einen Pflaumenkern weit von sich und fragte: «Denkst du jetzt auch an deinen Großfürsten?»
Roxane zog ein wenig die Augenbrauen hinauf und antwortete ablehnend: «Was du nicht alles fragst.»
«Nun ja», fuhr Marie fort, «ich meine nur, du hast jetzt etwas, an das du denken kannst. Wir nicht.»
Roxane überhörte diese Bemerkung und sagte: «Speie doch die Kerne nicht so unanständig aus.»
«Unanständig?» Marie sah die Schwester erstaunt an. «Du hast das doch früher auch immer getan. Wenn ich mit einem Großfürsten verlobt sein werde, dann werde ich es auch nicht mehr tun. Übrigens, wie man es in Russland damit hält, ist noch sehr die Frage.» Da Roxane nicht antwortete, plauderte Marie weiter: «Ich finde ja deinen Dimitri reizend, sehr schöne Augen mit langen Wimpern, sein Schnurrbart ist wie aus bronzefarbener Seide, hübsch ist es, wenn er deutlich spricht, als ob er eigentlich singen wollte. Ein wenig stark parfümiert ist er, aber gutes Parfüm, Peau d’Espagne und etwas Süßes, ich glaube Heliotrop.»
«Seine Augen sind schön», ließ Eleonore sich vernehmen. «Auch wenn er lacht, sind sie traurig.»
«Ja, sie sind traurig», sagte Roxane feierlich. «Dimitri ist ja so heiter und amüsant, aber auf dem Grunde seines Wesens liegt etwas Trauriges. Schon seine Stimme. Wenn er von seiner Heimat erzählt, von Steppen, die blühen, und von Tataren mit kleinen schiefen Augen, immer klingt etwas Melancholisches mit.»
«Natürlich», meinte Eleonore, «wenn ich das Wort Russland höre, denke ich an eine große Ebene, auf der es dämmert. Ich kann mir nicht denken, dass die Sonne dort scheint; es ist dort immer Dämmerung, und in der Ferne ist eine große Stadt mit Lichtern in den Fenstern, und irgendwo in der Dämmerung singt einer oder weint einer.»
«Mademoiselle Laure sagt», berichtete Marie, «der Petersburger Hof ist der ausgelassenste Hof in Europa.»
Roxane zuckte verachtungsvoll mit den Schultern: «Ach die.»
Vom Abhang aus konnte Marie das Gartengitter sehen. Die Landstraße führte hier vorüber, dann ging es zur Dorfstraße in die Höhe mit den kleinen Häusern und Gärten, still und sonnig lag sie jetzt da, nur Hunde und Hühner trieben sich dort umher, zuweilen ging eine Frau mit einem Eimer zum Brunnen. Dahinter aber auf einem Hügel stand groß und weiß mit blitzenden Fenstern Tirnow, das Schloss des Grafen Dühnen. Marie ließ die Landstraße nicht aus den Augen, denn jeden Tag um diese Zeit kamen die drei Dühnenschen Jungen vom Flusse her, wo sie gebadet hatten, auf ihrem Heimwege hier vorüber. «Da sind sie!», rief Marie laut. Alle drei in blauen Leinenanzügen, die feuchten Badetücher über der Schulter, die Gesichter so gebräunt, dass die blonden Haare fast weiß erschienen. Da war Felix, der sechzehnjährige Kadett, hoch aufgeschossen und schmal, Bruno mit dem hübschen Mädchengesicht und Coco, ein ungezogener siebenjähriger Gnom. Die beiden älteren Knaben grüßten zu den Damen hinüber. Coco blieb stehen, drückte sein Gesicht gegen das Gitter und zählte: «Drei Kohlköpfe, drei Salatköpfe, drei Prinzessinnen.» Dann lief er davon. Marie folgte den Knaben aufmerksam mit den Augen, wie sie die Dorfstraße hinaufstiegen, immer kleiner wurden und endlich verschwanden. Und immer empfand sie dann etwas, das ihr das Herz schwer machte, als sei dort das freie, lustige Leben an ihr vorübergegangen.
Die Gräfin Dühnen war mit ihren Söhnen zwar einmal im Schlosse gewesen, aber da war Felix in seiner Uniform steif und geziert, die beiden anderen mit glatt gekämmtem Haar und weißen Kragen waren stumm und verlegen. Und alle drei ganz andere Wesen als die Knaben mit den losen Leinenkitteln, die heiß und noch feucht vom Bade am Gartengitter vorüberzogen. Traurig wandte sie sich wieder zu ihren Pflaumen. Als sie einen Blick auf Roxane warf, rief sie: «Aber, Roxane, wie siehst du aus, du willst ja weinen, du weinst ja schon.»
Wirklich waren Roxanes Wangen feucht von Tränen. Sie lächelte: «Es ist nichts», sagte sie, «mir war es nur plötzlich so seltsam, dass ich in wenigen Tagen hier all dieses nicht mehr sehen werde, dass es ganz, ganz weit sein wird, ein kleiner sonniger Fleck, nach dem ich mich sehnen werde.»
Marie zuckte die Achseln. «Diese alten Stachelbeerbüsche», meinte sie, «wären wohl das Letzte, nach dem ich mich sehnen würde.»
Ein kleiner Wagen fuhr jetzt auf der Landstraße am Gitter vorüber, und Marie meldete wieder: «Ach Gott! Da kommt er.» Es war Professor Wirth vom städtischen Gymnasium, der zweimal wöchentlich ins Schloss kam, um den Prinzessinnen einen Geschichtsvortrag zu halten. Marie streckte und dehnte sich im Vorgefühl der kommenden Langeweile. «Das ist auch ein Segen, ein Segen der Verlobung», sagte sie, «dass man vom Elend dieser Geschichtsstunden loskommt. Komm, Lore, Roxane hat es gut, die kann hierbleiben und an ihren Dimitri denken.» Seufzend erhoben sich die beiden Mädchen und gingen träge und langsam dem Schlosse zu.
*
Um vier Uhr stand die Kalesche mit dem Viererzug von Rappen vor dem Schlosse. Um diese Stunde pflegte die Fürstin mit ihren Töchtern eine Spazierfahrt zu machen. Marie hielt nicht viel von diesen Fahrten, sie verliefen meist schweigsam, und der Weg war ihr allzu bekannt. Immerhin war es eine Gelegenheit, ein wenig die Luft der Außenwelt zu atmen und einen Blick auf das Leben der anderen Menschen zu werfen. Da war zuerst die Dorfstraße. Wenn der Wagen durchfuhr, steckten die Frauen die Köpfe aus den kleinen Fenstern, Kinder saßen auf Gartenzäunen und sperrten die Mäuler auf, Männer grüßten, Hunde bellten, es gab eine lustig lärmende Erregung. Neben der Kirche lag das Pfarrhaus. Im Garten stand die Pfarrerin mit ihren zwei Töchtern, sie hielten große Schüsseln und pflückten Johannisbeeren. Ihre glatten, braunen Scheitel glänzten in der Sonne. Wenn sie des Wagens ansichtig wurden, fassten sie ihre Schüsseln mit beiden Händen und machten tiefe Knickse. Dann kam Tirnow. Alle Fenster standen offen, drinnen wurde auf dem Klavier ein Walzer gespielt, in den Kirschbäumen an der Gartenmauer saßen die Jungen; blaue Gestalten in all dem Grün und Rot. Coco schwenkte seinen Strohhut und rief dem Wagen etwas nach. Auf die Chaussee brannte die Sonne heiß nieder, eine Staubwolke begleitete den Wagen, die Gegend war nur durch einen trüben, gelben Schleier zu sehen, die großen Klettenblätter am Wegrain waren staubgrau wie Löschpapier, und widerwärtige, große Fliegen umsummten die Nasen der Fahrenden. Marie wurden die Augenlider schwer, und sie begann wieder an dem Vergnügen dieser Spazierfahrten zu zweifeln. Aber noch gab es etwas zu sehen. Sie kamen an Schlochtin, am Landsitze des Baron Üchtlitz, vorüber. Ja, das war der eigentliche Höhepunkt dieser Fahrten. Kühl lag das rote Haus zwischen seinen mächtigen alten Linden. Im Garten, auf dem Tennisplatze, trieben sich junge Mädchen mit bunten Kappen, junge Herren in hellen Anzügen umher, ihre lauten Stimmen klangen bis auf die Landstraße hinaus. Im Grünen hing eine Schaukel, und auf ihr saß ein Mädchen im roten Kleide, unten stand ein Offizier und schaukelte. Die Knöpfe an seinem dunklen Waffenrock blitzten wie kleine Feuer. Und wenn das Mädchen hoch in die Zweige hinaufflog, dann stieß es einen kleinen, schrillen Schrei aus, und der Offizier bog den Kopf zurück und lachte. «Köstlich», dachte Marie und seufzte.
Jetzt bog der Wagen in den Wald ein, und es gab nichts mehr, worauf sie sich freuen konnte. Steif und regungslos stand die endlose Reihe der Kiefern da, ein Wald riesiger Bleistifte, schräg schien die Nachmittagssonne durch die Wipfel. «Wie das duftet», sagte Eleonore, sie sagte das jedes Mal, Marie wusste, dass das kommen würde. Und dann zeigten sich einige Rehe zwischen den Stämmen, und Roxane sagte: «Sieh doch, Rehe!» Das geschah ebenso regelmäßig wie das Erscheinen des Kuckucks auf der alten Kuckucksuhr, die Fräulein von Dachsberg, die Erzieherin, von ihrer Mutter geerbt hatte, die Uhr schnurrt, der Kuckuck erscheint und sagt: «Kuckuck.» Die Uhr schnurrt, und Eleonore sagt: «Wie es hier duftet.» Die Uhr schnurrt, und Roxane sagt: «Sieh doch, Rehe.»
Der Wald war nun zu Ende, und die lange Pappelallee begann. Am Ende derselben wurde das Schloss sichtbar, groß und grau mit seinen geschweiften Giebeln, seinen dicken Säulen und seinem grünen Kupferdache. Auf der Freitreppe stand Böttinger, eine kleine blau und silberne Figur, und wartete.
Vor dem Diner versammelte man sich im grünen Zimmer, das war stets ein hübscher Augenblick, der etwas Festliches hatte. Die drei Mädchen erschienen in weißen Kleidern mit Rosen im Gürtel, Mademoiselle Laure de Bouttancourt, die schwarzlockige Französin, liebte es, sich in helle Seide zu kleiden. Sie unterhielt sich mit dem Grafen Streith, sie bog den Kopf zurück und schaute aus den grellschwarzen Augen kokett zu ihm hinauf. Fräulein von Dachsberg, die Erzieherin, mit den blonden Scheiteln und dem bleichen, geduldigen Gesicht, und der Major standen ein wenig beiseite und sprachen halblaut miteinander. Der Baron Fürwit scherzte mit den Prinzessinnen. Er war Hofmarschall beim Vater der Fürstin gewesen und glaubte hier auch etwas zu sein, war aber wohl nur in das Haus genommen worden, um ihm ein sorgenloses Alter zu bereiten. «Auf Ehre», sagte er, «mir träumte, drei weiße Damen kommen auf mich zu. Ich sage mir, das sind Engel. Sofort denke ich aber auch, wenn die in das Schloss gehen, wie stelle ich sie vor? Wie stellt man Engel vor?» Er lachte, trippelte auf seinen kleinen Füßen und strich seinen schönen, braungefärbten Backenbart. Endlich kam die Fürstin mit der Baronin Dünhof, ihrer Freundin und Gesellschaftsdame, einer kleinen asthmatischen Frau mit einem großen weiß und rosa Gesicht und einer schneeweißen Perücke. Man konnte zu Tisch gehen. Die Fürstin nahm den Arm des Grafen Streith, die drei Prinzessinnen folgten, Baron Fürwit führte die Baronin Dünhof, der Major Fräulein von Dachsberg, Mademoiselle Laure ging allein. «Wenn man zur Tafel geht», hatte Marie einmal zu Mademoiselle Laure gesagt, «sind alle hübsch angezogen, der Tisch, weiß und silbern, sieht aus wie ein Altar, man setzt sich ein wenig fröstelnd hin und wartet auf die guten Sachen, dann freut es einen doch etwas, dass man eine Prinzessin ist.»
«Ah ma pauvre petite!»,3 hatte Mademoiselle Laure geantwortet.
Bei Tische führte der Graf die Unterhaltung. Die Fürstin hörte ihm zu, und man sah es ihr an, sie fühlte sich gut geborgen und gut unterhalten, wenn er sprach. Die Baronin Dünhof und der Baron Fürwit äußerten zuweilen etwas, Fräulein von Dachsberg sprach halblaut mit dem Major, die Prinzessinnen saßen gerade auf ihren Stühlen und schwiegen.
«Ja», sagte der Graf, «gestern war der Baron Üchtlitz bei mir. Der alte Herr schien ganz außer sich. ‹Denken Sie sich›, sagte er, ‹unsere Hilda will fort und etwas leisten. Will sie Kranke pflegen, will sie studieren, will sie Postfräulein werden? Was weiß ich. Sie kann sich zu Hause nicht entwickeln, sagt sie. Haben Sie je gehört, dass zu unserer Zeit unsere Damen sich entwickelten? Nein – aber sie muss fort. Sie sagt, sie wird nicht wie eine Prinzessin zu Hause sitzen und auf eine Krone warten.›»
Das erregte Heiterkeit an der ganzen Tafel. «Sie war mir nie sympathisch», bemerkte die Fürstin, und die Baronin Dünhof meinte: «Schließlich, wenn diese Damen sich entwickelt haben, so weiß die Gesellschaft nicht, was sie mit ihnen anfangen soll.»
«Und es endet gewöhnlich mit einer törichten Heirat», warf Baron Fürwit ein.
Die Baronin nickte und erklärte mit Bestimmtheit, die Frau gehöre in das Haus.
Marie wurde nachdenklich. War Hilda das rote Mädchen auf der Schaukel gewesen, das sich von dem Offizier schaukeln ließ? Sie hatte Hilda immer bewundert, ihre aufgeregten, grauen Augen, die aschblonden Zöpfe und dann, Hilda hatte zuweilen eine Art, über Eltern im Allgemeinen, über den lieben Gott oder über Liebe zu sprechen, dass es einem kalt über den Rücken lief, es war schrecklich, aber doch angenehm erregend. Die Fürstin hob die Tafel auf.
Die Gesellschaft begab sich in den Gartensaal. Hier verhüllten grüne Spitzenschirme die Lampen, die Glastüren standen weit offen, und die Sommernacht füllte den Saal mit ihrem kühlen, süßen Duft. Die Fürstin ließ zwei Sessel an die Türen heranrücken, dort saß sie, neben ihr der Graf. Sie unterhielten sich, der Graf dämpfte seine Stimme, gab ihr einen weichen, singenden Klang, zuweilen hörte man sie zusammen lachen, oder sie schwiegen und schauten in die Nacht hinein. Dann legte die Fürstin wohl flüchtig die Hand auf den Ärmel des Grafen und sagte: «Streith, die Sterne.»
«Ja, hm, die Sterne», erwiderte der Graf und suchte nach etwas Besonderem, das er sagen könnte.
«Eigentlich müssten sie uns nervös machen, diese stets erleuchteten Nachbarhäuser, von denen wir nie erfahren, wer in ihnen wohnt.»
Die Baronin Dünhof spielte mit dem Baron Fürwit Halma, und der Major schaute ihnen zu. Die anderen gingen in den Garten hinaus. Eleonore legte den Arm um Roxanes Taille, und beide wanderten den breiten Kiesweg hinab. Jetzt, da die Trennung bevorstand, hatten sie viel miteinander zu besprechen und konnten dabei einen Dritten nicht brauchen. Fräulein von Dachsberg und Mademoiselle Laure folgten den Prinzessinnen in einiger Entfernung.
Marie fühlte sich ausgeschlossen und vernachlässigt. Was sollte sie tun? Sie ergriff Mademoiselles Arm und zog sie auf einen Nebenweg. «Kommen Sie», sagte sie, «erzählen Sie wieder von der Pension und wie Sie aus dem Fenster stiegen, um mit den Studenten spazieren zu gehen.»
«Ce n’est rien pour les petites princesses»,4 erwiderte Mademoiselle Laure steif.
Das kannte Marie. Wenn die Französin guter Laune war, dann erzählte sie lauter Geschichten, die nichts für kleine Prinzessinnen waren, war sie jedoch traurig und sehnte sich nach dem Vicomte, mit dem sie heimlich verlobt gewesen war und der sie verlassen hatte, dann war alles unpassend.
Gut, Marie ließ sie einfach stehen und schlug einen anderen Weg ein.
«Prinzessin Marie!», hörte sie es hinter sich herrufen, aber sie kümmerte sich nicht mehr darum, jetzt wollte sie einsam und unglücklich sein. Angenehm war es nicht, allein in der Finsternis umherzuirren, aber sie wollte leiden. Die Nacht um sie her war samtschwarz; schaute sie empor, dann flimmerten die Sterne so unruhig, dass ihr schwindelte. Von der Dorfstraße kam noch ein leises Singen und Lachen herüber, ein Wagen fuhr auf der Landstraße, durch die nächtliche Stille hörte man lange sein Rollen, und es gab Marie das Gefühl einer unendlichen, dunklen Weite. Ja, wenn die anderen einen verlassen, dann ist man allein in einer unendlichen, dunklen Weite.
Drüben aus den schwarzen Massen der Parkbäume scholl ein sachtes Rauschen, es wurde unheimlich. Selbst die Blumen, an denen sie vorüberging und die sie an ihrem Duft erkannte, die Rosen und Levkoien, schienen fremd, und wenn sie sich auf sie niederbeugte und sie anfasste, waren sie kalt und feucht und abweisend.
«Prinzessinnen sitzen zu Hause und warten auf eine Krone», das fiel ihr jetzt ein, und sie sprach es laut in das Dunkel hinaus. Das klang eigentlich tragisch, es klang eigentlich unheimlich, sie wusste nicht, warum, aber es klang unheimlich, und mit großen Schritten ging sie dem Hause zu.
Im Gartensaal rüstete man sich zum Aufbruch. Graf Streith verabschiedete sich, und auch die anderen wollten sich zurückziehen, und man bot sich eine gute Nacht. Nur Mademoiselle Laure fehlte, sie streifte noch durch den finsteren Garten und dachte an ihren Vicomte.
Die Prinzessinnen schliefen alle in einem großen, weißen Zimmer. Alles war hier weiß, die Wände, die Betten, die Toilettentische und die vielen Musselinvorhänge. Marie ließ sich von Alwine, der alten Kammerzofe, schweigend und regungslos wie eine Puppe entkleiden. Sie wollte schlafen, sie sehnte sich danach, diesen freudlosen Tag zu beschließen. Wie sie im Bette lag und die Zofe fortgeschickt worden war, saßen Eleonore und Roxane noch beieinander und flüsterten. Marie hörte es dem Tonfall der Stimmen an, dass das Gespräch innig und rührend war, das rührte auch sie. Plötzlich begann auch sie mitzusprechen: «Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum ich nicht mit zur Hochzeit fahren darf.»
«Weil du zu jung bist», antwortete Roxane sanft.
«Zu jung», erwiderte Marie böse, «das ist es nicht. Hochzeiten kann man auch mitmachen, wenn man nicht erwachsen ist. Es ist der Toilette wegen, und das finde ich so unglaublich kleinlich.» Da keine Antwort kam, schloss sie die Augen, allein die Erbitterung ließ sie nicht schlafen. Im Zimmer wurde es still. Eleonore war zu Bett gegangen, und Roxane saß vor ihrem Spiegel, bürstete ihr schönes, schwarzes Haar und schaute in das Licht der Kerzen. Das tat sie allabendlich, und seitdem sie verlobt war, dauerte es oft bis tief in die Nacht hinein. Heute aber erschien Marie diese Gestalt, die unermüdlich über das lange, schwarze Haar hinstrich und dabei in die Ferne starrte, herzbrechend traurig. Sie begann zu weinen.
«Weinst du, Kleine?», fragte Roxane. Sie erhob sich und trat an Mariens Bett heran: «Warum weinst du?»
«Weil du fortgehst», schluchzte Marie, «und weil alles so traurig ist.»
Roxane küsste die Stirn der Schwester: «Schlafe nur», sagte sie, «so ist es nun zuweilen, und dann wird alles wieder gut und lustig.» Damit ging sie zum Spiegel zurück, und Marie drückte ihr Gesicht in die Kissen und weinte, bis sie einschlief.
*
Der Morgen der Abreise nach Karlstadt kam. Für Marie waren die vorhergehenden Tage schon unerfreulich gewesen. Die anderen waren so sehr beschäftigt, man sprach von Toiletten, von Koffern, von der Abfahrtszeit der Züge, nur sie hatte nichts zu tun, sie konnte mit den Erzieherinnen spazieren gehen und allein dem Geschichtsvortrag des Professors Wirth zuhören. Als der Augenblick der Abfahrt kam, hing Marie an Roxanes Halse und weinte leidenschaftlich, aber sie war mit ihrem Schmerze ziemlich allein. Selbst Roxane, von der Erregung der Abfahrt hingenommen, brachte es zu keiner tieferen Rührung. So fuhren sie denn ab. Marie ging in ihr Zimmer, warf sich auf das Bett und schluchzte. Zuweilen kam Alwine, nach ihr zu sehen, stand da und versuchte es, ihr zuzureden: «Wozu das Weinen? Wie lange wird es dauern, und Prinzesschen wird selbst Hochzeit halten.»
Allein das konnte Marie nicht trösten. Zum Frühstück erschien sie mit verweinten Augen, saß wortlos da und ärgerte sich darüber, dass Fräulein von Dachsberg, der Major, Mademoiselle Laure, alle, die sonst bei Tisch zu schweigen oder nur halblaut zu sprechen pflegten, heute eine laute Unterhaltung führten. Nach dem Frühstück ging sie in den Garten hinaus und streckte sich unter dem alten Pflaumenbaum platt auf den Rasen hin. Sie lag ganz still da, die tiefen, beruhigenden Stimmen der Hummeln sangen nahe an ihrem Ohr vorüber, Libellen setzten sich auf ihre Brust, aber sie regte sich nicht, sie lag da wie tot. Ja, das hätte sie denen im Schlosse gegönnt, wenn sie wirklich tot gewesen wäre, gestorben an Vereinsamung und Enttäuschung. Plötzlich fuhr sie auf, die Dühnenschen Jungen mussten gleich kommen. Sie beschloss, die Knaben heute am Gitter zu erwarten, es war unschicklich, sie wusste es, aber gerade das wollte sie. Sie erhob sich und ging, sich am Gitter aufzustellen. Da kamen sie schon, gerade bogen sie auf die Landstraße ein, voran Coco, die Hände voller Kieselsteine, mit denen er nach den Stäben des Gartengitters warf. Als er Marie sah, blieb er verwundert stehen.
«Holla!», rief er, «heute nur eine.»
Auch die beiden anderen Knaben blieben stehen und grüßten.
«Heute allein?», fragte Felix und errötete.
Auch Marie errötete: «Ja», erwiderte sie, «meine Mutter und meine Schwestern sind verreist.»
Da Felix nichts mehr zu sagen wusste, führte Marie die Unterhaltung weiter: «Haben Sie gebadet?»
Ja, sie hatten gebadet.
«Baden Prinzessinnen nicht?», fragte Coco.
Marie antwortete darauf nicht, sondern wandte sich wieder an Felix: «Ist es weit, dort, wo Sie baden?»
«Nein», erwiderte er, «gleich hier um die Ecke auf der kleinen Wiese am Waldrande.»
«Ist es dort schön?», forschte Marie weiter.
«Kennen Sie das nicht?», fragte Felix erstaunt, «Wenn Sie hier über den Weg gehen, sind Sie gleich da», und plötzlich erhellte ein schlaues Knabenlächeln Felix’ sonst so ernstes Gesicht, «wir führen Sie hin», schlug er vor.
«Wie kann ich?», stotterte Marie, und das Herz schlug ihr stärker.
«Nun», meinte Felix, «wir laufen ganz schnell über den Weg und die Wiese hinab, im Walde sieht uns keiner.»
Ein leichter Schwindel ergriff Marie, wie er Menschen ergreift, die sich mit einem plötzlichen Entschluss blindlings in eine große Gefahr stürzen. «Warten Sie», sagte sie und lief zu der kleinen Gitterpforte des Gartens, und dann stand sie auf der Landstraße.
«Sie kommt! Sie kommt!», triumphierte Coco.
«Nun los!», kommandierte Felix, und sie begannen zu laufen. Von der Landstraße bogen sie auf eine kleine, gemähte Wiese ab. Der Boden war dort feucht, bei jedem Schritte gab es ein leise glucksendes Geräusch, und ein wenig schwarzes Wasser spritzte über die Schuhe. Da war auch der kleine Fluss blitzend im Mittagsscheine, umstanden von hohem, grünem Schilfe. Hier roch es nach Wasser, nach Schilf und feuchter Erde. Eine seltsam aufregende Abenteurerluft, dachte Marie. Und endlich waren sie am Waldrande, Marie blieb stehen, legte die Hand auf die Brust und rang nach Atem.
«Tüchtig gelaufen», bemerkte Felix.
Marie versuchte zu lächeln: «Es ist nichts», sagte sie, aber das Weinen war ihr nahe.
«Jetzt können wir langsam gehen», meinte Felix. Bruno und Coco liefen voraus, sammelten Tannenzapfen und warfen damit nach einem Eichkätzchen, das von einem Baume spöttisch auf sie niedersah. Felix ging neben Marie her und machte höflich den Wirt des Waldes. Alte Tannen standen hier mit majestätisch niedergebogenen Zweigen und grauen Moosbärten, weiter fort kam dichtes Unterholz, mächtige Wurzeln schlängelten sich über den Boden, der mit grünem und rotem Moose bedeckt war. Die Sonne sprühte auf den Tannennadeln, und die Luft war schwer von warmem Harzgeruch.
«Ja, mit den Wurzeln muss man sich hier in Acht nehmen», sagte Felix, «man sieht sie nicht, und dann fällt man. Das dort ist eine Eidechse, soll ich sie fangen? Sie hat einen gelben Bauch.»
«Ach nein», bat Marie.
«Oh, sie tut nichts», sagte Felix, «ja, Heidelbeeren gibt es hier auch, aber wir kommen an eine Stelle, da gibt es mehr davon, da können wir uns voll essen.»
Marie blieb stehen und lauschte einem Ton, der durch das Gehölz zu ihr drang. «Was ist das?», fragte sie.
«Das sind die Tauben», berichtete Felix. «Am Morgen, wenn man sich unter einen abgestorbenen Baum stellt und sie lockt, dann kommen sie.» Und Felix begann den Ruf der Waldtauben nachzuahmen.
«Das können Sie gut», sagte Marie bewundernd.
Felix zuckte die Achseln: «Ich kann noch viele Vögel locken», meinte er.
Allerdings, dieser Wald war anders interessant als der Wald, durch den Marie nachmittags mit der Kalesche fuhr oder in dem sie mit Fräulein von Dachsberg, den Lakaien hinter sich, spazieren ging. Und wie zu Hause die Knaben hier waren, Bruno und Coco sprangen umher wie in einer großen Spielstube, und Felix sprach von den Tannen und Eidechsen wie von Kameraden, und es war ihr demütigend, nicht auch zu dem allem zu gehören, sondern hier umherzugehen wie ein fremder Besuch. Jetzt kamen sie an einen kleinen Bach, der sich durch die schwarze Walderde durchwühlte, auch sein Wasser war schwarz, nur hie und da mit einer grünen Pflanzendecke überdeckt. Ein morsches Brett diente hier als Brücke. Coco und Bruno liefen sicher hinüber und ließen das Brett schaukeln.
«Können Sie hinüber?», fragte Felix höflich.
«O ja», antwortete Marie zuversichtlich, aber das Herz klopfte ihr, das Brett war schlüpfrig und schaukelte, sie fürchtete zu fallen, und – dann fiel sie auch schon, stand mitten in dem schwarzen, lauwarmen Wasser, und am Ufer erhoben Bruno und Coco ein lautes Gelächter. Hilfesuchend schaute sie zu Felix auf, aber auch dessen höfliches Gesicht war von einem breiten, höhnischen Knabenlachen verzerrt. Auf einem großen Blatte saß eine dicke Kröte und sah sie starr und verdrießlich an, und über ihr in den Baumwipfeln lachten die Waldtauben.
«Das ist ja wie ein ganz, ganz böser Traum», dachte Marie, und sie begann zu weinen.
Endlich sprang Felix herzu, streckte ihr die Hände entgegen und sagte gutmütig: «Kommen Sie.» Mühsam wurde Marie an das Ufer hinaufgezogen, da stand sie dann, das Kleid schwarz und nass, die Füße schwer von Schlamm. Sie weinte noch immer, und Coco lachte noch immer sein wildes Lachen, Felix aber wurde ernst und nachdenklich. «Das ist dumm, was tun wir?», sagte er. Er besann sich und fasste einen Entschluss. «Bitte, Prinzessin Marie, gehen wir hier hinein», wandte er sich jetzt wieder sehr höflich an Marie und führte sie in das Dickicht an einen kleinen mit Moos und Heidekraut bedeckten Platz, der ganz von jungen Tannen umstanden war. «Bitte es sich hier bequem zu machen», fuhr Felix fort, «hier sieht Sie keiner, hier sind unsere Badetücher, bitte. Ich laufe schnell nach Hause und sehe, ob ich etwas Trockenes erwische. Ich bin bald wieder da, Sie können ganz ruhig sein.»
Damit ging er. Marie ließ sich auf das Moos nieder, sank kummervoll in sich zusammen. Ihr war sehr elend zumute, jetzt hatte sie Gewissensbisse, was würden die zu Hause sagen, aller Mut, alle Abenteuerlust waren gewichen, und sie war nur noch das kleine Mädchen, das fürchtete, gescholten zu werden. Mechanisch begann sie sich die Strümpfe und Schuhe auszuziehen, legte die nassen Röcke ab und hüllte sich in die Badetücher. Der Erregung folgte eine große Müdigkeit und eine dunkle Ergebung. Aus der Ferne hörte sie die Stimmen der beiden Knaben, Coco sang: «Ich habe die Beine der Prinzessin gesehen!» Sie streckte sich auf das Moos aus, über ihr in einem lichtblauen Himmel wiegten sich Tannenwipfel langsam hin und her, um sie an den Zweigen schaukelten sich winzige Spinnen an blanken Fäden, und Meisen flogen lautlos hin und her wie kleine, graue Federknäuel, alles war so beruhigt und sorglos, es war fast demütigend hier zu liegen und ein böses Gewissen zu haben. Der Wald sang seine Töne zu ihr herüber, ein Specht arbeitete unermüdlich irgendwo, und der Eichelhäher stieß zuweilen seinen erregten Wacheruf aus. Marie streckte sich, die Sonne schien jetzt warm auf ihre nackten Füße. Wenn es nicht so schrecklich gewesen wäre, so hätte es gemütlich sein können, dachte sie, griff nach einigen Heidelbeeren, die neben ihr wuchsen, und aß sie. Über ihr auf einem Föhrenzweig ließ sich ein großer, blauer Vogel nieder, ruhig saß er da, und äugte auf Marie herunter. Sie aber empfand es wie eine Ehre, dass der schöne Vogel auf sie wie etwas Bekanntes und Hierhergehöriges herabsah. Sie schloss die Augen, sie dachte nicht mehr an das Schloss und an Fräulein von Dachsberg, das alles schien plötzlich unendlich weit, sie dachte an nichts mehr; ein süßes Daseinsbehagen erwärmte ihren Körper, es war ihr, als wiegte sie sich wie die besonnten Tannenwipfel dort oben im Blau sachte hin und her, oder als würde sie wie die kleinen Spinnen an silbernen Fäden sanft geschaukelt.
Sie wurde von etwas aufgeschreckt, das auf sie niederfiel. Sie richtete sich auf, missmutig darüber, dass sie gestört wurde. In ihrem Schoß lag ein Paket in eine Zeitung gewickelt, und als sie es öffnete, fand sie darin ein Paar Knabensocken und eine reingewaschene blaue Leinwandhose. Ratlos blickte sie die Gegenstände an, dann legte sie sich zurück und begann zu lachen, lachte so, dass es ihren ganzen Körper schüttelte und ihr warm dabei wurde. Das gab ihr neuen Mut. Gut, es ging auch so. Sie zog die Socken an, schlüpfte in die Leinwandhose, legte darüber ihre nassen Kleider an und trat so aus dem Dickicht hervor. Die drei Knaben empfingen sie ernst, gewaltsam hielten sie ihre Gesichter und ihre Lippen in Zucht.
«Nicht wahr, Prinzessin», sagte Felix zeremoniös, «so geht es auch, etwas anderes war nicht zu haben.»
«Oh, ich danke», erwiderte Marie, jetzt wieder ganz Prinzessin, «so ist es sehr gut.»
Sorgsam wurde sie über den gefährlichen Steg geleitet, und auf dem Gang durch den Wald gab Felix Anleitungen dazu, wie sie ungesehen an das Haus gelangen könnte. Er tat das mit der Sachkenntnis eines, der in verbotenen Unternehmungen wohl bewandert ist. Auf der Wiese begannen sie wieder zu laufen, jagten über die Landstraße hin und hielten vor der Gittertüre des Schlossgartens.
«Ich danke Ihnen», sagte Marie jetzt wieder befangen, «es war doch sehr schön.»
«Das machen wir jetzt öfters», meinte Felix, dann trennten sie sich.
Vorsichtig schlich Marie durch die Stachel- und Johannisbeerbüsche, den Buchsbaumhecken entlang, dem Schlosse zu, das noch schweigend in seiner Mittagsruhe dalag. Wäre nicht ihr nasses Kleid gewesen, und die übel zugerichteten Schuhe, sie hätte das eben Erlebte für einen Traum halten können, so unwahrscheinlich erschien es ihr hier mitten in der altgewohnten feierlichen Stille. Ungesehen gelangte sie an die Hintertüre des Schlosses und in ihr Zimmer. Dort klingelte sie nach Alwine, die würde schelten, aber sie nicht verraten. Vordem jedoch zog sie die leinene Hose aus und verbarg sie.
Alwine kam, und als sie erfahren hatte, was geschehen war, schalt sie sehr heftig: «Eine Prinzessin, die sich mit fremden Jungen im Walde umhertreibt, hat man je so etwas gesehen! Es war eine Schande! Das wird eine schöne Königin geben. Ich möchte das Volk sehen, das solch eine Königin will.» Marie musste sich zu Bett legen und ruhig liegen bleiben, Alwine wollte draußen sagen, die Prinzessin habe Kopfweh und dürfe nicht gestört werden.
Als die Alte fort war, schloss Marie die Augen, nein, sie bereute nichts, sie war nur sehr müde und schlief lächelnd ein.
Marie erwachte heiter und erquickt. Sie musste sich zuerst darauf besinnen, was denn Besonderes geschehen war, und dann wusste sie es, in ihr einfaches Prinzessinnenleben hatte sich ein Geheimnis, eine lustige Ungeheuerlichkeit, eingeschlichen, die ihr entgegenkicherte, sobald sie daran dachte. Und sie dachte viel daran. Sie dachte daran, wenn der Baron Fürwit sie zum Diner führte, und sie dachte daran während des Essens, mitten in der Feierlichkeit des Esssaals, vor dem weiß und silbernen Altar des Esstisches, und dann spürte sie ordentlich wieder den Hauch der Moorerde, des Harzes und der Tannen. Abends ging sie mit Mademoiselle Laure im dunklen Garten auf und ab, und Mademoiselle erzählte von der Pension und den Studenten. Als sie schlafen ging, bat sie Alwine, ein wenig bei ihr zu bleiben, denn sie fürchtete sich allein in dem großen, weißen Zimmer. Es war behaglich, vom Bette aus Alwines friedliches Gesicht, mit der großen Brille über den Strickstrumpf gebeugt und von der Lampe hell beschienen, vor sich zu haben.
«Alwine», sagte Marie, «warst du hübsch, als du jung warst?»
«Das weiß ich nicht», erwiderte Alwine verdrießlich, «Prinzesschen soll schlafen.»
Aber Marie fragte weiter: «Alwine, liefst du auch zuweilen mit fremden Jungen in den Wald?»
«So was fragen Prinzesschens nicht», antwortete die Alte.