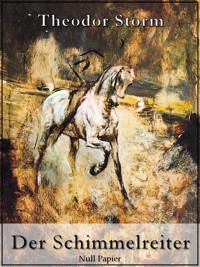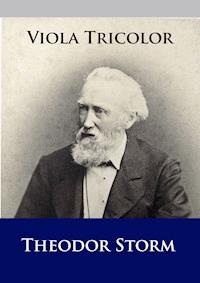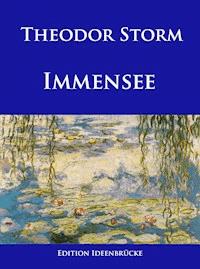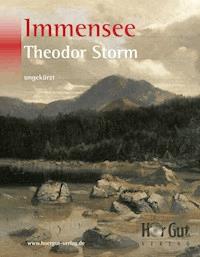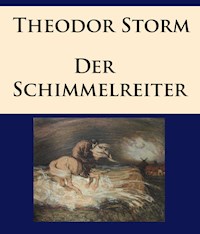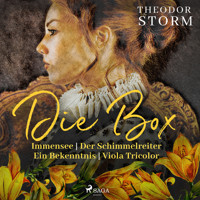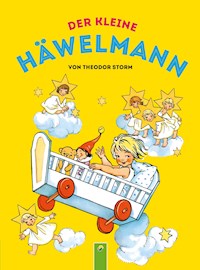3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Noch einmal hab ich schwärmerisch in Mädchenaugen mich vergafft." Er ist ein Meister der Dichtung von Sturm und Wind. In seinen Liebesgedichten aber zeigt sich ein anderer Storm: ein Mann, der sich immer zur falschen Zeit in die richtige Frau verliebt. Und einer, dem die Liebe vor allem eines gibt: unbändige Lebenslust. Schauspieler, Regisseur und Storm-Kenner Hark Bohm hat die schönsten Liebesgedichte für diesen Band zusammengestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 45
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Theodor Storm
Laß mich ruhn in deinem Arm
Die schönsten Liebesgedichte
Ausgewählt und mit einem Vorwort von Hark Bohm
Hoffmann und Campe Verlag
Storm? Theodor Storm? Warum?
Da beißt ein Briefträger einen Hund. Ich reiße meine Frau am Arm:
Guck mal! Guck mal!
Kennen Sie diesen Impuls? Sie entdecken etwas und müssen es unbedingt jemandem mitteilen? Ich habe Storm entdeckt, ich habe Theodor Storms Liebesgedichte entdeckt, und ich muß das unbedingt mit Ihnen teilen.
Nun fragen Sie, was ist das für ein Mann, der erst heute Storm entdeckt. Und was ist da Großes dran, an Storm? Wo ist der Briefträger? Wo der Hund? Sie haben recht. Klar, ich kannte den Namen Storm. Aber wenn ich ihn hörte oder las, schüttelte es mich. Und wieso schüttelte es mich? Um das zu erklären, muß ich zurückschauen.
Die Insel Amrum liegt am weitesten von allen friesischen Inseln draußen im Meer. Für uns Kinder war dieses vom Wasser getragene, vom Horizont umschlossene Stück Land die ganze Welt.
Der eher unangenehme Teil dieser ganzen Welt war mir die einklassige Volksschule in Norddorf. Dort regierte mit seinem Zepter, besser, mit seinem Rohrstock ein Lehrer. Er kam vom Festland, ein Fremder! Und nicht nur das. Normale Leute vom Festland sprachen Friesisch wie wir, auch wenn das ein Festlanddialekt des Friesischen war, den wir kaum verstanden. Oder sie sprachen Plattdeutsch. Nicht ganz so normale Fremde sprachen Hochdeutsch. Dieser Lehrer aber sprach ein Deutsch, das kein Deutsch war. Er sprach Ostpreußisch. Er war Katholik. Die kindliche Grausamkeit findet da schnell einen Reim:
Katholiken,
wie sie quieken,
wenn sie in die Bibel kieken.
Heute weiß ich, das war ein gütiger Mann. Er hatte unter feindlichem Feuer durch Flucht sein Leben retten können; kaum vorstellbar, was er gesehen und hatte ertragen müssen. Er wollte uns, sicher nach bestem Können, nicht nur das Rechnen und das Schreiben beibringen. Wir sollten auch den großen Dichter Nordfrieslands, Theodor Storm aus Husum, kennenlernen. Vermutlich sollten wir stolz auf unsere friesische Kultur werden.
An’s Haf nun fliegt die Möwe,
Und Dämm’rung bricht herein.
Und das mit ostpreußischem Akzent gelesen. Damit hatte der doppelt fremde Fremde endgültig Schiffbruch erlitten. Wenn wir auf der Insel das Wort Möwe hörten, überlegten wir, wo wir ihre Nester finden und ihre Eier klauen konnten. Das war nach dem Winter 1947/48, in dem unsere Steckrüben und Kartoffeln gefroren und noch im Frühling als ekliges Mus auf den Tisch kamen. Da waren Möweneier die reine Delikatesse.
Können Sie sich vorstellen, Sie stehen 1948 als kurzer, dicker Ostpreuße vor der versammelten Dorfjugend einer kleinen nordfriesischen Insel? Vor einer Dorfjugend, deren Voreltern nur durch Härte, auch sich selbst gegenüber, auf dem mageren Stück Land oder auf See überlebt hatten? Die Jugend, die Sie erziehen wollen, sitzt vor Ihnen wie ein Steinwall, steht vor Ihnen mit der Gleichgültigkeit einer Mauer.
Der arme Mann konnte nur reagieren, wie er es gelernt hatte, mit dem Rohrstock. Statt mich ins Werk Storms einzuführen, hat er mir den Storm ausgeprügelt.
War das noch eine im Vorbewußten des Kindes wirkende Austreibung, kam später eine bewußte Verurteilung Storms hinzu. In den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts war uns die Moral der Eltern unerträglich geworden. Sie hatten das Dritte Reich gewollt, zumindest aber nichts dagegen unternommen. Schlimmer noch, sie wollten oder duldeten, daß Wirtschaftsführer, hohe Beamte, Richter, sogar Professoren, die im Dritten Reich ihre Karriere begonnen hatten, auf das Werden der jungen Bundesrepublik entscheidend Einfluß nahmen. Der Bundeskanzler Adenauer hatte den Kommentator der nationalsozialistischen Nürnberger Rassegesetze, Globke, zu seinem Staatssekretär gemacht.
Im Kampf gegen die Werte dieser Welt fanden wir, die Studenten, daß die Nationalsozialisten auch Theodor Storm als Dichter des Deutschen benutzten oder, wie einer schrieb, als den Dichter des »nordgermanischen Naturgefühls. Pfui Teufel, nicht nur »germanisch«, auch noch »nordgermanisch«. Weg damit, auf den Müllhaufen ideologischer Heimatverkleisterung, einfach weg damit!
Im September 2006, vierzig Jahre waren vergangen, hatte mich Arnulf Conradi, der Verleger, nach Sylt eingeladen. Wir wollten dort rastende Zugvögel beobachten. Birdwatching ist unser beider Leidenschaft. Zur Vorbereitung unserer Exkursion suchte ich in ornithologischer Literatur. Ich telefonierte mit meinem Amrumer Vetter Georg Quedens, dem versiertesten Seevogelornithologen, den ich kenne. Und ständig gingen mir dabei zwei Zeilen durch den Kopf:
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her.
Was war das? Was war das?
Sie wissen wahrscheinlich, was ich da zitiere. Ich aber brauchte Tage, um es herauszufinden. Mit diesen Zeilen beginnt die zweite Strophe eben jenes Gedichtes, das in mir versackt war wie ein Wrack im Wattenschlick, im Klei, wie man auf Amrum sagt.
Ich suchte und fand eine Gesamtausgabe von Storm, die meine Frau mal gekauft hatte, weil sie so verführerisch billig gewesen war. Ich hatte vorher nie hineingeschaut.
An’s Haf nun fliegt die Möwe,
Und Dämm’rung bricht herein;
Über die feuchten Watten
Spiegelt der Abendschein.
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her;
Wie Träume liegen die Inseln
Im Nebel auf dem Meer.
Ich höre des gärenden Schlammes
Geheimnisvollen Ton,
Einsames Vogelrufen –
So war es immer schon.
Noch einmal schauert leise
Und schweiget dann der Wind;
Vernehmlich werden die Stimmen,
Die über der Tiefe sind.
Ich lese. Ich bin so aufgeregt wie ein Schwein, das Trüffeln findet. Ich bin so gebannt, ich hätte nicht einmal aufgeschaut, wenn unser Postbote unseren Hund gebissen hätte.
Klar, werden Sie denken, Sehnsucht nach Kindheit, nach Heimat und so weiter. Nein, ich bin häufig auf der schönsten Insel der Welt, Amrum. Da rennt mir meine Kindheit ständig auf der Dorfstraße entgegen, und Heimat ist mir heute dort, wo meine Frau und meine Kinder sind. Auch darüber hat Storm ein intensives Gedicht gemacht.
So komme, was da kommen mag!
So lang du lebest, ist es Tag.
Und geht es in die Welt hinaus,
Wo du mir bist, bin ich zu Haus.
Ich seh’ dein liebes Angesicht,
Ich sehe die Schatten der Zukunft nicht.
Nein, im Gegenteil, nicht die Verklärung von Heimat ist hier von Storm zur Sprache gebracht. Theodor Storm ist kein nordfriesischer Heimatdichter, er ist ein Dichter. Er hat eine Empfindung so in Worte gefaßt, daß unser Gefühl durch Sinn und Melodie in ein Schweben versetzt wird. Andere Leute kiffen vielleicht. Ich lese Gedichte. Haben Sie schon einmal diese Ungewißheit empfunden, wenn das Gewohnte, das Klare weicht und die Angst vor dem Dunkel, vor dem Unüberschaubaren sich anschleicht? Wenn die Furcht vor dem Unbekannten und die Sehnsucht nach Ruhe sich unsicher die Waage halten?
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her;
Wie Träume liegen die Inseln
Im Nebel auf dem Meer.
Und zum Schluß des Gedichtes hören wir:
Vernehmlich werden die Stimmen,
Die über der Tiefe sind.
Kündigt sich da ein Grauen an? Meine Spiegelneuronen rufen aus dem unbewußten Gedächtnisspeicher Erinnerungen wach. Aber ich gerate nicht in Panik wie ein Kind, das im dämmernden Watt die Orientierung verloren hat. Ich genieße auch nicht die Stille, die mich hören läßt, was sonst vom Lärm des Tages überdeckt wird.
Es ist das Beieinander von Sinn, Rhythmus und Melodie der Worte, das mich schweben läßt. Es ist die Ordnung, in die meine aufgerufenen Gefühle durch die Form des Gedichtes gebracht werden. Ich bilde mir beim Lesen ein, ein Wispern zu hören, und genieße den Luxus, es so oder so deuten zu können.
Nicht die Heimat an der Küste interessiert, behaupte ich, den Dichter Storm. Er verwendet seine höchstpersönlichen Erfahrungen von dort, um mittels seines Könnens, seiner Kunst, eine Erinnerung beherrschbar zu machen, eine Erinnerung an die Ungewißheit, die in unser aller Vorbewußtem wirkt, ob wir Hamburger Filmemacher oder Viehzüchter auf den Steppen der Mongolei sind. Einer universellen Empfindung mit Hilfe höchstpersönlicher Erfahrung unter sorgsamer Anwendung des dichterischen Werkzeugs – das sind Wortbilder, Melodie und Rhythmus in Vers und Strophe – einen Ausdruck zu geben, der durch Schönheit fasziniert; das ist das Große an Storm.
Ein anderer Großer, der Schweizer Dichter Conrad Ferdinand Meyer, hat mit seinem Gedicht »Schwüle« einer ähnlichen Empfindung Gestalt gegeben. Seine Heimat liegt um den Zürichsee. Er fand dort seine Bilder.
Was von Stockschlägen eines Lehrers und ideologischen Vorurteilen gewissermaßen ins Watt geprügelt und gestampft war, im Klei versunken, tauchte wie das sagenhafte Rungholt wieder auf.
Ich lerne Gedichte auswendig, weil sie mir so schmecken, daß ich sie, unabhängig von Büchern und Hörbüchern, überall zur Verfügung haben will. Ich lernte also jetzt Storm-Gedichte auswendig.
Nebenbei: Ich entdecke nicht nur, daß Storm keineswegs ein Mann war, der irgendwelche Sehnsüchte nach einem umfriedeten Dasein bedient. Ich lese auch, daß er ein republikanischer Demokrat ist.
Er reibt sich die Hände: »Wir kriegen’s jetzt!
Auch der frechste Bursche spüret
Schon bis hinab in die Fingerspitz’,
Daß von oben er wird regieret.
Bei jeder Geburt ist künftig sofort
Der Antrag zu formulieren,
Daß die hohe Behörde dem lieben Kind
Gestatte zu existieren!«
Er unterstützte 1848 die erste erfolgreiche Revolution auf deutschem Boden, in der die Schleswig-Holsteiner den absolutistischen dänischen König aus dem Land jagten und eine provisorische Regierung in Kiel bildeten. Im Jahr 1852 übernahm der dänische König mit Billigung Preußens wieder die Macht. Storm erhielt Berufsverbot. Er mußte mit seiner Frau Constanze und vier Kindern für zwölf Jahre ins Exil, ins absolutistische Königreich Preußen. Soviel zu meinen Vorurteilen.
Als Arnulf Conradi und ich dann auf Sylt mit unseren Ferngläsern versuchten, Zugvögel zu fassen zu kriegen, den Regenbrachvogel oder die Pfuhlschnepfe aus Lappland, fing ich an, »An’s Haf nun fliegt die Möwe« zu rezitieren, auf dem Deich bei herbstlichem Schmuddelwetter. Und wie stolz war ich, daß ich es, ohne zu stottern, zu Ende brachte. Und welche Überraschung, Arnulf Conradi konnte mindestens so viele Storm-Gedichte wie ich. So gingen wir, Storm rezitierend, durch die Regenböen. Von Zeit zu Zeit stoppte einer von uns mitten im Vers, den Blick aufs Watt gefesselt. Durchs Glas sahen wir graues Geflügel neben dem Wasser herhuschen. Wir kannten seinen Namen. Da huschten Goldregenpfeifer.
Das erzählte ich bei Gelegenheit dem Verleger des Hoffmann und Campe Verlags, Günter Berg. Der fragte mich, ob ich bei ihm Storm-Gedichte herausbringen wolle. Ich hatte noch nicht zu denken begonnen, als er hinzufügte: Liebesgedichte.
Liebesgedichte von Storm? Im erwähnten Wälzer mit Storms Gesamtwerk war ich über die Liebesgedichte immer hinweggeflogen, hatte kaum eins wirklich gelesen. Nun las ich sie. Und nun biß der Briefträger, um das Bild nicht zu vergessen, den kläffenden Mops.
Ich lese also die Gedichte, die Liebesgedichte. Ich bin völlig überrascht. Ich renn zu meiner Frau. Ich zieh an ihrem Arm. Sie muß die Gedichte hören.
Aber weshalb hatte ich sie nicht beachtet? Sie hatten doch vor meinen Augen gelegen.
Das Storm-Bild, das mein Gedächtnis wiedergefunden hat, war ein Foto. Es zeigt einen Mann mit weißem Haar und weißem Bart.
An diesem Rauschebartbild hingen Worte wie »Husum«, »Landvogt«, »Amtsrichter«, »Chorleiter« und »Patriarch«. »Liebe« lockt einen heiteren Heine oder einen lustgeplagten Baudelaire vor mein inneres Auge, keinen nüchternen Storm.
Welch ein Vergnügen fand ich an Storms Liebesgedichten, als sie sich aus dem Zaun meiner Vorurteile befreiten. Wie hatte der Mann, der in ständiger Sorge um seine Familie, ja, um ihr materielles Auskommen, zwölf Jahre in einem quälenden Exil leben mußte, so Großes schaffen können?
Erlauben Sie mir dazu eine kurze kunsttheoretische Spekulation.
Goethe soll gesagt haben, Kunst setze die genaue Beobachtung von Mensch und Natur voraus, ohne sie zu zerstören. Ich möchte das umwandeln, um Ihnen meinen Eindruck von Storms Liebesgedichten zu vermitteln. Seine Liebesgedichte gewinnen ihren Stoff aus der Beobachtung des Menschen als Natur. Ich will sagen, aus der Beobachtung eines Organismus, der sein Leben nur durch Lernen gewinnt, aber gleichwohl den Naturgesetzen unterworfen bleibt.
Kunst, man darf nicht müde werden, es zu wiederholen, gewinnt ihr Eigentliches nur, wenn der Künstler seine emotionale Beobachtung in eine angemessene Form bringt. Diese in Form gebrachte Beobachtung muß den Adressaten überraschen, ihm aber gleichzeitig wahrhaft vorkommen. Er muß dem Künstler glauben. Das kann er nur, wenn der Film, das Lied oder hier das Gedicht in ihm eigene emotionale Erfahrungspartikel abruft. Das Gedicht bringt diese Erfahrungspartikel in eine neue Ordnung. Sie oder ich, Leser oder Hörer, entdecken etwas Neues. Etwas Neues, Ungewohntes zu entdecken versetzt wahrscheinlich jedes Lebewesen in hohe Aufmerksamkeit. So eine Erregung wird aber nur ein Selbstgenuß, wenn wir das Neue gleichsam spontan mit unserer sonstigen Erfahrung abgleichen und als sinnvoll entschlüsseln können. Neu ist, wenn der Postbote den Pudel beißt. In der Neuordnung, der Umkehrung der Verhältnisse – das Opfer wird zum Angreifer –, entpuppt sich ein Körnchen Wahrheit. Das ist des Pudels Kern. Der Mann-beißt-Hund-Geschichte fehlt allerdings die Wahrhaftigkeit und die angemessene Form, daher bleibt sie banal.
Ich spekuliere hier ein paar kunsttheoretische Krückstöcke herbei. Ich möchte Ihnen damit etwas näherbringen, obwohl – das krumme Wortspiel gestatten Sie – so etwas schlecht geht.
Storm ist ein unerbittlicher Beobachter menschlicher Natur, der eigenen und der anderer. Unerbittlich soll nicht heißen, daß er uns nur Tragisches anbietet. Das tut er zwar auch, zum Beispiel wenn er aus der Erfahrung als Amtsrichter sein Erbarmen mit einem straffälligen Mädchen zu Kunst macht.
[…]
Was fang’ ich an!
Für all’ mein Stolz und Freud’
Gewonnen hab’ ich Leid.
Mein Herz ist tief bewegt. Durch die Form, in der eine höchstpersönliche Verzweiflung, gleichzeitig ein universelles Thema für mich empfindbar werden. Die Form ist neu, keine Allegorien, Metaphern oder Gleichnisse mehr. Das ist Realismus, wie Storm ihn wohl so als erster in deutscher Dichtkunst wagte. »Was fang’ ich an!« Hat ein anderer Dichter Verzweiflung genauer auf den Punkt gebracht?
Aber auch die Stormsche Form ist »nur« eine kulturelle und persönliche Variation einer archaischen Grundform, die im Lerntier Homo sapiens sapiens angelegt ist. Storm war, das sei auch gerade in diesem Zusammenhang gesagt, ein radikaler Materialist. Es gibt keine Ordnung, die ein höheres Wesen uns vorgegeben hat. Das archaische Bedürfnis nach einer Ordnung ist genetisch in uns verwurzelt. Wir müssen ihre zeitgemäße und uns entsprechende Form finden. Storm ist in seinem unerbittlichen Beobachten wahrhaftig.
Ich sage bewußt nicht »wahr«. Wahrhaft zu sein ist relativ. Das heißt für mich, seinem durch die Epoche geprägten Gewissen zu gehorchen. Das heißt aber auch zu bekennen, wenn man die von der Moral gesetzten Grenzen verletzt.
Und war es auch ein großer Schmerz,
Und wär’s vielleicht gar eine Sünde,
Wenn es noch einmal vor dir stünde,
Du tät’st es noch einmal, mein Herz.