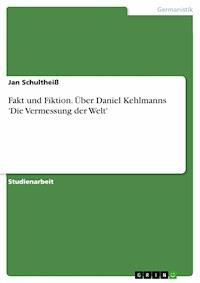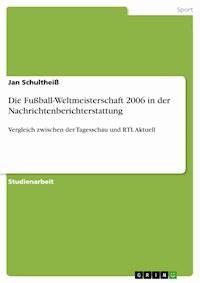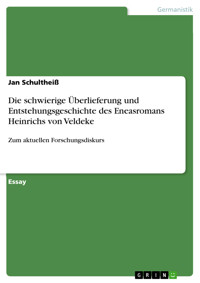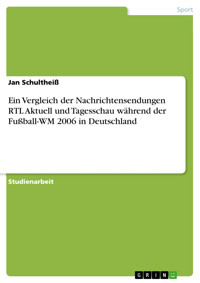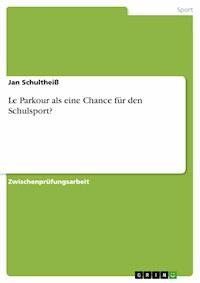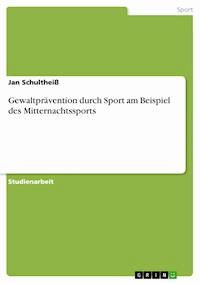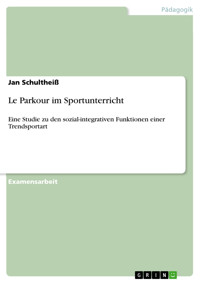
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 2,0, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Sprache: Deutsch, Abstract: „Mittwoch, 11 Uhr 20. Die Schüler eines Tübinger Gymnasiums haben Sportunterricht. Ein ganz normaler Vormittag an der Schule. Die Unterstufenklasse spielt ihr beliebtes Spiel: Völkerball. Die Schüler werfen sich gegenseitig geschickt die Bälle zu, treffen ihre Gegenspieler, versuchen den gegnerischen Angriffen mal mehr, mal weniger erfolgreich auszuweichen, mit dem Ziel, ihrem Team zum Sieg zu verhelfen. Doch da gibt es in der Klasse auch noch Markus, Peter und Maria. Sie spielen auch mit, irgendwie. Sie würden auch gerne ihre Gegner abwerfen, dafür müssten sie aber erst einmal den Ball zugespielt bekommen und das kommt, wenn überhaupt, sehr selten vor. Peter und Maria werden von ihren Mitschülern einfach nicht beachtet, oder schlichtweg übersehen. Markus will von sich aus nicht mitmachen. Das macht die drei zu Außenseitern. Sie sind nicht in die Klasse integriert, auch außerhalb des Sportunterrichts. Ein ganz normaler Vormittag an der Schule.“ Mit der vorliegenden Arbeit wird der exemplarische Versuch unternommen, inwieweit sich gefestigte Strukturen einer Schulklasse (z.B. „Grüppchenbildungen“) lockern lassen, um weniger integrierten Schülern den Anschluss an den Klassenverband zu erleichtern. Dabei soll die Trendsportart Le Parkour die sozial-integrative Triebfeder bilden. Der Aufbau der Arbeit sieht dabei folgendermaßen aus: Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie der Außenseiter, die im Hinblick auf die soziometrische Untersuchung näher betrachtet wird. Nach Überlegungen über Trendsportarten im Schulsport, wird in die Trendsportart Le Parkour eingeführt und ihre Entstehung, „Philosophie“ und Aktualität dargelegt. In einem nächsten Schritt werden mögliche Außenseiter oder Außenstehende einer Schulklasse einer Tübinger Gymnasialunterstufe mithilfe einer soziometrischen Befragung in Form eines Fragebogens erfasst. Gleichzeitig soll anhand der Ergebnisse dieser Befragung die Beziehungsstruktur der Klasse sichtbar gemacht werden. In einem zweiten Schritt werden auf Grundlage der gewonnenen Daten und der vorangestellten didaktisch-methodische Ausführungen Überlegungen für eine Unterrichtseinheit mit dem Inhalt „Le Parkour“ angestellt und über vier Doppelstunden mit der Klasse durchgeführt. Mit diesem Schritt wird dem Sport, insbesondere der Trendsportart Le Parkour, eine sozial-integrative Funktion zugeschrieben, welche es im nächsten Schritt empirisch zu beweisen gilt (...)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 3
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen
Tab. 1: Arten des Parkoursports, S. 19 Tab. 2: Suchergebnisse zum Parkoursport auf der Videoplattform youtube, S. 23 Tab. 3: Grundbewegungen in Le Parkour und ihre Funktionen, S. 24 Tab. 4: Soziometrische Rohdaten der ersten Untersuchung, S. 36 Tab. 5: Einteilung der Übungsgruppen, S. 41 Tab. 6: Soziometrische Rohdaten der zweiten Untersuchung, S. 50
Abb. 1: Abgabe der Wahlen insgesamt, S. 51 Abb. 2: Anteil der erhaltenen Wahlen der ersten Untersuchung, S. 52 Abb. 3: Anteil der erhaltenen Wahlen der zweiten Untersuchung, S. 53 Abb. 4: Mittelwerte der erhaltenen Wahlen, S. 54 Abb. 5: Mittelwerte der gegebenen Wahlen, S. 54
Page 1
1. Einleitung:
„Mittwoch, 11 Uhr 20. Die Schüler eines Tübinger Gymnasiums haben Sportunterricht. Ein ganz normaler Vormittag an der Schule.
Die Unterstufenklasse spielt ihr beliebtes Spiel: Völkerball. Die Schüler werfen sich gegenseitig geschickt die Bälle zu, treffen ihre Gegenspieler, versuchen den gegnerischen Angriffen mal mehr, mal weniger erfolgreich auszuweichen, mit dem Ziel, ihrem Team zum Sieg zu verhelfen.
Doch da gibt es in der Klasse auch noch Markus, Peter und Maria. Sie spielen auch mit, irgendwie. Sie würden auch gerne ihre Gegner abwerfen, dafür müssten sie aber erst einmal den Ball zugespielt bekommen und das kommt, wenn überhaupt, sehr selten vor. Peter und Maria werden von ihren Mitschülern einfach nicht beachtet, oder schlichtweg übersehen. Markus will von sich aus nicht mitmachen. Das macht die drei zu Außenseitern. Sie sind nicht in die Klasse integriert, auch außerhalb des Sportunterrichts. Ein ganz normaler Vormittag an der Schule.“
Mit der vorliegenden Arbeit wird der exemplarische Versuch unternommen, inwieweit sich gefestigte Strukturen einer Schulklasse (z.B. „Grüppchenbildungen“) lockern lassen, um weniger integrierten Schülern1den Anschluss an den Klassenverband zu erleichtern. Dabei soll die Trendsportart Le Parkour die sozial-integrative Triebfeder bilden.
Der Aufbau der Arbeit sieht dabei folgendermaßen aus: Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Theorie der Außenseiter, die im Hinblick auf die soziometrische Untersuchung näher betrachtet wird. Nach Überlegungen über Trendsportarten im Schulsport, wird in die Trendsportart Le Parkour eingeführt und ihre Entstehung, „Philosophie“ und Aktualität dargelegt. In einem nächsten Schritt werden mögliche Außenseiter oder Außenstehende einer Schulklasse einer Tübinger Gymnasialunterstufe mithilfe einer soziometrischen Befragung in Form eines Fragebogens erfasst. Gleichzeitig soll anhand der Ergebnisse dieser Befragung die Beziehungsstruktur der Klasse sichtbar gemacht werden. In einem zweiten Schritt werden auf Grundlage der gewonnenen Daten und der vorangestellten didaktischmethodische Ausführungen Überlegungen für eine Unterrichtseinheit mit dem Inhalt „Le Parkour“ angestellt und über vier Doppelstunden mit der Klasse durchgeführt. Mit diesem Schritt wird dem Sport, insbesondere der Trendsportart Le Parkour, eine
1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes verwende ich das maskuline Genus, meine aber trotzdem beide Geschlechter.
Page 2
sozial-integrative Funktion zugeschrieben, welche es im nächsten Schritt empirisch zu beweisen gilt. Dazu wird nach Ablauf der Einheit die soziometrische Befragung wiederholt, ausgewertet und mit den Ergebnissen der ersten Befragung verglichen, wobei die Unterschiede in der Beziehungsstruktur und im Status des einzelnen Schülers herausgestellt werden. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob sich deutliche Verbesserungen durch eine Le Parkour-Einheit erkennen lassen, oder, ob diese empirisch nicht haltbar sind. In einem letzten Schritt werden die Befunde im Hinblick auf die eingangs gestellte These ausreichend diskutiert und in einem abschließenden Fazit zusammengefasst.
2. Zur Integration von Außenseitern
In folgendem Abschnitt wird der thematische Schwerpunkt auf die Theorie der Integration von Außenseitern gelegt. Dabei wird zuerst der Versuch unternommen eine Definition und eine Typologie von Außenseitern aufzustellen. Es folgt die Erläuterung des Vorhabens, anhand einer soziometrischen Untersuchung Außenseitertypen erkennen und analysieren zu können, um dann die sich daraus ableitenden Möglichkeiten der Integration von Außenseitern darzulegen.
2.1 Definition und Typologie von Außenseitern
Unter einem Außenseiter2versteht man den Typ eines Schülers, der von seinen Mitschülern schlichtweg nicht beachtet, oder besonders häufig abgelehnt wird. Die Außenseiter einer Klasse schließen sich untereinander meist zu einer Gruppe zusammen, die oft in Opposition zum gesamten Klassenverband steht (vgl. Reiß 1969, S. 66).
Der Außenseiter steht wie der Star3in einer Extrem-Position - beide stehen am Rand der Gruppe. Außenseitertypen gelten der Gruppe oft als Ärgernis und werden daher von ihr nach außen gedrängt. Außenseiter können als aggressiv empfunden werden und werden deshalb von der Gruppe meistens abgelehnt, oder schlichtweg nicht
2Der Begriff des Außenseiters oderOutsiderswurde aus dem Bereich des (Wett-)Sports in die Soziologie übernommen. AlsOutsidergilt ein Wettkämpfer mit geringen Siegchancen. Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Pferderennsport.
3Person, die überwiegend positive Wahlen und kaum Ablehnungen von der Gruppe erhält und damit einen (sehr) hohen soziometrischen Status hat.
Page 3
beachtet. Außenseiter können auch von sich aus aufgrund geringen Sozialbedürfnisses so genannte Grenzgänger sein. Man muss deshalb zwischen zwei Typen von Außenseitern unterscheiden, nämlich denjenigen, die nicht gemocht werden und denjenigen, die nicht dazugehören wollen (vgl. Ruppert, 1965, S. 228). Beide Außenseitertypen lassen sich mithilfe der soziometrischen Untersuchung erkennen:
Aus den abgegebenen Bewertungen lässt sich ablesen welcher Schüler von seinen Klassenkameraden häufig abgelehnt wird und welcher Schüler häufig Ablehnungen ausspricht.
Zu beachten ist die Tatsache, dass es nicht den absoluten Außenseiter gibt. Das heißt, dass eine Außenseiterposition, ungeachtet welchen Typs, immer nur gruppenrelativ gesehen und gedeutet werden kann (vgl. 2.2 Soziometrie: Identifikation und Analyse von Außenseitern).
Rehs konstatiert mit Blickwechsel auf den Schulsport einen weiteren Typus des Außenseiters: den leistungsschwachen Schüler. Nach Rehs gelten als Außenseiter zum einen solche Schüler, die von ihren Klassenkameraden abgelehnt bzw. nicht beachtet werden, zum anderen solche, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung dem „Anspruch des Sportunterrichts im motorischen Bereich nur schwer genügen" (Rehs, 1983, S. 27). Zu diesem Außenseitertypus zählen vorwiegend adipöse Schüler, die im Bezug zum Sportunterricht folgendermaßen charakterisiert werden können (vgl. Rehs, 1983, S. 73): Sie treiben in ihrer Freizeit weniger Sport, haben eine schlechtere Einstellung zum Sportunterricht, besitzen geringeres sportspezifisches Wissen, fühlen sich vom Sportlehrer ungünstiger beurteilt als Normalgewichtige und erhalten schlechtere Noten im Fach Sport. In soziometrischen Befragungen erhalten sie weniger Wahlen in Bezug auf die sportliche Leistungsfähigkeit (bspw. Mannschaftswahlen). Eine wichtige Erkenntnis machte Rehs hinsichtlich ihrer sozialen Einstellung. Adipöse seien „in verstärktem Maße durch Desintegration, Rigidität4und Solidarität mit der Autorität“ gekennzeichnet (Rehs, 1983, S. 73).
Eine aktuelle Studie von Heim & Wolf hat in Ansätzen versucht zu erklären, welche Auswirkungen negative Erfahrungen im Sportunterricht auf den leistungsschwachen Schüler haben, indem sie einen Einblick in die Verbreitung und Auswirkungen von sportunterrichtlicher Leistungsschwäche geben (vgl. Heim & Wolf 2008, S. 2). Sie
4Starrheit, Unbeweglichkeit (soziale-)
Page 4
kommen zu dem Ergebnis, dass im Gegensatz zu den vorwiegend kognitivintellektuell ausgerichteten Fächern, Leistungsunterschiede im Sportunterricht weitaus häufiger im Wortsinn „beobachtet“ werden können, da körperlich-motorische Leistungsunterschiede auf offener (Unterrichts-)Bühne für den Lehrer und die Mitschüler sichtbar werden. Egal, ob bei der Turnübung, dem Ausdauerlauf oder dem Spiel - im Sportunterricht versagen leistungsschwache Schüler in der Regel in der Öffentlichkeit der Schulklasse.
Hierzu stellt Lutter fest: „Mithalten-Können ist eine Art Selbstverständlichkeit, Nicht-Mithalten-Können bedeutet an den Rand verdrängt sein, an Ansehen einbüßen, nicht Mitreden dürfen“ (Lutter, 1983, S. 25). Dass eine solche Außenseiterrolle weit über den unmittelbaren Sportunterricht hinausreicht, wird durch Beobachtungen unterstrichen, nach denen leistungsschwache Schüler von ihren Mitschülern bei der Frage nach dem besten Freund in ihrer Klasse seltener genannt werden als andere Schüler (vgl. Rehs, 1983, S. 47). Man kann sogar soweit gehen und behaupten, der Sportunterricht lege gar den „Keim zur Aufsplitterung einer Klassengemeinschaft bzw. zur Diskriminierung schwacher Schüler“ (Storf, 1982, S. 63). Prenner führt Überlegungen zur Sozialisation des „schlechten“, leistungsschwachen Schülers im Sportunterricht aus. Er sieht das Problem darin, dass in den meisten Untersuchungen zum „leistungsschwachen Schüler“, das leistungsschwache Verhalten überwiegend auf individuelle Faktoren zurückgeführt wird: Geringe Bedeutung des Sports in der Freizeit solcher Schüler, mangelnde Motivation, ungünstige körperliche Voraussetzungen, ablehnendes Verhalten gegenüber dem Schulsport, Formen der Angst etc.
Dabei wird aber ein wesentlicher Faktor ausgeklammert, nämlich die Bedeutung der sportunterrichtlichen Interaktionsprozesse, die einen leistungsschwachen Schüler erst „produzieren“. Zu Interaktionsprozessen zählen vor allem Erwartungshaltungen, Zuschreibungsvorgänge (Etikettierung5) und Selbst- und Fremdbeurteilungen (Typisierung). Zur Beschreibung dieser interaktiven Prozesse eignen sich die Theorie des „Symbolischen Interaktionismus“ und der „Definitionsansatz“ (vgl. Prenner, 1976, S. 299). Der Ansatz des „Symbolischen Interaktionismus“ geht davon aus, dass ein Individuum „im Laufe seiner Erfahrungen ein Selbstverständnis und eine Identität entwickelt, die wesentlich durch die Reaktionen signifikanter Bezugsgruppen
5Def.: Prozess, innerhalb dessen z.B. ein Schüler aufgrund bestimmter Merkmale und Verhaltensweisen die Rolle und den Status des Außenseiters zugeschrieben bekommt (Prenner, 1976, S. 299).
Page 5
beeinflusst werden“ (ebd.). Ähnlich sind die Überlegungen des „Definitionsansatzes“, dass keinem Individuum Andersartigkeit oder Abweichung der Norm von vornherein innewohnt, sondern diese Andersartigkeit erst in der Interaktion erzeugt wird. Vor allem in der Schule und im Unterricht finden ständig Zuschreibungen statt. Ein Verhalten, das nicht der Norm entspricht, entsteht meist aus der Unstimmigkeit zwischen den Verhaltenserwartungen der Schule als Institution und dem tatsächlichen Verhalten der Schüler. Diese Abweichung kann sich auf Leistungskriterien und soziale Verhaltensstandards beziehen, denn „der soziale Status eines Schülers bestimmt sich nach den erbrachten Leistungen und dem Kriterium des Erfüllens oder Nicht-Erfüllens der Normen der formellen Schulkultur (Brusten/Hurrelmann nach Prenner, 1976, S. 300). Vor allem im Sportunterricht bestimmen Leistungsprinzip und körperliche Leistungsfähigkeit die soziale Identität von Schülern maßgeblich (vgl. ebd.). Im Rahmen des Sportunterrichts kann daher diese Diskrepanz besonders deutlich zu Tage treten, wenn ein Schüler aufgrund seiner Körperlichkeit und/oder seines sozialen Verhaltens den Anforderungen des Sportunterrichts nicht genügend entspricht. Ihm bleibt oft nur eine Verhaltensweise, die als „abweichend“ definiert wird, um die entsprechende Situation bewältigen zu können. Sein abweichendes Verhalten bestätigt wiederum die vorab erfolgte negative Zuschreibung („Self-Fulfilling-Prophecy“). Häufig verstärkt sogar der Sportunterricht mit seinem Verlauf und seinen symbolischen Ritualen, mit denen Leistungen demonstriert werden (Wettkämpfe, Schulsportfeste, Tests, Benotungen usw.) ein solches Verhalten zusätzlich (vgl. Prenner, 1976, S. 301).