
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nina erwacht aus dem Koma. Sie hatte einen Unfall, daran erinnert sie sich ganz genau - doch ihre Eltern und ihre Freunde widersprechen. Nichts von dem, was sie erzählt, sei wahr. Aber Nina hat Bilder im Kopf, Bilder von einem Berg, einem Haus und einem Jungen, in den sie verliebt ist. Keiner ihrer Freunde weiß, wovon sie spricht. Da steht plötzlich der Junge vor ihr: Arthur. Er kennt Nina nicht, doch all die Erlebnisse in ihrem Kopf treten nun genauso ein, wie sie sich erinnert. Nina kann sich dem gefährlichen Sog von Arthur und den Bildern nicht entziehen … und muss den Unfall verhindern, der ihr in der Erinnerung bereits zugestoßen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Claudia Pietschmann
Leben
RÜCKWÄRTS LIEBEN
Weitere Bücher von Claudia Pietschmann im Arena Verlag: GoodDreams. Wir kaufen deine Träume Cloud
Claudia Pietschmann,1969 in der Mark Brandenburg geboren, verbrachte ihre Kindheit und Jugend inmitten zahlloser Bücher. Sie studierte in Berlin Betriebswirtschaftslehre und arbeitete anschließend als Marketingberaterin und Werbetexterin. Dies ist ihr dritter Jugendroman.
1. Auflage 2018 © 2018 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München – www.ava-international.deCovergestaltung: Alexander Kopainski, unter Verwendung von Bildern von shutterstock.com: © tomertu; © Augustino; © Roman Sigaev; © Elena Terletskaya ISBN 978-3-401-80789-8
Besuche uns unter: www.arena-verlag.dewww.twitter.com/arenaverlagwww.facebook.com/arenaverlagfans
Kapitel 1
Zu viel Platz für neue Gedanken
Meine Hände zittern, als wollten sie ein Bild in die Luft malen. Ein Bild aus Vergangenheit und Zukunft und ich frage mich, ob das alles nicht nur ein total mieser Traum ist. Der Fußboden ist kalt unter meinen nackten Füßen, er flüstert von Vergessen. Ich bin eine Fremde in einem fremden Leben.
Wenn alles, was ich vergessen habe, Platz für Neues schafft, dann habe ich jetzt sechs Monate zusätzlich. Normalerweise kein Grund zum Jubeln, wenn man erst siebzehn ist. Man kann nicht ermessen, wie wertvoll Erinnerungen an ein halbes Jahr irgendwann sein werden. Ich allerdings weiß es genau. Wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen und einfach nicht von der Felswand in die Tiefe stürzen. Dann wären auch meine letzten sechs Monate vor dem Unfall nicht futsch und ich müsste nicht vor dem Spind stehen und sehnsüchtig zu dem schmalen Klinikbett schauen. Es sind nur fünfzehn Schritte bis dorthin, aber ich bin nicht sicher, ob ich sie schaffe. Obwohl ich mit den Krücken mittlerweile ganz gut zurechtkomme, fehlt mir manchmal noch die Kraft. Mein Pyjama hängt wie ein Sack um meinen Körper und ich bin so dünn geworden, wie ich es früher immer gern sein wollte. Fünf Wochen Klinik sind eine fantastische Diät. Auf jeden Fall dann, wenn man vier davon im Koma liegt.
Mit einem leisen Geräusch geht die Tür auf und Laura betritt den Raum. Sie mag ich von allen Krankenschwestern am liebsten, weil ihre Arme von oben bis unten tätowiert sind und das überhaupt nicht zu ihrem Job passt. Wie üblich grinst sie mich an und wirft mir einen Blick zu, der alles Mögliche heißen könnte. Vielleicht möchte sie wissen, ob ich Hilfe brauche. Ich zucke so lässig wie möglich mit den Schultern und schaue ihr dabei zu, wie sie mit großer Geste einen winzigen Plastikbecher auf dem Nachttisch platziert.
»Deine Drogen, Nina. Sieh zu, dass du sie nicht wieder vergisst oder in den Papierkorb leerst oder ins Klo kippst. Du weißt, dass du das Zeug brauchst. In Ordnung?«
»Ja, Ma’am, obwohl mir lieber wäre, wenn endlich irgendwer meinen Akku aufladen könnte«, sage ich und versuche zu salutieren, was gründlich danebengeht. Mit einem Ruck fährt meine Hand zur Schranktür und ich kann mich in letzter Sekunde daran abstützen. Nicht auszudenken, wenn ich vor Lauras Augen das Gleichgewicht verlieren und hilflos auf dem blank polierten Boden liegen bleiben müsste, bis sie mir wieder hochhilft. Drei Mal reicht mir dieses Vergnügen. Ich habe keine Lust, mich wieder der Abordnung der Ärzte zu stellen, die mich zweifellos mit endlosen Fragen bombardieren würden. »Nein, das war kein Kreislaufabfall«, »Nein, mir ist nicht schwarz vor Augen geworden und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Welt um mich herum ihre Konturen verliert«, »Ja, mir geht’s wieder gut. Ich hatte nur kurz vergessen, dass meine Beine zwei Zicken sind. Was aber auch kein Wunder ist, wenn man die Zahl meiner Knochenbrüche bedenkt.«
Was mir genau passiert ist, weiß ich nicht, aber ich träume jede Nacht davon, dass ich an einer Felswand hänge und meine Beine zu zittern beginnen. Mit letzter Kraft gelingt es mir, mich über die Felskante zu schwingen. Und dann stürze ich ab und … Üblicherweise sind das die Momente, in denen ich nass geschwitzt erwache und froh bin, dass es nur ein Traum war. Meine Eltern weigern sich bis heute, mir zu erzählen, was genau passiert ist. Sie sagen, es sei besser für meine Heilung. Und dass sie mich schonen und auf gar keinen Fall aufwühlen wollen. Aber die Ungewissheit ist viel schlimmer als alles, was mir vor fünf Wochen passiert sein kann. Klar habe ich überlebt, aber was ist das wert, wenn ich nicht weiß, was mir passiert ist?
Ein paar Sekunden lang atme ich ganz bewusst tief ein und aus, dann habe ich mich wieder so weit im Griff, dass ich mich zu Laura umdrehen kann. Sie überzieht mein Bett gerade mit frischer weißer Bettwäsche und mustert mich skeptisch. Aber ich kann ihr ansehen, dass sie mich versteht. Auch ihr liegt vermutlich nicht viel daran, während ihrer Schicht die gesamte Belegschaft der Neurochirurgie, der Orthopädie und der Inneren Medizin in Alarmbereitschaft zu versetzen und auf die Station zu rufen. Denn das würde definitiv passieren, wenn ich zusammenbreche.
»Alles gut, wenn ihr mich unbedingt vollpumpen müsst mit euren Drogen. Ist bloß nervig, das Zeug vier Mal am Tag zu schlucken.« Ich grinse und beobachte ihre Reaktion auf meine Worte genau, weil es gut sein könnte, dass ich Blödsinn rede. Keine Ahnung, ob ich die Medikamente drei- oder viermal schlucken muss. Die Angst, bei Dingen zu versagen, die früher normal und einfach für mich waren, ist manchmal so greifbar, dass sie mir ohne Vorwarnung den Hals zuschnürt. Dann kann ich nicht atmen, fühle mich wie gefangen in meinem Körper und schon rollt sie auch auf mich zu: eine waschechte Panikattacke. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und schiebe schnell jeden Gedanken daran fort, wie es mir in diesen Momenten geht. Vielleicht werde ich irgendwann lernen, meine Angst besser zu verarbeiten, jetzt aber kann ich sie nur verdrängen. Gut möglich, dass das falsch ist, aber meine seelische Muskulatur hat momentan keine Lust auf einen Marathon. Also schone ich sie und lasse sie gemächlich spazieren gehen.
Laura schaut mich aufmerksam an, nickt aber verständnisvoll und schüttelt das Kopfkissen auf. »Klar, kann ich gut nachvollziehen. Aber irgendwann kommst du hier raus und dann wird alles gut.«
Sie wirft mir eine Kusshand zu und schließt die Tür hinter sich. Draußen auf dem Gang höre ich sie mit der Frau reden, die uns das Essen bringt. Ich habe keinen Appetit.
Obwohl mich das lange Stehen Kraft kostet, schaue ich wieder in den Schrank und kann mich immer noch nicht entscheiden, welche der Jogginghosen ich anziehe.
Dabei habe ich mich früher nie für Klamotten interessiert oder dafür, was ich anziehe. Mathematik und Algorithmen waren schon eher mein Ding.
Nach einer gefühlten Ewigkeit stakse ich zum Bett zurück, lasse mich langsam darauf sinken und schaue auf meine Beute. Slip, BH, Jogginghose, Hoody, Socken und ein weißes Shirt. Ich glaube, Jogginghosen hätte ich früher nie getragen. Aber vielleicht irre ich mich auch. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, weil gerade gewisse Teile meines Gehirns Urlaub machen und ich bisher vergeblich versuche, sie dazu zu überreden, wieder zurückzukommen. Ich werde nicht aufgeben. Ich habe das Gefühl, jemand wie ich gibt nicht so einfach auf. Auch dann nicht, wenn alles, was in den sechs Monaten vor meinem Unfall passiert ist, einfach aus meinem Kopf gelöscht ist. Ich weiß praktisch nichts mehr. Nothing, nada – und das fühlt sich ziemlich bescheuert an.
Dieser Sturz hat mein Leben in zwei ungleiche Teile geteilt. Im Vorher war alles in Ordnung. Im Nachher bin ich nicht ich selbst, ich fahre auf Autopilot und sollte wahrscheinlich dankbar dafür sein, dass wenigstens der funktioniert.
Zehn Minuten später bin ich endlich fertig und seufze erleichtert. Dennoch fühle ich mich, als wäre ich auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Als Herr Schlader, mein Ergotherapeut, den Raum betritt, ist er offenbar zufrieden, dass ich schon fertig angezogen dasitze und auf ihn warte. Wie immer ist alles an ihm dunkelbraun. Die Aktentasche, die er unter den linken Arm geklemmt hat, die Anzughose und das Oberhemd, dessen Knopfleiste über seinem Bauchansatz leicht offen steht, sodass ich ein weißes Feinrippunterhemd erkennen kann. Selbst die Altersflecken auf seiner Halbglatze sind braun.
»Hast du das alleine gemacht, Nina?«, fragt er, während er aus seiner Aktentasche ein paar Kopien zieht. Eine nach der anderen, schön langsam, wie es zu ihm passt.
»Ja klar«, gebe ich zurück, auch wenn das gar nicht so klar ist. Ich merke, dass ich auf meiner Unterlippe herumbeiße. Dumme Angewohnheiten verliert man offenbar selbst durch Unfälle nicht, die einen fast das Leben kosten.
»Das ist gut.« Schlader rückt seine Brille zurecht, schiebt mir ein Blatt zu und ich würde ihm am liebsten sagen, dass ich noch immer Konzentrationsprobleme habe. Einerseits. Andererseits will ich so schnell wie möglich nach Hause. Und wahrscheinlich schmeißen sie mich früher raus, wenn ich gut zurechtkomme.
Schladers Blick bohrt sich in mich, während ich angestrengt auf das Blatt starre. Im Zimmer herrscht Totenstille und ich muss mich zwingen, die Aufgabe zu lesen.
»Hast du Schwierigkeiten, sie zu verstehen?«
Ich zucke mit den Schultern und beginne zu schwitzen.
»Dann lies sie am besten laut vor. Das hilft manchmal.«
Ich räuspere mich. »Die Mutter des Mannes ist die Schwiegermutter meiner Mutter. Wer ist der Mann?«
Angestrengt versuche ich nachzudenken, aber mein Kopf füllt sich mit rosa Wattebällchen. Sie sind weich und riechen nach Waschmittel. Vielleicht auch ein wenig süß. Ja, das ist besser. Es sind gar keine Wattebäusche. Es sind Marshmallows. Wenn ich in eines reinbeißen könnte, würde es langsam auf meiner Zunge schmelzen und süß schmecken. Es muss an meinem vierzehnten Geburtstag gewesen sein, da haben wir die Dinger über dem Feuer gegrillt. Meine Mutter hat sich geweigert, auch nur davon zu kosten. Papa jedoch … Mein Kopf zuckt hoch.
»Der Mann ist der Vater«, sage ich schnell und hoffe, dass ich richtigliege.
Schlader zieht die Augenbrauen hoch und schreibt irgendetwas in ein braunes Notizbuch. »Das ist gut, das ging ziemlich schnell. Sehr schnell sogar.« Er schaut mich prüfend an. »Du hast doch nicht geraten, oder?«
Ich schüttle den Kopf und fühle mich erbärmlich. »Nein, natürlich nicht, wo denken Sie hin? Es ist doch ganz einfach.« Fieberhaft nachdenkend lege ich mir die Worte zurecht, dann rede ich weiter: »Ich habe einfach überlegt, wer die Schwiegermutter meiner Mutter ist. Das ist zweifellos die Mutter meines Vaters. Also ist der gesuchte Mann der Vater.« Nachdem ich geendet habe, atme ich hörbar aus.
Schlader macht eine weitere Notiz. »Du machst großartige Fortschritte, Nina. Ziehst dich allein an, löst Logikaufgaben in Windeseile. Das freut mich. Ich glaube, ich kann die Empfehlung geben, dich bald zu entlassen.«
Nervös rutsche ich vor bis auf die Stuhlkante. Ich weiß nicht so richtig, ob ich mich über seine Worte freuen soll. Klar möchte ich nach Hause, aber ich komme mir vor wie eine Hochstaplerin.
Alles ist so kompliziert geworden. Jede Entscheidung, die ich treffen soll. Jeder noch so simple Handgriff, jede Aktion. Wenn ich müde bin, fühlt sich sogar meine Zunge schwer an.
Offensichtlich hat Herr Schlader mitbekommen, dass ich gerade nicht so gut drauf bin, denn er greift über den Tisch nach meiner Hand und tätschelt sie väterlich.
»Möchtest du mir sagen, was dir Sorgen bereitet?«
Möchte ich das? Ich weiß es nicht. Schon wieder muss ich mich entscheiden und schon wieder bereitet mir das Kopfschmerzen.
Langsam taste ich nach den richtigen Worten. »Ich fühle mich seltsam, irgendwie orientierungslos, weil ich mich an so viele Dinge nicht erinnern kann. Alles kommt mir fremd vor, als würde es gar nicht mich betreffen … So als wäre mein Kopf noch immer nicht richtig gebootet«, füge ich noch hinzu und spüre, dass das genau das richtige Bild ist, um meinen Kopfzustand zu beschreiben. Das Boot-Menü meiner Festplatte braucht dringend eine neue Einstellung.
Zwar nickt er mir zu, aber trotzdem fühle ich mich unwohl und komme mir vor, als hätte ich mein tiefstes Inneres vor ihm ausgebreitet. Mein tiefstes Inneres, das ich ja selbst nicht mal richtig kenne.
»Ich habe dir schon gesagt, das ist vollkommen normal. Du bist erst vor einer Woche aufgewacht, und das nach knapp einem Monat Koma. Ich habe keine Ahnung, wie viele Knochen du dir genau gebrochen hast, aber man sagte mir, es wären eine ganze Menge gewesen.«
Unbewusst schaue ich runter auf meine Beine, die wegen der beiden Orthesen so aussehen, als würden sie in dick gepolsterten schwarzen Stiefeln stecken.
»Siehst du? Bei deinen Beinen akzeptierst du es einfach. Sie sind gebrochen, man hat sie genagelt, geschient, geschraubt oder was auch immer die Chirurgen damit getan haben. Sie brauchen Zeit zum Heilen, dann kannst du mit Sicherheit wieder ohne diese Dinger und ohne Krücken laufen. Mit deinem Kopf solltest du nicht strenger sein als mit ihnen. Der Sturz hat dein Gehirn ordentlich durcheinandergeschüttelt und du kannst froh sein, dass es keine ernsteren Verletzungen davongetragen hat.«
Ich würde gern wissen, ob er nähere Infos über meinen Unfall hat. Schon gestern habe ich ihn danach gefragt, aber angeblich hat er keine Ahnung. Daher zucke ich nur mit den Schultern.
»Das hätte auch richtig schiefgehen können«, fährt er fort, »du musst Geduld haben. Auch wenn du das Wort vermutlich schon nicht mehr hören kannst.« Er schmunzelt. »Alles wird gut, aber es braucht Zeit. Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Wir alle glauben an dich. Die Schwestern, die Ärzte und natürlich deine Eltern.«
Ganz automatisch balle ich die Fäuste, weil ich es blöd finde, dass anscheinend alle über mich reden statt mit mir.
»Vielen Dank, es ist gut zu wissen, dass alle an mich glauben«, sage ich mit zusammengebissenen Zähnen. »Wissen Sie, wie ich auf die Idee komme, daran zu zweifeln? Vielleicht liegt es daran, dass …« Ich lege eine dramatische Pause ein, ziehe die Stirn in Falten und tue so, als würde ich angestrengt nachdenken. »… ich seit einer Woche ständig untersucht werde und immer noch keiner der Ärzte weiß, woher meine Amnesie kommt. Sie haben mich von oben bis unten durchleuchtet, mich auf den Kopf gestellt und wieder zurück. Aber meine Symptome wollen einfach nicht ins Bild passen. Es ist, als würden Anfänger nach einem Trojaner suchen, der mir eingepflanzt wurde.« Ich weiß, wie ätzend und undankbar ich klingen muss, aber ich habe diese Ungewissheit und die blöden Floskeln einfach satt. Alles wird gut. Wir glauben an dich. Gib deinem Köper Zeit zu heilen. Du wirst es schaffen.
Ich hätte zu gern gesehen, wie er auf meine Provokation reagiert, aber dummerweise klopft es gerade jetzt an der Tür und bevor ich »Herein« sagen kann, wird sie auch schon aufgeschoben.
Ich muss mich nicht umdrehen, ich kann meine Eltern riechen. Es ist der Geruch, der sie umgibt, seit ich denken kann: die Ölfarben, die mein Vater benutzt, und das Fixativ, das meine Mutter über ihre Pastellmalerei sprüht, um die Bilder haltbar zu machen.
Schlader steht auf und ich sehe ihm an, dass ihm die Störung nicht gefällt. Aber da meine Eltern in dieser Privatklinik quasi direkt seine Rechnungen bezahlen (auch wenn ich keine Ahnung habe, wie sie das hinkriegen), muss er die Unterbrechung wohl hinnehmen.
»Frau Wagner, Herr Wagner, wir sind fast fertig. Nina geht es gut, ihre Kombinationsfähigkeit macht große Fortschritte.«
Während er mich mit seinen Lobgesängen preist, schiebe ich den Stuhl zurück, halte mich an der Tischkante fest und stehe langsam auf.
»Oh, das sind so gute Nachrichten, Nina. Du kannst dir nicht vorstellen, wie stolz ich auf dich bin!«, ruft Mama, kommt auf mich zu und reißt mich so abrupt an ihre Brust, dass ich ins Wanken komme. Ich küsse sie auf die Wange und inhaliere den Nitrogeruch, der mich an zu Hause erinnert, dann wische ich über ihr Kinn. Es ist spitz geworden, früher war sie nicht so dünn. Diese Koma-Diät scheint auch bei den nächsten Angehörigen zu funktionieren, schießt es mir durch den Kopf und ich schäme mich für den Gedanken.
»Heute war wohl Grün dran? Lass mich raten? Eine Wiese? Ein Wald – oder was hast du gerade auf der Staffelei?«
Als sie lacht, bilden sich winzige Fältchen in ihren Augenwinkeln. »Tut mir leid, ich hätte wohl mal in den Spiegel schauen sollen, aber wir wollten so schnell wie möglich zu dir.«
Ich drehe mich ein wenig zur Seite, damit ich Herrn Schlader zuwinken kann, der bereits an der Tür steht. Jetzt, wo meine Eltern hier sind, wirkt er wie ein Fremdkörper in diesem Zimmer, das durch meine Eltern auf einmal bunt geworden ist. Papa hat sich auf mein Bett gesetzt und zwinkert mir fröhlich zu. Auch er scheint Pinsel und Palette einfach fallen lassen zu haben, denn er trägt noch immer seinen üblichen blauen Overall, der von bunten Farbflecken übersät ist. Das Grau seiner Haare ist mit winzigen gelben Punkten gesprenkelt. Im Gegensatz zu meiner Mutter hat er sich jedoch offenbar die Zeit genommen, noch kurz das Gesicht zu waschen. Oder vielmehr zu schrubben, wie mir seine geröteten Wangen verraten.
»Geht es dir wirklich besser, meine Süße?«
Ich nicke und angle nach meinen Krücken. Mama springt dazu, reicht sie mir und hilft mir, zum Bett zu gehen.
Ich sehe, dass Papa mich genau beobachtet, und hoffe, dass er mir nicht ansieht, welche Schwierigkeiten ich dabei noch immer habe.
»Toll machst du das schon. Aber ich habe auch nie daran gezweifelt, weil ich immer wusste, dass du es bald wieder hinbekommst.«
Mama öffnet ihren Rucksack, zieht eine Plastiktüte hervor und räumt die Mitbringsel aus.
»Wer soll das denn alles essen?«, frage ich, nachdem sie den kleinen Tisch mit Lebensmitteln vollgeladen hat.
»Ach, so viel ist das nicht. Du bist dünn geworden, du brauchst dringend was Nahrhaftes. Und da waren wir schnell noch einkaufen.«
Die nächste halbe Stunde verbringen wir mit dem, was wir täglich tun, seit ich erwacht bin und sich herausgestellt hat, dass ein Teil meiner Erinnerungen verschwunden ist: Sie erzählen mir Dinge, die ich früher in der Schule erlebt habe, reden über meine Lehrer, über ihre Arbeit, über die Leute, die in unserer Straße wohnen. Meine Mutter sagt, dass Selma angerufen und sich erkundigt hat, wann sie mich mal besuchen kann. Und dass es sich wohl dringend angehört hat. Dringend? Was hat sie mir denn so Wichtiges zu erzählen? Und wann erlauben die Ärzte mir endlich mehr Besuch? Ich habe das Gefühl, hier drin jeden Tag auf neue Dinge zu warten. Als wären meine Wünsche von gestern nicht genug. Als würde irgendeine unbekannte Macht dafür sorgen, dass ich nie zufrieden bin.
Worüber meine Eltern nicht mit mir reden, ist die Tatsache, dass an meinem Computer eine ganze Festplatte einfach zu fehlen scheint. Meine Eltern haben von solchen Dingen natürlich keine Ahnung und tun einfach so, als würde es reichen, wenn sie die Gedächtnislücken mit ihren Erinnerungen füllen. Aber ich sehne mich nach meinen eigenen, weil ich endlich wieder ohne doppelten Boden und ohne Hilfestellung denken will. So wie es jetzt ist, fühlt sich mein Leben an, als wäre es aus zweiter Hand.
Bei diesem Gedanken platzen meine angesammelte Ungeduld und mein Frust der letzten Woche aus mir heraus. »Können wir jetzt aber bitte endlich über meine Amnesie reden? Nicht zu wissen, wie genau dieser Unfall passiert ist, macht mich total fertig.« Ich schaue auf und sehe in zwei starre Gesichter. »Versteht ihr das denn nicht?«, schiebe ich zaghaft hinterher.
Mein Vater verschränkt die Arme vor der Brust, Mama greift nach meiner Hand und drückt sie fest. »Mein Liebling. Das alles ist Vergangenheit. Wir finden: Du hast überlebt und musst nach vorne schauen. Nur darauf kommt es an. Jetzt im Moment zumindest. Deine Erinnerung wird ganz sicher zurückkommen, wenn die Zeit dafür reif ist. Konzentrier dich darauf, dass du ganz schnell wieder gesund wirst.« Sie schlägt diesen künstlich geduldigen Tonfall an, mit dem man kleinen Kindern zum tausendsten Mal die Welt erklärt.
Wäre ich dazu in der Lage, würde ich aufspringen und mit den Füßen aufstampfen. Wenn ich schon wie ein kleines Kind behandelt werde, habe ich das gute Recht, mich auch so zu verhalten.
So aber bleibe ich auf dem Bett sitzen und schaue abwechselnd von einem zum anderen. Die Tatsache, dass meine Mutter erbleicht ist, macht mir weniger Sorgen als das Aussehen meines Vaters. Er sitzt nur da, hat die Lippen zu einem dünnen Strich zusammengepresst und versucht, das Zittern seiner Hände zu verbergen.
Was. Bitte. Ist. Hier. Los? Ich weiß, dass hier irgendwo ein riesengroßer Bug ist, aber ich kriege den Hotfix nicht installiert.
»Es ist nicht gut für dich, wenn du dir immer das zurückwünschst, was du im Moment nicht haben kannst«, bringt er mit gepresster Stimme heraus. »Du weißt, dass du dann …«
Ich schlage mit der Hand auf das Laken und bedauere, dass es nicht einmal ein bisschen knallt. »Ich nehme meine Tabletten. Alle, die sie mir hinstellen. Auch die Beruhigungsmittel. Ich mache die Ergotherapie, die Physiotherapie, lasse die normale Visite, die Chefarztvisite, die EEGs, die EKGs, die CTs, die MRTs und all die anderen Untersuchungen der inneren, neurologischen und orthopädischen Stationsärzte über mich ergehen, ohne mich auch nur ein einziges Mal zu beschweren! Aber das, was mich wirklich verrückt macht, ist diese Ungewissheit. Was soll ich denn tun, wenn ich morgen aufwache und nicht einmal mehr weiß, wer ich bin? Könnte doch passieren, wenn keiner auch nur die geringste Ahnung hat, worunter ich leide. Alle sagen, der Unfall sei schuld, aber niemand findet heraus, was genau mit meinem Kopf nicht stimmt!«
Die Mundwinkel meiner Mutter sinken nach unten, dann ringt sie die Hände und sieht meinen Vater flehend an. Ich ahne, dass er am liebsten in sein Atelier fliehen würde, weil er so immer aussieht, kurz bevor er einfach den Raum verlässt, um sich aus einer Situation zu retten. Ich schlucke, ich möchte ihm keinen Druck machen – und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich in der nächsten Minute platzen werde, wenn er mir keine Antwort gibt. Nun nickt er und beginnt, mir mit gleichförmigen Bewegungen über den Rücken zu streichen.
»Du musst Vertrauen haben, Nina. Bitte. Dein ganzes Leben liegt noch vor dir und es ist allein von dir abhängig, was du daraus machst.«
Seine Worte klingen wie eine einstudierte Rede und ich rücke ein Stück von ihm ab, weil ich seine Berührung gerade nicht ertragen kann.
»Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, mit dieser Angst zu leben. Das war früher nicht so, das muss irgendwas mit dem Unfall zu tun haben. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einen von einem Augenblick auf den anderen Panik überkommt! Ich stehe vor dem Spiegel, schaue mein Gesicht an und habe das Gefühl, mich selbst nicht zu kennen.« Sie sehen mich mit leeren Blicken an, als würden sie meinen Zustand immer noch nicht begreifen. Also lege ich nach. »Immer wenn ich mich anschaue, beginnt das Blut in meinen Ohren zu rauschen und die Welt schrumpft auf dieses eine Geräusch zusammen. Es ist, als gäbe es nichts weiter als mich und das Rauschen. Als säße ich in einer Blase. Dann bricht mir der Schweiß aus, mir wird schwindelig und ich weiß, wenn ich jetzt umkippe, werde ich in die Unendlichkeit fallen. Ins Nichts.« Jetzt habe ich all das gesagt, was ich seit Tagen empfinde, ohne es jemandem anvertraut zu haben. Und augenblicklich tut es mir leid, denn ich sehe ihnen an, wie sehr mein Zustand sie schmerzt.
Mama greift nach meiner Hand und Papa atmet hörbar ein. »Nina, es ist für uns auch schwer. Du bist abgestürzt von diesem Felsen und wir konnten nichts tun. In dem einen Augenblick hast du noch oben auf der Klippe gestanden und eine Sekunde später warst du einfach verschwunden.«
Für einen Moment bin ich wie versteinert. »Ihr wart dabei? Aber in meinen Träumen … Warum habt ihr mir das nicht erzählt?« Ich hasse das Gefühl, nichts zu verstehen, und ich hasse mein Gehirn, in dem alles durcheinanderzugehen scheint. Ich habe so gehofft, dass sie mir irgendwas sagen könnten, das mich beruhigt, aber nun schlage ich die Hände vors Gesicht und kann das Zittern, das meinen Körper durchschüttelt, nicht unterdrücken.
Mama schnellt hoch und geht rüber zum Waschbecken.
»Was erzählt?«, fragt mein Vater.
»Dass ihr auch dort wart, ich dachte …« Ich schlucke trocken.
»Natürlich waren wir da. Wo sollten wir denn sonst gewesen sein?«, ruft Mama vom Waschbecken.
Ich schließe die Augen und höre, wie sie den Hahn aufdreht. Nur wenig später tippt sie an meine Schulter. »Bitte trink einen Schluck und beruhige dich.« Sie hält mir ein Glas hin und ich greife zu.
Das Wasser rinnt wohltuend kühl durch meine Kehle und ich merke erst jetzt, wie durstig ich war. Leise seufze ich und lasse mich gegen Papas Hand sinken.
»Leg dich hin. Das scheint alles etwas viel für dich zu sein. Du bist noch nicht wieder vollständig gesund, Liebling. Wir werden am Nachmittag wiederkommen. Einverstanden?«
Seine Worte schmerzen, weil sie mich wieder auf ein Später vertrösten, aber ich bin so erschöpft, dass ich nur nicke. Als er die Hand wegzieht, sinke ich nach hinten auf das Kopfkissen. Mama breitet die Decke über mich und klemmt sie unter mir fest, so wie ich es mag.
Ich bemerke noch, wie sie sich Blicke zuwerfen, die ich nicht deuten kann. Die Müdigkeit zerrt an mir wie ein Gewicht und ich falle in den Schlaf.
Kapitel 2
Für den Rest meines Lebens
Die Sonne blendet mich, aber ich genieße die Wärme auf meiner Haut. Endlich spüre ich, dass der Frühling da ist. Über mir rauscht es in den Wipfeln der Bäume, Vögel zwitschern, die Szenerie ist fast zu schön, um wirklich wahr zu sein. So muss sich Glück anfühlen, denke ich und schiebe die rechte Hand ein wenig höher, bis meine Finger die raue Felskante umfassen. Ein wenig bröckelig ist das Gestein an dieser Stelle, aber ich bin sicher, dass es mich halten wird. Schließlich bin ich nicht die Erste, die diesen Weg nimmt. Ich recke das Kinn noch ein wenig weiter vor und blinzle gegen die Strahlen an, die dunkle Punkte auf meine Netzhaut brennen. Ich wünschte, ich könnte ewig so verharren und die frische Bergluft atmen. Als meine Oberschenkel zu zittern beginnen, spüre ich, dass meine Kraftreserven schwinden.
»Nina, willst du dort unten Ferien machen? Soll ich dir vielleicht Kaffee und ein Stück Kuchen besorgen oder kommst du endlich?«
Nur mit Mühe kann ich ein Grinsen unterdrücken. Tu viens enfin, hat er gesagt. Mit zusammengekniffenen Lidern schaue ich auf und erkenne nur eine Silhouette, die sich über mir aus dem Gegenlicht schält. Ich würde ihm gern zurufen, dass ich gleich so weit bin, irgendeinen coolen Spruch bringen, aber das Brennen in meinen Muskeln warnt mich davor, noch länger zu warten. Ich atme einmal tief durch, reiße mich zusammen und trete mit dem linken Fuß gegen die Felswand. Dabei schiebe ich meinen Körper langsam Stück für Stück höher, bis ich mir zutraue, die zweite Hand auf die Kante zu legen. Für einen Moment baumeln meine Beine frei in der Luft, während mein Gewicht ausschließlich an den Armen hängt. Meine Finger sind über der Kante gekrümmt, meine Füße suchen unter mir nach Halt. Aber da ist nichts. Ich presse mich flach gegen die Wand und versuche, die aufsteigende Panik wegzuatmen. Du kannst es, rede ich mir ein, aber meine Finger sprechen eine andere Sprache. Ich bin zu schwer, habe zu wenig Kraft, um mein eigenes Gewicht zu halten. Verdammt, was soll ich tun?
»Attention!« Seine Stimme klingt hektisch.
»Ich kann nicht mehr!«, will ich brüllen, aber aus meinem Mund kommt nur ein gepresstes Stöhnen.
Das Verlangen, nach unten zu schauen, um die Höhe abzuschätzen, wird fast übermächtig. Aber ich weiß, dass ich das nicht tun darf. Fast komme ich mir vor wie ein Gecko, der platt an einer Wand klebt. Allerdings fehlen mir die Haftfüße des kleinen Kriechtiers. Und jetzt bräuchte ich sie dringender als je zuvor, denn ich merke, wie sich ohne mein Zutun die Finger meiner linken Hand öffnen. Ganz langsam, fast wie in Zeitlupe lösen sie die Umklammerung der Felskante. Ich kann nichts dagegen tun.
»Bitte, lieber Gott. Bitte hilf mir.« Etwas Heißes, Feuchtes läuft über meine Wangen.
Es duftet nach Frühling, nach dem Regen der letzten Nacht und … nach meinem Schweiß. Er bricht mir aus allen Poren, macht meine Hände rutschig. Nein!
Noch einmal mobilisiere ich sämtliche Energie, suche mit den Füßen nach einem Tritt. Ich brauche nichts weiter als ein paar Minuten, um Kraft zu schöpfen. Dann werde ich die Angst schon wieder los und kann endlich diesen dämlichen Klimmzug über die Kante machen.
Meine linke Fußspitze ertastet etwas, einen Vorsprung, schmal nur, aber er müsste genügen, um einen Moment lang auszuruhen. Ich drehe den Schuh hinein und presse mich noch enger an den Felsen. Der kühle Stein lindert die Hitze in mir etwas. Es fühlt sich gut an, so sicher auf einmal. Ich atme durch, drehe mich ein wenig ein, um das Gewicht zu verlagern, und schwinge meinen rechten Fuß nach oben. Riskant. Aber manchmal muss man im Leben etwas wagen. Manchmal kann man sich nicht nur auf die Dinge verlassen, die man praktisch im Schlaf beherrscht. Manchmal … Ein schwarzer Schatten rast auf mich zu. Er füllt mein gesamtes Blickfeld aus. Dann falle ich.
Ich erwache von meinem eigenen Schrei.
Die Angst pulsiert in meinem Körper, treibt das Adrenalin durch meine Adern wie Öl, das aus einem Bohrturm ins Freie schießt. Dann wird mir klar, dass es ein Traum war. Einer dieser entsetzlichen Albträume, die mich jede Nacht hochschrecken lassen. Es ist immer das Gleiche. Erst dieses schöne Gefühl, draußen zu sein, in den Bergen. Da ist dieser Junge, der zu mir herunterruft. Ich glaube, dass ich ihn kenne, gut kenne. Seine Stimme, sein Tonfall kommen mir vertraut vor, obwohl alles andere wie weggewischt ist. Und dann der Fall. Dieser endlose Fall in die Dunkelheit, der meinen Magen in einen harten Ball verwandelt.
Ruhig atme ich in meinen Bauch, wie es der Therapeut mir beigebracht hat. »Gib deiner Panik einen Namen«, sagte er. Aber das ist lächerlich. Soll ich sie etwa Hildegard nennen oder Jochen? Vielleicht funktioniert diese Methode bei Leuten, die Angst vor Spinnen haben oder vor dem Fliegen oder was weiß ich. Mich aber überkommt die Panik tagsüber einfach so, aus dem Nichts. Keine Ahnung, was sie auslöst. Nur nachts ist es immer derselbe Traum.
Nachts?
Verwirrt öffne ich die Augen. Im Zimmer ist es taghell. Die Sonne wirft weiße Lichtfenster auf das Parkett, die Vorhänge wehen im Wind. Vor meinem Fenster zittern die sattgrünen Baumkronen der Linden. Es ist warm und der Sommer sollte mich eigentlich fröhlich machen und in eine gute Stimmung versetzen. Aber das Gegenteil passiert. Denn dies war keiner meiner üblichen nächtlichen Angstträume. Wird das meine Zukunft sein? Werde ich für den Rest meines Lebens den Unfall immer wieder erleben, sobald ich auch nur die Augen schließe?
Mein Kopf beginnt zu dröhnen, jemand ruft nach mir. Mühsam stemme ich mich im Bett nach oben und versuche, mich zu orientieren. Ich bin so verwirrt, so aufgelöst und verzweifelt, dass ich ein paar Augenblicke brauche, um zu registrieren, dass sich draußen auf dem Flur Leute zu streiten scheinen. Wieder ruft jemand meinen Namen. Ich zucke noch ein Stück nach oben – diese Stimme, ich kenne sie. Aus meinem Traum. Das ist doch … Ein anderer Mann antwortet, aber ich kann durch die geschlossene Tür nicht verstehen, was er sagt. Sein Tonfall ist erst harsch, dann eindringlich.
»Merde!«, brüllt die Stimme aus meinem Traum, dann knallt etwas gegen die Tür, sodass sie erzittert.
Was ist da los?
In mir formt sich ein Gedanke … und plötzlich prallt er wie eine zentnerschwere Betonplatte auf meinen Brustkorb. Meine Rippen ächzen unter dem Gewicht, meine Lunge hat kaum noch Platz, ich bekomme keine Luft. Auch wenn es fast unmöglich ist, versuche ich, ruhig zu bleiben. Es ist nichts,Nina, rede ich mir ein. Alles ist gut. Ein Panikanfall, der vorbeigeht. Nichts weiter.
Ich schließe die Augen in der Hoffnung, dass es besser wird. Aber im Gegenteil. Hitze schießt in meinen Kopf, das Rauschen des Windes in den Bäumen dringt wie durch eine dickflüssige Masse zu mir. Von einem Moment auf den anderen habe ich das Gefühl zu schweben. Alles ist auf einmal leicht. Ich muss mich nicht quälen, muss dieses verdammte Leben nicht führen. Ich muss nur loslassen, nur geschehen lassen, was geschehen soll.
Dann fange ich an zu weinen. Die Schluchzer schütteln meinen Körper, zerren an meinen Rippen. So sehr, dass ich das Gefühl habe auseinanderzubrechen.
Etwas Schweres legt sich auf meine Schulter, drückt sie fest. Den Kopf zu wenden, kostet mich mehr Kraft, als ich vermutet habe.
Doktor Kühnbach sitzt auf dem Stuhl neben meinem Bett. Er ist mein Lieblingsarzt auf dieser Station, weil er viel jünger ist als die anderen Ärzte hier, immer bunte Halstücher über seinem Kittel trägt und total locker ist. Obwohl ich sein Gesicht nur verschwommen wahrnehme, erkenne ich das Paisleymuster seines Halstuches. Blau ist es heute. Die Farbe erinnert mich an den Himmel aus meinem Traum. Ich höre mich keuchen, meine Beine beginnen, unkontrolliert zu zittern. Hört auf damit!, befehle ich ihnen, aber sie gehorchen mir nicht.
»Nina, das ist eine Panikattacke. Du musst dich beruhigen. Hier bist du in Sicherheit.« Er nimmt meine Hand und drückt sie fest.
Seine Stimme verliert gegen das Rauschen des Blutes in meinen Ohren. Die Welt dreht sich um mich, beschleunigt, will abheben und mich mitreißen. Ich bäume mich auf, bis etwas in meinem Brustkorb knackt. Die Wände rücken immer näher, so nah, dass ich die Struktur des Putzes in allen Einzelheiten erkennen kann. Da ist nur noch Schmerz in mir. Alles tut so weh, als würde jemand versuchen, meinen Körper in eine viel zu kleine Kugel zu pressen. Ich will schreien, aber ich kann nicht. Mit letzter Kraft richte ich den Blick auf Kühnbach, der auf einmal am Ende eines langen dunklen Tunnels steht.
»Nina, beruhige dich, atme tief ein und aus.« Seine Worte dringen aus weiter Ferne zu mir. Auf ihrem langen Weg verlieren sie die Bedeutung.
Mein Herz rast. Schnell. Schneller. Zu schnell. Ich bin sicher, dass es jeden Augenblick aussetzen wird. Mein Körper gehört nicht mehr mir, er zuckt unter den Händen des Arztes. Mir bleibt nur, dabei zuzuschauen.
»Nina, wenn du dich nicht beruhigen kannst, muss ich dir etwas spritzen. Das Risiko ist zu groß, dass du bleibende Schäden zurückbehältst. Da sind Dinge in deinem Kopf … Verletzungen … Kannst du mir sagen, was dir solche Angst macht?«
Ich will nicken. Natürlich kann ich das! Mein Gehirn formt Worte, will sie an meinen Mund weiterreichen, aber die Zunge … Meine Zunge fühlt sich an wie ein schwerer Klumpen. »Gestoßen«, presse ich schließlich heraus.
»Meinst du deinen Unfall?«
Ich versuche zu antworten, bin aber nicht sicher, ob es mir gelingt. Am liebsten würde ich weglaufen. Aus diesem Zimmer, aus der Klinik. Irgendwohin, wo keine Menschen sind, die mir die Luft zum Atmen nehmen.
»Niemand hat dich gestoßen, Nina! Du bist gefallen, deine Eltern waren dort. Sie haben gesehen, dass du das Gleichgewicht verloren hast.«
Ich reiße die Augen auf. Will ihm sagen, dass das nicht stimmt. Da war dieser Junge in meinem Traum. Den ich kenne, dem ich vertraut habe.
Wie ein Axtschlag spaltet ein heftiger Schmerz meinen Schädel. Dann fühle ich ein Stechen in meiner Armbeuge. Kalte Flüssigkeit rinnt in mich und ich spüre, wie sie sich ihren Weg durch meinen Körper bahnt. Jeder Zentimeter, den die Droge zurücklegt, erleichtert mich. Ich lasse mich fallen, schäle die Angst von mir, bis endlich auch der Schmerz nachlässt. Die Dunkelheit umfängt mich wie eine weiche Decke. Sie duftet nach Blumen und nach Gras. Sie ist die Luft, die ich so dringend gebraucht habe. Sie ist meine Rettung.
Kapitel 3
Flüchtende Gedanken
Meine Finger umfassen die raue Felskante – Sonnenstrahlen. Schwarze Punkte auf meiner Netzhaut, für immer eingebrannt. Ferien machen, Kaffee, Kuchen. Kühnbach mit seinem bunten Tuch, eine Spritze in der Hand. Zitternde Oberschenkel in kühler Bergluft, die nach Frühling riecht und nach Regen. Schwarze Schatten mit zuckenden Armen, die auf mich zurasen. Unter mir die Unendlichkeit, die auf mich wartet. Ein Schrei!
Als ich erwache, ist Kühnbach noch immer da. Er steht am Tisch und blättert in meiner Akte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, auf jeden Fall aber genug, dass er sich umgezogen hat.
Noch immer zeichnen Sonnenstrahlen Muster auf den Boden, aber sie haben sich verändert. Genau wie der Geruch im Raum und auch die Luft fühlt sich anders an. Ruhiger. Ich bin ruhiger. Ich strecke meinen Arm aus und angle nach dem Handy auf meinem Nachttisch, doch ich rutsche ab und es fällt mit einem leisen Scheppern runter. Mist.
Kühnbach schnellt herum. Dann lächelt er und sieht mich dabei nachdenklich an.
»Hallo Herr Doktor, was für ein Hammerzeug haben Sie mir gespritzt?« Ich spüre, wie ein Grinsen meine Mundwinkel auseinanderzieht. Schon lange habe ich mich nicht mehr so erholt und beschwingt gefühlt. Stünden die beiden Krücken nicht genau in meinem Blickfeld, würde ich vermutlich aufspringen, auf den Flur hinauslaufen und die Welt umarmen.
»Nina, du bist wach.« Er schaut zur Tür. »Wie geht es dir?«, fragt er, als er sich neben mich setzt, meine Hand nimmt und den Puls fühlt.
»Sehr gut«, sagt er schließlich zufrieden und steht auf. »Kaum zu glauben, aber dein Puls hat sich komplett normalisiert. Wenn es dir gut genug geht, könntest du ein wenig aufstehen. Was meinst du? Soll ich dir Schwester Laura schicken?«
Als ich nicke, seufzt er erleichtert.
»Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das blaue Tuch hat mir besser gefallen.« Er schaut mich verständnislos an, dann hebe ich die Hand – die sich schwer und leicht zugleich anfühlt – und deute auf das grün gemusterte Tuch, das er umgebunden hat.
Mit einem Ruck fährt seine Hand hoch und er löst den Knoten. »Was meinst du?«
»Nichts weiter, nur, dass das grüne Tuch Ihnen nicht so gut steht. Vorhin trugen Sie das blaue. Das passt besser zu Ihren Augen.«
Hastig stopft er das Tuch in die Kitteltasche und stürmt ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer. Ehe ich mich wundern kann, warum es Kühnbach so verunsichert, dass ich was über seine Kleidung gesagt habe, kommt Laura rein. Ihr Lächeln ist strahlend wie immer und gibt mir sofort neue Energie.
»Super siehst du aus. Ich habe gehört, du bist in unseren Zaubertrank gefallen!«
»Keine Ahnung, was der Doc mir gegeben hat, aber das war der beste Trip ever. Hätte nichts dagegen, wenn Sie mich ab sofort täglich so wegbeamen würden.« Laura weiß, dass das nur ein Spruch von mir ist, trotzdem zieht sie einen imaginären Stift hinterm Ohr hervor und schreibt sich eine Notiz auf den ebenfalls unsichtbaren Zettel in ihrer Handfläche.
Dann fällt mir alles wieder ein. Die Ursache der Panikattacke … wie ein dumpfer Schlag in die Magengrube ist die Beklemmung für einen kurzen Moment wieder da. Ich stöhne auf und schiebe das Gefühl zur Seite. Langsam strecke ich die Beine aus, drehe mich zur Seite und lasse sie über die Bettkante hängen.
Laura greift unter meine Achsel und stützt meinen Rücken. »Bleib erst mal einen Augenblick so sitzen, bis sich dein Kreislauf stabilisiert hat, sonst wird dir noch schwindelig. Hast ja lange genug gelegen.«
So lange war es ja gar nicht, will ich erwidern, als mir tatsächlich kurz schwarz vor den Augen wird. Ich presse die Finger gegen meine Schläfen und zwinge mich, ruhig zu atmen.
»Kann es weitergehen?«
»Ja.«
Mit ihrer Hilfe schaffe ich es, so weit vor zur Bettkante zu rutschen, dass meine Zehen den Boden berühren. Eilig schiebt Laura mir meine Crocs zu und ich schlüpfe hinein. Dann werfe ich einen Blick auf die Krücken und sie versteht sofort, denn nur einen Augenblick später hat sie sie schon geholt und hält sie mir hin, sodass ich sie nur noch nehmen und mich darauf stützen muss.
»Willst du dich für ein paar Minuten an den Tisch setzen?«, fragt Laura und schaut auf die Uhr. »Bald müsste der Nachmittagskaffee serviert werden.«
Ich schüttle den Kopf. »Ich möchte nur kurz aus dem Fenster schauen.« Meine Stimmung ist gerade so gut und ich habe Sehnsucht danach, draußen zu sein, mein Gesicht in die Sonne zu halten und ihre Wärme zu spüren.
Nur wenig später stehen wir nebeneinander am Fenster. Laura öffnet es weit und ich bin verblüfft. Der laue Wind, der nun meine Nase umspielt, trägt den Duft einer Blumenwiese mit sich. Ich sehe Tulpen, Gänseblümchen und Löwenzahn, die Linde trägt winzige Knospen. Blätter, die gerade beginnen auszutreiben. Die Baumkrone ist nicht mal ansatzweise grün. Aber das ist unmöglich.
Offenbar hat Laura meine Verwirrung bemerkt, denn sie greift nach meinem Oberarm. »Ist dir nicht gut? Alles in Ordnung?«
Ich spüre eine Gänsehaut am ganzen Körper und ahne, dass sie nicht allein vom Wind kommt. »Ich weiß nicht, es ist seltsam. Aber die Luft, die Sonne, die Knospen an den Bäumen … Das alles erinnert mich an den Frühling.«
Ihr Lachen klingt hell. »Scharf kombiniert! Das liegt wahrscheinlich daran, dass April ist. Aber heute haben wir wirklich Glück mit dem Wetter. Noch gestern war es unfassbar hässlich und regnerisch draußen.«
April? Wie kann das sein? Ich schwanke, aber sie stützt mich sofort.
»Willst du lieber wieder ins Bett? Ist vielleicht doch ein wenig viel für dich?«
Obwohl mir klar ist, dass ich meine Entlassung damit nicht unbedingt beschleunige, nicke ich. Auf einmal scheint mich alle Energie verlassen zu haben. Mühsam schleppe ich mich zum Bett und lasse mich schwer daraufsinken. Laura hilft mir, mich richtig hinzulegen, dann setzt sie sich auf den Stuhl, der neben dem Kopfende steht.
»Was ist los? Eben noch warst du gut drauf und auf einmal bist du wieder blass und wirkst unendlich müde.«
»Ach. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass es total bescheuert klingt.«
Sie zuckt aufmunternd mit den Schultern. »Versuch es einfach.«
»Ich bin irgendwie verwirrt. Vorhin … da hatte ich doch einen Panikanfall. Dann bin ich aufgewacht und Doktor Kühnbach saß am Bett.«
Ihre Augen verengen sich und sie zuckt wieder mit den Schultern. »Ist alles so weit normal. Kein Grund, verwirrt zu sein.«
Keine Ahnung, warum ich auf einmal das Bedürfnis habe, ihr alles zu erzählen. Kurz schaue ich auf die geschlossene Tür und hoffe, dass meine Eltern nicht gerade jetzt hereinplatzen werden. Dann hole ich Luft. »Mein Kopf.«
Laura mustert mich prüfend. »Das ist normal. Du hattest diesen Unfall. Ein paar deiner Knochen waren gebrochen, dein Kopf hat auch ziemlich was abbekommen. Aber glaub mir, das wird wieder heilen. Du brauchst ein wenig Zeit, aber dann wirst du vollständig wieder gesund werden.«
Mein Zeigefinger fährt die Falten in der Bettdecke entlang. »Das sagen alle. Immer wieder. Ich würde es gern glauben, aber es wird jeden Tag schlimmer.«
Mit einem Stirnrunzeln schaut sie mir in die Augen. »Wie meinst du das?«
Kraftlos lasse ich den Kopf sinken. »Ich kann mich an meine letzte Panikattacke erinnern. Und daran, dass um mich herum alles schwarz wurde. Aber ich erinnere mich auch, dass ich vorher aus dem Fenster schaute und die Luft nach Sommer roch, irgendwie wärmer, sonniger.« Ich höre mich selbst und weiß, wie bescheuert und esoterisch das klingt. Aber es ist die Wahrheit.
»Sommer?« Ihr Gesicht ist ernst geworden.
»Ja Sommer. Außerdem trug Doktor Kühnbach vorhin ein blaues Halstuch und jetzt ein grünes«, sage ich lauter, damit sie endlich versteht, warum ich gerade fast durchdrehe.
Laura seufzt. »Mach dir keine Gedanken. In deinem Gehirn gehen die Dinge etwas durcheinander. Stell dir vor, dein Kopf wäre ein Mixbecher. Alle wichtigen Dinge sind drin, aber sie wurden ein wenig durchgeschüttelt und müssen erst wieder sortiert werden.«
Ich kann ein Stöhnen nicht unterdrücken. »Aber ich kann mich an so viele Dinge überhaupt nicht erinnern. Ich versuche es ständig, aber da ist nichts. Egal, wie sehr ich mich konzentriere, es ist einfach verschwunden. Mein Cache scheint komplett gelöscht zu sein.«
»Aber …«
Ich rede weiter, plötzlich sprudeln die Worte nur so aus mir heraus. »Ich träume immer wieder davon, dass ich abgestürzt bin. Dass ich klettern war, mit einem Jungen. Dieser Traum fühlt sich echt an … so richtig echt, als würde ich mich daran erinnern. Und dieser Junge …« Es ist das erste Mal, dass ich es jemandem erzähle. Klingt es genauso verrückt wie in meinem Kopf, wenn ich es laut ausspreche? Zögernd schaue ich Laura an, die mich ausdruckslos mustert – nicht entsetzt, nicht ungläubig, nicht bemitleidend. Ich gebe mir einen Ruck und spreche weiter: »… er ist so vertraut, wir gehen miteinander um, als würden wir uns schon ewig kennen. Meine Eltern behaupten aber, ich sei mit ihnen zusammen gewesen, als der Unfall passierte.« Ich seufze. »Das passt alles nicht.«
Laura lächelt mich breit an. »Oh, ich wusste gar nicht, dass du einen Freund hast. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er dich hier schon einmal besucht hat.«
Besucht hat – Lauras Worte klingen in meinen Ohren nach und auf einmal hämmert wieder dieser Schmerz in meinen Schläfen. Wie soll ich ihr erklären, dass ich glaube, dass er da gewesen ist? Aber war er das wirklich? Was, wenn ich mich irre? Wenn ich mir das alles nur einbilde? Ich weiß ja noch nicht einmal, wie er heißt oder wie er aussieht. Aber es gibt ihn, da bin ich mir ganz sicher.
Tief hole ich Luft. »Ich habe vergessen, wie er aussieht. Wenn ich die Augen schließe und ihn mir versuche vorzustellen, dann ist da nichts. Gar nichts. Verstehen Sie jetzt, warum ich mich so entsetzlich fühle? Ich muss doch wissen, ob ich einen Freund habe oder nicht! So etwas vergisst man doch nicht! Stattdessen besteht mein Leben nur noch aus Fragen, auf die ich keine Antworten habe.«
Schwester Laura steht auf, geht rüber zu dem kleinen Pult und blättert in meiner Akte, wie es vorhin Kühnbach auch getan hat. »Hier stehen keine Einzelheiten zu deinem Unfall. Frag am besten deine Eltern, was passiert ist, vielleicht kommen dann deine Erinnerungen zurück.«
Aber das habe ich schon. Was ist, wenn stimmt, was sie sagen? Dann stand ich auf einer Klippe und habe auf einmal das Gleichgewicht verloren. In meinem Traum bin ich aber gefallen, noch bevor ich oben auf der Klippe angekommen war. Auch das passt nicht zusammen. Die Gedanken beginnen, in meinem Kopf umherzuwirbeln wie Schneeflocken im Sturm.
Ich schließe die Augen und schlucke trocken. »Wie soll ich es jemals schaffen, mir über das, was passiert ist, klar zu werden, wenn ich nicht einmal in der Lage bin, die Informationen zu ordnen, die ich habe?«
Laura zieht die Stirn in Falten und tippt mit dem Finger auf ihre Nasenspitze. »Ich bin kein Therapeut …«
»Die können mir auch nicht helfen«, unterbreche ich sie.
Laura redet weiter: »… vielleicht ist es nicht das Richtige, aber ich bilde mich gerade weiter und muss ständig für irgendwelche Prüfungen lernen. Das fiel mir schon als Kind in der Schule total schwer, weil ich nicht in der Lage bin, Infos zu strukturieren. Aber weißt du, was mir dabei hilft?«
Ich zucke mit den Schultern.
Sie dreht eine Strähne ihres dunklen glatten Haares um den rechten Zeigefinger, beugt sich vor und sagt: »Die Methode nennt sich Gedächtnispalast.«
Lauras Stimme ist so nah bei meinem Ohr, dass ich zusammenzucke. »Gedächtnispalast? Was ist das?«
Laura legt den Kopf schief. Sie sieht aus, als würde sie angestrengt nachdenken. »Ich arbeite zwar schon seit einiger Zeit damit, aber ich weiß nicht genau, wie ich es am besten erklären soll«, sagt sie schließlich. »Damit kann man das Gedächtnis trainieren. Ich habe es aus dem Internet gelernt. Vielleicht kannst du selbst mal schauen, ob …«
Nein, nein, nein! Sie kann mich doch jetzt nicht am langen Arm verhungern lassen. »Ich habe keinen Computer hier und auch kein Internet.«
Sie spreizt die Finger und presst die Spitzen vor ihrer Brust zusammen. Die Gelenke knacken ein wenig. »Okay, dann im Schnellkurs.« Sie zwinkert mir zu. »Das System beruht auf der Loci-Methode. Sagt dir das was?«
Ich schüttle den Kopf. »Nie davon gehört.«
»Macht nichts. Auf jeden Fall geht es um das Faktenwissen, um Verknüpfen von Informationen und um die Verbesserung der Gedächtnisleistung.«
»Wow, das klingt genau nach dem, was ich gerade dringend brauche«, sage ich und setze mich bequemer hin.
»Jeder baut sich seinen eigenen Palast und legt die Dinge, die er bereits weiß, in den einzelnen Räumen ab.«
Ich hebe die Hand. »Stopp. Ich soll einen Palast bauen? Wie soll das gehen?«
Sie lacht, dabei blitzt eine Reihe weißer Zähne zwischen ihren Lippen auf. »Der Palast, den du errichten sollst, existiert nur in deinem Kopf. Ein versteckter Ort für all deine dunklen Geheimnisse. Verstehst du?«
Okay, ein Palast in meinem Kopf. Das klingt machbar … wie so ein Luftschloss, ein Fantasiegebilde. »Und dann?«
Sie hebt die Arme und gestikuliert in der Luft, als würde sie Wände hochziehen und ein Dach errichten. »Wie gesagt. Du entscheidest, wie der Palast aussieht, wie er aufgebaut ist, wie viele Räume er hat, welche Möbel drinstehen und das ganze Drumherum. Alles deine Entscheidung.«
»Es gibt also keine Vorgaben?«
»Eigentlich nicht. Du musst nur beachten, dass du vorher planst, wie viele Räume du brauchst. Wenn dein Palast erst mal steht, ist es schwierig, ihn um weitere Zimmer zu ergänzen. Klar, oder?«
Ich nicke. »Ist ja im echten Leben nicht anders.«
»Genau. So musst du dir das vorstellen. Der erste Schritt ist, den Palast zu entwerfen und die Räume zu planen. Wenn du das hast, geht es weiter. Dann legst du das, was du schon weißt, in den einzelnen Räumen ab. Damit organisierst du praktisch dein Wissen. Kannst du mir folgen?«
In meinem Kopf entwickle ich gerade das Bild einer Burg, die ziemlich düster und wehrhaft aussieht. Ein paar Türme aus grauen Steinen, ein tiefer Graben, der sie vor Feinden schützt, ein Verlies für die Menschen, die meine Welt unsicher machen.
»Der Palast sollte unbedingt so sein, dass du dich in ihm wohlfühlst. Er sollte Geborgenheit ausstrahlen, dir Wärme und Sicherheit geben.«
Ich wische mein Gedankenbild fort. Da werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen. »Muss ich erst mal drüber nachdenken.«
»Kein Problem, mach das ganz in Ruhe. Ich erkläre dir nur das Prinzip, soweit ich es kann. In Ordnung?«
Ich nicke und warte ungeduldig darauf, dass sie fortfährt.
»Wenn du die einzelnen Räume hast, gibst du jedem eine Funktion. Das ist ja in normalen Häusern auch so. Die haben einen Flur, eine Eingangshalle, ein Wohnzimmer, mehrere Schlafzimmer, die Bibliothek, ein …«
»Echt?«, falle ich ihr ins Wort und muss grinsen. »Sie haben eine Bibliothek zu Hause?«
Sie lächelt zurück und winkt ab. »Nee, aber meine Eltern früher. Da standen Bücherregale, ein bequemer Sessel zum Lesen und der alte Schreibtisch meines Vaters mit einer Stiftablage aus Jade. Die hat er mal auf dem Flohmarkt gekauft.«
Jade – das klingt so nach China und irgendwie auch mystisch. Laura ist noch nicht so alt, aber es fällt mir trotzdem schwer, sie mir als Kind vorzustellen. »Bei uns zu Hause gibt es nicht so viele Bücher, jedenfalls keine Romane. Meine Mutter sammelt Kunstbände.«
»Ja, ich habe schon gehört, dass sie beide malen. Ich beneide dich darum.« Vermutlich sieht sie mir meine Verblüffung an, denn sie sagt: »Ich wäre gern in einem kreativen Zuhause aufgewachsen.«
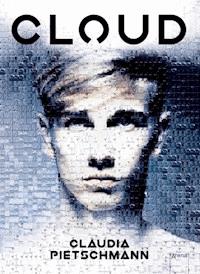















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












