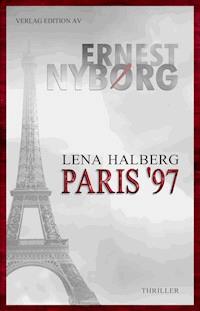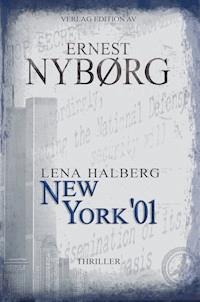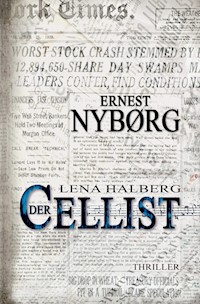Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Edition AV
- Sprache: Deutsch
Ernest Nybørg Lena Halberg: London '05 Thriller Die Profiteure des Terrors Der dritte Teil der Trilogie über die Verflechtungen von Politik, Geheimdiensten und Rüstungsindustrie Der Mann hastet auf den Bahnsteig hinaus. Zu spät – der Zug rollt gerade aus der Station am King's Cross. Wenige Sekunden später erschüttert ein dumpfes Geräusch den Bahnsteig. Es kommt von der Bombe, die in der Piccadilly-Line detoniert war. Die Journalistin Lena Halberg recherchiert zehn Jahre später für eine Story und entdeckt Fakten, die ihre ungeheure Vermutung bestätigen: London war nur einer von mehreren Anschlägen, zwischen denen eine Verbindung besteht. Ihre Nachforschungen führen sie bis zu einem Forschungsinstitut in Haifa. Hatte der israelische Geheimdienst damit zu tun oder war es ein Einzeltäter? Als Lena versucht die Schuldigen ausfindig zu machen, landet sie in der gefürchteten 'Facility', einem Gefängnis der militärischen Aufklärung. Kaum dem Verhör entkommen, nimmt sie die Spur wieder auf. Doch die führt zurück nach England, wo sich erneut ein ungeheuerliches Ereignis anbahnt. Nybørg blickt hinter die Kulissen des Terrors -eine dichte Mischung aus Fakten und Fiktion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernest Nybørg
Lena Halberg
LONDON ‘05
Thriller
Edition AV
Zum Buch
Der Mann hetzt auf den Bahnsteig – zu spät. Der Zug rollt gerade aus der Station am King's Cross. Sekunden später zerreißt eine Bombe den Triebwagen der Piccadilly-Line.
Die Journalistin Lena Halberg recherchiert für eine Story und entdeckt Fakten, die ihre ungeheure Vermutung bestätigen: London war nur einer von mehreren Anschlägen, zwischen denen eine Verbindung besteht. Ihre Nachforschungen führen sie nach Potsdam und in ein verdecktes Labor in Haifa. Hatte der israelische Geheimdienst mit der Sache zu tun?
Als Lena versucht, die Schuldigen ausfindig zu machen, landet sie in der gefürchteten Facility, einem Gefängnis der militärischen Aufklärung.
Kann sie dem brutalen Verhör rechtzeitig entkommen und den Wahnsinn aufdecken? Die Spur führt zurück nach England, wo sich wieder ein ungeheuerliches Ereignis anbahnt.
Zum Autor
Ernest Nybørg studierte Musik und Literatur. Als Drehbuchautor schrieb er viele Jahre erfolgreich für Film und Fernsehen. Mit spannungsgeladenen Thrillern, die reale Geschehnisse als Hintergrund verarbeiten, erweiterte er seine schriftstellerische Tätigkeit auf das Gebiet der Kriminalliteratur. Hier erkennt man seine Leidenschaft für menschliche Abgründe und eine sichere Hand für das Genre.
London ‘05 ist der letzte Teil der Lena Halberg Trilogie über die Verflechtungen von Politik, Geheimdiensten und den Rüstungskonzernen. Die beiden ersten Teile – Paris ‘97 und New York ‘01 – sind ebenfalls im Verlag Edition AV erschienen.
Nähere Infos unter www.ernestnyborg.com
Cip-Titelaufnahme der deutschen Bibliothek:
Nybørg Ernest; Lena Halberg: London ‘05
ISBN 978-3-86841-131-7
Die Spekulationen rund um die Anschläge auf die U-Bahn-Linienin London im Jahr 2005 liegen der Idee zu diesem Buch zugrunde.Trotzdem handelt es sich um ein rein fiktionales Werk, das keinetatsächliche geheime Verschwörung enthüllt. Sämtliche Figurenund Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit echtenPersonen oder Geschehnissen ist zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Auflage
© 2017, Copyright by Verlag Edition AV, Lich/Hessen
© 2017, Copyright by Ernest Nybørg, Wien
Literar-Mechana Austria, Reg.: 2017/7285
Alle Rechte vorbehalten
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg (Fotokopie, Mikrokopie usw.) zu vervielfältigen oder in elektronische Systeme einzuspeichern, zu verarbeiten oder zu verbreiten.
Lektorat/Korrektorat: Kerstin Thieme
Umschlag, Buchgestaltung, Satz: Ernst Kaufmann
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
Das Buch wurde vermittelt durch die Literaturagentur
erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Wer Terror nur aus den Medien kennt,
glaubt, er wäre davon nicht betroffen.
Inhalt
Cover
Titel
Zum Buch/Zum Autor
Impressum
Zitat
2005
Heute
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Facts
Weitere Bücher
2005
Diffuses Licht fiel aus den grünlichen Mattscheiben der Notbeleuchtung auf den dunklen Bahnsteig. Tom stand regungslos und keuchte schwer, sein Puls raste. Schwarzer Rauch schlug ihm entgegen, die Luft war drückend heiß. Er hatte plötzlich keinen trockenen Faden mehr am Körper und presste sein Taschentuch vor Nase und Mund.
Ein Zusammenstoß, dachte er und versuchte etwas zu erkennen, zwei Züge müssen frontal aufeinandergeprallt sein.
Nur Sekunden nach Abfahrt des Zuges, die letzten Lichter der U-Bahn waren eben in der schwarzen Röhre verschwunden, drang ein schweres, ohrenbetäubendes Geräusch auf die Plattform. Das massive Dröhnen wurde unmittelbar von einem dumpfen Schlag begleitet, der den Bahnsteig erschütterte und sich an den Betonwänden in einem erstickten Ton brach. Alle Wartenden zuckten erschrocken zusammen und duckten sich instinktiv. Augenblicklich war es auch stockdunkel, die Rolltreppen stoppten. Normale Störungen, Stromausfälle oder seltsame Geräusche war man in der überalterten Anlage gewohnt, nur dieser grobe Laut war anders gewesen – etwas Ungeheures musste geschehen sein.
Nach der gespenstischen Stille entlud sich der Schock der Menschen in einem Gewirr an Stimmen und Geräuschen – Männer riefen nach ihrer Partnerin, Kinder begannen leise zu weinen, jeder versuchte sich zu orientieren, hielt sich unbewusst am Nachbarn fest, eine Lautsprecherdurchsage mahnte zur Ruhe.
Tom lehnte sich fest gegen eine Wand, suchte an einem Mauervorsprung Halt. Zwei Leute streiften ihn unsanft, einer davon trat ihm mit voller Wucht auf die Füße. Tom stöhnte auf, der andere murmelte etwas und drängte weiter. Eine Frau rief einen Namen, jemand rannte im Dunkeln, suchte nach dem Ausgang, stürzte. Wieder eine Durchsage mit der Aufforderung ruhig zu bleiben.
Endlose Minuten später flackerten die Neonröhren und das Licht ging an. Die Menschen blickten verstört um sich, verließen panisch die Station nach draußen, fuhren mit den Rolltreppen, die mit einem Signal wieder anliefen, nach oben. Nur weg aus dieser Unsicherheit! Viele wollten hastig telefonieren und versuchten, ein Netz zu finden. Einige Männer standen vorgebeugt am Rand des Tunnels. Sie starrten in die Finsternis, aus der das donnernde Geräusch gekommen war, versuchten zu erkennen, was geschehen sein könnte, gestikulierten heftig.
Wenn es ein Unglück gegeben hatte, woran kein Zweifel bestand, musste man versuchen zu helfen. Bis Rettungskräfte von draußen kamen oder die Feuerwehr zur Stelle war, würde es für Schwerverletzte zu spät sein.
Er ließ die schützende Plakatwand los, kämpfte sich gegen den Strom der flüchtenden Menge nach vorn zur Bahnsteigkante. Kurz verständigte er sich über einen Zuruf mit den Männern auf der Plattform, sprang hinunter auf die Gleise und lief in den Tunnel hinein. Zwei aus der kleinen Gruppe folgten ihm. Es gab gerade genügend Licht, um nicht zu stolpern. Hinter ihm in der Station sprang ein Alarm an, der pulsierend bis in sein Gehirn schrillte.
Bereits nach wenigen Metern begann es nach verbranntem Gummi oder ähnlichen Stoffen zu riechen – unangenehm, scharf, beißend. Im Halbdunkel tauchten undeutlich die Umrisse eines Waggons auf. Er stand leicht seitlich geneigt auf den Schienen, die Scheiben waren geborsten.
Personen torkelten aus den Rauchschwaden auf Tom zu. Ein Mann trug einen Feuerlöscher in den Händen, damit hatte er die hintere Scheibe des Wagens eingeschlagen, um aus dem Zug zu kommen. Die Frau dahinter blutete aus einer klaffenden Kopfwunde, sie stöhnte, während sie an Tom vorbeilief. Ein junger Bursche, der am ganzen Körper zitterte, packte Tom an den Schultern.
»Weg, weg!«, schrie er dabei mit vor Angst überschnappender Stimme. »Eine Explosion, es war eine Explosion, vorn sind alle tot!«
Tom schob ihn zur Seite und hastete weiter bis zum Zug. Die Männer aus der Station, die Augenblicke zuvor noch hinter ihm waren, sah er nicht mehr. Vielleicht halfen sie den Entgegenkommenden oder sie waren aus Furcht, es könnte weitere Detonationen geben, umgekehrt. Er sah in den letzten Wagen hinein. Die Menschen dort schlugen mit verschiedenen Gegenständen die restlichen Scheibensplitter aus dem Fensterrahmen, um einigermaßen unverletzt hinausklettern zu können.
Die helfen sich schon selbst, dachte Tom und lief weiter. Durch den Geruch war ihm ziemlich übel, er hustete in das Taschentuch und presste es noch fester vor den Mund. Nicht schlappmachen, trieb er sich an, die Leute brauchen Hilfe.
Am vorderen Ende des Zugs sah es verheerend aus. Eine andere U-Bahn war nicht in Sicht, es war also kein Zusammenstoß gewesen. So wie die aufgerissene Längsseite des ersten Waggons aussah, musste es tatsächlich eine Explosion gegeben haben. Tom schlitterte über zerbrochenes Sicherheitsglas, das den öligen Betonboden wie feuchter Rollsplitt bedeckte. Er konnte nur mit knapper Mühe einen Sturz abfangen. Dabei trat er auf ein scharfes Metallstück, das in die Höhe schnellte, sich durch die Hose in sein Schienbein bohrte. Er schrie auf, riss das Teil heraus, schmiss es zur Seite und humpelte weiter.
Das Loch an der Seite des Wagens war riesig. Ganze Teile der Wand fehlten, die Aluminiumplatten der Verkleidung hingen zerknittert in den verbogenen Metallverstrebungen, so als wären sie aus dünner Folie. Stücke der Inneneinrichtung lagen herum, ein bunter Plastiksitz ragte aus einem der Fenster, eine halbe Handtasche baumelte daran. Tom schaute über die abgerissene Schiebetür ins Innere des Zugs und prallte zurück. Direkt vor ihm lag ein Mann verdreht am Boden. Die Augen starrten Tom aufgerissen an, ein Arm fehlte. Das Blut hatte eine große Lache gebildet, rann unter dem Körper weg, tropfte aus den Resten der Türverankerung auf die Gleise. Tom schob den Toten ein Stück zur Seite, atmete schwer durch und kletterte in den Wagen hinein.
Vorne hatten einige der nur leicht Verletzten die Tür zur Führerkabine aufgebrochen und sprangen angsterfüllt über die Armaturentafel hinaus in den Tunnel. Von dort liefen sie entsetzt über das Erlebte zur nächsten Station am Russel Square. Manche schüttelte es wie in Weinkrämpfen, andere wieder tasteten sich stumm vor Schrecken die Tunnelwand entlang.
Denen, die unmittelbar rund um das zerrissene Wagenteil lagen, war nicht mehr zu helfen. Tom sah sich um, es ekelte ihn fürchterlich – überall Leichenteile, zerstörte Körper, Schuhe, Taschen, angesengte Kleidungsstücke. Die massiven Stahlplatten des Bodens waren nach unten gebogen, so als hätte eine zornige Riesenfaust hineingeschlagen. Überall war Blut. Von irgendwoher kam ein Laut wie ein unterdrücktes Weinen. Tom sah sich um – es war nicht festzustellen woher, nichts rührte sich. Er taumelte einige Schritte, wie über ein Schlachtfeld, durch den Waggon zur zweiten Tür, oder was davon übrig war. Waren die leisen Töne von dort gekommen, lebte abseits der größten Zerstörung noch jemand?
Neben der hinteren Türöffnung lag eine Frau, das war an weißen Jeans und einer am Fuß steckenden Sandale zu erkennen. Ihr Bauch war aufgerissen, es sah aus, als wäre er von innen heraus explodiert, der Darm hing in Fetzen aus dem offenen Fleisch, es stank fürchterlich. Tom schlug sich die Hand vor den Mund, als er an dem Körper hochsah – die Hälfte des Gesichtes fehlte, aber über der Brust erkannte er die blutigen Reste eines hellgelben Sommertops.
Das war die Frau mit dem Mädchen an der Hand gewesen. Sie erschraken, als sich die Türen schlossen und Tom – der gelaufen kam und nicht mehr stoppen konnte – gegen die Scheibe prallte. Dann sahen sie sein verdutztes Gesicht und winkten ihm lachend. Vor Tom blitzten für eine Sekunde die heiteren Augen der Frau auf, die ihm zugelächelt hatten. Wäre er nur zehn Sekunden früher dran gewesen und hätte die U-Bahn noch erreicht, läge er jetzt neben der Frau. Tom traf der Gedanke wie ein Schlag in die Magengrube. Er wandte sich ab und übergab sich mehrmals.
Als er wieder hochblickte, sah er etwas Rotes, ein Stück Stoff. Eigentlich fiel es ihm nur auf, da die Farbe grell aus dem ganzen Dreck hervorleuchtete. Die Puppe, durchzuckte es Tom, die Puppe, die das Mädchen zuvor in der Hand hielt, mit der sie ihm gewunken hatte! Er überwand seinen Abscheu und stieg mit einem Fuß über den Körper der Frau, um an den Kunststoffteil heranzukommen, hinter dem die Puppe hervorschaute. Er hob ihn an – da lag das Mädchen. Es war nicht bei Bewusstsein, es atmete und wimmerte leise. Das war der Laut, den Tom gehört hatte. Auf der Brust unter ihrem Hals war eine große blaurote Schwellung, einer ihrer Arme sah aus, als wäre er mehrfach gebrochen und von der Stirn sickerte Blut aus einer Wunde in die blonden Haarlocken. Aber sie war am Leben, der Teil der Plastikwand hatte sie anscheinend wie ein Schild geschützt.
Tom sah, dass ein Trenchcoat zwischen zwei verbeulten Sitzen steckte. Er riss ihn heraus und legte ihn auf den Boden. Ganz behutsam fasste er das Mädchen mit beiden Händen und zog es unter dem Wandpaneel hervor. Den gebrochenen Arm presste er an den kleinen Körper und achtete darauf, nicht auf die Schwellung zu drücken. Tom hatte keine Ahnung, ob er das überhaupt machen durfte, der Erste-Hilfe-Kurs in der Fahrschule war verdammt lange her. Trotzdem hob er die Kleine über die Leiche – wobei er vermied, in das halbe Gesicht der Frau zu blicken – und legte sie sachte auf den Mantel. Er wickelte sie fest ein, um den Arm zu stabilisieren und ihre Wunde vor dem ätzenden Rauch zu schützen. Die rote Puppe, die ihn auf das Kind aufmerksam gemacht hatte, packte er dazu. Danach stieg er vorsichtig aus dem Trümmerfeld hinunter auf die Gleise und turnte über die herumliegenden Blechteile zurück zum hinteren Ende des Zugs.
Fahrgäste in anderen Waggons, an denen er vorbeimusste, hämmerten mit den Fäusten gegen die Fensterscheiben, um sich bemerkbar zu machen. Tom versuchte vergeblich, mit der freien Hand eine der Schiebetüren aufzubekommen. Er fand keinen Notmechanismus, die Rahmen waren verzogen und ließen sich kein Stück bewegen. Tom deutete den Passagieren beruhigend, dass bald Hilfe käme. Dann ließ er sich mit dem verletzten Mädchen im Arm nicht weiter aufhalten und rannte zurück Richtung King’s Cross.
Diese verdammten Röhren, dachte er im Laufen bitter, der Wahnsinn des Massentransports. Drei Millionen Passagiere fuhren täglich stundenlang durch die vierhundert Kilometer langen Tunnel der Underground, die in einer Hassliebe nur als The Tube bezeichnet wurde.
Als Tom die Plattform erreichte, herrschte ziemliche Ratlosigkeit. Nachdem sich der Schrecken gelegt hatte, standen jetzt jede Menge Neugierige herum, die sich lautstark darüber unterhielten, was geschehen sein könnte. Mehrere Polizisten gingen auf und ab, versuchten den Bahnsteig zu räumen. Sie sprachen über Funkgeräte mit Einsatzkräften, denen sie einen Lagebericht gaben, während sie die gaffenden Leute zu den Ausgängen wiesen. Die Signale standen alle auf Rot. In regelmäßigen Abständen kam eine Durchsage, dass der Verkehr auf der Linie aufgrund eines Stromausfalls unterbrochen sei und der Bereich deshalb geräumt würde. Auch auf allen Infoscreens der weitläufigen Doppelstation blinkte die Anzeige, man möge die Station verlassen.
»Stromausfall«, murmelte Tom vor sich hin, »das sagen sie nur, um eine Panik zu vermeiden.«
Zwei Bahnbeamte in Uniform kamen ihm entgegen. Schon von weitem riefen sie, was er hier mache, welche Befugnis er habe, einfach in den Tunnel zu laufen. Glücklicherweise gäbe es einen Stromausfall, meinten sie, sonst hätte er sich verletzt, das Betreten sei gefährlich und für Zivilpersonen bei Strafe verboten.
In Tom stieg ein unbändiger Zorn über so viel Bürokratie und Engstirnigkeit auf.
»Lächerlich!«, fuhr er sie an, ohne stehen zu bleiben. »Das war kein Stromausfall! Den vorderen Waggon der U-Bahn hat es komplett zerrissen, in den Trümmern liegen jede Menge Leichen.«
»Erzählen Sie keine Märchen«, gab einer der Beamten zurück. Er zitierte einen Paragraphen aus der Bahnverordnung über das Betreten von Geleisen.
Tom zeigte empört auf das bewusstlose Mädchen. »Glauben Sie, das macht ein Stromausfall? Wenn ich nicht das verletzte Kind tragen müsste, würde ich euch zwei Idioten auf der Stelle mit einer saftigen Beschwerde bei eurem Vorgesetzten abliefern!«
Wütend schloss Tom noch einige grobe Bemerkungen an. Er merkte, wie gut ihm das Schreien tat, es befreite ihn von seiner eigenen Spannung und machte der Beklemmung Luft, die ihm seit dem Anblick der vielen Toten in der U-Bahn die Kehle förmlich abschnürte.
»Kommen Sie, ich helfe Ihnen!«, rief jetzt ein Herr vom Bahnsteig herunter, der die Szene beobachtet hatte. Er streckte Tom hilfreich die Hände entgegen. »Lassen Sie die beiden Hohlköpfe stehen.«
Tom wich den Beamten aus, warf ihnen aber einen feindseligen Blick zu. Die beiden sagten noch etwas, aber er hörte gar nicht mehr hin und ging zur Kante der Plattform. Der Mann am Bahnsteig fasste ihn beim Arm und zog ihn hoch. Er trug trotz der Hitze einen Anzug. Als sich ein Ärmel des Sakkos hochschob, fiel Tom eine Tätowierung am Handgelenk des Mannes auf, die wie ein Armband mit mehreren feinen Linien rundum lief.
Schöne Arbeit, dachte Tom, der schon öfter überlegt hatte, selbst auch ein Tattoo zu tragen. Gleichzeitig wunderte er sich darüber, dass er in dieser Situation überhaupt an so eine Belanglosigkeit denken konnte.
»Danke«, sagte er und atmete durch.
»Keine Ursache«, antwortete der Fremde, »brauchen Sie etwas? Soll ich versuchen, die Rettung anzurufen?«
»Nein, besten Dank«, gab Tom zurück. »Ich habe selbst ein Mobiltelefon, aber hier unten gibt es kein Netz. Ich schaue, dass ich oben einen Arzt finde.«
»Sie sind doch der, der sofort nach dem Knall in den Tunnel lief, um zu helfen«, stellte der Mann anerkennend fest. »Was ist mit dem Kind?«
»Ich weiß es nicht. Es war eingeklemmt, hat zum Glück aber die Explosion überlebt.«
»Explosion?« Der Fremde schaute überrascht. »Dann sind die Durchsagen über dem Stromausfall falsch?«
»Ganz sicher«, gab Tom zurück, »oder reißt ein Stromausfall die ganze Seitenwand eines U-Bahn-Wagens weg?«
Der Fremde schüttelte den Kopf.
Tom bedankte sich, drehte sich um und eilte weiter zu den Rolltreppen.
»Viel Glück für Sie und das Kind«, hörte er den Fremden noch hinter sich sagen. »Würden alle Menschen solchen Respekt vor dem Leben anderer haben, wäre vieles nicht nötig.«
Tom fand die Bemerkung übertrieben, aber zumindest war der Mann hilfreich gewesen, nicht so wie die beiden lächerlichen Bahnbeamten mit ihren Vorschriften. Er wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß aus dem Nacken, während er kurzatmig zum Ausgang hastete.
Die Rolltreppe war überfüllt. Tom fühlte sich in dem Gedränge unwohl. Anfang Juli stand die Luft bereits am Morgen aufgeheizt zwischen den Betonmauern und mischte sich mit den stickigen Abgasen des dichten Berufsverkehrs. Der warme, säuerliche Geruch der Menge, mit dem Aroma unterschiedlicher Sorten billiger Deo-Sprays, machte es nicht erträglicher.
Mit entschuldigenden Worten zwängte er sich an den Passanten vorbei. Die meisten wichen zur Seite aus und machten Platz, nur einige murrten. Sie meinten, alle wollen schnell nach draußen und drängen mache keinen Sinn. Sie verstummten aber, als sie das verletzte Kind sahen.
Auf dem King’s Cross, der breiten Kreuzung vor der Station, war der Verkehr angehalten worden. Die Polizei begann abzusperren, um die Fahrbahnen für eintreffende Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Aus dem Bahnhof strömten Verwundete auf die Straße, der riesige Knotenpunkt der Piccadilly Line im Zentrum Londons war nun heillos verstopft. Die Uhr am Bahnhof zeigte kurz nach neun. Wie immer um diese Zeit war der Zug randvoll gewesen.
Viele der Fahrgäste, auch wenn sie nicht unmittelbar in der Nähe des ersten Waggons waren, hatten sich im Tumult nach der Explosion und während der darauf folgenden chaotischen Flucht aus dem Tunnel verletzt. Die Rettungswagen verließen mit laufender Sirene die Kreuzung. Es waren zu wenige, um den Ansturm zu bewältigen, so versorgten die Sanitäter viele Verletzte direkt vor Ort, legten sie auf Decken am Boden oder setzten sie zum Verbinden auf abgestellte Tragen.
Tom sprach im Vorbeigehen zwei der Sanitäter an. Sie deuteten, nach einem kurzen Blick, in die Richtung der Krankenwagen vor der Absperrung und wendeten sich dann wieder Menschen mit offenen Wunden zu. In dem Durcheinander einen Arzt zu finden, der sich die Kleine in Ruhe ansah, war aussichtslos.
Er überlegte, was zu tun sei: Das Mädchen war bewusstlos, atmete aber und schien stabil zu sein, soweit er dies beurteilen konnte. Nur die Schwellung auf der Brust wirkte größer als zuvor. Er musste das Kind schnellstens in ein Krankenhaus bringen, in dem es ein Röntgengerät gab. Zwei größere Spitäler waren in der Nähe, das Saint Pancras zwei Straßen neben der Station und etwas weiter das Great Ormond Street, nur die beiden Notfallstationen würden in kürzester Zeit vollkommen überfüllt sein. Dort auf eine schnelle Behandlung zu hoffen machte keinen Sinn.
Da fiel ihm Maddy ein. Madeleine Summer, eine gute Bekannte Toms, war medizinische Biologin und arbeitete im Labor im Whittington Health, das sogar eine eigene Kinderambulanz hatte. Bis hinaus nach Highgate waren es zwar zwanzig Minuten, aber besser, als hier die Zeit mit der Suche nach einem Arzt zu verbringen, der dann ohne die nötigen Geräte auch nichts tun konnte.
Ein Fahrzeug, schoss es Tom durch den Kopf, ich brauche ein Fahrzeug. Er lief auf die andere Seite der Station, wo die Sicherheitskräfte begannen großräumig abzusperren, zwängte sich durch zwei Sperrbalken hindurch und stürmte hinaus auf die Pancras Road, wo die Taxis parkten.
Noch im Laufen fingerte er in seiner Hosentasche nach dem Handy, zog es heraus und lehnte sich gegen eine Mauer, um eine Hand zum Wählen frei zu haben.
Zum Glück war Madeleine nicht nur im Dienst, sondern auch gleich am Telefon. Tom erklärte ihr in knappen Worten die Situation mit der Explosion und dem verletzten Kind. Sie hatte eben erst die Meldung über die Vorfälle im Radio gehört und war ziemlich schockiert.
»Und du steckst da mittendrin?«, entfuhr es ihr entsetzt.
»Nein, nicht direkt, aber das ist jetzt egal«, unterbrach er sie, um weitere Fragen abzuwenden, »kannst du mir bitte helfen, das Kind muss behandelt werden.« Er berichtete von den Verletzungen, vor allem von der bläulichen Wölbung auf der Brust.
»Wo bist du jetzt?«, fragte sie.
»Noch am King’s Cross, nehme aber ein Taxi und bin in zwanzig Minuten bei dir draußen.«
»Gut, aber komm nicht zu mir ins Labor, da kann ich nichts für euch tun, und auch nicht in die Notaufnahme, dort ist es ziemlich voll am Vormittag.« Maddy hatte den Schock überwunden und war wieder ganz professionell in ihren Anweisungen. »Bring sie direkt auf Level drei in die Radiologie zum MR – die Abteilung ist unten bei der Einfahrt angeschrieben. Ich verständige Doktor Kerry, damit er euch einschiebt. Kerry ist unser Chef-Radiologe, da ist die Kleine in besten Händen. Ich hab ihn heute früh schon gesehen, er ist also da.«
»Danke Maddy, du hast was gut bei mir!« Tom stieß sich von der Mauer ab und hetzte weiter.
»Ja, ja. Ich warte im MR auf euch. Und beeil dich, das mit der Schwellung hört sich nicht gut an!«
Dort, wo normalerweise die Taxis in Zweierreihen standen, gab es jetzt nicht ein einziges. Tom winkte einigen, die vorbeifuhren, aber sie waren besetzt und beachteten ihn gar nicht. Er lief den Bürgersteig nach vorn, sprang einfach auf die Straße und stoppte das nächste Fahrzeug, das kam – ein großer schwarzer Geländewagen. Der Fahrer blinkte zunächst mit der Lichthupe, nachdem Tom aber nicht zur Seite wich, blieb er stehen und ließ sein Fenster hinunter. Tom rannte zur Fahrerseite.
»Ich muss ins Spital, dringend!«
»Aber nicht mit mir«, sagte der dicke Fahrer mit Goldrandbrille, sichtlich verärgert über den Aufenthalt. »Gehen Sie doch ins Pancras, das schaffen Sie zu Fuß.« Er murmelte etwas von einem wichtigen Termin und dass er sich seine teuren Ledersitze nicht versauen lasse. Er gab unvermittelt Gas, der schwere Wagen schoss davon.
»Arschloch!«, schrie Tom hinter ihm her, außer sich vor Zorn.
Was jetzt? Er drehte sich verzweifelt um. Auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof, dessen Zufahrt offen war, stand ein kleiner weißer Toyota mit offener Heckklappe. Eine junge Farbige, etwa um die zwanzig, lud ihre Einkäufe ein und sah interessiert auf die Polizeifahrzeuge, die draußen mit laufender Sirene zur vorderen Station einbogen. Sie war offensichtlich so mit Shopping beschäftigt gewesen, dass sie von der Hektik am King’s Cross nichts mitbekommen hatte. Tom lief über die Straße, hinein auf den Parkplatz und winkte der Frau. Sie schaute ihn verwundert an.
»Was is’n da los?«, fragte sie neugierig in breitem Cockney-Slang, als Tom atemlos bei ihr ankam.
»Ein Unfall in der U-Bahn«, antwortete er schnell, ohne auf nähere Details einzugehen, »das Kind ist verletzt, können Sie mich bitte ins Whittington fahren?«
Sie war zunächst ziemlich irritiert, sah aber dann die Wunde am Kopf des Mädchens und wurde unsicher, wie sie sich verhalten sollte.
»Na ja«, versuchte sie die Sache abzubiegen, »is’n da keine Rettung bei der Station?«
»Schon«, drängte Tom, »aber die sind überfordert. Das Kind ist bewusstlos und braucht dringend ein Röntgen!«
»Aber is’n nicht das Ormond um die Ecke …?«
»Das ist sicher schon überlastet, es gab viele Verletzte.« Tom ließ nicht locker. Er hatte den Türgriff auf der Beifahrerseite schon in der Hand. »Bitte! Die Kleine stirbt sonst womöglich!«
Die junge Farbige warf die Heckklappe zu, zuckte ein wenig hilflos mit den Schultern und kam nach vorne.
»Na okay«, sagte sie und ließ sich auf den Fahrersitz fallen, »wo woll’n wir hin?«
»Nach Highgate Hill beim Waterlow Park.«
»Wo is’n das genau …?«
»Einfach die Royal College nach Norden und dann die Fortress bis …« Sie schaute verständnislos und hatte sichtlich keine Ahnung von der Strecke. Tom winkte ab. »Ich sage es Ihnen einfach an.«
»Okay!« Sie parkte schwungvoll aus, rollte vom Parkplatz und sah Tom von der Seite an.
»Ich bin Ruby.«
»Tom.«
Sie deutete lächelnd auf das Kind. »Is’ Ihres?«
»Nein.«
»Von ‘ner Bekannten?«
»Auch nicht, das Kind wurde bei dem Unfall verletzt.«
»Und sonst’n war keiner mit?«
»Doch, die Mutter.« Tom nervte die Fragerei.
»Und wo is’n die jetzt?«
»Sie ist leider ums Leben gekommen.«
»Fuck, das is’n Wahn!« Die junge Frau schüttelte den Kopf. »Das muss man sich geb’n. Ich will später keine Kinder …«
Tom sah nach der Kleinen, sie war noch bewusstlos. Einmal zuckte er zusammen, da er dachte, das Mädchen atme nicht mehr, aber als er sie leicht anhob, holte sie nach einer Schrecksekunde wieder tief Luft.
»Könnten Sie schneller fahren?«
»Aber …«
»Ich zahle alle Strafen, nur bitte machen Sie!«
»Okay!«
Sie trat das Gaspedal durch, der kleine Wagen machte einen Satz und schoss förmlich nach vorn. Tom nahm jetzt doch den Gurt und schnallte sich an.
»Neu’zig PS«, sie grinste stolz, »is’n ganz Schneller!«
Nach einigen Straßen hatte sich Tom an die rasante Fahrweise gewöhnt und begann sogar, Rubys Übersicht zu bewundern. Er selbst fuhr mit den alten Mühlen, wie er seine beiden Oldtimer oft liebevoll bezeichnete, eher gemütlich. Das konnte man von seiner Fahrerin nicht behaupten.
»Wie gehts’n weiter?«, fragte sie ständig und warf den winzigen Toyota zwischen den Spuren hin und her.
Tom kam mit dem Ansagen des Weges fast nicht nach. Ruby kurvte, hupte, bremste, zeigte anderen Verkehrsteilnehmern diverse Finger und schaffte die Strecke, trotz des dichten Morgenverkehrs, in knappen siebzehn Minuten.
»Passt das so?«, fragte sie, als sie vor dem Krankenhaus hielten.
»Großartig, danke!«, sagte Tom freundlich und meinte es ehrlich. Er stieg aus, griff in die Brusttasche seiner Jacke, zog eine Visitenkarte heraus und drückte sie Ruby in die Hand. »Wenn Sie mal was brauchen, dann melden Sie sich.«
Sie nahm die Karte, beugte sich vor, hob die Puppe des Mädchens auf, die im Fußraum des Beifahrersitzes lag, und hielt sie ihm durch die offene Autotür hin.
»Die is’ während der Fahrt weggelauf’n!« Dazu lachte sie breit.
»Ah, habe ich gar nicht bemerkt«, sagte Tom und steckte die Puppe ein, »danke, Ruby!«
»Schon okay!« Sie hob beide Daumen hoch. »War ‘ne schicke Fahrt. Hoff’, die Kleine kommt zu ‘nem Super-Doc, der sie durchbringt.«
Tom winkte zurück und lief ins Krankenhaus. Wie versprochen wartete oben Madeleine mit dem Arzt. Doktor Kerry, ein großer, knochiger Mittfünfziger mit eisgrauer Stoppelglatze, empfing Tom freundlich. Er nahm ihm das Mädchen ab, schaute sich die Schwellung und die Armbrüche an.
»Wir machen jetzt erst mal ein paar Bilder, ich hole einen Thorax-Spezialisten dazu und dann sehen wir weiter. Danke für Ihr schnelles Eingreifen, aber mehr können Sie nicht tun.«
Damit schob er ihn wieder hinaus auf den Gang.
Tom ging nun schon seit einer geschlagenen Stunde auf dem Flur von Level drei vor dem Central Imaging Department, so hieß hier die Radiologie, auf und ab. Noch immer waren die Ärzte bei dem Mädchen. Es machte ihn unsicher, dass die Untersuchung so lange dauerte, er hielt dies für ein eher schlechtes Zeichen.
Sein Termin mit dem Historiker im Archiv der Universitätsbibliothek fiel ihm wieder ein, der einige interne Daten aus Statistiken für ihn kopiert hatte. Tom war unterwegs zur Uni gewesen, als das Unglück geschah. Er brauchte diese vertraulichen Unterlagen für sein neues Buch über Börsengeschäfte und Terrorismus, an dem er gerade arbeitete. Er dachte daran, den Wissenschaftler mit einem Anruf zu verständigen und ihm die Situation zu erklären. Dann jedoch steckte er sein Handy wieder weg. Er fühlte sich überhaupt nicht imstande, mit jemandem zu sprechen oder seine Erlebnisse schildern zu müssen.
Früher, als er für die Reportagen der wichtigen Fernsehstationen große Storys rund um den Globus recherchierte, bekam er alle Hinweise, die er brauchte, ohne danach zu fragen. Die Leute drängten sie ihm förmlich auf, so gierig waren sie, im Fernsehen Beachtung zu finden oder ihre Erkenntnisse über andere loszuwerden. Nach einem größeren Flop und der darauf folgenden Schadenfreude seiner eifersüchtigen Kollegen zog sich Tom vom schnellen Tagesgeschäft in ein Haus bei den Londoner Docks zurück. Dort verbrachte er sein Leben seitdem als Autor von politischen Sachbüchern und nur wenige seiner alten Kontakte waren ihm geblieben. Er würde also später eine Mail schreiben, dass er mitten in dem Vorfall am King’s Cross stecken geblieben war und sich damit für sein Nichtkommen entschuldigen.
Um elf ging er den langen Gang nach hinten, bis ans Ende zu den Liften, wo er beim Hereinkommen einen Aufenthaltsraum mit Fernseher gesehen hatte. In den Nachrichten sollten die Sender einiges an Informationen bringen. In den durchlaufenden Infozeilen konnte man lesen, dass es mehrere Explosionen gegeben haben musste, wodurch die ganze Stadt gelähmt war.
Vor dem allgemeinen Aufenthaltsraum befand sich ein größerer freier Platz. Den Fernsehbereich mit dem TV-Gerät trennte eine Glasschiebewand ab, damit Leute, die sich unterhalten wollten, vom lauten Ton nicht gestört wurden. Die Schiebetür stand offen, eine Menge Patienten, die wie gebannt die Sendungen verfolgten, drängten sich bereits im offenen Zugang.
Tatsächlich wurde auf jedem News-Channel darüber berichtet. Die offizielle Pressemitteilung der Polizeibehörde bestätigte danach, dass kein Stromausfall Schuld an dem Chaos trug, sondern London das Ziel eines mehrfachen Anschlags geworden war.
Laut offiziellen Angaben hatten vier arabische Terroristen die Anschläge verübt: Selbstmordattentäter, die Rucksäcke mit Sprengstoff trugen, den sie zündeten und sich damit in die Luft sprengten. Drei der Araber, so die weiteren Details, taten dies gegen neun in verschiedenen U-Bahn-Linien und etwa eine Stunde später ein weiterer in einem städtischen Autobus.
Am stärksten betroffen war die überfüllte Piccadilly-Line bei der Station am King’s Cross, so die Berichte weiter, alleine in dieser Zuggarnitur gab es wahrscheinlich über zwanzig Tote. Die Überlebenden konnten erst nach einer Stunde von den Einsatzkräften befreit werden.
»Wahnsinn«, murmelte Tom, der sich an die verzweifelten Gesichter der eingeschlossenen Menschen erinnerte, die gegen die Fensterscheiben gehämmert hatten. »Eine Stunde in der Ungewissheit, was weiter passiert, ob es nicht eine neuerliche Explosion gibt …«
Auf BBC und CNN sprach man von über dreißig Toten und hunderten Verletzten, Sky meldete sogar tausend Verwundete.
Wie sich später herausstellte, war das unerwartete Problem für die Sicherheit, dass die Attentäter davor schon in Großbritannien gelebt hatten, drei von ihnen waren sogar gebürtige Briten. Dadurch boten die genauen Kontrollen auf den Flughäfen, die man seit dem Anschlag in New York vom elften September auch in England durchführte, in diesem Fall leider keinen Schutz.
In den folgenden Reportagen des Tages brachten sie Fotos von den zerstörten U-Bahnen und dem zerfetzten Bus. Ein verwackeltes Privatvideo zeigte Einsatzkräfte, die versuchten, Ordnung in die aufgeregte Menge zu bringen. Die Stadtverwaltung hatte den gesamten U-Bahn-Verkehr und die Buslinien in der Innenstadt eingestellt – die Stadt hielt den Atem an.
Tom konnte der Sendung nicht weiter zuhören, sie brachte die Erinnerung an das Erlebte sofort zurück. Er wischte sich über die Stirn, um die aufkommenden Bilder in seinem Kopf loszuwerden, und ging langsam zurück zur Radiologie.
Madeleine kam ihm entgegen, sie suchte ihn schon und hielt die Puppe des Mädchens in der Hand. Tom bemühte sich, in ihrem Gesicht zu lesen, wie es dem Mädchen ging. Sie sah den Blick und winkte beschwichtigend.
»Sie lebt, allerdings hat sie, außer den Armbrüchen, einen einseitigen Riss in der Lunge und eine Ansammlung von Blut oberhalb der Brust. Sie ist in der Vorbereitung, unser Oberarzt wird sie operieren, den Blutschwamm absaugen und eine fixe Drainage in die Lunge legen.«
»Wird sie durchkommen?«
»Das kann man nicht sagen. Wenn sie eine Kämpferin ist und keine schweren inneren Verletzungen hat …«
»Danke, Maddy, zumindest besteht Hoffnung!«
»Hast du in den Nachrichten gehört, was los war?«
»Ja, Anschläge von Terroristen, vier Bomben in der U-Bahn und im Bus, den ganzen Betrieb in der City haben sie deshalb eingestellt.«
»Irre, als wir zuerst telefonierten, sagten sie im Radio nur etwas von einer Explosion wegen eines Stromausfalls«, meinte Madeleine bestürzt.
»Das haben sie nur gemacht, damit es keine Panik gibt, solange man nicht wusste, was geschehen war.«
Tom ließ sich auf einen der Besucherstühle fallen, die an den Wänden entlang des Flurs standen. Madeleine blickte auf ihn hinunter.
»Du siehst auch ziemlich fertig aus«, sagte sie, »ich bring dir was zum Anziehen, einen starken Kaffee, dann musst du duschen und ich versorge den Fuß.«
»Was?«
Tom verstand zuerst nicht, was sie meinte, dann sah er in die Glasscheibe der Etagentür gegenüber, in der er sich spiegelte. Sein Gesicht war zerkratzt, an verschiedenen Stellen von dem Rauch im Tunnel schwarz verschmiert und seine Haare standen ziemlich wirr vom Kopf. Auch die Jacke und seine Jeans waren dreckig, an den hellen Sneakers klebte ölige Schmiere und über dem rechten Fuß war die Hose zerrissen. Rund um die Stelle, wo sich das Metallstück hineingebohrt hatte, war der Stoff mit getrocknetem Blut getränkt. In dem Moment, wo er die Wunde sah, begann sie, wie höllisch zu arbeiten.
»Ja, danke Maddy, das wäre toll«, stöhnte er mit einem flehenden Blick, der Madeleine sogar in der ernsten Situation zum Schmunzeln brachte.
»Ich hole jetzt Kaffee, Verbandszeug und eine saubere Hose von einem unserer Pfleger.« Sie beugte sich vor und setzte die Puppe auf den Stuhl neben Tom. »Da, auf die musst du jetzt aufpassen, in den OP kann ich sie der Kleinen nicht mitgeben. Sie leistet dir Gesellschaft, bis ich wieder da bin. Ich muss davor aber schnell die Blutproben des Mädchens ins Labor bringen und mich mit meiner Kollegin absprechen. Wird etwas dauern.«
»Keine Angst«, antwortete Tom müde, »ich lauf dir nicht davon.«
»Terroristen mitten in London …« Madeleine schüttelte im Weggehen fassungslos den Kopf. Dann drehte sie sich nochmals um. »Übrigens ein Glück für die Kleine, dass du sie getragen und bewegt hast. Hätte man sie auf eine Trage gelegt, wäre sie erstickt.«
Trotz des schwülen Tages ließ sich Tom das Wasser brühheiß über den Rücken laufen. Es war inzwischen Mittag vorbei, sein Schienbein zierte ein frischer Verband und er stand unter der Dusche. Die Wärme tat ihm gut, löste seine Verkrampfungen.
Der Mann am Bahnsteig fiel ihm ein. Letztlich hatte er recht, würden die Menschen mehr Respekt vor anderen haben, wäre es besser für die Welt. Es gäbe weniger Konflikte, weniger Verwicklungen und – mit einem besseren Verständnis für die arabische Welt – hätte sich London vermutlich auch die heutigen Terroranschläge erspart. Konnte man die Attentäter überhaupt als Araber bezeichnen? Angeblich waren es Briten gewesen. Aber so ticken wir in England, dachte Tom, alle hier geborenen Europäer, Inder, Asiaten oder Schwarzafrikaner sind einfach Briten, aber die aus den arabischen Familien sind seit 9/11 wieder nur Araber.
Irgendwann nach einer endlosen Weile klopfte es an der Duschtür, Madeleine stand davor. Tom öffnete die Augen und sah sie durch den Wasserstrahl an.
»Sie ist auf der Intensiv«, sagte sie laut, damit er sie hören konnte, »sie kommt durch!«
Als Maddy wieder draußen war, versagten Tom fast die Beine, so glücklich war er. Er hockte sich müde auf die warmen Bodenfliesen der Duschkabine und warf den Kopf zurück. Der starke Strahl traf sein Gesicht, nahm ihm den Atem. Er wollte sich die letzten Stunden abwaschen – die Zerstörung, die Toten und das ganze Leid, das er hatte mit ansehen müssen.
Zur gleichen Zeit verließ Tony Blair das Gleneagles Hotel in den schottischen Ochil Hills nahe Edinburgh und die dort seit dem Vortag stattfindende G8-Gipfelkonferenz, um sich ein Bild von den Vorfällen in London zu machen.
Er verhandelte mit George W. Bush, Wladimir Putin und den Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen über ein Hilfspaket von drei Milliarden Dollar für die palästinensischen Autonomiegebiete. Sein Ziel war es, mit den Zahlungen den Friedensprozess im Nahen Osten zu fördern.
Nach seiner Rückkehr verfolgte er das Thema nicht weiter, die Hilfe für die arabischen Regionen wurde zur großen Zufriedenheit Israels eingefroren. Das Hauptthema der Konferenz war nun die Bekämpfung des Terrors und die davor laut gewordenen Überlegungen der britischen Regierung, sich von den Konfliktherden in Afghanistan und dem Irak zurückzuziehen, wurden verworfen. Man entschied, an der Seite der USA mit aller Härte weiter am Krieg teilzunehmen.
Heute
1
Die gleichmäßig graue Wolkendecke ließ zum ersten Mal in diesem Winter feine Flocken auf die Londoner Innenstadt fallen. Unten auf der Straße verwandelten sie sich in hellbraunen Matsch, der den Fahrern, die an diesem Freitagnachmittag Anfang Dezember unterwegs waren, schlitternde Bremsmanöver bescherte. Schon wenige Zentimeter Schnee konnten die Metropole an der Themse vollkommen lahmlegen – es gab ihn selten, man war nie darauf vorbereitet und kaum ein Fahrzeug in England fuhr mit Winterreifen.
Lena stand beim Fenster im letzten Stockwerk des Aldersgate Towers, dem dunkelblauen Glaskomplex mitten in der City, der beim Postman’s Park neben dem historischen Museum von London aufragt. Sie schaute fasziniert über die Dächer der Londoner Börse und der Temple Bar auf die sich langsam weiß färbende Kuppel der St. Pauls Cathedral, die zum Greifen nahe schien. Wie der frisch gestärkte Reifrock einer eleganten Frau aus dem vorigen Jahrhundert, so kam ihr das gewölbte Dach des Doms vor.
Dahinter wand sich die Themse in einer weiten Linksbiegung durch die Millionenstadt. Auf den Brücken, die von hier aus zu sehen waren, pulsierte dichter Verkehr. Alles war geschäftig auf den Beinen nach Hause oder am Einkaufen für das bevorstehende Wochenende und staute in überfüllten Fahrbahnen nach allen Richtungen quer durch die Stadt. Lena genoss den Anblick des bunten Treibens, es fühlte sich lebendig an und für eine Journalistin konnte hinter jedem der Menschen eine Story stecken, die es wert war, erzählt zu werden.
In dem eleganten Office-Building, hoch über den Dächern der Stadt, residierte das Redaktionsbüro Barod International, für das Lena seit letztem Sommer arbeitete. Sie kannte Shyam Barod, den Besitzer der Firma, schon lange aus der Branche. Ihr gefiel seine Entschlossenheit, heikle Themen aufzugreifen. Shyam hatte eine gute Hand für Storys, was der Grund für seinen Erfolg und die rasche Karriere war. Mehrmals hatte er bereits versucht, Lena von ihrem alten Job abzuwerben, bis sie ihm schließlich die Reportage anbot, die sonst niemand machen wollte: Business and Terror – Wer profitierte vom Anschlag am elften September?
Er bewies auch diesmal Mut, griff sofort zu und gab Lena ein eigenes Sendeformat für politische Dokumentationen. In ihrer Reportagereihe Behind Headlines sollten regelmäßig anspruchsvolle Hintergrundberichte zu politischen Ereignissen erscheinen, die er plante, in allen wichtigen News-Kanälen Englands unterzubringen.
Lena ging zurück in den Besprechungsraum, wo schon einige vom Team, die andere Programmschienen betreuten, warteten. Alle sahen gespannt auf Shyams jungen Assistenten Clark, der die Statistiken betreute und die Listen mit den laufenden Quoten ausgebreitet vor sich liegen hatte.
»Ja, euer Chef-Analyst sagt euch«, eröffnete er lachend die Runde, »wir haben wieder einmal den Vogel abgeschossen.«
Der quirlige Clark war erst Anfang dreißig, stets bester Laune und mit seinen bunt gemusterten Sakkos der schräge Vogel in der arrivierten Mannschaft. Er nahm die Kopien von den Berichten und schob sie über den Tisch, während sich Lena bei der Kaffeemaschine neben dem Eingang einen Cappuccino zubereitete.
»Vier unserer aktuellen Reportagen sind in ganz England gelaufen, zwei haben sich auch nach Deutschland, die Schweiz und Frankreich verkauft und dein Bericht über die neuen Entwicklungen in der IRA«, er nickte einem älteren Mitarbeiter mit dunklem Haarzopf und runder Nickelbrille zu, »hat es bis nach Übersee geschafft – gratuliere, tolle Arbeit. Aber diesmal habt ihr es schwer, Lenas neues Reportformat hat alle Erwartungen übertroffen.«
Clark stand auf und winkte Lena mit einer einladenden Geste zu sich. Sie warf Zucker in ihre Tasse und ging umrührend hinüber zum Tisch.
»Sensationell«, fuhr er fort und hielt ihr den Ausdruck hin, »deine Story über 9/11 hat sich bisher in zwölf Länder verkauft, darunter USA, Japan, Australien und Island – dort hatten wir noch nie etwas auf Sendung – und wurde insgesamt dreißig Mal ausgestrahlt. In Amerika warst du damit im Hauptabendprogramm und hast eine Welle von erbosten Reaktionen der konservativen Republikaner ausgelöst, die auf den sozialen Netzwerken deine Spekulationen zur Beteiligung der Waffenlobby an den Vorgängen empörend fanden. Es ist daher anzunehmen, dass du ins Schwarze getroffen hast. Mehr als dieses Echo kann man sich für eine Reportage nicht wünschen …«
Alle Kollegen pochten mit den Knöcheln anerkennend auf die Tischplatte und Lena rührte verlegen im Cappuccino.
»Und von Shyam, der nicht hier sein kann, weil er in der Schweiz zu tun hat«, warf Ruth ein, die auch beim Tisch saß, »soll ich dir ebenfalls ausrichten, dass er froh über den Erfolg deiner ersten Arbeit für uns ist.«
»Danke euch, das freut mich sehr. Es war oft an der Kippe, ob ich das Thema gegen den politischen Widerstand durchbringe«, sagte Lena und ihre Augen wurden feucht, »auch habe ich einen lieben Freund in dieser Zeit verloren.«
»Ich weiß: Niels«, sagte Ruth tröstend. »Er war ein bemerkenswerter Kollege, den auch wir sehr geschätzt haben. Schon deshalb ist es wichtig, dass deine Sendung jetzt eine derartige Anerkennung findet.«
Lena setzte sich an den Tisch und verfolgte die weiteren Gespräche mit dem wehmütigen Gefühl, dass Niels nicht mehr da war, aber auch mit Zufriedenheit ob des neuen Jobs. Sie arbeitete gerne in dieser ruhigen, sachlichen Crew und sie mochte Ruth, Shyams Mutter, gut leiden. Sie war eine große, elegante Frau Mitte sechzig, hatte kurze dunkle Haare mit einer Silbersträhne und trug mit Vorliebe streng auf Figur gearbeitete Hosenanzüge. Ruth mischte sich in Shyams Leitung der Redaktion nicht ein. Sie machte mit Clark zusammen die Statistiken, half bei der Buchhaltung und absolvierte gelegentlich die offiziellen Termine, wenn ihr Sohn unterwegs war.
»What’s next?«, fragte sie Lena nach der Besprechung, als nur noch sie beide und Clark im Raum waren, zu deren neuen Plänen. »Hast du schon ein Folgeprojekt im Auge, das 9/11 toppen kann?«
»Was schwer sein wird, denn es gibt nicht viele Ereignisse, die von so allgemeinem Interesse sind«, gab Lena zurück. »Ich werde jetzt einmal über die Feiertage ausspannen und überlegen.«
»Wenn du möchtest«, warf Clark dazwischen, »stehe ich dir gerne bei einem gediegenen Abendessen für ein privates Brainstorming zur Verfügung.«
Lena schmunzelte über die Formulierung. Clark behauptete, er stamme von einem alten Adelsgeschlecht ab und versuchte, alle Frauen damit zu beeindrucken.
»Das ehrt mich sehr«, antwortete sie amüsiert, »aber die Antwort ist wie immer …«
»Du wirst das eines Tages bereuen«, ergänzte er und legte die Stirn in Falten. »Sobald ich die elterlichen Ländereien in Sheffield erbe, würde ich dich mitnehmen.«
»Ganz bestimmt«, Lena blinzelte ihn an, »und glaube mir, wenn ich zehn Jahre jünger wäre …«
»Also«, unterbrach Ruth das scherzhafte Geplänkel der beiden und wurde wieder sachlich. »Was sage ich Shyam, wenn er zurückkommt?«
»Dass ich meine zwei Wochen Urlaub benutze, um die Themen zu sondieren«, meinte Lena und packte ihre Sachen. »Ich melde mich dann nach Weihnachten bei ihm.«
»Sehr gut, nach dem Erfolg mit deiner neuen Sendung sollten wir nicht zu lange warten. Wie du ja selbst weißt, die Leute lieben Sensationen und wollen gefüttert werden.«
Lenas Wolljacke lag auf dem Beifahrersitz, die Heizung des schwarzen Mini Coopers blies auf der größten Stufe warme Luft in den Fußraum und der USB-Stick mit Chris Reas Driving home for Christmas steckte im Player – besser geht’s nicht, dachte sie.
Der Verkehr hatte etwas nachgelassen, trotzdem ging es nur zäh voran. Für die zwanzig Kilometer bis nach Twickenham im Südwesten der Großstadt, wo Lena ihr Haus hatte, würde sie mehr als die übliche Stunde brauchen. Nur heute störte sie das nicht. Im Gegenteil, sie überlegte sogar, stehen zu bleiben, um einen Bummel einzulegen.
Obwohl sie im Winter ihrer Leidenschaft – mit dem Motorrad über die englischen Landstraßen zu flitzen – nicht nachgeben konnte, liebte sie diese Jahreszeit. Die letzten Wochen vor Weihnachten waren für sie schon immer etwas Besonderes gewesen. Die Menschen waren freundlich, zumindest bemühten sie sich, wenn man sie daran erinnerte, und die beleuchteten Dekorationen gaben den Straßen und Plätzen der Innenstadt ein festliches Flair. Wenn dann, so wie jetzt, auch noch Schnee fiel, mischte sich das letzte Licht des Spätnachmittags mit der Straßenbeleuchtung zu einer ganz eigenen Stimmung, die Lena an ihre Kindheit in Dänemark erinnerte.
Der kleine Ort in der Nähe von Aalborg, in dem sie aufgewachsen war, bis die Familie nach England zog, lag ebenfalls am Wasser. Der Abendhimmel über dem engen Fjord, der zur Ostsee hinauslief, hatte im Winter die gleiche rötliche Färbung in der Dämmerung. Überhaupt war das Klima durch die Nähe zum Meer ähnlich feucht und frisch wie in England. Anfangs hatte Lena unter der Umstellung sehr gelitten. Sie war erst sechs, als ihr Vater die Anstellung bei der dänischen Handelsmission in London bekam und sie von dem Dorf in die Metropole übersiedelten. Später als Teenager war sie froh, der Enge der Landgemeinde entkommen zu sein. Sie blieb dann auch in England, als ihre Eltern wieder zurückgingen. Dennoch pflegte sie ihre dänischen Freundschaften und kümmerte sich regelmäßig um die Familie in Aalborg.
Vielleicht fahre ich zu den Feiertagen wieder einmal hin, überlegte sie, während sie auf der Great Chertesey Road über die Chiswick Bridge fuhr. Die Weite des Watts in Dänemark hatte im Winter ein außergewöhnliches Flair. Wie so oft spielte sie mit dem Gedanken, sich dort für ihren Ruhestand im Alter ein Haus zu kaufen, doch in Wahrheit empfand sie die dänische Provinz bei jedem Besuch als beengend und fuhr gerne wieder nach London zurück.
Es war ein turbulentes Jahr gewesen, das sich dem Ende zuneigte. Das Aufdecken der miesen Geschäfte des Rüstungstycoons Bronsteen und seines korrupten Umfeldes, bis hin zu dessen Verstrickung in die Anschläge auf das World Trade Center, hatte ihr großes berufliches Ansehen gebracht. Verglichen mit ihrem tragischen Verlust kam ihr das jedoch bedeutungslos vor. Sie würde den ganzen Erfolg, den neuen Job und die gesamte Anerkennung gegen einen einzigen weiteren Tag mit Niels eintauschen. Anfangs hatten sie nur beruflich miteinander zu tun gehabt, später unternahmen sie rasante Motorradtouren durch die englische Landidylle, auf denen Lena sich in den eigenwilligen Sturkopf verliebte, der ihr in vielem sehr ähnlich war. Schließlich – eine endlose Zeit später – funkte es auch bei ihm. Niels, der sonst gerne raubeinig tat, erwies sich als gefühlvolle Ergänzung. Nach einigen belanglosen, ernüchternden Beziehungen genoss sie diese Partnerschaft.
Zweieinhalb Wochen später musste er zu einer sehr riskanten Recherche, die ebenfalls mit Bronsteens Netzwerk zusammenhing, und kam nicht mehr zurück. Offiziell hieß es, er wäre Opfer eines Raubüberfalls im nächtlichen Rom geworden, doch Lena wusste genau, wer wirklich dahintersteckte. Sie hatte keine Chance gehabt, die Sache zu verhindern oder Niels irgendwie davor zu bewahren. Dessen ungeachtet machte sie sich Vorwürfe und das dumpfe Gefühl, versagt zu haben, blieb. Dagegen halfen weder die Aufdeckung von Bronsteens Machenschaften noch dessen späterer Tod.