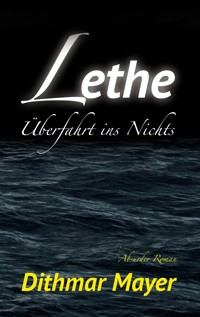
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In O., einer Stadt in Österreich, deren Existenz geleugnet wird, trifft Liam, ein Fremder mit einem unliebsamen Auftrag, auf Aro, einen wirren Straftäter auf der Flucht, und die selbstvergessene Anna. Sie erfahren in der Stadt Wahrheiten über sich selbst und die sie umgebende Welt, die ihren Verstand auf die Probe stellen. Die drei warten auf den Fährmann, sie über die Lethe, einen Fluss mit mysteriösen Eigenschaften, zu führen. Das andere Ufer birgt ungeahnte Einsichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Der Österreicher Dithmar Mayer verfasst Romane abseits fixer Genres. Seine Figuren werden häufig in eine absurde Wirklichkeit entlassen, in welcher sie der Herausforderung gegenüberstehen, ihre verschüttete eigene Identität freizulegen, ihr eine Bedeutung in dieser oder einer ganz anderen Welt zu verleihen.
»Der Raum in O. sehnt sich nach der Zeit. Sie kokettiert, kann sich nicht entschließen. Er könnte sich eine andere nehmen, zum Beispiel die Fantasie, aber die ist zu realitätsfremd; die Hoffnung zu unstet; die Freiheit eine Intrigantin – nein, nur die Zeit rührt an sein Herz.«
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Frösche
Der Fremde
Civic
Kätzin
Der Auftrag
Der Fluss
Leoparden
Die Fähre
Mond
Nichts
Feuervogel
Letholin
Liquor
Vierzehn
Nebel
Säugling
Maneki-neko
Korridore
Erdloch
Yersinia pestis
Krieg
Nahost
Unter dem Kastanienbaum
Nukleotide
Schläuche
Ortsende
Flügelschlag
Zweites Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Erstes Buch
Diesseits von O.
Frösche
Graz an der Lethe: Hier, wo die scharfen Buge der Ozeanriesen ins Kiesufer schneiden, tanzen mir Möwen den Wiener Walzer. Am Westufer des Flusses steht eine glühende Sonnenscheibe über dem Horizont,verbrennt das trockene Gras. Die Pelzmenschen am östlichen Ufer kämpfen mit den Übergriffen der Eisbären, doch das ist eine Geschichte in ihrem eigenen Recht. Das Ödland prahlt mir mit seiner Vielfältigkeit. Die Falten in letzterem Wort wirft die Steiermark, wie sie leibt, quer über meine Landkarte.
Aro – dreiundzwanzig, untersetzt, dünner Schnurrbart – schloss die Fensterflügel der Altbauwohnung. Straßenlärm: aus.
»Setzt du dich dann zu uns?«, fragte seine Mutter. »Der Kaffee wird nicht wärmer vom Warten.«
»Schon gut, Mama«, sagte er, warf einen Blick auf seinen Vater, der die Augen überdrehte, wie jedes Mal, wenn Aros Name fiel. Seine Schwester Eva und ihr Freier saßen bereits auf ihren Plätzen. Sie waren zu Besuch, Aro lebte hier, wenn man das so nennen konnte. Es war der letzte Tag, das hatte er sich geschworen. Nicht einen Tag länger! Eva und der ihrige – Statist, sprach nie ein Wort – hatten hier übernachtet, wollten in einer Stunde zurückfahren nach Schwanberg, einem Ort voller Lianen, die von Mammutbäumen hingen. Auf deren Ästen stiegen Pfeilgiftfrösche und Leoparden einher. Aro hatte den Ort mehrmals besucht. Er predigte den Leoparden in seinem Kopf, sie lauschten andächtig. Die Pfeilgiftfrösche bedeuteten ihm wenig, ihre Macht versteckte sich hinter Harmlosigkeit, war heimtückisch. Raubkatzen zeigten stolz ihr Vermögen, zu töten. So wollte er sein. Und doch saßen die Frösche hinter seiner Stirn, quakten, insgeheim Herren seiner Gedanken.
»Sie haben ein Baby gefunden in der Mur«, sagte Eva, breitete in ihren Händen eine Tageszeitung aus. »Das heißt: eine Babyleiche.«
»Das ist kein Thema beim Essen!«, sagte die Mutter. »Erzähl uns doch von eurem Besuch imZeughaus.«
»Ach Mama!« Aro stöhnte. »Der alte Blechhaufen für Touristen. Wen interessiert denn das?«
»Zum Beispiel den Lebensgefährten deiner Schwester, der es noch nicht kannte.« Die Mutter nickte Evas Freier zu, hob die Kaffeekanne an. »Will noch jemand Kaffee?«
»Es war in ein Badetuch gewickelt, das Bündel mit Steinen beschwert.« Eva zitierte aus der Zeitung. »Krass, da hatte jemand Nerven.«
»Vielleicht hatte er ja gute Gründe.« Aro nahm einen Schluck aus seiner Tasse.
»Das habe ich nicht gehört!«, sagte die Mutter, blickte zu Boden.
»Du verletzt deine Mutter«, sagte sein Vater. »Siehst du nicht, wie sie leidet wegen dir?«
»Es geht schon«, sagte die Mutter.
»Halt’ die Klappe, wenn ich rede!« Vater erlaubte niemals Einwürfe, schon gar nicht von seinem Weib. »Er hat kein Gefühl für irgendwas«, fuhr er fort. »Ein nutzloser, skrupelloser Parasit! Eines Tages wird er uns töten.« Aros Augen glänzten. Eva zupfte an ihrer Zeitung.
»Jemand hat es beobachtet, konnte aber niemanden erkennen. Es war Nacht. Er sah nur zwei Menschen, die etwas von der Brücke in die Mur warfen.«
»In die Lethe«, sagte Aro. Eva tippte mit einem Finger an ihre Schläfe. »Euer Sohn ist wirklich krank, Leute.«
»Genug jetzt – anderes Thema!« Die Mutter setzte sich aufrecht. »Will jemand einen Teller Suppe?«
»Zum Kaffee?«, fragte der Vater, reckte seinen Hals wie eine Schildkröte.
»Eine Suppe ist immer gut, wärmt, richtet den Magen ein.«
»Du machst mir Spaß.«
»Ich hätte gern etwas Suppe«, sagte Eva.
»Ich mache einen Topf voll warm.« Die Mutter erhob sich. »Aro nimmt sicher auch welche.«
»Nein, Mama«, sagte der Angesprochene.
»Papperlapapp. Das wird dir guttun.« Sie verschwand in der Küche.
»Ist gut, Mama.« Aro drehte sich zum Fenster, starrte in den Himmel.
»Du ruinierst die Stühle«, sagte der Vater. »Kannst du nicht einmal still sitzen?«
Evas Freier deutete mit zwei Fingern auf eine Stelle der Zeitung. Die Augen der jungen Frau folgten ihnen.
»In dem Bündel wurde eine Kette mit einem rotschwarzen Frosch als Anhänger gefunden«, sagte sie. »He, Aro! Hast du nicht deiner Freundin eine Kette mit einem Pfeilgiftfrosch geschenkt?«
»Pfeilgiftfrösche gibt es in allen Farben. Meiner war gelb.« Aro wandte seinen Blick nicht vom Fenster, sein Körper versteifte sich. »Frösche sind Glücksbringer. Die hängen an vielen Ketten, das heißt gar nichts.«
Die Mutter kam zurück, einen Topf in Händen, stellte diesen in die Mitte des Tisches, schob das Kaffee geschirr an den Rand. Aro drehte sich wieder zum Tisch. Die Suppe dampfte im Topf, die Mutter schöpfte etwas davon in die Teller.
»Lasst es euch schmecken«, sagte sie, wandte sich an Eva. »Und du nimm die Zeitung vom Tisch. Schlechte Nachrichten verderben den Appetit.«
Aro starrte auf seinen Teller. Aus dem Dampf über der Suppe trat eine Frau auf eine Brücke. Der Nebel lichtete sich. Sie bewegte sich auf das Geländer zu, zitterte. Nacht. Scheinwerferlicht. Du warst doch mitgekommen, es war so abgemacht, alles fixiert. Du trugst ein Bündel in Armen, dein Gesicht drückte nichts aus. Du stiertest ins Wasser, dann in meine Augen. Ohne Seele im Leib wandtest du dich ab – einmal durchatmen! –, liefst los ans Ende der Brücke. Ich holte dich ein, packte dich an den Schultern, drehte dich zu mir, brüllte in dein verheultes Gesicht: Wir haben es doch besprochen, es muss sein, mach jetzt keine Szene, keiner tut das gern, was denkst du, wie es mir dabei geht, komm schon, ich habe jetzt wirklich keine Nerven für das, wir haben stundenlang darüber gesprochen, tagelang, das fangen wir jetzt nicht von vorn an, Karin, gib her, na gib schon, stell dich nicht so an, ich tu es für dich, für uns, es ist das Beste für alle, einfach alle, gib her, krall dich doch nicht so fest, ich will dir nicht wehtun, gib mir das verdammte Ding, mir reicht es jetzt, ich schwöre dir, ich schlage dich, wenn du nicht sofort loslässt, ich mache keine Witze. Du klammertest dich mit einer Hand an das Brückengeländer, drücktest mit der anderen das Bündel fest gegen deine Brust. Verdammte Tusse! Die ganze Überzeugungsarbeit für A und F. Was hätte ich tun sollen? Ich habe dir eine gelangt, dann hast du es losgelassen. Ich wusste, ich musste schnell handeln, solange du nicht reagieren konntest. Es ging rasch. Ein dumpfes Klatschen, als das Bündel aufschlug – die beigelegten Steine zeigten ihre Wirkung. Nur gut, ich hatte daran gedacht! Das Päckchen sank sofort – aus den Augen, aus dem Sinn. Wir waren doch nicht die Ersten. Wer war schon heilig? Das kannte doch jeder aus den Medien. So viel Getue! Bei einer Abtreibung sagte keiner etwas. Von der Lethe »abgetrieben«. Im Fluss des Vergessens vergessen – vergiss es! Wer konnte schon ernsthaft bestimmen, bis wohin es Lebensplanung und ab wann es Mord darstellte? Es war Notwehr in jedem Fall. Jawohl. Die Bedrohung hörte doch nicht auf, weil die Schnalle es gekriegt hatte – gegen mein Verbot! Da fing es erst richtig an. Karin hatte Schuld. Sie hatte sich versteckt und es einfach geworfen. Das gehört doch besprochen! Ich kann ihr auch jetzt nicht trauen. Ob sie den Rand hält? Ihr ist alles zuzutrauen.
»Willst du die Suppe nur anstarren oder auch etwas davon essen?« Die Mutter, sie saß neben ihm, wedelte mit einer Hand vor seinen Augen herum.
»Sie ist heiß«, sagte Aro. Er setzte sich zurück, verschränkte seine Arme.
»Eine Suppe muss heiß sein. Jetzt schmolle nicht wie ein störrisches Kind.« Sie sah Aros Vater an. Der blickte nicht von seinem Teller auf, verzog denMund.
»Zurückgeblieben ist er! Das kommt von deiner Erziehung. Weichling! Mamis Liebling!«
»Ist dein Problem, dass nicht du ihr Liebling bist?«, sagte Eva. Stille. Das durfte nur Eva wagen. Der Vater hielt kurz inne, löffelte dann weiter seine Suppe. Aro konnte nicht glauben, seine Schwester kam damit durch. Sagte er etwas Derartiges – Vater holte die Axt aus dem Keller. Die Mutter hielt einen kleinen Teller hoch.
»Schnittlauch irgendwer?« Sie streckte den Arm nach verschiedenen Seiten aus. Aro nahm als Einziger mit Daumen und Zeigefinger etwas von dem Grün. Wie beiläufig sagte sie: »Da wir gerade von Babys reden: Die Tochter der Strohmeiers hat ein ganz entzückendes Wurm nachhause gebracht. Wann wird es denn bei euch so weit sein?« Sie blickte zwischen Eva und deren Freund hin und her.
»Mama!« Eva hob einen Zeigefinger. »Nicht schon wieder! Du weißt, wir wollen uns nicht geistlos vermehren. Wenn wir die Voraussetzungen geschaffen haben und uns ein Kind wünschen sollten, werden wir eines haben, sonst nicht.«
»Niemand macht mich zur Großmutter«, sagte die Mutter, stöhnte. »Aro fällt auch aus.« Der Angesprochene starrte wieder in seine Suppe. »Iss wenigstens!«, setzte sie an ihn gewandt hinzu. Ihr Sohn füllte seinen Löffel. Zwei Tage lang warst du Großmutter. Ich habe es dir genommen, Schachtel. Er blies den Dampf über der kleinen Pfütze fort, senkte den Arm, schüttete die Suppe zurück in den Teller.
»Ich gehe jetzt«, sagte er.
»Was heißt das?«, fragte seine Mutter.
»Das, was ich sagte.«
»Wie sprichst du mit deiner Mutter!« Der Vater erhob sich, stemmte seine Arme in die Hüften. Aro stapfte aus dem Raum, seine Sohlen knallten. Er riss imVorbeigehen auf dem Gang seine Jacke von der Garderobe – den Abgang hatte er geübt –, schlug die Tür zu und lief die Treppe hinab. Mich seht ihr nicht wieder. Verrottet meinetwegen! Ihr seid bereits Vergangenheit.
Zu seinem Camaro zu gelangen, musste er die Innenstadt durchqueren. Der Chevrolet hatte einen kleinen Kofferraum, aber Aro hatte seine Sachen akribisch im ganzen Innenraum des Wagens verteilt. Planung ist alles. Er trat auf die Straße. Schon stürmte sein Vater aus dem Haus, rannte mit weit ausholenden Bewegungen hinter ihm her. Aro beschleunigte etwas, der Fünfzigjährige hatte keine Chance, ihn einzuholen. Na, alter Mann? Kleiner Herzinfarkt gefällig? Er sah seinen Vater keuchen, die Hand auf der Brust. Bald stand dieser mit nach vorne gebeugtem Oberkörper, als kotze er. Geh zur Hölle, du Auslaufmodell! Martin und ich, wir holen uns die Welt. Ihr seid nichts als Versager. In ein paar Tagen bin ich ein feiner Pinkel, auf euch spucke ich nur noch runter.
Er lief durch die Sackstraße. Links wucherten Prä-riegras und Macchiestauden, rechts standen vereiste Fichten dicht aneinandergedrängt, ein Langläufer schritt aus. Aro erreichte den Hauptplatz, die großen Hafenanlagen von Graz. Vor dem Rathaus im Zentrum des Platzes stellte der Formel 1-Rennstall eines Milliardärs seine Boliden aus, bot den Besuchern ein Unterhaltungsprogramm. Aro ging am Rand des Platzes entlang. Das Motorengeheul, das er nun in der Fußgängerzone wahrnahm, schrieb er zunächst den präsentierten Rennwagen zu. Dann geschah Seltsames. Wo die Herrengasse in den Platz einmündete, flogen Stühle durch die Luft, zum Teil saßen Menschen auf ihnen. Ein Wagen wühlte sich durch Holzsplitter und das Metallgestühl, schob einen Mann auf einem Tisch vor sich her. Die Stuntmen waren schon Teufelskerle. Was dabei alles geschehen konnte! Der Veranstalter scheute keine Mittel, den Zuschauern etwas zu bieten. Nein, das Entsetzen in den Gesichtern war echt. Der Stunt lief schief – oder war es gar keiner? Warum bremste der Fahrer nicht? Er beschleunigte weiter. Aufs falsche Pedal getreten – das musste es sein. Das Gaspedal wurde offenbar blockiert, trieb das Fahrzeug weiter. Schreie. Einige Menschen begriffen den Ernst der Lage. Jetzt nahm der Wagen Kurs auf Aro. Für einen Moment sah dieser ein Gesicht hinter dem Lenkrad. Jemand verrichtete die Arbeit, die er sich vorgenommen hatte, so, wie es die Gesellschaft gern sah – ein Mann, eine Tat. Das hatte nichts mit der Veranstaltung zu tun. Aro sprang in den Arkadengang neben ihm. Ein Mann, den er eben überholt hatte, blieb gebannt stehen, als der Wagen auf ihn zusteuerte. Er wurde erfasst, prallte auf die Kühlerhaube, die Frontscheibe, rollte das Dach entlang, fiel auf die Straßenbahngleise. Aro umarmte eine alte Frau, die mit ihm unter die Arkaden geflüchtet war.
»Ein schrecklicher Unfall!«, rief sie. Sie hatte ein braunes und ein grünes Auge.
»Das ist kein Unfall.« Er sprach langsam, mehr, sich selbst zu unterrichten, als die alte Dame. »Das ist Amok.« Der Wagen bremste kurz ab, fuhr rückwärts über den reglos Liegenden, noch einmal im Vorwärtsgang. Er schleuderte in Rallyemanier am Ende des Platzes – U-Turn nannte man das wohl –, fuhr auf der gegenüberliegenden Seite zurück, geriet aus Aros Blickfeld, verschwand hinter Würstchenbuden, von wo wieder Schreie zu hören waren, das Knacken von Holz, Kreischen. Stille. Einige Passanten liefen zu dem auf den Gleisen Liegenden, andere setzten Notrufe ab, Geschockte stützten einander. Um die Opfer bildeten sich Gruppen, erste Hilfe zu leisten. Würde der Amokfahrer zurückkommen? Menschen strömten in die Pomeranzengasse, die zu schmal war, ein Auto hindurchzusteuern. Aro hatte ein Ziel, er konnte nicht bleiben. Sein Camaro wartete am Dietrichsteinplatz, wo sich die Löwen sonnten nach dem großen Fressen. Er passierte die Fassungslosen entlang der Herrengasse. Jetzt zeigte sich, der Amokfahrer hatte bereits eine lange Spur des Leids gezogen, ehe er den Hauptplatz erreichte. Wie schön Macht war! Alle strömten ins Zentrum, der Dietrichsteinplatz lag menschenleer. Hier trotteten die Löwen satt einher, die Antilopen hatten sich bereits beruhigt, nachdem eine der ihren ihr Leben ließ. Aro fand seinen Camaro, kletterte ins Fahrzeuginnere. Weg hier!
Er fuhr Richtung Nordwesten, die Lethe entlang. Wer die Wechsel zwischen Fjorden und Palmenhainen nicht gesehen hatte, wusste nicht, was nordische Exotik bedeutete. Die Hundertfüßer, Boas und Wildpferde würden in Aros Kopf fortleben, die ausgedehnten Regenwälder zwischen Fronlethen und Bruck an der Lethe seine Träume befeuern.
Martin wohnte in Leoben, dessen Goldminen Abenteurer aus aller Welt anzogen, harte Kerle mit dicker Haut und Unterarmen wie Popeye. Aro parkte seinen Camaro im Hinterhof des Zinshauses, das die Wohnung seines Freundes beherbergte. Die Tür stand offen, Martin steckte in seinem Sofa wie ein Pfeil in einem Strohsack, sah fern.
»Da bin ich!«, sagte Aro.
»Hast du den Wagen getankt?« Martins Stimme schien aus der Tiefe des Sofas zu dringen.
»Hab’ nur wenig Benzin verbraucht. Morgen kann ich noch nachtanken.«
»Schon gut.«
»Der Plan steht?«
»Er steht. Das ziehen wir durch. Der andere Wagen, der Civic, den ich von dir übernommen habe, steht auch im Hof.«
»Es war ein Kinderspiel«, sagte Aro. »Es lebe das Darknet. Die Anleitung zum Aufbrechen des Wagens war perfekt. Es gibt nichts mehr, was man im Internet nicht lernen könnte. Meine Alten hab’ ich einfach stehen lassen. So oder so, ich bin weg. Im Knast oder auf Hawaii.«
»Deinen Camaro stellen wir an die Lethe für den Autotausch, wie besprochen.«
»Du musst mir noch zeigen, wie man mit der Waffe umgeht.«
»Du wirst sie nicht abfeuern müssen. Es reicht, wenn man dir glaubt, du weißt, damit umzugehen, und bist bereit sie einzusetzen.«
»Abknallen will ich keinen. Ich hab’ Grenzen.«
»Ich auch. Das wird schon. Mach dir nicht ins Hemd! Es war schwierig genug, die Knarren aufzutreiben. In den Krimis sieht es immer so aus, als stünden die Hehler auf der Straße herum und warteten nur darauf, einen Kunden bedienen zu dürfen.« Er streckte die Hand aus, drehte seinen Daumen nach unten. »Bei euch in Graz war heute einiges los. Ein Amokfahrer ist durch die halbe Stadt gerast.«
»Er hätte mich fast niedergefahren.«
»Das hätte unser Projekt im letzten Moment zu Fall bringen können!«
»Ging doch gut aus. Was berichten sie? Ist viel passiert?«
»Genaues wissen sie noch nicht. Es gab mehrere Tote.«
»Ich hab’ genug für heute. Ich haue mich mal aufs Ohr.«
Aro legte sich aufs Gästebett, das Martin im hinteren Teil des Wohnzimmers aufgestellt hatte. Das Fernsehgerät war nicht zu laut, es störte nicht, er konnte aber auch zuhören, wenn ihn etwas interessierte. Während der ganzen Fahrt nach Leoben hatte er nicht ein einziges Mal an das Erlebnis im Grazer Stadtzentrum gedacht. Er vermochte nicht zu sagen, ob es sich dabei um Verdrängung oder Gleichgültigkeit handelte. Die alte Dame mit den verschiedenfärbigen Augen, die er im Arm gehalten hatte, tauchte in seinem Gedächtnis auf. Sie klammerte sich an ihn – es war fast erotisch. Karin wird zu mir zurückkehren, wenn ich erst die dicke Kohle vorweisen kann. Ich werde vor ihr stehen und ein Bündel Scheine aus der Brusttasche ziehen. Sie fällt mir um den Hals und verzeiht mir, so viel ist klar. Sie muss verstehen, warum ich so handelte. Es ist doch ganz einfach. Jeder verstünde das. Wie kann man sich nur so anstellen! Ja, ich hab’ ihr Geld gestohlen, um den Camaro anzuzahlen. Es war eine Art Darlehen. Ich zahle es ihr mit Zinsen zurück, sie wird sehen, ja, das wird sie. Wir ziehen die ganz große Sache durch, Martin und ich. Wir werden in der Zeitung stehen, aber ohne Namen, weil sie uns nicht identifizieren können. Der Plan ist wasserdicht, die Bank ausgekundschaftet. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. In der Schule hab’ ich nie welche abgeliefert, aber das ändert sich. Alles ändert sich. Ich werde ein feiner Pinkel mit di ckem Auto, noch dicker als der Camaro. Ich komme ganz groß raus, und sie wird betteln, von mir genommen zu werden – auf Knien wird sie rutschen, jawohl. Aro im Camaro strahlt wie ein verdammter Staro auf dem Walk of Fame. Hier kommt Aro im Camaro, Leute!
Der Fremde
Die letzten paar Kilometer hatte er zu Fuß zurückgelegt. Die Haltestelle, die nicht existierte, hatte er schließlich doch gefunden, nun folgte er seinen Eingebungen. Der angebotene Shuttlebus zum Lethe-Zentrum bei O. wurde, abgesehen von Angehörigen, ausschließlich von den künftigen Bewohnern des Hospizes auf einer Flussinsel in der Lethe genutzt, die man zuvor in der Spezial-Palliativeinrichtung für Demenzpatienten am diesseitigen Ufer unterbrachte und behandelte. Liam Charon fiel trotz des mitgeführten Gepäcks der Entschluss zur Fußreise nicht schwer. Er war ohnedies einen Tag zu früh in O. angekommen, vermochte so, sich einen besseren Eindruck von der Umgebung seines künftigen Arbeitsortes zu verschaffen. Der erfahrene Krankenpfleger kannte die Stadt nur aus Erzählungen, die dem Ort eine mystische Bedeutung unterstellten. Hier sei der Anfang der Welt, zugleich ihr Ende, laut der Diktion der Alten seiner Heimat in der Levante. Er freute sich aus unterschiedlichen Gründen darauf, sich dem Fluss des Vergessens endlich zu nähern, der nur hier »breit war wie der Ozean«. Neben der beruflichen führte ihn eine bedeutendere Agenda hierher. Doch vorerst mussten formelle Dinge erledigt werden. Der Neuankömmling schritt eine lose gepflasterte Straße entlang. Weißen Würfeln glichen die traditionellen Häuser des Städtchens, weißen Würfeln die modernen öffentlichen Gebäude. Die Architekten hatten sich für den Rückzug ins Vorhandene entschieden, nicht für den mutigen Fingerzeig. Daran mochten die Honoratioren der Flusssiedlung nicht unschuldig sein. Der Anblick modern gekleideter Menschen, Kinder mit Skateboards, in Videospiele auf ihren Smartphones versunken, sowie moderner Autos auf den Straßen, wirkte hier erfrischend. Liam hatte befürchtet, in eine mittelalterliche Welt voller puristischer Regelwerke und Verbote einzutreten. Der erste Eindruck sprach dagegen, doch was wusste man? Die Mehrzahl der Menschen, die ihm begegneten, waren allerdings höheren Alters. O. galt als geheimer Ort, dessen Existenz vielfach geleugnet wurde. Forschungsteams und Expeditionen berichteten, die Stadt nie gefunden zu haben. In österrei chische Landkarten fand sie so wenig Eingang, wie in offizielle Dokumente. Politiker, die behaupteten, O. besucht zu haben, wurden als unglaubhaft abgewählt. Das steirische Volk hatte entschieden, O. existiere nicht, basta.
Liam fragte sich zum Einwohnermeldeamt durch, das, wie erwartet, im einzigen Verwaltungsgebäude des Städtchens untergebracht war – ein Komplex ineinandergeschobener Kuben, dessen Front die Sehne eines angeschnittenen Kreises bildete, welcher den Marktplatz darstellte, den »Platz der lächelnden Stille«. Liam schien, dem »Platz des himmlischen Friedens« wurde hier ein kleiner Bruder beigestellt.
Bald stand er vor dem Portikus des Gebäudes. Das Tor war etwa fünf Meter hoch und mit Kupferplatten beschlagen. Sie versuchten, dich mit gewaltigen Bauteilen zu beeindrucken, dich im Vergleich klein zu halten, wie überall in der Welt. Das Tor war verschlossen. Ein wuchtiger Türklopfer erwies sich als Attrappe, Liam vermochte nicht, ihn zu bewegen.
Er setzte ein paar Schritte zurück, blickte an der Fassade hoch. Heute würde er hier nichts mehr ausrichten. Er hob seinen Koffer an, wandte sich dem offenen Platz zu.
Ein alter Mann stand vor ihm, wie aus dem Nichts getreten, musterte ihn von Kopf bis Fuß. Er lief in einem Halbkreis um Liam herum, streckte wiederholt sein Kinn weit nach vorn, zog es in einer rollenden Bewegung zurück, fuchtelte mit den Armen – ein Huhn,das im Neuankömmling eine Körnerquelle entdeckt hatte. Der hob schützend seine Hände, drehte dem Schreitvogel seine Seite zu.
»Dich kenn’ ich nicht«, sagte der alte Mann, schnupperte am Kragendes andern.
»Ich bin neu«, sagte Liam. »Also … nicht von hier, eben angekommen.«
»Du bist jung.«
»Ich bin Mitte fünfzig, immerhin.« Liam wich zurück.
»Du bist jung. Woher kommst du?«
»Ich habe jetzt keine Zeit. Also dann …« Liam versuchte, sich aus der Einengung zu lösen. Der wunderliche Alte ließ nicht locker.
»Wo bist du zuhause?«
»Ich muss jetzt wirklich…«
»Du bist nicht von hier.« Der alte Mann setzte seinen Hühnertanz fort.
»Das erwähnte ich bereits.« Liam wand sich, hoffte, links an seinem Gegenüber vorbeizukommen.
»Niemand ist von hier«, sagte der wunderliche Alte. »Keiner!« Er zwang mit einem Ausfallschritt den Neuankömmling in sein Gesichtsfeld zurück. Der stöhnte.
»Keiner, den Sie kennen«, schlug Liam vor.
»Keiner. Woher kommst du?« Der alte Mann verzichtete nicht auf seine Frage, doch etwas in Liam wehrte sich dagegen, sie zu beantworten. In der Levante und manchen anderen Teilen der Welt empfahl es sich nicht, sich zu seiner Herkunft zu bekennen. Er mutmaßte, dies könnte auch hier gelten. Du musstest in guter Verfassung sein, mit Verachtung umgehen zu können. Das war Liam nicht. Er hätte die Arbeitsstelle nicht angenommen, wäre er nicht auf der Flucht vor … »Diesen Ort gibt es nicht«, sagte der Alte.
»Welchen Ort?«
»Na, diesen hier. Niemand spricht seinen Namen aus.«
»Heißt er nicht einfach O.?«
»Was soll das sein, O.?«
»Das weiß ich doch nicht!« Liam hatte genug, er wollte nur noch in sein Zimmer, sich auszuruhen.
»Der Punkt nach dem O heißt doch etwas.« Das Huhn bestand auf seiner Aussage.
»Was?«
»Frag mich!«
»Gut, ich frage dich. Was bedeutet das O, was der Punkt?«
»Es ist nicht wirklich ein O, es ist eine Null. Nichts.«
»Was hat das mit dem Punkt zu tun?«
»Das wissen nur die.«
»Die?«, fragte Liam. Der wunderliche Alte drehte sich zum Verwaltungsgebäude, wies mit einem Zeigefinger auf die oberste Fensterreihe.
»Die.« Er tauchte mit dem Kopf ab, fuhr mit seinen Pickbewegungen fort, begleitete sie nun gar mit Gegacker. Liam holte Luft, rannte los, an dem Alten vorbei, der erfolglos versuchte, ihn einzuholen. Der trotz Kof fer und Rucksack Ausdauerndere umrundete einen Block, bis er überzeugt war, seinen Verfolger abgeschüttelt zu haben. Nun hieß es, die Herberge finden, in der er ein Zimmer reserviert hatte.
Er erkundigte sich bei einer Reihe von Passanten, die jedoch sämtlich einen verwirrten Eindruck hinterließen, ihn meist nur wortlos ansahen. Er hatte nicht damit gerechnet, die Dementen liefen auf den Straßen umher. Nach einer Weile bemerkte er, die Personen sprachen durchaus vernünftig miteinander, wirkten wach. Erst wenn er sie ansprach, sackten sie in sich ein, ihre Augen trübten sich, sie stammelten oder verstummten gänzlich. Er folgte mit wenig Zuversicht Fingerzeigen, die zaghaft eine Richtung wiesen, gelangte auf diese Weise letztlich aber doch zur Herberge.
»Herr Charon.« Eine junge Frau las in seinem Pass, den er auf den Tresen gelegt hatte. Sie stemmte eine Hand in die Hüfte, wischte mit der anderen einige Haarsträhnen aus dem Gesicht.Sie wartete nicht auf eine Antwort des Gastes, zog einen Schlüssel aus einem Fach an der Wand der Eingangshalle, warf ihn auf den Tresen, blies sich eine weitere Strähne aus dem Gesicht und sagte:
»Vier.« Jetzt kam ein Kleinkind aus einem Nebenraum gelaufen, blieb vor Liam stehen.
»Haare!«, rief das Kind fachmännisch, zeigte mit einem Finger auf Liams Bart. Dieser war nicht auf Kleinkinder trainiert, konnte mit deren Direktheit nicht umgehen. Er nickte der Frau zu, die mit einer Hand auf den Gang links der Eingangshalle wies, ging ein paar Schritte, drehte sich zu ihr um, fragte:
»Frühstück morgen?« Die Frau hatte das Kind an eine Hand genommen, stemmte die andere wieder in die Hüfte.
»Nur Zimmer. Die Kneipe ist einen Block weiter. Die haben Fladenbrot und Aufstriche. Ab halb neun.«
Liam stellte seinen Tramperrucksack und den Koffer im Zimmer ab, legte sich aufs Bett. Er packte nichts aus. Es war kein Grund vorhanden, sich länger als nötig auf dieser Seite der Lethe aufzuhalten. Nur das Einwohnermeldeamt und die Führung der Palliativklinik würde er kontaktieren, dann reiste er weiter zum Hospiz auf der Insel. Was seine spezielle Aufgabe betraf, würde man ihn kontaktieren, hatte es geheißen, er konnte hierzu nichts beitragen. In der Fremde war es nie einfach. Die Gastwirtin wäre ihm kaum behilflich, mehr zu erreichen. Egal, er hatte noch einen weiteren Tag Zeit, schlimmstenfalls erledigte er seine Verpflichtungen am folgenden Morgen. Er schloss die Augen, ließ den Bildfolgen in seinem Kopf freien Lauf. Er rutschte, rutscht, ich rutsche …
… auf meinem Platz hin und her. Ich sehe meiner Verhandlung von der Anklagebank aus zu. Ein Experte wird gehört. Das müssen Sie mir näher erklären, Herr Doktor, sagt der Richter. Ich dachte, die Gefahr eines Helfersyndroms bestünde in der zu großen Selbstaufgabe des Pflegenden. Ist nicht dieser quasi sein eigenes Opfer? Der Psychiater dreht sich in Richtung des Rich terstuhls. Das Helfersyndrom, Euer Ehren, hat nichts damit zu tun, tatsächlich jemandem helfen zu wollen. Es geht darum, den Applaus für die Hilfeleistung einzuheimsen. Ist das Ziel erreicht, steht die Person, die unter dieser Störung leidet, vor einer Leere. Sie will mehr desgleichen. Es ist eine Art Sucht. Dieses Ziel kann sie nur erreichen, indem sie den geretteten Patienten wieder in die ursprüngliche oder bevorzugt eine fatalere Situation bringt, aus der sie ihn erretten kann. Die Rechnung lautet: Je schlimmer der Zustand des Patienten, desto größer der Applaus für dessen Rettung. Geht diese Rechnung nicht auf, ändert das nichts. Das Prinzip bleibt: mehr desgleichen. Es hat bisher geklappt, es wird weiterhin funktionieren. Man muss nur die Herausforderung erhöhen, dann stellt sich bestimmt der Erfolg ein. Der Richter kratzt seine Bartstoppeln. Der Patient hat also immer mehr zu erleiden zugunsten des gesteigerten Lobes für den Helfer. Ist das richtig? Das ist richtig, sagt der Psychiater. Allerdings steht dahinter nicht skrupellose Berechnung, sondern eine Störung, die unterschiedliche Ursachen haben kann – darüber wissen wir noch zu wenig. Stimmen Sie mir zu, fragt der Richter, dass der Patient in dieser Beziehung immer Opfer ist, unabhängig von den Absichten des Täters. Da gebe ich ihnen recht, Euer Ehren, sagt der Psychiater, in hellen Momenten versteht der Helfer auch die Tragweite seiner Manipulationen, begreift sich als – wie Sie es vorhin ausdrückten – sein eigenes Opfer, leidet unter dem Bewusstsein, diese Ta ten begangen zu haben, bis zum nächsten Verlangen nach Aufmerksamkeit und Lob. Der Richter lehnt sich zurück, streckt einen Arm aus. So, wie Sie es beschrieben haben, steigern sich die Manipulationen, den Zustand des Patienten zu verschlechtern, von Mal zu Mal. Wird dem kein Einhalt geboten, kann das logische Ende dieser Handlungskette nur der Tod oder eine ähnlich fatale Konsequenz für den Patienten sein. Der Psychiater atmet tief durch. In manchen Fällen ist das so. Gewöhnlich ergibt sich im Laufe der Zeit ein Hindernis, das dem Vorgang ein Ende setzt. Der Helfer beginnt dann anderswo von vorne. Im vorliegenden Fall ergab sich dieses Hindernis nicht, stellt der Richter fest. Der Patient, der sein Wohlergehen in die Hände des Herrn Charon gelegt hatte, wurde von diesem um dasselbe und sein Leben gebracht. Geben Sie mir einen Grund, warum ich das nicht als Totschlag werten sollte. Den gebe ich Ihnen nicht, sagt der Experte. Ich kann Sie bloß mit Informationen versorgen, nicht mit den ethischen Folgerungen oder gar einem Urteil. – Ich klinke mich aus meiner Verhandlung aus, starre nur noch vor mich hin. Sie können so wenig wie ich selbst mit meinem Verhalten anfangen. Sie werden mich verurteilen. Ich verdiene es. Ein Mensch, der sein Vertrauen in mich gesetzt hat, ist tot. Ich kann die beschriebenen Verhaltensweisen und Gedankengänge nicht mit mir selbst in Verbindung bringen, doch so muss es gewesen sein. Ich kenne mich selbst nicht. Ich habe getötet. Du sollst nicht töten. So weit habe ich mich vom Glauben meiner Gemeinde entfernt. Sperrt mich weg. Beendet den Albtraum. Ich kehre, kehrte, er kehrte …
… aus der Bilderwelt zurück in das Gästezimmer. Ein Schrank, ein Bett, ein Waschbecken,ein Brett an der Wand, das als Schreib- und Ablagefläche diente – die Nüchternheit des Raumes tat ihm gut. Seine Zeit hatte er abgesessen, teils in der Psychiatrie, teils im Gefängnis. Vor dem Gesetz war die Schuld gesühnt, in seinem Herzen nicht. Die Bilder verziehen ihm nicht, sie verfolgten ihn, bauten sich vor ihm auf, zeigten auf ihn: Wir klagen dich an. Du bist zu »lebenslänglich« verurteilt, täusche dich nicht!
Liam erhob sich, wusch sein Gesicht am Waschbecken, schäumte seinen Bart gleich mit ein, strich die Haare mit den Fingern nach hinten. Er machte sich zum Gehen fertig, ließ den Rucksack zurück, steckte nur etwas Geld und den Reisepass in seine Jacke. Er wollte noch auskundschaften, an welcher Stelle die Fähre über die Lethe setzte, um morgen nach der Erledigung der Formalitäten sogleich zur Insel überzusetzen. Er trat aus der Herberge auf die Straße. Es dämmerte bereits, er hatte länger geruht, als ihm bewusst war. Liam folgte dem Klang des rauschenden Flusses, erreichte bald dessen Ufer. Man konnte nicht bis auf die andere Seite sehen, der Fluss war hier tatsächlich sehr breit, strömte aber schnell das Ufer entlang, sodass es nicht mit einem See- oder Meeresstrand zu verwechseln war. Das Wasser, oliv- bis braungrün, schäumte stellenweise von Wildheit. Der Fährmann musste sehr erfahren sein, durch diese Gischt hindurchzusteuern. Liam lief das Ufer entlang gegen den Strom. Glanzpunkte tanzten auf den Wellen, sie stammten nicht von der Sonne – das schwindende Tageslicht war durch die Wolkendecke diffus –, Flutlichter warfen ihre Strahlen ins Wasser, stocherten in den Wellen.
Er war noch nicht lange gegangen, als ihm ein Schiff auffiel. Es erinnerte ihn an die Raddampfer aus alten Verfilmungen der Geschichten Mark-Twains. Näher gekommen, entdeckte er tatsächlich ein Schaufelrad. Im Zentrum ragte ein Kamin über das Dach aus weißem Holz, im Umgang hingen erloschene Laternen von den Ständern, die den Dachüberhang trugen. Die Brüstungen der Reling wurden von gedrechselten weißen Säulchen getragen. Liam erwartete, einen Jungen mit löchrigem Strohhut und einem Grashalm zwischen den Lippen an Deck lungern zu sehen. Hier endete jedoch das Klischee. Auf einem großen Messingschild stand der Name des Schiffes: »Lethe Ferry«. So groß hatte er sich die Fähre nicht vorgestellt, dafür moderner. Ob der Romantik-Boiler bei der starken Strömung eine einigermaßen gerade Linie über den Fluss halten würde können? Wäre es nicht möglich, hätte man das Schiff schon lange außer Dienst gestellt. Womöglich war ein gewisser Abtrieb einberechnet. Am Ufer stand ein kleiner Turm mit der Aufschrift »Fahrdienstleitung«. Hier würde er sich morgen einfinden.
Er spazierte noch ein Stück entlang der Lethe, genoss den leichten Wind, der durch den Sog des mächti gen Flusses entstand. Der Abend brachte nun Dunkelheit, nur noch von den Flutlichtern unterbrochen, die aber auf den Fluss hinaus strahlten. Straßenlaternen fanden sich hier nicht. So wandte Liam sich bald wieder in Richtung der Stadt. Sobald die ersten Häuser auftauchten, wurde der Weg erleuchtet. Er schlenderte durch die Innenstadt, dann auf seine Unterkunft zu. Ihm fiel ein, seine Wirtin hatte ihm ein Lokal empfohlen, das nur einen Block von der Herberge entfernt lag.
Er stieg in das Kellerlokal hinab. Der trockene Holzboden knarrte von seinen Schritten. Es roch, wie in alten steirischen Gasthäusern üblich, nach Schmierseife, gerösteten Erdnüssen, Bier und ein wenigModer.
Civic
Der Civic holperte seit einer Stunde über den Highway. Kein Vergleich zum Camaro. Der war weg. Aro blinzelte in die Sonne, den Fuß aufs Gaspedal gestemmt, als gälte es, die Bodenplatte durchzutreten. So hatten sie es nicht geplant. Jetzt saß er im Fluchtwagen, den Camaro hatten die Bullen, damit auch seine Identität. Der Bankbeamte hatte ihm ins Gesicht gegrinst: Schieß doch! Martin starrte ihn nur an, wartete. Der Kassier blickte zwischen ihnen hin und her. Aro hatte doch gesagt, er würde nicht schießen. Dann dieser unglaubliche Knall – der Beamte riss die Augen auf, er drehte sich zu Aro, sah ihn an – eine sterbende Frage –, fiel zu Boden. Mar tin schien selbst am meisten überrascht, abgedrückt zu haben. Er ließ die Waffe fallen, Tränen traten in seine Augen … Aro durfte nicht in die falsche Richtung denken. – Vorwärts sehen, nie zurück! Ein Kaktus stand wie ein Verkehrspolizist am Straßenrand, zwei Meter hoch, ein erhobener, abgewinkelter Arm, ein nach unter gebogener. Kakteen als Einzige besiedelten die Wüstenlandschaft, durch die der gestohlene Civic brauste. Die Sonne versuchte, die Karosserie des Fahrzeugs zu schmelzen. Sand bedrohte die mechanischen Teile des Wagens, verklebte die Schmiere an den Drehpunkten. Etwas blitzte rot auf in Aros pulsierendem Hirn. Rückleuchten. Der Camaro. Martin kniete vor dem Heck, während Aro aufs Gas stieg, das Steuer durchdrehte. Rote Glanzpunkte huschten über Handschellen. Er hatte noch gerufen: »Bleib hier!« Martin war hinausgesprungen, wollte den Camaro erreichen, wie geplant. Martin hielt sich immer an seine Pläne, immer, außer dem einen Mal. Er hätte nicht schießen dürfen, das war gegen alle Abmachungen! Im Rückspiegel sah Aro, wie die Bullen aus ihrem Golf sprangen, Martin packten. Die Rückscheinwerfer des Camaro leuchteten. Aro hatte vergessen, sie auszuschalten, jetzt strahlten sie in seinen Kopf, Laserskalpelle schnitten sein Hirn in Streifen, legten die Leere frei, die dort klaffte. Gas geben! Ein Buchstabe leuchtete wie Neonreklame in seinem Gangliengespinst: O. Nur dort war er sicher, an dem Ort, der nicht existierte, damit auch außerhalb jeder Gerichtsbarkeit liegen musste. Der In nenraum des Civic stank nach Hämorrhoidensalbe – Rentnerfahrzeug, ausgerechnet! Egal! Jetzt musste er mit der gegebenen Situation umgehen, vorhandene Mittel nutzen. Daran führte nichts vorbei. Wie fand man O.? Sollte gerade er über das Finderglück verfügen, das Expeditionen aus Experten, Eierköpfen fehlte? Ja. O. war hier, wartete nur darauf, entdeckt zu werden. Sein ganzes Gepäck hatte er im Camaro zurückgelassen, in der Hosentasche fand er nur etwas über achtzig Euro. Weit käme er damit nicht.
Die Wüste ging nun in eine Savanne über, die Hitze nahm jedoch nicht ab. Ein Rudel Elefanten stapfte in wenigen Metern Entfernung parallel zum Highway. Etwas rannte vor dem Civic über die Straße, Aro bremste nicht. Auf Tierleben konnte er keine Rücksicht nehmen, er war auf der Flucht, man fahndete sicher schon nach ihm. Obwohl er zu Beginn eine kurze Strecke in eine andere Richtung gefahren war, hatte er damit die Bullen wohl nicht lange täuschen können. Er spürte sie in seinem Genick, die Halswirbel schmerzten. Der Highway verwandelte sich in eine Schotterstraße, er kam nun weit langsamer voran. Ein Vogelschwarm latschte über den Himmel wie Daddy in Hausschuhen. Daddy, igitt! Der Gedanke an seinen Vater verursachte ihm Brechreiz. Ich habe es doch immer gewusst, würde der gerade zu Mama sagen, der Junge taugt nichts, du hast ihn verdorben. Alles deine Schuld. Halt ’s Maul, wenn ich rede, einen Versager hast du großgezogen, einen verdammten Versager. Im Knast ist er gelandet, wie ich es vorausgesagt habe – dort gehört er auch hin. Sei froh, er hat uns nicht abgeknallt. Hätte er zuhause schon die Waffe besessen, wären wir längst tot. Du hast recht, Vater, du hast recht. In Aros Hirn saß eine fette Kröte, die sich mehr und mehr aufblähte, gegen die Schädeldecke drückte. Sie hatte die agilen Pfeilgiftfrö-sche verjagt, protzte satt mit blöden Augen, nur die Zunge schoss in unregelmäßigen Abständen aus dem Maul, klebte an der inneren Schläfe, schnappte zurück – oder war es eine pulsierende Ader, die ihn nervte? Er musste ruhig bleiben. Karin würde jetzt seinen Nacken massieren. Halt still! Entspann dich! Denk an nichts, an gar nichts! Die Temperatur fiel um ein paar Grade, das Gras schien nun satter, höher. Eine Steppenlandschaft breitete sich vor ihm aus. Außer Gras und wenigen Bäumen in großer Entfernung nahm er nichts wahr. Hier hausten Wölfe, die heiligen Wölfe, die Tiere seines Herzens. Auch ihnen, wie den Leoparden, hatte er zu predigen versucht, doch sie lächelten nur nachlässig über ihn, sie wussten so viel mehr. Keiner ahnte, was der Wolf wusste! Das schöne Tier zeigte sich nicht. John Lennon: »Got tobe good looking ’cause he ’s so hard to see«1. Du spürtest ihn oder spürtest ihn nicht, er kannte dich, ehe er dich wahrnahm, wusste dich. Aro verzögerte die Fahrt bis der Civic am rechten Rand der Straße zum Stillstand kam. Er stieg aus dem Fahrzeug, schob es ins hohe Gras, erleichterte seine Blase, pinkel-te einen Schmetterling an. Der zeigte sich davon unbeeindruckt. Aro erinnerte sich, Schmetterlingsflügel zeigten den Lotuseffekt – oder hieß der Ferrarieffekt? –, der Flüssigkeit abperlen ließ. Der Krötenmensch grub sich tiefer in die dichte Graswand. Es strengte an, doch das war gut so. Aro fuchtelte mit den Armen, während er aufs Geratewohl loslief. Bald trat Schweiß auf seine Stirn. Er fand sich inmitten des Graslands, hinter ihm hatten sich die Halme wieder aufgerichtet. Er war nicht mehr sicher, in welche Richtung er laufen müsste, das Auto wiederzufinden. Den Hämorrhoidenofen wollte er auch gar nicht mehr sehen. Er pflügte weiter durchs Gras, weiß Gott wohin.
Aro vernahm ein Heulen. Die Wölfe hatten Witterung aufgenommen. Würden sie ihn als mögliche Beute betrachten oder als Komplizen, Vertrauten, einen der ihren? So sehr er die Tiere bewunderte, ein Aufeinandertreffen erschien gefährlich. Dennoch lief er auf das Heulen zu, wie Odysseus auf den Gesang der Sirenen, die wie die Wölfe versprachen, alles zu wissen, verraten zu wollen. Niemand band Aro an einen Schiffsmast, so drang er weiter vor. Das Heulen schien sich aber nicht zu nähern. Die Wölfe hielten den Abstand unverändert, lockten ihn. Nun erreichte er ein Sumpfgebiet. Das Gras blieb zuerst beständig hoch, doch stapfte er in zunehmend wasserhaltiger Erde. Die Sohlen seiner Schuhe saugten sich fest, schmatzten bei jedem Schritt. Die Muskeln seiner Waden schmerzten bald. Das Gras lichtete sich zusehends, Mücken fielen zu tausenden über ihn her. Etwas wischte über sein Gesicht. Es war der Flügel eines großen Vogels, der eine Libelle jagte. Die Libelle konnte sich schneller zwischen den Halmen hindurchbewegen. Der Vogel klatschte auf den nassen Boden. Aro beobachtete die Szene, ließ sich ohne Gegenwehr von den Mücken anzapfen. Sie haben Martin gerade in der Mangel. Wer ist dein Komplize, red’ schon! Wir haben Mittel, das aus dir rauszubringen, die du lieber nicht kennenlernen willst, glaub mir! Wenn der Camaro ihm gehört, wissen wir in ein paar Minuten, wer er ist. Wo wolltet ihr hin nach demÜberfall? Ist der Civic gestohlen? Wer von euch hat geschossen? Die Zeugen werden uns das ohnehin erzählen, du kannst das Verhör verkürzen, indem du redest. Wieso habt ihr diese Bankfiliale ausgewählt? Wer hat den Plan ausgearbeitet? Du siehst aus, als seist du der Schlauere von euch beiden. Er ist bestimmt der mit Bleifuß und nicht viel im Kopf. Richtig? Ihr seid doch beide Verlierer, er noch mehr als du. Er wohnt sicher noch bei Mami.
Aro fühlte eine befreiende Abkühlung, die Luft roch jetzt nach Schnee. Er brauchte nur wenige weitere Meter zu gehen, schon stand er in einer Winterlandschaft. Am Horizont war ein Eisberg zu sehen, auf dem sich Pinguine tummelten. Die Kröte in seinem Kopf quakte, hupte vor Erleichterung, schrumpfte etwas. Das Wolfsheulen war nicht mehr so klar zu vernehmen gewesen, nachdem er die Steppe verlassen hatte, nun hörte er es wieder lauter, die Weisen waren zurückgekehrt. Er ent deckte die Abdrücke ihrer Pfoten im Schnee. Eine riesige Harpyie breitete ihre Flügel, kreiste über seinem Kopf. Als sie zehn Meter von ihm entfernt landete, waren Schnee und Eis verschwunden, hinter ihr gähnte ein Abgrund. Jetzt sprangen Wölfe aus dem Nichts hervor, jagten die Harpyie, die schwerfällig vom Boden abhob, sich in den Abgrund stürzte, von Aufwind in die Höhe getragen wurde. Die Wölfe bellten ihr hinterher, sammelten sich, sprangen ins Nichts zurück. Aro wartete eine Minute, trat an den Abgrund. Unter ihm weitete sich ein Tal. Ein Fluss begrenzte es zum Horizont hin. Dieser erweckte den Eindruck, breit wie ein riesiger See oder ein Meer zu sein, doch bewegte er seine Wassermassen, wie nur ein Fluss es konnte. Eine ausgedehnte Siedlung, vielleicht eine Stadt, streckte sich an seinem Ufer, griff ins Grün aus. Die Häuser, weiße Kuben allesamt, duckten sich meist eingeschossig in die Erde. Aro wähnte sich in Vorderasien und hatte doch die Steiermark nicht verlassen. O. lag vor ihm! Kein anderer Ort konnte es sein.
Der Abgrund erwies sich als steil, jedoch begehbar. Er stieg, rutschte, stolperte nach unten. Die Winterlandschaft ließ er hinter sich. Mit sinkenden Höhenmetern erwärmte sich die Luft. Es dämmerte auf seinem Weg, dunkelte gänzlich ein, als er in der Talsohle anlangte. Aro erreichte bald die Stadt, lief durch die Straßen, unentschlossen, was er als Nächstes tun solle. Er kam an einer Kellertreppe vorbei, über der ein Schild für eine Gastwirtschaft warb. Er stieg hinunter, betrat das Lokal.
Der zur Gänze aus Holz gefertigte Raum atmete Tradition. Ein unbesetzter großer Stammtisch – durch einen Wimpel als solcher ausgezeichnet – erzählte von politisierenden Gruppen fünfzigjähriger Männer gleich Aros Vater, von Bier, Fußball, Bier, ordinären Witzen, Bier, Messerstechereien, Bier. Es waren nur wenige Personen anwesend. Zwei Männer lehnten am Tresen, lachten. Ein Bärtiger hockte an einem Bistrotischchen im Eingangsbereich, blätterte in einem Notizbuch. Die kleinen, runden Tische stellten den einzigen Stilbruch in dem urigen Lokal dar. In einer Nische im hinteren Teil des Lokales saßen eine Rollstuhlfahrerin um die achtzig und eine Frau in ihren späten Fünfzigern oder frühen Sechzigern, die an dem Fahrbehelf der Ersteren herumhantierte.
Jetzt trat eine junge Frau in einem Dirndlkleid aus der Tür hinter dem Ausschank, stellte Gläser auf ein Regal über dem Tresen. Aro ging auf sie zu, bestellte ein Glas Limonade, was ihm sogleich verächtliche Blicke der beiden Männer am Tresen einbrachte – Alphamännchen wie sein alter Herr, voller Verachtung für jeden, der ihrem Männerbild nicht entsprach. Er setzte sich an eines der Bistrotischchen, streckte seine Gelenke, in welchen noch die Anstrengungen der Reise steckten. Der Bärtige an einem der Nebentische vermittelte Aro ein Gefühl der Sicherheit, er war Bär in Aros Tierwelt, groß, stark, haarig. Sollte Schutz vor den Schakalen an der Bar vonnöten sein, setzte er auf ihn. Der Mann erhob sich. Aro fürchtete, sein Meister Petz verließe das Lokal, dieser verschwand jedoch in einem Gang, der zu den Toiletten führte.
***
Ich bin nicht wie ihr.
Hab’ das Wasser im Glasgezuckert, anstatt des Kaffees. Die Blenden gingen runter, ich war allein unter euch. Flutlichtstrahlen stachen durch die schmalen Schlitze, weiß, spitz. Das Lokal schwamm davon, irgendwohin – ich holte es nicht ein, griff hinterher. – Eine Hand, spastisch. Seht ihr auch manchmal durch die Ohren? Eine Stimme, blau war sie, wollte keine Nähe und suchte doch danach, dröhnte in meinem Kopf. Sie stapfte hinter mir vorbei, ihre grauen Schamhaare rauschten, die Sohlen plapperten über den Dielenboden: »Weg von mir, weg von mir! Mein Terrain!« Ihre Wärme leckte über meinen Hinterkopf, tropfte in den Nacken, kühlte dort ab. Sie hat sich weiterbewegt. Meine Schultern erinnern sich an sie, dort kommt ihr Strom zum Erliegen, sie schwappt in die Schlüsselbeingruben und verpufft. Stell dir vor, du liegst in ihren Armen – eine kalte, blaue Stimme sagt: Die Regeln unserer Beziehung sind die folgenden: a, b, c. Weshalb sind die andern immer die andern? So anders. Seid ich! Mittwoch – der verdammte Mitteltag. Warum habe ich mich in die Toilette zurückgezogen? Ich will hier nichts. Flucht. Egal. Liam hatte die Besitzerin der blauen Stimme gesehen, als er den Kopf auf dem Weg zu den Aborten kurz zum hinteren Teil des Lokals wandte. Sie war noch nicht so alt, wie sie sich angefühlt hatte, als sie hinter ihm vorbeiging. Was hatte sie gesagt? »Mama, die Türen sind breit genug, falls du mal musst.« Sie hatte die Toiletten für die Rollstuhlfahrerin inspiziert. Die Tochter mochte Ende fünfzig sein, zeigte das Gesicht von jemandem, der sich nichts mehr vormachte. Sie war die blaue Stimme. Liam quetschte ein paar Tropfen aus seinem Unterleib, um nicht völlig umsonst gekommen zu sein, wusch sich die Hände und kehrte ins Gastzimmer zurück.
Hier …
***
Der Bär stapfte ins Gastzimmer, sein pelziger Hals blähte sich beim Anblick der Szene, die sich in seiner Abwesenheit entwickelt hatte. Die Schakale hatten die Damen angegriffen, nachdem die offensichtlich verwirrte Alte laut geworden war. Nun fassten sie die Junge an. Aro hatte erwartet, das mächtige Tier würde mit ausgefahrenen Krallen gegen die Schakale losschlagen, doch es stand bloß, ließ seinen mächtigen Körper wirken. Ein knappes Brüllen, nicht mehr als ein Schnarchen – die hündischen Angreifer ließen von den Frauen ab, schlichen geduckt um das stärkste Landraubtier, gewahr, ein Hieb mochte sie in Fetzen reißen. Sie bellten frech, schlugen an, waren in der Überzahl und zählten dennoch nicht. Bald krochen sie zurück auf ihre Barhocker, knurrten noch ein wenig, verstummten endlich.
***
Liam wurde bewusst, er hatte sich in die Angelegenheiten der beiden Damen gemischt, ohne um Erlaubnis zu fragen. Vielleicht hatte er die Lage falsch eingeschätzt, sich unnötig aufgeplustert. Er wünschte, sich zu entschuldigen, erriet jedoch, das erschiene lächerlich nach seiner Beschützerpose, hieße nach Lob fischen. So nickte er bloß, kehrte zu seinem Platz zurück. Die Schankkraft blickte zwischen den handelnden Personen hin und her. Liam nahm sein Notizbuch zur Hand, blätterte darin.
»Meine Mutter möchte Ihnen danken«, sagte die blaue Stimme, die wieder hinter ihm erklang. »Ich übrigens auch.« Liam erhob sich, wandte sich der Frau zu.
»Keine Ursache«, sagte er, lächelte nur mit den Lippen, die Augen rollten nervös in den Schleimhäuten umher. Er war den Kontakt mit weiblichen Wesen nicht gewöhnt, unter seinen Besuchern im Gefängnis fanden sich keine Frauen. »Ich wollte nicht … ich meine … es war nur …« Er fuchtelte mit den Händen. Die Frau kniff die Augen zusammen, trat einen Schritt zurück,lächelte.
»Ich werde wieder Platz nehmen«, sagte sie, drehte sich um, ging an ihren Tisch zurück. Der junge Mann an dem Tischchen neben Liams grinste.
»Bären sind Einzelgänger«, sagte er. Liam blickte ihn verständnislos an, setzte sich, widmete sich wieder seinem Notizbuch. »Sie wissen es nicht«, setzte der junge Mann hinzu. »Aber Sie sind ein Bär. Ja, das sind Sie!«. Liam ignorierte ihn. »Bären sind gut«, fuhr der Fremde fort. »Zu gut für die Welt der Affen und Köter.« Liam drehte sich mit einem Ruck zu seinem Tischnachbarn, starrte ihm in die Augen. Dieser verstummte sofort, griff nach seiner Limonade, schluckte mit einem deutlichen Geräusch.
1 »Come Together«, Abby Road, Lennon/McCartney, APPLE-Records, 1969
Kätzin
Albas Buckel rundete sich wie ein Torbogen. Das samtige Fell der Katze glitt durch Annas Hand. Das Tier sprang vom Fensterbrett zu Boden, Anna sah auf die Straße. Es regnete. Durchatmen! Die kühle, feuchte Luft tat ihr wohl.
»Anna!« Avas Rollstuhl stand mit dem Rücken zur Tochter. »Fährst du mich zum Licht?«, fragte die Alte. Anna fasste nach den Handgriffen des Fahrbehelfs, löste die Bremse, steuerte ihn zum Fenster. Sie genoss die Momente, in denen ihre Mutter sie erkannte, sinnvolle Sätze zu formen vermochte.
»Atme tief ein!«, sagte Anna. »So frisch ist die Luft nicht oft.« Ava lächelte.
»Du bist wie ich, Schatz«, sagte sie. »Ganz die Mama.« Sie sog die Luft tief in ihre Lungen, nahm Annas Hand, legte ihre Wange darauf. Alba sprang auf Avas Schoß, rieb ihren Kopf an deren Bauch.
»So viel Zärtlichkeit in diesem Haus«, sagte Anna, lachte. Die Heftigkeit des Regens nahm zu. Die beiden Frauen sahen auf die Straße hinaus, lauschten dem Prasseln. Die Wohnung lag ebenerdig am Rahel-Braunschild-Boulevard, der Hauptstraße, benannt nach der ersten Bürgermeisterin der Stadt, mittlerweile von einemMann abgelöst. Ava streichelte Albas Rücken. Anna beobachtete sie. »Mir wird gerade bewusst, die Namen von uns dreien beginnen und enden mit einem ›A‹«, sagte sie.
»Du merkst auch alles.« Ava hob Alba an. »Ich habe mir schließlich euer beider Namen ausgedacht.« Sie hielt Anna die Katze hin. Diese nahm das Tier entgegen, setzte es wieder auf das Fensterbrett. Alba schnurrte. Avas sanftes Lächeln wandelte sich langsam in einen starren Blick. Anna wusste, was das bedeutete.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie. Ava sah zu ihr hoch.
»Warum bin ich hier?«
»Schon gut, Mama. Du bist bei mir. Ich bin Anna, deine Tochter.«
»Anna? Ich kenne keine Anna.«
»Ich weiß. Du musst mir einfach glauben.«
»Warum halten Sie mich hier fest?«
»Ich halte dich nicht fest. Wir leben zusammen. Wir sind hier, uns das Lethe-Zentrum anzusehen.«
»Kenne ich nicht. Ich will nichts sehen. Wo ist mein Mann?«
»Papa ist seit vier Jahren tot, Mama.«
»Sie lügen mich an. Er hat eine andere. Er verlässt mich. Sie sind die andere!«
»Nichts dergleichen. Er hatte Pankreaskrebs. Die Whipple-Operation – erinnerst du dich? Er hat es nicht geschafft.«
»Was für ein Wimpel?«
»Whipple.«
»Was erzählen Sie mir da? Halten Sie mich für verkalkt?« Ava schlug mit einer Faust auf die Armlehne des Rollstuhls. Anna nickte für sich, sagte nichts dazu. »Ich will nachhause gebracht werden«, sagte Ava.
»Du bist zuhause.«
»Das ist nicht mein Haus. Da draußen sehe ich nicht meinen Garten.«
»Das Haus haben wir verkauft. Wir setzten unsere ganze Hoffnung in O. Wenn dir geholfen werden kann, dann hier. O. besitzt die beste Palliativklinik, das beste Hospiz, die besten Ärzte des Landes, vielleicht der Welt.«
»Was schert das mich? Ich bin doch nicht plemplem.«
»Ach, Mama!«
»Würden Sie damit aufhören, mich Mama zu nennen! Sie machen mich älter, als ich bin. Wir sind fast gleichaltrig.«
»Du bist achtundsiebzig, Mama.«
»Unsinn! Was sagen Sie da?« Ava griff sich an die Stirn. Anna drehte den Fensterflügel, bis ihre Mutter sich im Glas spiegelte. Ava zuckte zusammen. Sie betrachtete ihr Abbild, zitterte. »Was ist geschehen?«
»Zeit ist vergangen, Mama, nichts weiter – Zeit.«
»Zeit«, sagte Ava, untersuchte ihre Hände, als zähle sie die Falten. »Nichts weiter. Nichts …« Alba sprang zurück auf Avas Knie, schnurrte wie ein kleiner Traktor. Die alte Frau strich über das Fell der Katze, ihres leichtfüßigen Beruhigungsmittels. Anna stellte das abgewinkelte Bein auf den Heizkörper unter dem Fenster. Sie blickte viel weiter, als es der Regen zuließ, die Blende in ihren Augen war auf »unendlich« gestellt. Sie sehnte sich, wusste nicht wonach. Bloß so ein Gefühl, Regengefühl – die Kühle war schuld, prickelte vom Knie aufwärts. Jetzt würden zärtliche Erinnerungen eintrudeln, hätte sie welche. So blieb es bei ungerichtetem Sehnen, Träumen, was hätte sein können.
»Sie sind meine Pflegerin«, sagte Ava. »Was habe ich? Sterbe ich? Sie sprachen von einemHospiz.«
»Das ist nur eine letzte Möglichkeit.« Anna stellte ihr Bein wieder auf den Boden. »Wir waren bei einem Spezialisten. Wir werden einen weiteren aufsuchen. Wir kämpfen. Ich bin deine Tochter.«
»Danach kommt die Palliativklinik«, sagte Ava.
»Das werden wir erst sehen. Wenn ja – es ist die beste Klinik. Sie vollbringen kleine Wunder.«
»Wird ein kleines reichen?« Ava nahm die Katze an ihren Hals. Anna sah ihre Mutter kurz an, blickte zu Boden.
»Vielleicht muss es gar kein Wunder sein.« Anna beugte sich zu Alba, strich nun ebenfalls über deren Fell. Die Hände der beiden Frauen berührten einander.
»Sie werden übergriffig!«, sagte Ava. Anna nahm ihre Hand zurück.
»Zeit für deine Medikamente«, sagte sie, holte eine Pillendose aus der Schublade einer Kommode links vom Fenster. Ava nahm die Dosierhilfe aus durchsichtigem Plastik in Augenschein.
»Was ist das für ein Zeug, das Sie mir da verabreichen wollen? Schön bunt, aber giftig!«
»Das brauchst du, sagen die Ärzte.«
»Und Sie tun alles, was die Halsabschneider sagen. Können Sie auch selber denken?«
»Denken kann ich, aber in deinem Interesse höre ich auf die, die sich ihr Leben lang mit Heilung beschäftigt haben. Wichtigtuer gibt es schon genug.«
»Feigling! Stehen Sie doch einmal für etwas selbst ein!«
»Du weißt nicht, was du da sagst. Ich hole etwas Wasser zum Schlucken der Pillen.« Anna ging zur Spüle, nahm ein Glas aus dem Hochschrank, füllte es mit Wasser. Als sie zu Ava zurückkehrte, hatten deren Augen ihren sanften Ausdruck zurückgewonnen. Die Wechsel zwischen den beiden Charakteren der alten Frau beschleunigten sich. Anna vermochte nicht zu entscheiden, ob das ein übles Anzeichen war, doch es beunruhigte sie. Im Moment kam es ihr gelegen, ihrer Mutter die Medikamente nicht unter Zwang verabreichen zu müssen. Ava schluckte ihre Pillen ohne Widerspruch, lächelte ihre Tochter an.
»Was täte ich ohne dich und Alba!«, sagte sie. Die Katze stellte sich wie aufs Stichwort auf die Hinterbeine, umfing mit den Pfoten Avas Hals. »Der Herr gestern ….«
»Welcher Herr«, fragte Anna.
»Na der, der uns verteidigte – er hatte ein Auge auf dich geworfen.«
»Ich weiß nicht … mir schien es auch ein wenig so, aber das spielt keine Rolle.«
»Warum denn nicht? Du sollst endlich leben, Schatz. Opfere dich nicht für mich. Ich bin nicht mehr lange hier. Was dann?«
»Sorge dich nicht. Ich finde mich zurecht. Ich habe den nächsten Spezialisten ausfindig gemacht. Er ist Facharzt für fast alles: Geriatrie, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, und und.«
»Titel. Du weißt, was ich davon halte.«
»Ich weiß. Natürlich bedeutet ein Titel nicht alles, ist aber ein ganz guter Ausgangspunkt. Wenn Menschlichkeit und Empathie dazukommen und er versteht, all das so zu vermengen, dass etwas Sinnvolles herauskommt, haben wir einen Treffer gelandet.«
»Wenn er so vieles verantwortet, ist er bestimmt ständig gestresst oder er muss alles delegieren. Dann helfen mir seine Fähigkeiten nichts, er hat keine Zeit für mich, ist bloß der Manager der Praxis.«
»Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Mehr, als es zu versuchen, können wir nicht tun.«
»Ich möchte nicht die alte Miesmacherin sein. Es strengt aber an, herumgekarrt zu werden, wie ein Kartoffelsack.« Sie blickte in Annas traurige Augen. »Entschuldige, ich weiß, du tust dein Bestes.«
»Welche Alternativen haben wir denn?«
»Zur Ruhe kommen! Das Hospiz ist vielleicht die beste Idee.«
»Die nehmen dich gar nicht. Du bist meist noch voll ansprechbar, sogar in gewisser Weise mobil. He! Du bist noch in guter Verfassung!«
»Wovon sprichst du? An mir ist kein Organ in guter Verfassung. Und geistig ist auch nicht mehr viel übrig. Da ist diese andere in mir. Ich kann ihr zusehen, aber nicht eingreifen, wenn sie Unsinn macht.«
»Sie ist auch du – bis zu einem gewissen Grad.«
»Ich mag sie nicht. Sie ist nicht nett zu dir.«
»Das ist schon in Ordnung. Ich warte auf dich. Du kehrst nach ihr wieder.«
»Sie nimmt mehr und mehr Raum ein. Bald werde ich nicht wiederkehren.«
»In meinem Herzen wirst du immer da sein. Ich fixiere einen Termin mit Doktor Kupfferstein, wenn du uns noch eine Chance gibst.«
»Tu, was du nicht lassen kannst, Schatz.« Ava strich über Annas Arm. »Ich bin müde. Bringst du mich zu Bett?«
Anna half ihrer Mutter aufs Sofa, drehte sie auf die Seite, warf ihr eine dünne Decke über. Alba sprang darauf, pumpte mit den Vorderpfoten, lief einige Male im Kreis, legte sich dann zu Avas Füßen.
Die Praxis von Doktor Kupfferstein stellte schon für den nächsten Tag einen Abklärungstermin für Ava zur Verfügung – eher als erwartet. Anna setzte sich an den Schreibtisch, suchte Dokumente zusammen, ordnete Avas Befunde und Krankengeschichten, erlebte in Gedanken vieles davon wieder – Jahre des Bangens, der Bemühungen um Therapien, Untersuchungen. Die Hoffnung auf den einen großen Treffer, der die Lösung ihrer Probleme bringen würde, blieb unerfüllt.
Der Regen endete so jäh, als hätte jemand die Brause abgedreht. Anna verspürte Lust, die feuchte Luft zu atmen. Sie zog sich eine Pelerine über, verließ das Haus, spazierte zur Lethe, die noch mehr Wasser führte, als sie es sonst ohnehin schon tat. Etwas vom Braun wurde aus dem Braungrün ausgewaschen, der Fluss kam als unreiner Smaragd daher. Sie schlenderte das Ufer entlang bis zur Fähre. Schon am Tag ihrer Ankunft hatte sie sich in das Schiff verliebt. In ihrem Kopf spielten Szenen vor dem Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs. Vivian Leigh, Olivia de Havilland stolzierten mit spitzenbesetzten Sonnenschirmchen an Deck auf und ab, während Paul Robeson »Ol’ Man River« brummte. Was als Genuss eines Stimmungsbilds begann, mündete bald in Verzweiflung gegenüber einer Welt, die einigen alles bot auf Kosten so vieler. Wo waren die unbeschwerten Sonnentage für ihre Mutter gewesen, wo für sie selbst? Dabei gehörten sie schon durch ihre Herkunft zu den vergleichsweise Privilegierten, hatten Zugang zu Sozialeinrichtungen in einem Staat, der medizinische Versorgung für alle garantierte. Doch es gab noch etwas, das zum Leben gehörte, in dem ihren aber fehlte: Ein Grund zu leben, der sich nicht auf andere bezog – nicht, für jemanden da zu sein, für sich selbst da zu sein. Wo war die Freude geblieben?
Hinter einem Bretterverschlag am Ufer rührte sich etwas. Anna schreckte zusammen. Ein Mann kroch unter einer Plastikplane hervor.
»Der Regen ist vorbei, was?«, sagte der junge Mann, den sie gestern in dem Lokal wahrgenommen hatte. Anna brachte noch kein Wort hervor. »Ich heiße Aro«, fuhr der Fremde fort. »Wir haben uns gesehen – Sie wissen schon –, als der Bär Sie gerettet hat.«
»Der Bär?« Anna wandte den Blick zum Schiffsbauch.
»In Ihnen finde ich noch kein Tier«, sagte Aro. »Das kommt vielleicht noch. – Oder auch nicht. Nicht jeder hat eines in sich.«
»Schützen Sie sich immer derart vor Regen?« Anna wies mit dem Kopf auf die Plastikplane.
»Ich bin erst gestern am Abend angekommen, hatte noch keine Zeit, mich um eine Unterkunft zu kümmern.«
»Stattdessen saßen Sie in einem Lokal herum?«
»Ich, äh …« Aro begriff, diese Ausflucht funktionierte nicht. »Also, genau genommen, ich bin finanziell nicht in der besten Situation. Aber ich bin jung und kräftig. Ich werde hier leicht eine Stelle finden. In dieser Stadt ist ja kaum jemand unter sechzig.«
»Damit könnten Sie recht haben.« Anna lächelte. »Und danke für das Kompliment.« Aro zuckte mit den Schultern, lächelte ebenfalls.
»Sorry.«
»Schon gut. Der ›Bär‹, wie Sie ihn nannten, scheint auch ein Neuankömmling zu sein. Man kennt sich hier.«
»Keine Ahnung. Der hat Sie wohl beeindruckt. Kein Wunder! Bären sind eindrucksvolle Tiere.«
»Und was sind Sie? Eine Schnecke?«
»Wieso das?«
»Sie kriechen nach dem Regen aus Ihrem Versteck, tragen Ihr ganzes Hab und Gut mit sich.«
»Ich sehe mich als Prediger der Leoparden, aber ich habe auch eine besondere Beziehung zu Amphibien.«
»Gut, ich nehme die Frösche«, sagte Anna. »Vielleicht bringen sie ja Glück.« Sie drehte sich zur Straße. »Ich überlasse Sie wieder den Gewalten der Natur, junger Mann.« Sie knöpfte den Kragen der Pelerine zu, ba lancierte zwischen den Lachen den Uferweg entlang in die Stadt.
»Wolf!«, rief Aro Anna hinterher. »Ich wäre gern ein Wolf. Das ist mein Ziel.« Anna wandte sich ein letztes Mal um, winkte dem jungen Mann zu, lächelte, zog die Pelerine am Hals zusammen. Es regnete wieder.
***





























