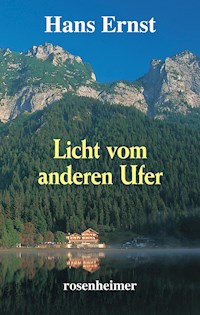
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den letzten Kriegstagen versteckt die hübsche Anna den amerikanischen Soldaten Oliver in einer einsamen Almhütte. Die beiden verlieben sich, obwohl Anna eigentlich den Sägewerksbesitzer Thomas heiraten soll. Doch nach Kriegsende muss Oliver nach Japan, und für Anna beginnt ein schwerer Weg ohne ihren Liebsten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 1998
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: Michael Wolf, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54744-7 (epub)
Worum geht es im Buch?
Hans Ernst
Licht vom anderen Ufer
In den letzten Kriegstagen versteckt die hübsche Anna den amerikanischen Soldaten Oliver in einer einsamen Almhütte. Die beiden verlieben sich, obwohl Anna eigentlich den Sägewerksbesitzer Thomas heiraten soll. Doch nach Kriegsende muss Oliver nach Japan, und für Anna beginnt ein schwerer Weg.
Kein Laut war an dem schönen Frühlingsmorgen zu hören. Die Nebel hatten sie gelichtet und die Bergspitzen lagen in der klaren Luft. Uber dem Goldenen Grund schien die Sonne und ließ die weißen Mauern des Grundhofes vor dem dunklen Fichtenwald wie carrarischen Marmor schimmern.
Lautlos zogen die beiden Goldfüchse des Grundhofers den Pflug durch den Acker. Nur die Pferdegeschirre knarrten leise und einmal kam der laute Ruf eines Kuckucks aus dem Wald. Die Mondsichel stand blass am morgendlichen Himmel, dann hörte man vom Dorf herüber dünn die Wandlungsglocke läuten, die einzige, die sie in Blockstein noch hatten. Die anderen hatte man heruntergeholt, um sie in Torpedorohre zu verwandeln. Drei Stück hatte man aus dem Turm geholt, aber als man sie abtransportieren wollte, waren es nur noch zwei. Die große St.-Josefs-Glocke war verschwunden, und zwar spurlos verschwunden.
Das war ein Aufruhr damals. Das ganze Dorf war scharfen Verhören ausgesetzt gewesen. Aber alle hatten geschwiegen. Sie wussten einfach nichts. Der Hakl von Reit saß ein halbes Jahr in Untersuchungshaft – praktisch stellvertretend für das ganze Dorf. Auf Hakl von Reit lag der größte Verdacht. Aber es war nichts aus ihm herauszubringen gewesen. Die Glocke blieb einfach verschwunden.
An all das dachte der Grundhofbauer Peter Rauscher, als er die Wandlungsglocke läuten hörte. Seine Fäuste hielten die Pflugsterze umklammert. So setzte er Fuß vor Fuß, den Kopf mit dem grauen Haar leicht gesenkt. Er war ein großer, kräftiger Mann, bald sechzig Jahre alt. Sein Gesicht war hager, doch dabei von einer gesunden Röte. Die grauen Augen maßen zuweilen die Linie der Furche, um zu überprüfen, ob sie auch schnurgerade verlief.
Hinter ihm legten sie die Kartoffeln ein. Die beiden kriegsgefangenen Franzosen Jean und André, die Polin Natascha, Anna, die Tochter des Grundhofes, und Emma Brommesberger, eine junge Tagelöhnerin, die sonst im kleinen Gemeindehaus in Blockstein wohnte.
Immer höher stieg die Sonne. Anna schob das Kopftuch in den Nacken und streckte für ein paar Minuten den Rücken gerade. Ihr Blondhaar glänzte in der Sonne. Anna war groß und schlank und hatte das schmale Gesicht ihres Vaters. Nur ihre Augen schimmerten mehr ins Bläuliche.
Neben ihr erschien Emma wie das Kind einer südländischen Rasse. Sie war klein und schmal. Ihr Haar war schwarz und borstig wie das Gefieder eines Raben. Beim Sprechen stieß sie ein bisschen mit der Zunge an und das war schade, denn ihre Stimme war dunkel und von einem schönen Klang. Wie bei allen, die sich nicht dazugehörig fühlen, war ihr Herz von einer drängenden Sehnsucht nach Liebe erfüllt, nach Geborgenheit und Wärme. Und wenn es nicht so streng verboten gewesen wäre, so hätte Emma dem kleinen, blassen Franzosen Jean gerne etwas mehr geschenkt als nur dieses schüchterne Lächeln unter gesenkten Brauen hervor. Sie war voller Mitleid für diese Menschen. Aber sie durfte nicht einmal die Hand heben, um über die gefurchten Stirnen zu streicheln. Einen Hund durfte man streicheln, aber diese Menschen nicht. Das wäre ein Verbrechen gewesen in dieser Zeit. In der Kreisstadt hatten sie deswegen wie in früheren Jahrhunderten einem Mädchen die Haare abgeschnitten und es an den Pranger gestellt. Emma dachte zwar, dass es um ihren zerzausten Haarschopf nicht schade wäre, aber vor dem Pranger hatte sie Angst.
Nein, Emma war kein Mädchen, das den Burschen schlaflose Nächte bereitet hätte. Keiner klopfte an ihr Fenster, obwohl sie sehnsuchtsvoll darauf wartete. Sie hätte nur ein bisschen etwas von dem gebraucht, was Anna an Anziehendem hatte. Zu der sah sie auf wie zu einer unerreichbaren Idealgestalt. Anna brauchte gewiss ihrem Nachtgebet nicht hinzufügen: »Lieber Gott, wenn du es machen kannst, dann schenk mir auch einen Burschen, den ich mögen kann.«
Ja, so betete Emma jeden Abend und fügte ihrer Bitte noch ein paar Einschränkungen hinzu. »Es muss ja nicht gleich ein Prinz sein«, bettelte sie. »Bloß brav soll er sein und nicht ganz so arm wie ich. Ein Häuschen, wenn es sein könnte, oder einen kleinen Bauernhof ...«
Aber bisher waren ihre Bitten noch nicht erhört worden und Emma sah ihr Leben schon vorgezeichnet bis ins Alter hinein. Solange sie konnte, würde sie auf den Höfen der Bauern arbeiten, die sie jeweils brauchten. Und wenn sie nicht gebraucht würde, dann saß sie in ihrem Stübchen mit den alten Möbeln, die die Mutter ihr hinterlassen hatte, die auch nur Erntehelferin gewesen war.
Am liebsten ging Emma zum Grundhof. Dort war man immer gut zu ihr gewesen. Dort ließ man sie nie fühlen, dass sie arm war, und Anna schenkte ihr über den Tagelohn hinaus oft einen Spenzer, einen Rock oder ein Paar Schuhe. Sonst aber war Emmas Leben ohne jeden Glanz. Mit schmerzendem Rücken kehrte sie abends in ihr Stübchen zurück und verbrachte einsam ihre Abende.
Der Bauer wendete den Pflug, stieß ihn nochmals in die Erde und spannte dann den linken Zugstrang aus.
»Brotzeit!«, schrie er über den Acker. Dann setzten sich alle in den Schatten der Haselnussstauden am Fuß des Hügels, der sich mit sanften Schwingungen hinunterzog bis ans Ufer der Riss, die weit hinter dem Goldenen Grund entsprang und die Gemeinde mit Strom versorgte. Sie trieb auch das Sägewerk Staffner und die Mühle am westlichen Dorfausgang an. Im Gasthaus »Zu den vier Aposteln« gab es zuweilen Forellen aus der Riss. Jetzt freilich nicht mehr für die gewöhnlichen Sterblichen, sondern nur für die »Herren dieser Zeit«, die den Draht von der Kreisstadt her spielen ließen und sich zum Forellenessen anmeldeten. Diese Herren tranken dann auf den Sieg und hatten blank gewichste Schaftstiefel an.
Hier unter der Haselnussstaude hatte niemand blank gewichste Stiefel an, sondern derbe Lederschuhe, an denen Erde klebte. Die Emma hatte bloß Holzpantoffeln an. Man aß auch keine Forellen zur Brotzeit, sondern nur trockenes Brot. Dazu tranken alle bitter schmeckendes Dünnbier.
Der Wind kam lau aus dem Goldenen Grund, der seinen Namen von einer Sage herleitete, wonach dort hinten ein goldener Sarg mit einem erschlagenen Abt vor vielen hundert Jahren tief in der Erde vergraben worden sei. Aber es war noch keinem vergönnt gewesen, auf diesen Sarg zu stoßen, obwohl sie zuweilen nach ihm gegraben hatten, heimlich oder offen. Zuletzt der junge Matthias Rauscher, bevor man ihn, ein halbes Kind noch, zu den Soldaten geholt hatte.
Schweigend saßen sie im Halbkreis beisammen. Es war eine stille Stunde und jeder hing seinen Gedanken nach, die bitter waren und manchmal weit abschweiften, bis sie doch wieder hier zusammenströmten im Schatten der Haselnussbüsche. Es war, als hielte ein stählerner Ring sie alle umklammert. Niemand konnte aus diesem Kreis ausbrechen. Jean und André konnten nicht nach Westen gehen und Natascha nicht nach Osten. Sie konnten höchstens die Köpfe heben und lauschen, ob der Klang der Freiheit nicht schon in den Lüften rausche. Und sie konnten auf ihre Herzen horchen, ob sie schneller schlugen bei dem Gedanken, dass mit jedem Tag die Freiheit näherkam, obwohl auch das niemand auszusprechen wagte, weil es ein Verbrechen war, am Endsieg zu zweifeln.
Peter Rauscher dachte an seinen Sohn Matthias, der im Westen stand, und Anna schickte ihre Gedanken nach Bingen am Rhein, von wo sie aus einem Lazarett vor vier Wochen eine Nachricht von Thomas Staffner erhalten hatte. Vielleicht lebte er schon nicht mehr. Vielleicht war er gestern an seiner schweren Verwundung gestorben. Gestern oder heute Morgen oder gerade jetzt, in diesem Moment. Sie sah sein ernstes, gutmütiges Gesicht vor sich und dachte, dass es für alle schwer sein würde, wenn er nicht mehr käme. Schwer für seine alten Eltern, schwer auch für sie, denn sie war diesem ruhigen, gesetzten Menschen recht zugetan. Nein, es war keine flammende, verzehrende Liebe, nur ein stilles Gefühl von Geborgensein in seiner Nähe. Anna Rauscher war viel zu herb und zu kühl in ihrem Wesen für eine tiefe Leidenschaft. Oder es war noch nicht der Richtige gekommen. Sie wusste, dass ihre Eltern es gerne sähen, wenn sie Sägemüllerin würde. Dagegen hatte sich immer etwas in ihr aufgelehnt und manchmal war sogar etwas wie eine zornige Abneigung über sie gekommen, weil Thomas Staffner es wie eine Selbstverständlichkeit hinnahm, was seine Eltern über ihn beschlossen haben mochten.
»Der Vater und die Mutter sind halt der Meinung«, hatte er einmal gesagt, »dass du gut in die Sägemühle passen würdest.«
»So?«, hatte sie gefragt und ihn mit schmalen Augen angesehen. »Und deine Meinung? Wie ist die?«
Ganz verwundert hatte er sie angesehen. »Das musst du doch wissen, dass ich dich für mein Leben gern hab.«
Ich merke nichts davon, hatte sie sagen wollen. Aber sie verschwieg es und wartete, dass er sie in die Arme nähme. Aber er hatte nicht den Mut dazu. Diesen groß gewachsenen Menschen fiel eher ein leichtes Zittern an, hinter dem sich seine ganze Scheu verbarg, als dass er sie leidenschaftlich umarmt und geküsst hätte. O ja, Anna Rauscher sehnte sich oftmals unsagbar danach, begehrt zu werden, fortgetragen zu werden von einer hohen Welle des Glücks. Und weil Thomas dies nicht verstand, war sie ihm immer ferner gerückt, bis zu dem Tag, an dem er in den Krieg musste.
Unterm Halbmond hatten sie an der leise rauschenden Riss gestanden und es war wohl das Mitleid, das sie zwang, sein Gesicht mit ihren Händen zu umschließen, um die ungeheure Traurigkeit aus ihm fortzunehmen.
»Bleibst mir treu, Anna?«, hatte er gefragt.
Sie hatte genickt, weil sie nicht wusste, was Untreue ist, und weil sie dachte, dass es ihm das Fortgehen etwas erleichtere. Das andere war jetzt sowieso nicht mehr spruchreif. Erst musste der Krieg vorbei sein.
»Komm nur gesund wieder heim«, sagte sie und sie war froh vor sich selber, dass dieser Wunsch ihr aus ehrlichem Herzen kam. Thomas aber nahm es als Versprechen, dass sie voller Sehnsucht auf ihn warten werde. Mit diesem Glauben im Herzen war er gegangen und Anna wartete vergebens darauf, dass er in seinen spärlichen Briefen einmal die Worte finden würde: »Ich hab dich lieb.«
Nein, das konnte Thomas einfach nicht schreiben. Es war nicht seine Art und Anna dachte, dass der Krieg ihn vielleicht doch noch zum Mann formen werde oder dass sie sich mit dem Los abfinden müsse, nicht aus einer himmelhoch jauchzenden Liebe heraus zu heiraten.
Aber da sie ihm Treue versprochen hatte, verschloss sie sich anderen Werbungen. So kam es, dass sie als stolz verschrien wurde, obwohl sie doch alles andere als hochmütig war. Sie waren eben so, die Rauschers, wie sie sein mussten, ein zäher Schlag in allen Dingen, mit einem strengen Maß an Selbstdisziplin, heftig aufbegehrend, wenn es sein musste, und gerecht, wenn Unrecht aufstehen wollte, jenes schreiende Unrecht der Zeit, in der schon das Abhören eines fremden Senders ein Verbrechen war, das mit dem Tod bestraft wurde. Und weil die Rauschers so waren, darum hatten sie es nicht leicht. Und weil sie es nicht leicht hatten, darum waren sie vorsichtig. Wenn der Rauscher spät am Abend an seinem Radio drehte, stand Anna draußen Posten. Gestern hatten sie ein Schwein ohne Schlachtschein geschlachtet, und zwar um zwei Uhr früh, weil nicht anzunehmen war, dass sich da noch jemand herumtreibt. Am wenigsten der Polizeikommissar Frankenberg, den man im ganzen Tal »General Franko« nannte. Er war alt und müde geworden, ein Mann, der anfing, den Glauben an ein gutes Ende zu verlieren und den der Heldentod seines Lieblingssohnes schneeweiß hatte werden lassen.
Nein, Franko war weniger zu fürchten. Schon eher der Urban Loferer, den man weithin den »Schleicher« nannte. Kein Mensch wusste eigentlich, warum er nicht Soldat hatte werden müssen. Er war einfach immer unentbehrlich, tat vielerlei Dienste, die Spitzeldiensten nicht unähnlich waren. Er hatte die Fleischbeschau vorzunehmen, das Milchmessen, den behördlich genehmigten Holzeinschlag. Ferner hatte er die Aufsicht darüber, dass die Bauern ihr Ablieferungssoll erfüllten, und er wurde in einer geheimen Liste als »Vertrauensmann« geführt.
Unter seiner niederen Stirn blickte ein Paar kleine, grünlich schillernde Augen in die Welt. Um seinen schmalen Mund spielte fast immer ein überlegenes Lächeln, das Satanslächeln einer zwiespältigen Natur, die hinter allem etwas Verdächtiges witterte.
Gerade als die Grundhoferleute ihre Brotzeit beenden wollten, bog der Schleicher wie aus dem Erdboden gewachsen um die Haselnussstauden. Er trug einen grauen, abgeschabten Lodenanzug und einen grünen, verwaschenen Hut mit einer Spielhahnfeder. Niemand hatte ihn kommen hören. Der Rauscher runzelte die Brauen, in seinen Fäusten zuckte es und er hätte am liebsten geknurrt: Schleichst schon wieder umeinander, du Gauner? Aber er wusste, wie gefährlich dieser Urban Loferer werden konnte und verschluckte seinen Ärger.
Mit dem sonnigsten Lächeln der Welt strich der Schleicher sein dünnes Bärtchen auf der Oberlippe. In seinen Augen aber war ein eiskaltes, tückisches Glitzern.
»So ist’s recht«, sagte er mit seiner dünnen Fistelstimme. »Schön einträchtig sitzen sie beim Rauscher wieder bei der Brotzeit beieinander. Deutsche, Franzosen und Polen. Ganz nah beieinander wie eine Familie.«
»Ganz recht, wie eine Familie«, antwortete der Rauscher und trank den Rest aus seiner Bierflasche.
»Du weißt aber doch, dass das verboten ist. Aber der Herr Rauscher kümmert sich ja nie um das, was verboten ist. Der Herr Rauscher macht sich seine Gesetze selber.« Die flinken Augen des Schleichers huschten über die Gesichter der beiden Franzosen und blieben an der Polin Natascha hängen. »Was seh ich denn da? Wo hat denn der Trampel sein ›P‹ wieder?« Ruckartig stieß er sein schmales, verlebtes Gesicht vor wie ein Raubvogel. »Weiß du vielleicht nicht, dass du das tragen musst? Aber natürlich, der Herr Rauscher kümmert sich ja tun nichts. Da werd ich halt einmal eine Meldung machen müssen.«
Langsam war der Rauscher aufgestanden und zog jetzt seine Hose am Bund hoch.
»Tu, was du nicht lassen kannst. Es wäre ja nicht das erste Mal.«
»Und das musst ausgerechnet du sagen. Hab ich dich vielleicht schon einmal angezeigt?«
»Weil ich dir noch keine Gelegenheit gegeben habe.«
»So, meinst du?« Loferer zwinkerte mit dem linken Auge in einer Art schlampiger Vertraulichkeit. »In welcher Einbildung du lebst! War mir doch, als hätte ich heute Nacht so um zwei Uhr herum eine Sau plärren hören. Wenn mich nicht alles täuscht, war das im Goldenen Grund. Aha, jetzt schießt dir die Farbe ab. Also, nur nicht gar so großmaulig sein. Es kostet mich nämlich bloß ein Wort.«
»Und Beweise«, sagte der Rauscher mit engem Atem.
»Die lassen sich finden.«
Der Rauscher konnte nichts mehr antworten. Es war die Furcht, die ihn schweigen ließ, die Furcht eines Mannes, der in seinem ganzen Leben nie Angst gehabt hatte. Er schämte sich vor Anna, vor den Franzosen, vor der Polin und vor Emma. In diesem Augenblick trat Anna zwischen ihn und Urban Loferer. In ihren Augen glühte eine dunkle Flamme.
»Und das muss mein Vater sich von dir gefallen lassen«, schrie sie, lodernd vor Zorn. »Wer bist denn du schon? Ein hergelaufener Kerl, ein Spion, ein Schleicher, einer, der dem Herrgott den Tag stiehlt, während andere in deinem Alter im Krieg fallen.«
»Anna«, sagte der Rauscher warnend.
»Ach was, lass mich Vater. Ich könnte keine Stund ruhig schlafen heute Nacht, wenn ich dem die Meinung nicht einmal sagen könnte. Das brennt mir schon lange auf der Zunge. Regt der Kerl sich auf, wenn wir hier gemeinsam bei der Brotzeit sitzen. Du hast dir ja noch keine verdient. Was tust denn du schon? Umeinanderschleichen und anständige Leute aushorchen.«
Loferer war grau geworden im Gesicht. »Noch ein Wort, dann ...«
»Dir sag ich noch mehr, wenn du es haben willst. Aber die Zeit ist zu schade, um sie mit dir zu verschwenden. Kommt Leute, wir müssen Kartoffeln legen.«
Mit schmalen Augen starrte der Schleicher hinter der Gruppe her.
»Wart nur, das zahl ich dir heim, du hochmütiges Luder. Auf den Knien sollst du mich noch bitten. Aber dann zeig ich dir, wer wem was zu sagen hat.«
Den Hut aus der Stirn schiebend, stelzte er mit seinen dürren Beinen über die Wiesen hinunter ins Dorf, blieb eine Weile auf der hölzernen Brücke stehen, die über die Riss führte, und suchte dann sein Stübchen auf.
Am Nachmittag dieses Tages ging der Rauscher auf seine Niederalm, die auf der anderen Seite der Riss in einer breiten Mulde im Fichtenwald lag. Das Futter war in diesem Jahr schon sehr knapp geworden, und wenn da oben schon einigermaßen Gras gewachsen war, dann sollte Anna gleich in den nächsten Tagen mit einem Teil der Herde hinaufziehen.
In seinem Innern loderte immer noch die Wut über die Auseinandersetzung mit dem Schleicher am Vormittag. Die Wut und die Ohnmacht darüber, dass man in dieser Zeit wie ein lästiger Wurm zertreten werden konnte, wenn man sich mit den Mächtigen auf Auseinandersetzungen einließ. Er selber hatte sich ja mühsam beherrscht. Aber Anna war aus dem Rahmen gefallen, und darum war es vielleicht ganz gut, wenn sie in den nächsten Tagen auf die Alm zog, weg aus dem Blickfeld dieses verdammten Schleichers, von dem man nie wusste, was er wieder ausspionierte. Zunächst rechnete der Rauscher mit einer Hausdurchsuchung, die nichts ergeben würde, denn es war ja nicht schwer, eine geschlachtete Sau so zu verstecken, dass nichts davon zu finden war, wenn man nicht einmal eine zwölf Zentner schwere Glocke gefunden hatte.
Außerdem war damit zu rechnen, dass der Schleicher jetzt noch mehr im Goldenen Grund herumspionieren würde. Also musste der Bauer noch vorsichtiger sein, wenn er im Radio die Wahrheit hören wollte, er musste in Zukunft lieber die erfolgreichen Rückzugsbewegungen schlucken als sich über den siegreichen Vormarsch der anderen zu freuen. Es war ja nicht ratsam, kurz vor Schluss noch den Kopf zu riskieren.
Überall drang der Frühling schon mächtig aus der Erde. Die jungen Fichten setzten schon die hellen Triebe an, und als dem einsamen Wanderer ein Wiesel über den Weg lief, sah er, dass es nicht mehr weiß war, sondern schon braune Flecken hatte. Das war ein Zeichen, dass die warme Jahreszeit kam.
Nach einer knappen Stunde sah der Rauscher seine Almhütte vor sich. Es war ein fest gemauerter Bau, schon fast ein kleiner Hof. Die Fensterläden waren dicht geschlossen und mit breiten Eisenbändern zusätzlich gesichert. Genauso die Türen. Niemand war in der langen Zwischenzeit dort gewesen, wie im Vorjahr, als zwei flüchtige englische Gefangene die Hütte aufgebrochen und sich darin acht Tage versteckt hatten, bis ihnen der Schleicher auf die Spur gekommen war. Für diese Heldentat hatte man dem Schleicher das Verdienstkreuz I. Klasse verliehen und ihn als leuchtendes Beispiel hingestellt und als eine verlässige Stütze des Staates.
Der Rauscher setzte sich auf die Bank vor der Hütte, legte den Hut neben sich und fuhr sich mit der Hand über die feuchte Stirn. Ringsum war tiefer Friede. Nur einmal hörte man einen Specht seinen rasenden Wirbel ins Holz schlagen. Und ringsum war das Gras schon handbreit hoch geschossen. Wenn man es recht betrachtete, so war alles um acht Tage früher daran, gerade so, als ob die Natur wüsste, dass heuer das Futter in den Tennen schon recht knapp geworden war.
Ach ja, dachte der Bauer vom Goldenen Grund, es wird dann doch alles wieder recht. Und bald muss auch dieser unsinnige Krieg sein Ende finden. Dann konnte man auch mit diesem Schleicher ein deutliches Wort reden. Man brauchte sich nicht mehr vor ihm zu ducken, wenn seine Macht zerbrach und das zum Vorschein kam, was er in Wirklichkeit war, ein Narr, der in normalen Zeiten nur ein mitleidiges Lächeln wert war, bei dessen Anblick einem die Schamesröte aufsteigen musste, weil man vor einem solchen Jammerburschen sich einmal geduckt hatte, als die Macht hinter ihm stand.
Eigentlich konnte der Rauscher sich gar nicht vorstellen, dass einmal wieder normale Zeiten kämen und dieser ungeheure Druck sich von den Menschen löste und die kleine Glocke auf dem Kirchturm zu Blockstein nicht mehr so jämmerlich ängstlich die traurige Kunde über die Dächer hinbimmeln musste, dass wieder einer für »das Reich« gefallen war. Wie es wohl sein musste, am Morgen nicht mehr mit dem schweren Druck auf dem Herzen aufzuwachen, mit der bösen Angst, ob heute nicht in den Goldenen Grund der Bote käme mit der Nachricht, dass nun auch der Gefreite Matthias Rauscher im Krieg gefallen sei. Er sprach zu niemandem über seine Angst davor, um all seine Hoffnungen betrogen zu werden. Auch zu seiner Frau Barbara nicht, obwohl sie von der gleichen Bedrängnis erfüllt war. Aber es war wie ein stilles Einverständnis, dass sie auch nicht darüber sprachen, wenn sie stundenlang wach lagen. Er sah in sie hinein, sah ihr Haar langsam ergrauen, das bis über die Fünfzig hinaus immer noch ganz dunkel gewesen war und nur ein paar graue Fäden gezeigt hatte. Und er sah auch, wie sie oft und oft mit angstvollen Blicken über den Goldenen Grund hinaussah auf den Weg, der zum Dorf führte, ob nicht jemand daherkäme, von dem man wusste, dass er schlechte Botschaft bringen könnte.
Zweiundzwanzig Jahre war Matthias Rauscher nun alt. Seit drei Jahren war er Soldat und seine letzte Nachricht war kurz nach Weihnachten, nach der missglückten Ardennenoffensive, gekommen. Seitdem hatten sie kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten. Das Haar der Mutter wurde mit jedem Tag grauer, aber ihr Mann sagte es ihr nicht, wie auch sie verschwieg, dass sein Haar unter der gleichen Sorge vom Schimmelgrau ins Weiße wechselte.
Seufzend erhob er sich, sperrte die Tür auf und trat ein. Es war alles noch in Ordnung. Nur Spinnweben hingen in den Ecken und eine Maus hatte ein Loch in das Sofakissen gefressen, das unter dem Herrgottswinkel auf der Bank lag.
Im Stall war noch alles so, wie sie es im Spätherbst verlassen hatten. Die Ketten lagen im blank gescheuerten Barren und die Streu war aufgeschichtet.
Morgen konnte also Anna mit der Herde hier heraufziehen und für die nächsten sechs Wochen hier bleiben. Dann erst konnte der Auftrieb zur Hochalm erfolgen.
Mit ein paar müde blinzelnden Sternen lag die Nacht über den Häusern und Höfen von Blockstein. Kaum wahrnehmbar hörte man das leise Plätschern der Riss. Ein weinerlicher Wind strich durch die Bäume am Kirchberg und einmal jaulte ein Kater die Not seiner Liebe durch die rabenschwarze Finsternis. Kein Lichtschein fiel aus den abgedunkelten Fenstern, und wenn aus den »Vier Aposteln« nicht gelegentlich die Stimmen vom Stammtisch geklungen wären, hätte man annehmen können, dass bereits Mitternacht wäre und alles schliefe. Aber es war erst neun Uhr, am zweiten Mittwoch im April.
In ihrem Stübchen saß Emma Brommesberger und nähte an einem Kittel. Das Licht der Lampe fiel auf ihr zerzaustes Haar. Die Finger führten flink die Nadel und ein Wecker, der auf der Kommode stand, tickte die Sekunden in die Stille.
Auf einmal fuhr Emma zusammen. Hatte es nicht am Fenster geklopft? Sie hielt den Atem an und horchte.
»Ist jemand draußen?«
»Ja, mach auf.«
Weil Emma die Stimme des Schleichers erkannte, beschloss sie nicht aufzumachen. Aber da hörte sie bereits den Schritt im Gang. Die Haustür war ja selten zugesperrt, weil im oberen Stockwerk noch der alte Flickschuster Haberl wohnte, der um diese Zeit noch in den »Vier Aposteln« saß.
Urban Loferer rüttelte an der Zimmertür.
»Mach doch auf, ich tu dir doch nichts«, sagte er mit betonter Freundlichkeit, aber doch so, als habe er ein Recht, eingelassen zu werden. »Brauchst doch keine Angst zu haben.«
Die Emma schob den Riegel zurück. »Ich hab keine Angst.«
»Das hoff ich auch nicht«, antwortete der Loferer und huschte in das Zimmer. Er legte seinen Lodenumhang, den er über der Schulter getragen hatte, über die Stuhllehne und rieb sich die Hände.
»Nett hast es hier. Und so schön warm.«
»Es ist draußen auch nicht kalt.«
»Sag das nicht. Es geht ein ganz frischer Wind. Darf ich Platz nehmen?«
»Hock dich nur nieder. Was willst du?«
»Höhö, nur keinen so patzigen Ton. Das mag ich nicht. Immer schön freundlich sein zu mir.« Er nahm umständlich Platz und zündete sich eine Zigarette an. »Wirklich gemütlich hast du es hier.« Er sah sich in dem kleinen Raum um und nickte anerkennend. »Und alles blitzsauber. Das hätt ich dir gar nicht zugetraut.«
Emma strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Dann lehnte sie sich gegen die Kommode und verschränkte die Arme über der Brust.
»Jetzt möcht ich wissen, was du von mir willst.«
»Ich von dir?« Er sah sie mit strengem Ausdruck an. »Nichts! Obwohl, wenn du nicht dein Arbeitsgewand trägst, schaust du gar nicht so übel aus. Wirklich, du müsstest ein bissl mehr auf dich halten. Dann könnt’s leicht sein, dass ich Appetit bekäm.«
Die Emma lachte laut heraus. Und dieses Lachen machte sie irgendwie schön. Sie bekam zwei Grübchen in die Wangen und ihre schwarzen Augen hatten einen seltsamen Glanz. Der Loferer bekam größere Augen und schluckte.
»Tatsächlich, heut seh ich dich zum ersten Mal anders.«
»Der Herr Schleicher hat mich halt noch nie richtig angeschaut.«
Er runzelte die Stirn. »Loferer heiß ich, das bitt ich mir aus. Oder musst du auch die Dummheit der anderen nachplappern? Ich weiß schon, wer mir den Namen angehängt hat. Aber mit dem rechne ich schon noch ab.«
»Dann musst mit dem ganzen Dorf abrechnen, weil es alle sagen.«
Es blieb eine Weile still. Nur der Wecker tickte. Der Loferer war auf einmal nachdenklich geworden. Es war, als horche er in sich hinein und denke darüber nach, dass niemand ihn mochte. Sie taten ihm schön ins Gesicht, weil sie Angst vor ihm hatten. Allerdings auch nicht alle. Die Anna vom Goldenen Grund zum Beispiel. Oh, wie die Schmach noch immer an ihm brannte, die sie ihm heute Vormittag bei den Haselnussstauden angetan hatte. Und er konnte es ihr nicht heimzahlen. Wenigstens noch nicht.
Achtlos klopfte er die Asche seiner Zigarette auf den Boden.
»Ferkel«, sagte Emma mit sprödem Klang in der Stimme. »Siehst den Aschenbecher dort auf dem Tisch nicht?«
Er lachte belustigt auf und musterte sie wieder mit staunenden Augen. »Teufel! Du gefällst mir immer besser. Ferkel sagt sie zu mir! Komm, setz dich her zu mir. Ich möcht dich was fragen.«
Emma stieß sich von der Kommode ab und setzte sich ihm gegenüber auf die Bank, stemmte die Ellbogen auf den Tisch und legte den Kopf in die Fäuste. »Frag«, sagte sie hart.
»Na, na! Musst du mich denn gleich anbellen wie ein Hund? Kann man mit dir überhaupt nicht vernünftig reden?«
»Was kann von dir schon Vernünftiges kommen?«
Loferer drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und lehnte sich weit in den Stuhl zurück. »Ich seh schon, du bist auch verhetzt. Und das ist schad, denn dich hab ich immer recht gut leiden können.«
Emma sah ihn unentwegt an, so durchdringend, dass er seinen Blick senken musste. Seine letzten Worte ließen sie aufhorchen. Sie waren über sie hingegangen, wie im Frühling ein leiser Wind die jungen Ähren eines Kornfelds streichelt.
»Ist das wahr, Loferer?«
Loferer verbarg ein Lächeln und legte Kummer in seinen Blick. »Auf mein Wort, Emma. Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon von dir geträumt hab.«
»Wirklich?« In ihre Augen war eine scheue Neugier gekommen.
Der Loferer, mit allen Wassern gewaschen, merkte sofort, dass seine Worte ein offenes Ohr fanden und strich sein Bärtchen. »Wenn ich es dir sag!«
Die Emma rückte die Ellbogen weiter auf den Tisch. »Was hat dir denn geträumt, Loferer?«
Tief schnaufend, beugte auch er sich weiter vor. Ihre Stirnen kamen sich ganz nahe.
»Genau weiß ich’s auch nicht mehr«, log er. »Auf alle Fälle war es recht schön. Soweit ich mich erinnern kann, hab ich mit dir irgendwo auf einer Bank gesessen – ich hab den Arm um dich gehabt und du hast dein liebes Köpfchen so vertrauensvoll an mich hingelehnt.« Plötzlich fasste er nach ihren Händen und hielt sie fest. »Schau, Emma, du bist ein armes Luder, und – was bin denn ich schon recht viel mehr? Könnten wir zwei denn nicht Zusammenhalten?«
Das Mädchen zog mit einem Ruck die Hände zurück. »Arm bin ich, ja, aber Charakter hab ich. Und das kann man von dir leider nicht sagen.«
Er biss sich auf die Lippen. »Du kennst mich eben nicht, wie ich wirklich bin.«
»Ja, du bist undurchsichtig.« Sie sagte es ganz trocken und lachte plötzlich laut. »Heut früh hat dir’s eine wenigstens richtig gesagt. Ich hätt mich kranklachen können dabei.«
Nur mit großer Mühe bezwang er seinen aufsteigenden Zorn und brachte es fertig, eine ergebene Duldermiene aufzusetzen. »Sie verkennen mich halt alle. Dabei mag ich die Anna wirklich gern. Zwar nicht so gern wie dich, aber sie war mir bisher nicht unsympathisch. – Arbeitest du eigentlich immer beim Grundhofer?«
Emma schüttelte den Kopf. »Morgen soll ich zum Lechner hoch.«
»So, so, zum Lechner. Aber beim Grundhofer ist doch ein gutes Arbeiten, oder?«
»Ja, beim Grundhofer helf ich gern aus.«
»Das Essen ist auch gut dort?«
»Recht gut sogar.«
»Fleisch ist halt überall wenig jetzt, weißt. Aber es kommen ja auch wieder bessere Zeiten, wenn wir den Krieg erst gewonnen haben.«
Hier lachte Emma wieder, aber er überhörte es geflissentlich.
»Die längste Zeit hat er ja schon gedauert«, sagte er.
»Ja, das glaub ich auch. Die Amerikaner sind ja schon über den Rhein.«
»Wer sagt dir denn das?«
»Das hört man halt so.«
»Ja, ja, ich weiß schon, das täten manche gern sehn. Aber da bleibt ihnen der Schnabel sauber. Kann ja sein, dass ein paar Männer rübergekommen sind übern Rhein. Er geht ja zur Zeit nicht recht hoch. Aber die werden schon bald wieder zurückgetrieben. Und wie. Unser Führer weiß schon, was er will.«
»Wer?«
»Unser Führer.«
»Ach so, der.«
»Brauchst gar nicht so spöttisch zu lachen. Aber dir nehm ich’s gar nicht übel, weil du ja geistig doch ein bissl beschränkt bist.«
»Was bin ich?«, fragte Emma und man sah in ihren Augen den Zorn glimmen.
»Nicht direkt, mein ich. Du weißt halt nicht, wie du dich ausdrücken musst.«
»Das kann schon sein. Aber jetzt weiß ich wenigstens, für was du mich anschaust.«
»Geh, nimm es doch nicht so wörtlich. Vorhin hab ich gemeint, wir zwei könnten uns ganz gut verstehn. Und wenn du dir’s genau überlegst – du hättest kein so schlechtes Leben bei mir, wenn der Krieg erst vorüber ist.«
»Wenn der Krieg vorbei ist, musst du abhaun, weil sie dich sonst erschlagen.«
Urban Loferer verfärbte sich. »Wer sagt denn das?«
»Das hab ich schon ein paarmal gehört. Zum ersten Mal, als du von allen am eifrigsten nach der verschwundenen Glocke gesucht hast.«
Loferer schlug nach einer Fliege an seiner Wange. »Weißt du vielleicht, wo sie ist?«
Emma schüttelte den Kopf. »Und wenn ich’s wüsst, dir tät ich es am allerwenigsten sagen.« Sie drehte den Kopf nach dem Wecker. »Halb zehn ist es schon. Jetzt musst gehn, ich möcht mich schlafen legen.«
Der Mann war mehr verdutzt als verärgert über ihre Art, wie sie ihn hinausbefördern wollte. Er lächelte. Als ob man ihn so einfach fortweisen könnte. Dieses Mädchen schien noch keinen Begriff davon zu haben, wie mächtig er war. Langsam stand er auf und schob sich zu ihr in die Bank, drückte sie bis in den Herrgottswinkel hinein, dass sie nicht mehr wegkonnte. Sein Gesicht war plötzlich wieder von jener Undurchsichtigkeit, die Angst einflößen konnte.
»Wenn du das Gutsein nicht verstehst, kann ich auch anders mit dir reden. Also, raus mit der Sprach. Der Grundhofer hat doch gestern Nacht ein Schwein geschlachtet.«
»Wie soll denn ich das wissen?«
»Weil es heut zu Mittag dort Schweinernes mit Kraut gegeben hat.«
»Das stimmt schon – aber«, platzte die Emma heraus und merkte sofort, dass sie in die Falle gegangen war. Sie wollte es noch etwas abschwächen und fügte hinzu: »Wahrscheinlich wird der Grundhofer einen Schlachtschein gehabt haben.«
»Eben nicht. Ich hab bereits nachgefragt auf der Gemeindekanzlei.«
Da wurden die Augen der Emma ganz schmal vor Verachtung. »Du bist doch ein ganz gemeiner Hund.«
Der Loferer zwirbelte sein Bärtchen. »Von dir nehm ich es hin, weil von dir sogar Frechheiten sich recht nett anhören. Wenn du mit der Zunge anstößt, das gefällt mir so gut, dass ich dir am liebsten ein Bussl geben möcht.«
Und schon hatte er den Arm um sie geschlungen. Er hatte nur nicht mit ihrer Behändigkeit gerechnet. Mit einem derben Stoß rückte sie den Tisch zurück und stand dann mitten in der Stube.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























