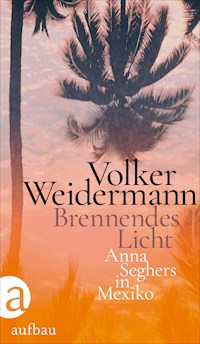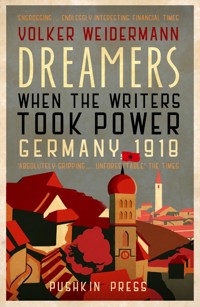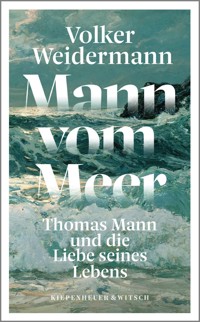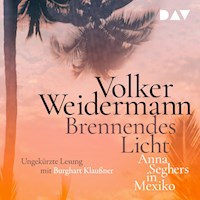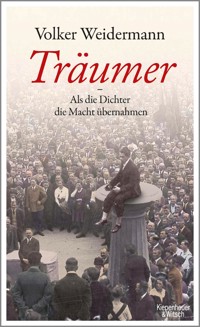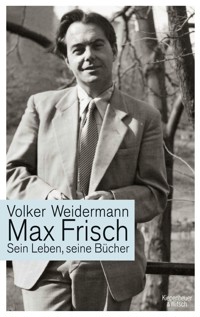9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wen soll man lesen, wen soll man lassen? Weidermanns Literaturgeschichte weiß die Antwort 60 Jahre, 135 Autorinnen und Autoren: Was für eine Zeit, was für eine Vielfalt! Mit frischem Blick, Leselust und Meinungsfreude wird hier die jüngste Epoche der deutschen Literatur gemustert, erzählt und sortiert. Volker Weidermann, Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hat dort angefangen, wo erstmal alles zu Ende war. Wie ging es los nach dem Krieg, wer war schon da, wer kam dazu, wer wollte zurück und was ist daraus geworden? Exilanten und innere Emigranten, alte Eminenzen und junge Wilde werden vorgestellt, mächtige Herren und kämpferische Frauen – ein Panorama der deutschen Literatur von der Stunde Null bis heute. Und ein Bild von der ungeheuren Dynamik, mit der sich die Literatur der Zeit entwickelt und verändert. Im Westen wird die Gruppe 47 gegründet und wieder zerlegt, im Osten der Sozialismus gefeiert und bekämpft, im Westen verkünden sie Innerlichkeit und Revolte, im Osten geht man den Bitterfelder Weg oder verlässt das Land. Es geht um vergessene Könner und vermessene Bekenner, große Erfolge und stille Triumphe – und um viele, viele einzelne Schicksale. Mit Leidenschaft, Humor und großem Wissen nimmt Volker Weidermann den Leser mit auf einen schnellen Streifzug durch die goldenen Jahre der deutschen Literatur, schlägt große und kleine Bögen, skizziert Einflüsse, Abhängigkeiten und Gegensätze und landet mit Christian Kracht, Judith Hermann, Feridun Zaimoglu, Daniel Kehlmann, Ingo Schulze u.v.a.m. in unserer Gegenwart. Vor allem und immer wieder zeigt er den einzelnen Autoren, der unbeirrt seinen Weg weitergeht. Und plötzlich will man unbedingt Gert Ledig lesen, oder Hubert Fichte, oder Max Frisch mal wieder – ein Buch der Überraschungen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
TitelVorwort1 – Wo waren sie am 8. Mai?2 – Verfall einer Familie – die traurige Geschichte der drei Manns3 – Wir kommen nicht wieder – die Amerikaner4 – Die West-Heimkehrer5 – Wir sind noch da!6 – Der Schriftstellerstaat7 – Einsame8 – Heilssucher, Religionsstifter9 – Konservative Wundermänner10 – Ein anderes Land11 – Von diesem schwarzen Punkt aus12 – Wir sind die anderen!13 – Schreiben statt kämpfen14 – Der Menschenfresser15 – Die Heiligen Drei Könige16 – Sechs Frauen17 – Gewaltdichter des Ostens18 – Ein fernes Land – eine ferne Literatur19 – Wir haben schlechte Laune20 – Vorbilder21 – Weltliteratur aus der Schweiz22 – Die Liebe von Ernst und Friederike23 – Wut im Süden24 – Der Witz. Die Welt. Die Wirklichkeit. Dichter in Frankfurt25 – Wahre Größe kommt von außen26 – Vom Ende der Welt27 – Die drei Goldjungs28 – Politik, Aufklärung, Verklärung29 – Sammler und Bewahrer, Mitschreiber, Dokumentaristen. Des Alltags. Der Geschichte. Der Sprache. Der Außenseiter. Des Ich30 – Jenseits des Ostens – die Grenzüberwinder31 – Kurz vor der Stille32 – Die Erzähler33 – Hass und Tanz und Wirklichkeit und LiebeNachwortDie Autoren und ihre WerkeTextnachweiseAngangBuchAutorImpressumVorwort
Vor etwa einem Jahr fand ich in einem Antiquariat ein kleines Buch mit dem Titel Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde. Ein herrliches Buch. Der deutsche Dichter Klabund hat es Anfang der zwanziger Jahre geschrieben. Auf weniger als hundert Seiten stürmt er darin durch die Geschichte der deutschen Literatur der letzten tausend Jahre. Vom Wessobrunner Gebet des Kaiserbiografen Einhart über Wieland, Goethe, Heine bis schließlich zu sich selbst wütet, lobt und preist er sich durch die Welt der deutschen Bücher und ihrer Autoren, dass es eine wahre Freude ist. Thomas Mann wird in zwei Zeilen erledigt, Goethe bekommt sieben Seiten Lob. Heute völlig vergessene Dichter der Jahrhundertwende werden wortreich empfohlen, wesentliche lässt er einfach aus. Es ist das subjektive Begeisterungsbuch eines echten Lesers, der Zusammenhänge entdeckt, dringend empfiehlt, einteilt, urteilt und verurteilt, wie es ihm gefällt. Keinen Professoren verpflichtet, keiner Schule und keiner Wissenschaft. Nur sich selbst.
Warum gibt es das nicht für unsere Zeit, habe ich mich gefragt, als ich Klabunds Buch las. Warum gibt es für die deutsche Literatur der sechzig Jahre nach dem Krieg anscheinend fast nur nörgelnde akademische Bedenkenträgereien, solide, germanistische Ausführlichkeitsbücher oder spezielle Untersuchungen einzelner Autoren, einzelner Gruppen, einzelner Jahrzehnte? Warum kein Buch, das mit Leidenschaft all die Jahre durchstreift, ohne dabei in erster Linie absolute Vollständigkeit, All-Gerechtigkeit und allseits abgesicherte Urteile im Blick zu haben? Warum?
Ich fand beim besten Willen keinen Grund, und also habe ich es selbst versucht. Natürlich ist es ein ganz anderes Buch geworden. Lächerlich, sich mit Klabund messen zu wollen. Lächerlich, etwas nachzuahmen, was einmalig ist und bleibt. Im Vergleich mit seinem Schnellfeuerbuch ist es geradezu ausufernd lang und ausführlich und umfasst dabei doch nur einen winzigen Zeitraum, wenn man die gesamte deutsche Literaturgeschichte im Blick hat. Aber es umfasst auch eine besonders interessante und aufregende Epoche, eine besonders vielfältige Zeit, in der in Deutschland, im Westen wie im Osten, in Österreich und in der Schweiz so viele disparate Schreibstile, so viele interessante Lebens- und Schreibentwürfe nebeneinander existierten wie in kaum einer Epoche zuvor. Schreiben gegen die Zensur und auf dem Bitterfelder Weg, Schreiben als Neuerfindung, als politischer Akt, als Selbstbefreiung und Kampf und Wahn und Glück. Und Leben.
Wie hängt das zusammen? Das hat mich immer interessiert. Das Leben und das Schreiben. Wo kommt einer her? Wie entstehen die guten und also notwendigen Bücher? In welchen persönlichen, politischen, gesellschaftlichen Zusammenhängen? Was ging da für ein Kampf voraus? Was ist das für ein Mensch, der dieses Buch geschrieben hat?
So ist ein Buch entstanden, das die Geschichte der letzten sechzig Jahre der deutschsprachigen Literatur in vielen einzelnen Porträts beschreibt, in Lebens- und in Werkporträts, die hoffentlich am Ende ein zusammenhängendes Bild ergeben. Am schwierigsten war die Auswahl der Autoren. Eine Literaturgeschichte ist ein ewig unabschließbares Projekt. Fast jeder, mit dem ich während der Entstehungsphase sprach, nannte mir einen ihm besonders am Herzen liegenden Schriftsteller, auf dessen Beschreibung er sich ganz besonders freue, und wie oft musste ich bekennen: »Oh, ich fürchte – der kommt leider gar nicht vor.« Es ist eine Auswahl. Ich halte sie für richtig, und niemand hat auf sie Einfluss genommen. Es war ein großes Glück, dass auch der Verlag Kiepenheuer & Witsch während der Entstehungszeit des Buches nie versucht hat, die Auswahl zu beeinflussen. Das ist für eine Literaturgeschichte die Voraussetzung, aber alles andere als selbstverständlich und für einen Verlag mit vielen deutschen Autoren bestimmt nicht leicht zu ertragen.
Aber nur so konnte das Buch in der vorliegenden Form entstehen. Die Geschichte einer der interessantesten und reichsten Epochen der deutschen Literatur.
1 – Wo waren sie am 8. Mai?
1
Wo waren sie am 8. Mai?
Wo sind die Hauptfiguren der deutschen Nachkriegsliteratur, als sie beginnt? Wo sind die deutschen Schriftsteller im Mai 1945? Wo sind die Alten? Die, die im Exil waren, und die Dagebliebenen? Wo sind die Jungen? Die Neuen, die noch gar nicht Schriftsteller sind, die noch gar nicht wissen, dass sie einst bedeutende Bücher schreiben werden? Wo sind sie in der Stunde Null? – Schreiben sie? Kämpfen sie? Warten sie?
Günter Grass kämpft. Er ist siebzehn Jahre alt und glaubt an den Endsieg. Um ihn herum sterben die letzten Kameraden. Grass zweifelt keine Sekunde an der Berechtigung des Krieges. Und als die Amerikaner ihm zusammen mit anderen deutschen Kriegsgefangenen das Konzentrationslager in Dachau zeigen, sagt einer der Mitgefangenen, ein Maurer, das sei alles frisch gebaut und in der letzten Woche erst fertig geworden – klingt plausibel. Grass jedenfalls glaubt nicht an diese KZ-Sache.
Auch die sechzehnjährige Christa Wolf ist bis zum Schluss überzeugt, dass die deutsche Sache noch nicht verloren ist. Und als sie am Ende ihrer Flucht von Landsberg nach Schwerin auf einen entlassenen KZ-Häftling trifft, fragt sie ihn, wie er denn da hineingekommen sei. Er sagt: »Ich bin Kommunist.« Und sie: »Aber deshalb allein kam man ja nicht ins KZ.«
Walter Kempowski, der später jede schriftliche Spur der Nazizeit besessen sammeln und in großen Büchern zusammenstellen wird, haben die Jungs von der HJ wegen Renitenz schon früh den Kopf rasiert. Im Januar wird er zu einer Kuriereinheit einberufen, doch als er im April noch von der SS rekrutiert werden soll, gelingt es ihm, das abzuwenden. Am Ende des Krieges wird er fast von einem russischen Soldaten erschossen, weil er in einer Rostocker Mineralwasserfabrik keinen Schnaps für ihn finden kann.
Der kleinste Widerstandskämpfer heißt Peter Rühmkorf. Er ist fünfzehn, als der Krieg zu Ende geht, schreibt in seiner Schülerzeitung anonyme Gedichte gegen den nazitreuen Direktor, ist Mitglied einer Kinderuntergrundorganisation, der »Stibierbande«, stiehlt SA-Bestände, was das Zeug hält, und als die Engländer nach Hamburg kommen, hängt er ein weißes Begrüßungsbetttuch aus dem Fenster. Da die Befreier den kleinen Rühmkorf aber nicht auf ihrer Widerstandsliste haben, betrachtet er auch die neuen Machthaber bald mit misstrauischem Blick.
Alfred Andersch, einer der wichtigsten Schriftsteller der ersten Nachkriegsjahre, sitzt seit seiner Desertion im Juni 1944 in einem Kriegsgefangenenlager am Mississippi mit Wasserschildkröten und Pelikanen unter Bäumen und redigiert die Literaturseiten der deutschen Kriegsgefangenen-Zeitschrift Der Ruf, aus deren Redaktion später in Deutschland die Gruppe 47 hervorgehen wird.
Erst mal jedoch wird er unter Erich Kästner für die gerade gegründete Neue Zeitung in Deutschland arbeiten, auch wenn Kästner schon früh feststellen muss, dass sein junger Redakteur parallel an seinem eigenen Projekt arbeitet. Kästner selbst, der während der Nazizeit in Deutschland geblieben war, dessen Bücher verboten waren, der aber Filmdrehbücher schrieb, ist zur Zeit des Kriegsendes zusammen mit sechzig Filmschaffenden im Zillertal unterwegs. Angeblich um zu drehen, doch da jeder wusste, dass es mit dem Krieg und mit diesem Deutschland nicht mehr lange gehen würde, hatten sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, einen Film in die Kamera einzulegen.
Auch der große Schweiger der Nachkriegsliteratur, Wolfgang Koeppen, war beim Film – weit weniger widerständig, als er das später glauben machen wollte. Er war NSDAP-Mitglied, und die letzten Kriegsmonate verbrachte er im Klubhaus eines schönen Hotels in Feldafing, wohin sich die Münchner Boheme zurückgezogen hatte. »Genießen wir den Krieg. Der Frieden wird fürchterlich«, war das Motto. Kurz nach Kriegsende kommt Klaus Mann vorbei, um Koeppen als Redakteur für eine neue Zeitung zu gewinnen. Die beiden verpassen sich.
Und Klaus Mann stürmt als Soldat der US Army atemlos durch das besiegte Europa. Keiner der Emigranten hat so entschlossen wie er gegen das Naziregime gekämpft. Jetzt stürmt er als Kriegsberichterstatter voran und voran. Interviewt den Kriegsgefangenen Hermann Göring und den einst bewunderten Komponisten Richard Strauss, besucht am Tag des Kriegsendes das zerstörte Elternhaus in München, in dem in den letzten Jahren anscheinend ein Lebensborn-Programm betrieben wurde, und sucht gute, einsichtige Deutsche für das Jetzt. Die Zeit danach. Kein deutscher Schriftsteller verbindet mit dem Ende des Krieges so große Hoffnungen. Niemand wird so bitter enttäuscht werden vom Nachkriegsland, von der Nachkriegswelt.
Das kann seinem Vater nicht passieren. Er, der fast Siebzigjährige, den Klaus so mühsam dazu hatte bringen müssen, mit dem offiziellen Deutschland zu brechen, sitzt im sonnigen Kalifornien und schreibt in sein Tagebuch: »Es sind rund eine Million Deutsche, die ausgemerzt werden müssten.« Seine Rede über die deutschen KZ wird am 8. Mai 1945 im amerikanischen Radio ausgestrahlt und zwei Tage später in deutschen Zeitungen gedruckt. Einen Tag nach Kriegsende schreibt er nach einem kleinen Champagner-Empfang bei den Werfels in sein Tagebuch: »Plan, einen kleinen Privatstrand zu kaufen zum Arbeiten und Ruhen im Sommer.« Und am 2. Juni heißt es unnachahmlich thomasmannesk: »Nachrichten über die bevorstehende gefährliche Hungersnot in Deutschland. Old fashioned Cocktail, benommen. Dinner, mäßig wie immer mit Erika und Eugene. Musik und Plauderei, Bier.« Niemand wird später, wenn in Deutschland öffentlich von den »Logenplätzen der Emigration« gesprochen wird, so beleidigt reagieren wie Thomas Mann.
Auch der um zwei Jahre jüngere Hermann Hesse hat in Montagnola in der Schweiz eher Luxussorgen. Der Sommer ist zu heiß und trocken dort oben im Tessin, das Schicksal seiner Verwandten, die aus Estland fliehen müssen, drückt ihn. Im Mai 1945 kommt ein befreundeter Maler nach Montagnola, um den alten Dichter in zahlreichen Sitzungen zu porträtieren. Hesse hat weit größeres Mitgefühl mit den so genannten »inneren Emigranten«. Diese Leidgeprüften, so Hesse, seien besonders exponiert gewesen, da sie, anders als die Polen und Russen, ja sogar die Juden, als Individuen und in aller Stille in die Enge getrieben wurden und keine »Gemeinsamkeit, Schicksalsgenossen, ein Volk oder eine Zugehörigkeit gehabt hatten«.
Eine eigenwillige Ansicht des buddhistischen Weisen aus der Schweiz, die aber etwa ein Gottfried Benn sicher ganz gern gehört hätte. Der große deutsche Dichter, der die Nazis 1933 euphorisch begrüßt und die Emigranten mit Spott überzogen hatte, bereitete im Stillen schon lange seine Position für die Zeit nach dem Krieg vor. Die Meinung der Emigranten solle im Nachkriegsdeutschland jedenfalls gar nicht zählen: »Es ist so belanglos, ob sie kommen, was sie denken, wie sie urteilen.«
Doch niemandem ist es so gleichgültig wie dem Soldaten Ernst Jünger. Der zieht sich, nachdem ihn ein amerikanischer GI nach der Kapitulation in seiner Scheune in Kirchhorst mit einem Revolver bedroht hat, beleidigt in seine Bibliothek zurück und liest die Bibel. In seinem Tagebuch lässt er die Naziherrschaft Revue passieren, und man muss sagen, dass niemand so früh und so eindrücklich die Banalität des Bösen beschrieben hat wie der Autor der Stahlgewitter (1920). Seine Notate über die »penetrante Bürgerlichkeit« Heinrich Himmlers und den Schrecken des geschäftsmäßigen, freundlichen Terrors gehören zum Besten, was in diesen Tagen geschrieben wird: »… der Fortschritt der Abstraktion. Hinter dem nächstbesten Schalter kann unser Henker auftauchen. Heut stellt er uns einen eingeschriebenen Brief und morgen das Todesurteil zu. Heut locht er uns die Fahrkarte und morgen den Hinterkopf. Beides vollzieht er mit derselben Pedanterie, dem gleichen Pflichtgefühl.« Für die nächsten Jahre hat Ernst Jünger Publikationsverbot in Deutschland.
»Was während der Kriegsjahre das Leben eines Juden war, brauche ich nicht zu erwähnen«, schreibt der jüdische Dichter, der sich jetzt Paul Celan nennt, knapp und lakonisch vier Jahre später. Von 1941 bis 1944 hat Celan, der damals noch Antschel hieß, in einem rumänischen Zwangsarbeiter-Bataillon Dienst tun müssen. Seine Eltern waren 1942 im Lager Michailowka östlich des Bug ermordet worden. Freunde Celans, die gemeinsam mit ihren Eltern dorthin deportiert worden waren, kehrten auch mit ihren Eltern zurück. Celan hat sich der Deportation entzogen. Ein Leben lang macht er sich Vorwürfe, dass er seine Eltern nicht begleitet hat, dass er sie nicht vor dem Tod bewahrt hat. Im Frühjahr 1945 verlässt er seine Heimatstadt Czernowitz und flieht nach Bukarest, wo er als Lektor und Übersetzer arbeitet. In dieser Zeit schreibt er die Todesfuge, das Gedicht, das die Schrecken der Zeit in Sprache fasst wie kein zweites.
Die Sirenen der Zeitung heulen dreimal in Santo Domingo. Das bedeutet: internationale Nachrichten von großer Wichtigkeit. Hilde Domins Radio ist kaputt, deshalb läuft sie auf die Straße, zum nächsten Telefon, um zu erfahren, was geschehen ist. Ein zerlumpter Dominikaner am Straßenrand sagt zu ihr: »Wunderbare Nachrichten, Señora. Wunderbar! Der Krieg ist aus. Frieden!« Hilde Domin ist fünfunddreißig Jahre alt. Zusammen mit ihrem Mann hat es sie in dieses Paradies-Exil verschlagen. Der Dominikaner, der ihr die Nachricht des Kriegsendes überbringt, will augenblicklich, zusammen mit seinem Boss, einem französischen Kinobetreiber, nach Paris fahren. Hilde Domin erinnert sich später: »Das war sie also, die lang ersehnte Nachricht. Ich fühlte nichts … wie es geht, wenn das Erwartete da ist und die Spannung uns loslässt.« Es wird neun Jahre dauern, bis die jüdische Dichterin zusammen mit ihrem Mann nach Europa zurückkehrt.
Und Arno Schmidt, der sich eben noch freiwillig an die Front gemeldet hatte, um dadurch schneller Heimaturlaub zu bekommen, sitzt in englischer Kriegsgefangenschaft und schreibt Geschichten über Feen und Elementargeister, die sich die Hände reiben, und dann auch den erstaunlich lebenseuphorischen Satz: »Ich will wie eine Fackel durch die Städte rennen: Lebt doch! Lebt doch!« Er verwendet das Zitat später in seinem Roman Abend mit Goldrand (1975), da dann aber im manischen Schmidt’schen Lesesinne mit dem Ausruf »Lest doch! Lest doch!« am Schluss.
Der Österreicher Heimito von Doderer, NSDAP-Mitglied, der die pompösesten deutschsprachigen Romane der Nachkriegszeit schreiben wird und gerade am allerpompösesten, den Dämonen (1956), arbeitet, sitzt im norwegischen Kriegsgefangenenlager, liest Goethes Italienische Reise und leugnet die letzten Jahre einfach weg: »Der deutsche Staat zwischen 1933 und 1945 hat nie existiert und ich wusst es doch immer. Soll ich’s jetzt gerade vergessen?«
Der Soldat Heinrich Böll zieht mit gefälschten Papieren durchs Land, verbirgt sich bei seiner Familie in einem kleinen Dorf am Rhein, Ende April muss er doch noch einmal in den Kampf und gerät dann »endlich« in amerikanische Gefangenschaft. Sein erster Sohn Christoph wird im Juli geboren, er wird nicht einmal drei Monate alt.
Hans Henny Jahnn fühlt sich in seiner Bornholmer Abgeschiedenheit plötzlich ins Weltgeschehen hineingerissen: »Als eines Morgens russische Soldaten und dänische Freiheitskämpfer bei meinem Haus erschienen, da begriff ich, dass ich nicht ein Mensch, nicht ein Dichter, nicht ein Kämpfer für die Freiheit des Fühlens und Wollens war, sondern ein besiegter Deutscher …«
Der kleine Peter Handke, der später die Gruppe 47 mit einem Federstrich auflösen wird, reist mit seiner unglücklichen Mutter von Kärnten nach Berlin zu den Eltern seines Vaters. Die haben die beiden eher ungern bei sich, und so reisen sie wieder ab. Schnell schon nach Kriegsende reisen sie wieder an. Der Vater lebt inzwischen mit einer anderen Frau zusammen. Doch man arrangiert sich. Sie ziehen als kleine Familie nach Berlin-Pankow. Peter wird im Dezember drei Jahre alt.
Thomas Bernhard ist schon vierzehn, und der große Unglücks- und Weltwutautor der späteren Jahre führt ein fürchterliches Leben in einem nationalsozialistisch geführten Internat in Salzburg. Vier seiner Freunde haben sich schon umgebracht. Er selbst trägt sich den ganzen Tag mit Selbstmordgedanken und spielt in der Schuhkammer Geige, so dass er die Sirenen der Luftangriffe gar nicht hört vor lauter Geige und Selbstmordgedanken. Später holt ihn die Mutter heim aufs Land, schickt ihn aber nach Kriegsende gleich wieder ins Internat. Hier ist der Nationalsozialismus durch einen ebenso brutalen und menschenverachtenden Katholizismus ersetzt worden. Es hat sich nichts verändert. Die Verzweiflung bleibt.
Und in der Schweizer Nervenheilanstalt Herisau sitzt seit vielen Jahren der gewesene Schweizer Dichter Robert Walser, geht spazieren und dichtet nicht mehr. Bis zum Jahr 1933 hat er auf winzige Zettel ganze Romane, Dramen und unzählige Geschichten geschrieben, die man erst lange nach seinem Tod in den siebziger Jahren wird entziffern können. Aber jetzt, 1945, schreibt er nichts mehr. Er sei zufrieden, gibt er den Ärzten in ihren Konsultationen einmal im Jahr zu Protokoll. Ob er nicht etwas schreiben wolle, er sei schließlich ein berühmter Schriftsteller, draußen in der Welt. Nein, das sei er nicht, all seine Romane taugten nichts, entgegnet Walser immer wieder. Er liest die ausliegenden Illustrierten. Er geht spazieren. Von einem Krieg dort draußen, von seinem Ende, vom Schreiben dort draußen und einem Neubeginn nimmt er keine Notiz.
Doch er ist da, der Neubeginn. Dort in Deutschland, in der Welt. Und damit fangen wir an.
2 – Verfall einer Familie – die traurige Geschichte der drei Manns
2
Verfall einer Familie – die traurige Geschichte der drei Manns
Klaus Mann, Kämpfer ohne Hoffnung. Heinrich Mann, Greis ohne Wiederkehr. Thomas Mann, der König, der sich selbst verachtet
Wie wenige sind übrig geblieben. Wie wenige nur haben zwölf Jahre Naziherrschaft in Deutschland überlebt. Das Exil hat viele große Schriftsteller das Leben gekostet. Stefan Zweig und Joseph Roth, Ernst Toller und René Schickele, Rudolf Borchardt und Walter Benjamin, Robert Musil, Kurt Tucholsky, Else Lasker-Schüler und unendlich viele andere haben die Zeit dort draußen – zumeist ohne Geld, ohne Leser, fern der eigenen Sprache, fern der Heimat – nicht überstanden. Einige wenige haben überlebt. Sie haben ausgeharrt. Sie haben gewartet. Zwölf Jahre lang. Und jetzt?
»Wir müssen zurück«, hat Klaus Mann (1906–1949) die Romanfigur Marion von Kammer in seinem Exilroman Der Vulkan (1939) sagen lassen. »Ungeheure Aufgaben werden sich stellen, wenn der Albtraum ausgeträumt ist. Wer soll sie denn bewältigen – wenn wir uns drücken?! Die alten Gruppierungen und Gegensätze – ›rechts und links‹ – werden keine Geltung mehr haben. Die Menschen, die guten Willens sind – die anständigen Menschen finden sich, vereinigen sich, arbeiten miteinander.«
So hatte es sich Klaus Mann gewünscht. So hatte er es sich vorgestellt. Deshalb war er, der Pazifist und schwärmerische Schöngeist der Weimarer Republik, in die US Army eingetreten und hatte gekämpft, hatte Flugblätter verfasst, Gefangene verhört und war mit den voranschreitenden Truppen nach Deutschland geeilt. Er hatte, wie sein Vater, wirklich geglaubt, dass das »böse Deutschland das fehlgegangen gute« ist und dass das Land, dass seine Menschen nur verführt worden seien. Aber er hatte sich getäuscht. Nirgends traf er auf Einsicht. Nirgends auf Reue. Schon nach kurzer Zeit war er überzeugt, dass in dem Moment, in dem die alliierten Soldaten abziehen würden, neunzig Prozent der Bevölkerung ihre Nazifähnchen wieder in den Wind und die Hitler-Bilder wieder an die Wände hängen würden. Kein einziger der Romane, die Klaus Mann im Exil geschrieben hatte, wurde zu seinen Lebzeiten in Deutschland veröffentlicht. Es gab keine Verständigung zwischen Klaus Mann und den Deutschen.
Trotzdem hat Klaus Mann sein schönstes Buch nach dem Krieg geschrieben. Der Wendepunkt (1952), Übertragung, Umarbeitung und starke Erweiterung seines schon 1942 in Amerika veröffentlichten Romans The Turning Point, zugleich Autobiografie, Besichtigung eines Zeitalters und Lebensbeschreibung einer der erstaunlichsten Familien, die es im letzten Jahrhundert in Deutschland gegeben hat. Aber er fand keinen Verlag, und auch für neue Projekte interessierte sich keiner. Und als dann auch noch der Langenscheidt-Verlag seine Zusage zurückzog, den Roman Mephisto (1936) in Deutschland zu veröffentlichen, jenen Roman über den unaufhaltsamen Aufstieg des ewigen Opportunisten Hendrik Höfgen, das kaum verhüllte Porträt Gustaf Gründgens’, mit der Begründung, dieser spiele schon wieder eine so bedeutende Rolle in Deutschland, da war es mit dem letzten Lebenswillen des ewig Lebensmüden und immer stärker den Drogen Verfallenden vorbei. »Ich weiß nicht, was mich mehr frappiert«, schrieb Klaus Mann an den Verleger, »die Niedrigkeit Ihrer Gesinnung oder die Naivität, mit der Sie diese zugeben.« Und er schließt verbittert: »Man weiß ja, wohin das führt: zu eben jenen Konzentrationslagern, von denen nachher niemand etwas gewusst haben will.« Er schreibt noch einen letzten Essay, Die Heimsuchung des europäischen Geistes (1949), in dem er Europas führende Intellektuelle zum kollektiven Selbstmord auffordert, als letztes Fanal der Vernunft. Dann geht er ihnen voran. Am 21. Mai 1949 stirbt Klaus Mann an einer Überdosis Barbiturate in Cannes.
Heinrich Mann (1871–1950) war am Ende. Was für ein trauriges Leben hat der Autor des Untertan (1918) und des Professor Unrat (1905) im Exil geführt. Vereinsamt, verarmt und ungelesen. Nur wenige Minuten entfernt vom prachtvollen Haus seines jüngeren Bruders, des einst so herzlich mit ihm verfeindeten Thomas Mann, der mit seinen Büchern auch in Amerika noch viel Geld verdient. Heinrich Mann und seine Frau Nelly leben »manchmal von 4 Dollar, manchmal von 2 die Woche«. Seine Frau trinkt. Ihre Arbeit als Krankenschwester überfordert sie. Im Dezember 1944 bringt sie sich um. Heinrich Mann vereinsamt immer mehr, zieht sich weiter in sich selbst zurück. Einmal pro Woche besucht er den strahlenden Bruder auf dem Berg. Sie sprechen über alte Zeiten. Italien, die Buddenbrooks. Einem alten Pflichtbewusstsein folgend schreibt und schreibt er. Den rührseligen, altmodisch-süßlichen, autobiografisch gefärbten Roman Der Atem (1949) und Empfang bei der Welt (1956). In seinen merkwürdig unpersönlich geschriebenen Erinnerungen Ein Zeitalter wird besichtigt (1945) hält er politische Rückschau und lobt darin ausdrücklich die Moskauer Schauprozesse als mutige Tat eines moralisch hochgerüsteten Staates, auf den er selbst inzwischen all seine politischen Hoffnungen setzt. Zur Belohnung werden seine Bücher in der Sowjetunion massenhaft gedruckt, und auch aus der deutschen Ostzone kommen bald Stimmen, die den alten Mann zurückrufen. Man verleiht ihm Ehrendoktorwürden, verfasst den Aufruf »Deutschland ruft Heinrich Mann«, stellt ihm Villa, Wagen und Chauffeur in Aussicht, wählt ihn zum Präsidenten der neu gegründeten Deutschen Akademie der Künste und überredet ihn damit zu einer letzten Übersiedlung und großen Überfahrt. Doch Visa-Schwierigkeiten zögern die Rückkehr weit hinaus. Als endlich alle Papiere zusammen und die Fahrkarten gekauft sind, stirbt Heinrich Mann in seiner kleinen Wohnung in Santa Monica an einer Gehirnblutung. Aus Westdeutschland kommt von offizieller Seite kein Wort des trauernden Gedenkens. Gar nichts.
Ist die Geschichte der Familie Mann nach dem Krieg also eine einzige Unglücksgeschichte? Die Geschichte der Familie, deren Protagonisten das kulturelle Leben der Weimarer Republik bestimmten wie sonst keiner? Sie haben all das überstanden für – nichts?
Oh nein. Einer strahlt. Sein Ruhm leuchtet weit, weit sichtbar. In Amerika. In Deutschland. In Ost und West. Der einzige Schriftsteller der Welt, der den Nobelpreis beinahe zweimal bekommen hätte. Am Ende seines Lebens umrauscht von Festlichkeiten, die einem König zur Ehre gereicht hätten. Das Monument der deutschen Kultur: Thomas Mann (1875–1955).
Er hat den Deutschen gleich nach Kriegsende mit dem Doktor Faustus (1947) den Roman ihres Untergangs präsentiert. Das große Deutschlandbuch über den Tonsetzer Adrian Leverkühn, der sein Leben dem Teufel verschreibt und der Liebe abschwört, um das vollkommene Kunstwerk zu schaffen. Erzählt von seinem Freund, dem Altphilologen Serenus Zeitblom, der zeitgleich mit dem in der Rückschau erzählten Untergang des Komponisten den Teufelspakt und Untergang seines deutschen Vaterlandes im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs schildert, um am Ende, in dem berühmten letzten Satz, das Schicksal beider zusammenfließen zu lassen: »Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei euerer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland.«
Man muss Thomas Manns alte These von der ungeheuren Verführungskraft der fehlgegangenen, dunklen deutschen Romantik nicht teilen, um diesen Roman eines der größten deutschen Bücher des letzten Jahrhunderts zu nennen. In dem das dramatische Weltgeschehen quasi im Livemitschnitt aufgeschrieben und verknüpft wird mit der Kulturgeschichte einer ganzen Nation, in dem Moment, in dem sie moralisch und militärisch an ein Ende kommt. Gleichzeitig ein Roman über die Geschichte der modernen Musik, über Nietzsches Leben und über das Leiden des Künstlers als eiskalter Mensch, der all sein Gefühl, sein Leben an seine Kunst verschwendet. Ein Roman auch über den Autor selbst. Über Thomas Mann.
Ein solches Buch hat es danach nicht wieder gegeben. Ein solches Buch wird es nie mehr geben. Es ist ein Finale. Ein Schlusspunkt. Das wusste auch Thomas Mann. Er hatte lange gezögert, den Faustus zu beginnen. Fast ein Leben lang hatte er ihn geplant. Und ein Leben lang wusste er: Das würde sein letztes Buch sein. Sein Parsifal. Es hätte ihn fast umgebracht. So hat es Thomas Mann zumindest gesehen, und so erklärte er sich die schwere Krebserkrankung, die ihn im April 1946 niederstreckte. Der »schreckliche Roman« sei schuld, schrieb er in sein Tagebuch und an Freunde. Doch der Wille zum Roman, zu seinem letzten Roman habe ihn noch einmal gerettet. So stellte er es sich vor. Und dann war der Roman also fertig und irgendwann auch der »Roman des Romans« – Die Entstehung des Doktor Faustus (1949) und: Er lebte weiter in dem Bewusstsein, »der Letzte« zu sein, »der Letzte, der noch weiß, was ein Werk ist«. Er fühlte sich wie Hanno Buddenbrook, der früh verstorbene Untergangsprinz aus seinem ersten Roman, der einen Strich unter seinen Namen im Familienbuch zog und sagte: »Ich dachte, es käme nichts mehr.« Und er schreibt: »Oft will mir unsere Gegenwartsliteratur, das Höchste und Feinste davon, als ein Abschiednehmen, ein rasches Erinnern, Noch-einmal-Heraufrufen und Rekapitulieren des abendländischen Mythos erscheinen – bevor die Nacht sinkt, eine lange Nacht vielleicht und ein tiefes Vergessen.«
Was sollte jetzt noch kommen? Thomas Mann, der alte Kaufmannssohn und große, ewig pflichtbewusste, applaussüchtige, arbeitssüchtige Bürger, musste weiterschreiben. Bücher, die ihm selbst oft genug als unwürdiges Nachspiel erschienen. Den Erwählten (1951) zuerst, die Legende des großen Sünders Grego-rius, der sich einst des Inzests schuldig machte, siebzehn Jahre allein auf einem Felsen Buße tut und schließlich zum Papst gewählt wird. Die merkwürdige Erzählung Die Betrogene (1953) dann, die Geschichte über Rosalie von Tümmler, die sich im Alter von fünfzig Jahren in den Englischlehrer ihrer Tochter verliebt und in der Euphorie einer letzten Liebe die Blutströme eines Gebärmutterkrebsleidens für Zeichen neu erwachter Fruchtbarkeit hält – eine schauerliche Parabel über das Versagen der eigenen Körperkräfte. Und schließlich noch den Krull (1954). Das letzte Buch. Den Hochstaplerroman, den er fast fünfzig Jahre zuvor begonnen und dann lustlos liegen gelassen hatte. Er nimmt ihn nicht ernst. Aber die Menschen lieben ihn. Endlich ein Thomas Mann fürs Volk, ohne seitenlange Bildungsvorträge und unverständliche Schlaumeiereien, die im Zauberberg (1924), in den Josephs-Romanen (1933–43), im Doktor Faustus von der schönen Handlung ablenken. Es ist ein letzter Triumph für den Dichter, der, inzwischen in die Schweiz übergesiedelt, zu mehreren offiziellen Besuchen nach West- und Ostdeutschland aufbricht, die zu wahren Triumphfahrten werden.
Doch die Triumphe verstärken nur das schlechte Gewissen eines Mannes, der tief empfindet, dass all der Jubel einem Menschen gilt, den es nicht mehr gibt. Der alles gegeben hat. Der sterben will. Nach den Feiern zu seinem 80. Geburtstag ist es endlich so weit. In einer Tischrede zum 70. Geburtstag seiner Frau Katia hat er voller Hoffnung gesagt: »Wenn dann die Schatten sich senken und all das Verfehlte und Ungeschehene und Ungetane mich ängstet, dann gebe der Himmel, dass sie bei mir sitzt, Hand in Hand mit mir, und mich tröstet, wie sie mich hundertmal getröstet und aufgerichtet hat in Lebens- und Arbeitskrisen, und zu mir sagt: ›Lass gut sein, du bist ganz brav gewesen, hast getan, was du konntest.‹«
Am Abend des 12. August 1955 ist er gestorben. Katia war bei ihm.
3 – Wir kommen nicht wieder – die Amerikaner
3
Wir kommen nicht wieder – die Amerikaner
Franz Werfel, jüdischer Katholik im kurzen Glanz. Lion Feuchtwanger, Amerika liebt einen Stalinisten. Oskar Maria Graf, die Lederhose in New York. Hermann Broch, Tod am Heimkehrkoffer
Nur wenige Emigranten sind in ihrem neuen Heimatland Amerika geblieben. Die meisten kehrten spätestens mit den Inquisitionen der McCarthy-Ära nach Europa zurück. Der österreichische Dichter Franz Werfel (1890–1945) starb zu früh, um sich überhaupt entscheiden zu können. Gut drei Monate nach der Kapitulation Deutschlands. Kaum ein Exilschriftsteller war erfolgreicher als er. Seinen größten Erfolg verdankte er einem Gelübde, das er abgelegt hatte, als er den deutschen Truppen in letzter Sekunde in Lourdes entkam: Er gelobte, die Geschichte der wundersamen Rettung des Mädchens Bernadette Soubirous und der Wunder von Lourdes zu singen. Das Lied von Bernadette (1941) wurde in Amerika im Jahr seines Erscheinens fast eine halbe Million Mal verkauft. Bei einigen Mitemigranten kam es allerdings nicht gut an, dass ein jüdischer Dichter in diesen Zeiten einen katholischen Errettungsroman schrieb. Auch in seinem letzten Roman, dem 1946 postum erschienenen Stern der Ungeborenen, ist ein Großbischof am Ende der »letzte Vertreter der Menschheit«, unterstützt allerdings von einem »Juden des Zeitalters«. Eine etwas überlyrische Zukunftsfantasie der Welt in hunderttausend Jahren, in der trotz »Unifizierung des Globus« und einer großen »Einheitsstadt« kein Friede herrscht und die Menschen in einem rückwärts gewandten Schöpfungsakt »retrogenetisch« aus der Welt geschafft werden. Kurz nach Vollendung des Romans stirbt Werfel. Seine Witwe Alma, deren erster Ehemann, der Komponist Gustav Mahler, 1911 starb, kam nicht zur Beerdigung. »Ich bin nie dabei«, erklärte die erstaunliche Witwe. Eine Äußerung, die Thomas Mann am Sarg seines Freundes fast laut auflachen ließ.
Ähnlich erfolgreich wie Werfel war sein Lieblingsfeind Lion Feuchtwanger (1884–1958). Die beiden stritten sich, seit sie sich 1937 bei einer PEN-Club-Tagung in Paris kennen gelernt hatten. Werfel warf Feuchtwanger blinde Stalin-Verehrung vor, und Alma nannte ihn nach einem Lied in Hoffmanns Erzählungen »Klein-Zack«, ein Spitzname, der in Emigrantenkreisen gerne aufgenommen wurde. Die Emigration, so Feuchtwanger, mache die Starken stärker und die Schwachen schwächer. Er war stolz, zu den Starken zu gehören, schrieb einen dicken Historienroman nach dem anderen, von denen allerdings heute bestenfalls noch Die Jüdin von Toledo (1954) lesenswert ist. Er war viel zu sehr berauscht vom eigenen Weltruhm, als dass er seine Freunde ernst genommen hätte, die ihn auf die nachlassende Qualität seiner Werke hinwiesen. Ein wahres Martyrium war allerdings Feuchtwangers Ringen um die amerikanische Staatsbürgerschaft. Der Autor des Stalin huldigenden Reiseberichts Moskau 1937 (1937) konnte die amerikanischen Behörden bis zu seinem Tod nicht von seiner Läuterung überzeugen. Immer und immer wieder wurde er tagelang verhört. Einen Tag nach seinem Tod, am 21. Dezember 1958, riefen die Behörden bei seiner Witwe an, um ihr mitzuteilen, dass sie und ihr Mann nun, nach achtzehn Jahren als Staatenlose, mit der Zuerkennung der amerikanischen Staatsbürgerschaft rechnen könnten.
Im selben Jahr erhielt sie auch der wunderbare bayerische Volks- und sozialistische Gerechtigkeitsdichter Oskar Maria Graf (1894–1967). Obwohl er sich als entschiedener Pazifist weigerte zu unterschreiben, dass er bereit sei, sein neues Vaterland mit der Waffe zu verteidigen. Man hat den Satz extra für ihn gestrichen. Graf war wohl der erstaunlichste Emigrant von allen. In bayerischer Lederhose und ohne ein Wort Englisch zu lernen stapfte er durch Manhattan und verkaufte seine Romane und Geschichten, die bei winzigen Verlagen oder im Selbstverlag erschienen waren, einfach selbst. Politisch hielt er sich sehr zurück. Die Emigranten müssten jetzt schweigen, sagte er. Das Letzte, was Deutschland brauche, seien Ratschläge von außen. Er organisierte Hilfssendungen nach Deutschland und schrieb an seinem Roman Unruhe um einen Friedfertigen (1947), die Chronik eines bayerischen Dorfes in den Jahren 1914–33, die Chronik eines Landes auf dem Weg in den Untergang.
Graf, den viele für den glücklichsten Emigranten hielten, wurde immer defätistischer, beschrieb den Menschen als »unergründliche Fehlleistung der Natur« und schrieb apokalyptische Schauerszenarien, die von seiner erzählerischen Erlebenskraft früherer Jahre nichts mehr wissen. Sein letzter Heimatersatz war sein New Yorker Stammtisch von Deutschamerikanern, den er bis zu seinem Tod im Juni 1967 einmal wöchentlich um sich versammelte. Den Stammtisch, so heißt es, gibt es heute noch.
Und ein Mann hatte in Amerika Allergrößtes vor: das Ende der Dichtung angesichts des Weltschreckens. Der Wiener Mathematiker, Philosoph und Schriftsteller Hermann Broch (1886–1951) schrieb Der Tod des Vergil (1945), einen groß angelegten Denkerroman, der angesichts der Lage der Welt zu dem Schluss kommt, dass alle Dichtung ihr Daseinsrecht verspielt habe und es nur noch auf tätige Hilfe ankomme. Die Zeit braucht keine Gedichte mehr. In dem historischen Roman beschließt der historische Dichter Vergil kurz vor seinem Tode, sein dichterisches Hauptwerk, die Aeneis, zu opfern, da es an der Wirklichkeit vorbeigedichtet sei. In einer heute eher schwer verdaulichen, übermystischen, bedeutungsschweren Zentnersprache wird Vergils Ausschweben aus der Welt als Rücknahme der Schöpfung beschrieben. Und die Aeneis hat er dann doch nicht vernichtet. Das Buch erschien 1945 zugleich auf Englisch und auf Deutsch, kam bei der Kritik gut, bei den Lesern eher weniger an. Broch widmete sich der tätigen Hilfe für Deutsche und Österreicher, schickte Care-Pakete und pflegte eine überbordende Korrespondenz mit seinen Lesern in Europa. Lange schon hatte er seinen Tod vorausgeträumt, im Jahr 1951 sollte es geschehen. Und als er endlich seine erste Europareise vorbereitete, brach Hermann Broch neben seinem halb gepackten Koffer tot zusammen – 1951.
4 – Die West-Heimkehrer
4
Die West-Heimkehrer
Alfred Polgar, unwillkommen in Salzburg. Erich Maria Remarque, Welterfolg und Angst vor Osnabrück. Alfred Döblin, der rasende Rückkehrer und sein großes Missverständnis. Carl Zuckmayer, der Versöhner
Die Geschichte der deutschen und österreichischen Heimkehrer, die sich für den Westen entschieden, ist eine Unglücksgeschichte. Die Heimat war ihnen fremd geworden. Und sie war unheimlich. Der Geist des Nationalsozialismus hatte das Land mit der bedingungslosen Kapitulation nicht verlassen. Und auch die Hoffnung, der man sich im fernen Amerika hingegeben hatte, trog. »Ich bin überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit der heutigen Wiener Bevölkerung mit Sehnsucht den Augenblick erwartet, die heimischen Hakenkreuzstrolche büßen zu lassen, was sie verbrochen haben«, schrieb der große alte Meister des kleinen Textes, Alfred Polgar (1873–1955), 1943 in New York. Aber es war Verklärung. Heimatverklärung. Die Polgars lebten, unterstützt von einigen wenigen Freunden, in einer kleinen Wohnung, »in dieser Wüste aus Ziegelsteinen und Zeitungspapier« nur »mit einem Viertel ihres Herzens zu Hause«, und er konnte nichts publizieren. Schickte Text auf Text an seinen Agenten Dr. Horch, der wieder und wieder nichts vermitteln konnte.
Polgar! Der Polgar! Von dem ein einziger, kristallklarer Satz ganze Romane einer Heerschar von Kollegen aufwog. Der Mentor und Lehrer Joseph Roths in dessen Schreibtagen nach dem Ersten Weltkrieg in Wien. Ein Zeitungsschreiber, ja. Aber einer, der die Forderung Joseph Roths, »ein Journalist kann, er soll ein Jahrhundertschriftsteller sein«, mehr erfüllte als jeder andere in Deutschland oder Österreich.
Trotzdem zögert Polgar mit seiner Rückkehr. Als er schließlich doch besuchsweise nach Österreich zurückkehrt, schaudert er. Die Menschen sind ihm unheimlich: »Hinter ihrer Freundlichkeit lauert fühlbar die Tücke«, sie seien feindselig gegenüber Remigranten, und über die Stadt Salzburg schreibt er mit bitterem Spott: »Hier gibt es mehr Nazis als Einwohner.« Der Glaube an die wenigen »Nazistrolche« war verflogen. Von der neuesten deutschen Literatur hält er gar nichts, sie sei »einfach unlesbar, verqualmt, absichtlich nebulos, noch ärger als die deutsche Abreagier-Literatur nach dem ersten Weltkrieg«.
Das ganze Unglück der Rückkehrer, der ganze Wahnsinn der Zeit findet sich in der kurzen Passage, in der Alfred Polgar den Moment beschreibt, in dem er erfährt, dass seine Schwester nicht mehr lebt: »In den Häusern, die hier standen und nun liegen, wohnten zumeist Juden, und wer, vorbeipassierend, denkt, was ihnen geschah, ist versucht, es in Ordnung zu finden, dass jetzt niemand mehr dort wohnt, außer in den öden Fensterhöhlen das Grauen. An dieser beklemmenden Gegend vorbei führte mein Weg zu dem Hausmeister, von dem ich etwas über das Schicksal einer alten nahen Verwandten zu erfahren hoffte. Er unterbrach einen Augenblick das Geschäft des Flurfegens, sagte mit einer Stimme, die klang wie tongewordene Wurschtigkeit: ›Die? Die haben’s abgeholt‹, und setzte seinen Besen wieder in Schwung.«
Am Abend des 24. April 1955 ist Alfred Polgar in Zürich gestorben. Es gab in Europa niemanden mehr, der sich seinen Schüler nannte.
Erich Maria Remarque (1898–1970) lebte ein glanzvolles Leben in Amerika. Erstaunliche Autos, prachtvolle Häuser, herrliche Feste, Marlene Dietrich als Geliebte und eine wertvolle Gemäldesammlung. Remarque war eines der Glückskinder der Emigration. Der auch in Amerika berühmte Bestsellerautor des Antikriegsbuches Im Westen nichts Neues (1928) verkaufte seine Romane als teure Filmskripts, noch bevor sie fertig waren. Er mied die Emigrantenkreise, erhielt die amerikanische Staatsbürgerschaft nach der Mindestwartezeit und betrachtete New York noch lange nach Ende des Krieges als sein Zuhause. Doch auch ihn zog es irgendwann zurück. Vor allem der Sprache wegen. Aber er zog nicht nach Deutschland. Er zog in die Schweiz, fern seiner alten Heimatstadt Osnabrück. Seinen Roman Der Funke Leben (1952), die Geschichte eines Konzentrationslagers, siedelte er in einer Stadt an, die er »Mellern« nennt, die aber ganz offensichtlich Osnabrück ist. Fünfundzwanzig Jahre hat Remarque nach Kriegsende noch gelebt. Er hat Osnabrück nie wieder besucht. Er liebte seine Heimatstadt. Aber sie war ihm unheimlich geworden. In seinem letzten Roman Schatten im Paradies (1971) erklärt der Erzähler einem amerikanischen Filmemacher die deutsche Vergangenheit, die deutsche Gegenwart: »Er wollte mir nicht glauben, dass dies ganz normale Leute waren, die eifrig Juden töteten, so, wie sie auch als Buchhalter eifrig gewesen wären; die, wenn alles vorbei wäre, wieder Krankenpfleger, Gastwirte und Ministerialbeamte werden würden, ohne eine Spur von Reue oder das Bewusstsein von Unrecht.«
Das ist unser Mann im Dichterolymp: Alfred Döblin (1878–1957). Der mit Berlin Alexanderplatz (1929) dafür sorgte, dass die deutsche Literatur Kontakt zur Weltspitze behielt. Die Geschichte von Franz Biberkopf, so lange gebrochen, bis er funktioniert. Berlin Alexanderplatz, das ist: Modernität, Montage, Großstadt, Zerstückelung, Vereinzelung, das Leben, die Kälte, die Wirklichkeit.
Der kleine, geniale Arzt aus Stettin verließ als einer der Letzten Europa, mit Notvisum und Geld von Freunden. Amerika und die Amerikaner verachtete er. Seine letzten Freunde schockierte er mit der zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag feierlich-dramatischen, schuldbeladenen und schuldbekennenden Erklärung seiner Konversion zum Katholizismus.
Schon im November 1945 raste er geradezu nach Deutschland zurück. Wo er im Rang eines Oberst für die französische Militärverwaltung in Baden-Baden das Bureau des lettres leitete. Er reiste als Vortragender und Belehrender in französischer Offiziersuniform durchs Land. Seine Einschätzung, »Russland sei ein frisch modern, ja preußisch konzipiertes Gebilde«, rief in dem sich positionierenden Frontstaat Deutschland-West Befremden hervor. Döblin, der noch im März 1946 an einen Freund geschrieben hatte, er habe »hier im Lande massenhaft Verlagsmöglichkeiten und -angebote«, war ein im wahrsten Sinne des Wortes unverkäuflicher Autor. Der Absatz seiner Bücher war gleich null. Seine im Exil entstandenen Werke, die Amazonas-Trilogie (1937–48) und das vierbändige Erzählwerk November 1918 (1939–50), waren zwar sperrig, schwierig, trocken und längst nicht mehr auf der Höhe seiner Alexanderplatz-Kunst, aber diesen regelrechten Boykott von Lesern und Buchhändlern erklärte das nicht. Emigranten waren nicht erwünscht. Und belehrende jüdische Emigranten schon gar nicht.
Die von ihm mit Mitteln der französischen Militärbehörde gegründete Zeitschrift Das Goldene Tor, in der er vor allem eigene Texte, darunter wutschnaubende Abrechnungen mit Mitemigranten, allen voran Thomas Mann, abdruckte, aber auch Texte von Schriftstellern der jüngeren Generation wie Peter Rühmkorf, musste, nachdem die finanzielle Unterstützung ausgeblieben war, eingestellt werden. 1953 verließ er Deutschland erneut, in Richtung Paris, ins Exil. An den Bundespräsidenten schrieb er: »Es wurde keine Rückkehr, sondern ein etwas verlängerter Besuch … Ich bin in diesem Lande, in dem ich und meine Eltern geboren sind, überflüssig.« Der bald schon todkranke, beinahe blinde und an den Rollstuhl gefesselte Schriftsteller kam noch manchmal zu Kuren zurück in den Schwarzwald. Am 26. Juni 1957 ist er im Krankenhaus in Emmendingen gestorben. Drei Monate später nahm sich seine Witwe in ihrer Wohnung in Paris das Leben.
Nur Elend also? Verständnislosigkeit. Ablehnung. Schweigen. Und sonst nichts?
Ah nein, nein. Da ist er. Der Lichtstrahl. Der glückliche Emigrant. Der glückliche, der gefeierte Rückkehrer: Carl Zuckmayer (1896–1977). Er liebt Amerika. Der Dramatiker und Autor vom Fröhlichen Weinberg (1925) und dem Hauptmann von Köpenick (1931) kauft sich mit seiner Frau gleich zu Beginn der Emigration in Vermont eine große Farm und arbeitet idyllisch und ländlich und hart wie in alten Zeiten. Mitunter kommt die Tochter vorbei, die die Eltern in einer, wie sie selbst zugaben, infantilen Amerika- und Karl-May-Begeisterung »Winnetou« genannt hatten. Einmal kommt auch Freund Brecht. »Bert!«, ruft Zuckmayer nur und die beiden lachen und lachen und lachen. Brecht sagt: »Mit dir kann man lachen, auch wenn es gar nichts zu lachen gibt.« Und sie sprechen über neue Dramen und alte, als gingen sie wie früher an der Isar entlang.
Für Deutschland und die Deutschen empfindet Zuckmayer keine Bitterkeit. Deutschland sei zwar schuldig geworden vor der Welt, erklärte er aus Anlass einer Gedenkfeier für den verstorbenen Carlo Mierendorff, »wir aber, die wir es nicht verhindern konnten, gehören in diesem Weltprozess nicht unter seine Richter«. Und »bei aller Unversöhnlichkeit gegen seine Peiniger und Henker werden wir Wort und Stimme immer für das deutsche Volk erheben«. Und das deutsche Volk liebte ihn. Was für eine Szene in seinem Erinnerungsbuch Als wär’s ein Stück von mir (1966), als er an seinem ersten Abend in Deutschland in einem Frankfurter Hotel um ein Zimmer für die Nacht bittet: »Starrte mir der alte, verhungert aussehende Portier ins Gesicht. Und dann sagte er, im schönsten Frankfurterisch: ›Ei sin Sie womöschlisch der vom Fröhlische Weinbersch?‹ Und als ich nickte, packte er meine Hände. ›Ei was e Freud‹, sagte er immer wieder, ›ei was e Freud, dass Sie haamkomme sin!‹« Und Carl Zuckmayer bekommt ein frisches Handtuch und zwei Kissen. Als er am nächsten Tag in Berlin den Verleger Peter Suhrkamp trifft, der von seiner Haft im Konzentrationslager so krank und geschwächt ist, dass er aussieht wie ein Sterbender, leeren die beiden in einer Nacht die Flaschen Whisky und Cognac, die Zuckmayer aus Amerika mitgebracht hat.
Und dem Theater und den Deutschen hat Carl Zuckmayer bei seiner Rückkehr vor allem ihr großes Versöhnungsstück mitgebracht. 1946 wurde in Zürich Des Teufels General uraufgeführt, das Drama des deutschen Mitläufers und begeisterten Fliegers General Harras, der doch nur fliegen will und dabei schuldig wird. Und der, nachdem er festgestellt hat, dass sein bester Freund, der Chefingenieur Oderbruch, ein Saboteur ist, seine Schuld erkennt und sich zum Selbstmord entschließt: »Wer auf Erden des Teufels General wurde und ihm die Bahn gebombt hat – der muss ihm auch Quartier in der Hölle machen.« Es wurde das meistgespielte deutsche Drama der Nachkriegszeit. Und eines der umstrittensten. Wie heldenhaft darf ein deutscher Wehrmachtsgeneral gezeigt werden? Kann ein sinnloser Selbstmord ohne Widerstandswillen eine heroische Tat sein? Zuckmayer reiste von Diskussion zu Diskussion. Durchs ganze Land. Aber ein Misstrauen blieb. Auch bei ihm. »Ich bin zurückgekehrt. Aber nicht heimgekehrt«, sagte er und suchte sich ein Haus in den Schweizer Bergen, in Saas Fee. Die politische Situation bereitete jetzt auch ihm, dem einzigen glücklichen Remigranten, Missbehagen. Sein Stück hat er in den sechziger Jahren mit einem Aufführungsverbot in Deutschland belegt. »Es wäre heute allzu leicht als Entschuldigung eines gewissen Mitläufertyps misszuverstehen«, schrieb Carl Zuckmayer 1963 aus den Schweizer Bergen.
5 – Wir sind noch da!
5
Wir sind noch da!
Erich Kästner, Weltverbesserer ohne Hoffnung. Karl Valentin, Witze über das Nichts. Wolfgang Borchert, der Unglücklichste. Heimito von Doderer, Thronfolger ohne Thron
Wo ist also der Aufbruch? Wer sind die Träger der neuen deutschen Literatur? Wer die Autoren der lebendigen, modernen, traditionsbewussten, im Lichte der geschichtlichen Erfahrungen der letzten zwölf Jahre geschriebenen neuen Bücher? Die im Exil geblieben waren, haben kaum Kontakt in ihr altes Heimatland, die Manns sind gescheitert oder präsidial-kaiserlich entrückt, die zurückgekehrten Emigranten gelten nichts im eigenen Land (zumindest im Westen, der Osten ist ein eigenes Kapitel), werden totgeschwiegen, ziehen sich zurück, in eine innere Emigration, in die Schweiz, nach Frankreich oder wieder nach Amerika. Wer bleibt also? Wer bleibt da noch für den Neubeginn? Nur die, die geblieben waren. Nicht die rasenden Nazis natürlich. Nicht Hanns Johst, Hans Grimm, Will Vesper. Die waren erledigt. Aber die anderen, die dageblieben waren. Die den Krieg in Deutschland miterlebt hatten. Und die jetzt, gemeinsam mit ihren Landsleuten, umgeben von Trümmern und Nichts, auf der moralischen Anklagebank der Welt saßen. Denen war man bereit zuzuhören. Und fast nur denen.
Erich Kästner (1899–1974) war geblieben. »Warum?«, hat man ihn immer und immer wieder gefragt. Auch seine Bücher hatten gebrannt, damals in Berlin. Er galt den Nazis als defätistisch, zersetzend, militärfeindlich – zu Recht. Doch Kästner blieb. Als Chronist, wie er sagt. Schrieb zunächst harmlos-hübsche Unterhaltungsbücher wie Drei Männer im Schnee (1934), die ihm die endgültige Verachtung der Emigranten einbrachten, durfte aber schon bald gar nichts mehr publizieren und fürchtete oft um sein Leben.
Jetzt, nach dem Krieg, war seine große Stunde. »Es ging zu wie bei der Erschaffung der Welt«, hat er über die ersten Nachkriegsjahre geschrieben. Und Erich Kästner war ein kleiner Gott. Einer der wichtigsten Männer im neu entstehenden Kulturbetrieb. Er ist Feuilletonchef der von den Amerikanern in Millionenauflage vertriebenen Neuen Zeitung, gründet die Jugendzeitschrift Pinguin, ist Mitinitiator und Haupttexter des Münchner Kabaretts Schaubude und bringt seine kämpferischsten Schriften aus der Zeit vor 1933 wieder heraus. Als die Sängerin Ursula Herking in der Schaubude Kästners Marschlied 1945 mit den Schlussversen »Tausend Jahre sind vergangen / samt der Schnurrbart-Majestät. / Und nun heißt’s: Von vorn anfangen! / Vorwärts marsch! Sonst wird’s zu spät!« zum ersten Mal sang, da »sprangen die Menschen von den Sitzen auf, umarmten sich, schrien, manche weinten, eine kaum glaubliche Erlösung hatte da stattgefunden«, schrieb die Sängerin in ihren Erinnerungen.
Aber auch die Glücksgeschichte Erich Kästners dauerte nur wenige Jahre. Schon 1952 notiert er: »Wir staunten nicht schlecht. Wir waren in der Zwischenzeit an die Vergangenheit verkauft worden.« Und dichtete: »Bete, wer kann! Er ist zu beneiden. / Kriege lassen sich nicht vermeiden. / Der Mensch muss leiden. Er kann nichts tun.« Da ist er wieder, der melancholische, hoffnungslose Kästner-Ton, den man schon aus seinen Gedichten vor dem Krieg kannte und der ihm von Walter Benjamin das klebrige Etikett des »Linken Melancholikers« eingebracht hatte. Immerhin: Kästner kämpft. Diesmal kämpft er. Er sagt, Widerstand sei keine Sache des Heroismus, sondern des Terminkalenders. Man müsse also früh damit beginnen, er tritt als Redner auf Demonstrationen gegen die Wiederbewaffnung, Atomkraft und Verjährung von Naziverbrechen auf, schreibt aber kaum noch etwas. Sein Tagebuch aus dem letzten Jahr der Naziherrschaft hat kaum dokumentarischen Wert, aber in seiner Konferenz der Tiere (1949) hat er die idyllische Wunschwelt seiner Kinderbücher mit der Politik versöhnt. Nach der tausendsten ergebnislos abgebrochenen Weltverbesserungskonferenz der Menschen haben die Tiere für ein paar Tage die Macht übernommen, um das Nötige ein für alle Mal zu regeln: Ein ewiger Friedensvertrag wird verabschiedet, Ländergrenzen und Militär abgeschafft und Lehrer werden die bestbezahlten Beamten des Landes. So sah Kästners Weltwunschprogramm aus. Und er musste also wohl ein unglücklicher Mensch bleiben. In den letzten Jahren seines Lebens schreibt er nur noch, um nicht zu verzweifeln. Da er aber nur noch Happyends erträgt, ihm seine Arbeiten aber unter der Hand immer ausweglos traurig geraten, veröffentlicht er gar nichts mehr, trinkt unaufhörlich Tee mit Whisky und Whisky mit Tee, lehnt eine Behandlung seines Speiseröhrenkrebses ab und stirbt sechs Tage nach seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag, am 29. Juli 1974.
Der Komiker und Sprachakrobat Karl Valentin (1882–1948), den Bert Brecht als seinen Lehrer bezeichnet, den Alfred Kerr, Kurt Tucholsky, Samuel Beckett und Adolf Hitler bewunderten und den das Volk liebte, hatte nach dem Krieg weniger Glück. Schon in den letzten Jahren der Nazizeit war er kaum noch aufgetreten. Weniger wegen Behinderungen durch die neuen Machthaber, wie er es später darstellte (lediglich sein Film Die Erbschaft (1936) wurde wegen »Elendstendenzen« verboten), als vielmehr wegen Erfolglosigkeit. Wahrscheinlich ist Karl Valentin das einzige Nicht-NSDAP-Mitglied, das auf dem Entnazifizierungsbogen zugegeben hat, Hitler gewählt zu haben. Wegen entwaffnender Ehrlichkeit darf er gemeinsam mit seiner kongenialen Partnerin Lisl Karlstadt wieder auftreten. Doch den beliebtesten Volkssprachkünstler der Vorkriegszeit will niemand mehr sehen. Sketche über den allgemeinen Kalorienmangel und über das »Nichts« kommen nicht gut an. Der Münchner Rundfunk lässt einen humoristischen Abend mit Valentin wegen Humorlosigkeit ausfallen. Am Rosenmontag 1948 ist der spindeldürre Sprachwahnenthüller an einer verschleppten Erkältung gestorben.
Da war der erste junge, neue Star, der erste Nachkriegsstar der deutschen Literatur schon drei Monate tot. Wolfgang Borchert (1921–1947), das One-Hit-Wonder des neuen Deutschland-West, starb in einem Schweizer Krankenhaus einen Tag, bevor sein Kriegsheimkehrerstück Draußen vor der Tür (1947) in Hamburg uraufgeführt wurde. »Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will«, heißt es im Untertitel. Das stimmte nicht. Die Deutschen wollten das melodramatische Verzweiflungsstück des Kriegsheimkehrers Beckmann, der seine Frau durch Verrat, seinen Sohn durch den Tod unter Trümmern und seine Eltern durch Selbstmord verloren hat, massenhaft sehen. Beckmann, den selbst die Elbe, in die er sich in Todesverzweiflung stürzt, nicht haben will, der die Vätergeneration und nur die Vätergeneration für den Wahnsinn des Krieges verantwortlich macht, der mit Gasmaskenbrille und steifem Bein durch seine Anklagewelt stapft, das ist – gemeinsam mit General Harras – der erste deutsche Dichtungsnachkriegsheld. Er klagt jeden an. Die ganze Welt. Das Schicksal. Gott. Nur nicht sich selbst. Borchert, der von den Nazis immer wieder wegen kritischer Reden, kritischer Briefe und einmal wegen einer angeblich absichtlich sich selbst beigebrachten Verletzung inhaftiert worden war und sich im Krieg ein unheilbares Leberleiden zugezogen hatte, war die erste große Identifikationsfigur der jungen Generation. Einer Generation, die er in einer programmatischen Erzählung so beschrieben hatte: »Wir sind eine Generation ohne Abschied, die sich davonstiehlt wie Diebe, weil sie Angst hat vor dem Schrei ihres Herzens. Wir sind eine Generation ohne Heimkehr, denn wir haben nichts, zu dem wir heimkehren könnten, und wir haben keinen, bei dem unser Herz aufgehoben wäre – …Wir sind eine Generation ohne Abschied, aber wir wissen, dass alle Ankunft uns gehört.« (aus: Generation ohne Abschied, in: Die Hundeblume. Erzählungen aus unseren Tagen, 1947)
Pathos, Schmerz, Selbstüberschätzung, Selbstmitleid und eine diffuse Zukunftshoffnung. Die ersten Protagonisten der neu gegründeten Gruppe 47, Alfred Andersch und Heinrich Böll, liebten ihn dafür.
Aber hier kommt einer, der einen Weg gegen alle Wahrscheinlichkeit gegangen ist. Gegen alle Vernunft. Gegen alle Menschlichkeit: Der österreichische Dichter Heimito von Doderer (1896–1966) war schon in die NSDAP eingetreten, als die Partei in seinem Heimatland noch illegal war. Und während die deutsche Intelligenz massenhaft aus dem Lande floh, machte sich also dieser merkwürdige Herr aus Wien in die entgegengesetzte Richtung auf, um seiner stockenden Karriere etwas Schwung zu geben. Doch in Deutschland ist er unbekannt und erfolglos und isoliert wie in seinem Heimatland. Enttäuscht notiert er: »Im Reiche draußen ist es mir bisher nicht gelungen, auch nur einen Schritt breit Boden zu gewinnen, eine recht verwunderliche Tatsache, wo man doch glaubte, dass für Schriftsteller meiner Art nun ein Morgenrot angebrochen sei.« 1938 trennt er sich von seiner jüdischen Frau und ein Jahr später zieht er als Hauptmann der Luftwaffe in den Krieg. Dass er nach dem Krieg als Parteimitglied der ersten Stunde mit einem dreijährigen Schreibverbot belegt wird, kann er kaum glauben. Er hatte seine Mitgliedschaft seit 1938 ruhen lassen und fühlte sich als Außenseiter der Nazigesellschaft, der nun – endlich – ein Recht auf Anerkennung habe. Eine merkwürdige Gestalt, die der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur mehrere Mammutwerke von erstaunlicher Breite, Tiefe und Absonderlichkeit hinzugefügt hat.
Strudlhofstiege (1951). Die Dämonen (1956). Merowinger (1962). Roman No 7 (1963/67). Das sind Doderers Hauptwerke nach dem Krieg. Es geht um Österreich. Um die Entwicklung eines Menschen jenseits der politischen Ereignisse. Es geht um eine Welt von gestern ohne Sentimentalität und Verklärung. Es geht um sadistische Sexualität als Genuss. Um Beschimpfung als Befreiung. Es geht um eine präzise geschilderte Innenwelt. Um ein Gesellschaftspanorama. Um ein Leben jenseits der Geschichte. Es geht um alles. Und um nichts. Hans Weigel hat einmal gesagt: »Doderer schreibt einen neuen Roman. Sein Inhalt? Herr von X geht über die Ringstraße. Die ersten tausend Seiten sind schon fertig.«
Der Spiegel widmete Doderer, nachdem innerhalb von zwei Jahren Thomas Mann, Bertolt Brecht und Gottfried Benn gestorben waren, eine Titelgeschichte. »Auf der Suche nach einem Thronfolger für den verwaisten Kronsessel der deutschen Literatur wendet sich der Blick des deutschen Lesepublikums nach Wien«, hieß es da. Es hat den Blick recht schnell wieder abgewendet.
6 – Der Schriftstellerstaat
6
Der Schriftstellerstaat
Johannes R. Becher, Dichtersammler, Hymniker. Hans Fallada, Honig, Butter, Morphium für den Roman der Nazizeit. Arnold Zweig, der unentschlossen Entschlossene. Anna Seghers, die Übermutter. Bertolt Brecht über alles
Hier war es anders. Hier im Osten. Die Emigranten wurden hofiert und umschmeichelt. Die sowjetisch besetzte Zone sollte eine Schriftstellerzone werden. Der spätere Staat ein Schriftstellerstaat. Natürlich nur der politisch angenehmen. Die in das Konzept des von der Sowjetunion vorgegebenen sozialistischen Realismus passten. Doch zu Beginn nahm man es da nicht so genau. Der Mann, der für die Sammlung aller verfügbaren Schriftstellerkräfte zuständig war, war Johannes R. Becher. Mit der ersten Maschine mit Ulbricht aus Moskau eingeflogen, war es seine Aufgabe als Leiter des Kulturbundes, Emigranten zurückzurufen, ihnen zu sagen, dass es hier ein Land gibt, das sie braucht, das auf sie hört, in dem sie schreiben können, schreiben sollen. Und man musste nicht unbedingt die Nazizeit außerhalb des Landes verbracht haben. Nein, auch Mitmacher waren hochwillkommen.
Er suchte den greisen Gerhart Hauptmann auf, der sich von Nazideutschland gern als Repräsentant benutzen ließ, um ihn für ein neues sozialistisches Deutschland zu gewinnen. Der Alte soll geantwortet haben: »Ich stelle mich zur Verfügung.«
Also zuerst Johannes R. Becher (1891–1958). Der Mann, der die Schriftsteller im neuen Staat sammeln sollte, um der neuen Partei, dem neuen Land zu Akzeptanz und zu Ansehen zu verhelfen. Zunächst als Vorsitzender des Kulturbundes, ab 1954 als Kulturminister. Er führt den Auftrag vorbildlich aus und hat den um sich versammelten Schriftstellern auch so viel Freiheit verschafft, wie es ihm möglich war. Den anderen aber, die nicht dazugehörten, nicht. Johannes R. Becher, der als Halbwüchsiger mit seiner Geliebten, die er nicht lieben durfte, einen Doppelselbstmord plante und dann nur sie erschoss und bei sich das tödliche Ziel verfehlte. Der so tief und fest an die Wirkung von Literatur glaubte, dass er mitten im Ersten Weltkrieg jubelnd zu seinen Freunden ins Café stürmte und rief, bald werde der Krieg zu Ende sein. Warum? »Demnächst erscheint mein Gedicht-band An Europa« (1916). Becher, der Lieblingsdichter Gottfried Benns, der das Exil in Moskau in Stalins Nähe mit Glück und Geschick überlebt hatte und der über seine Zeit der Macht den traurigen und wahren Satz geschrieben hat: »Ich hatte eigentlich alles, nur die poetische Potenz hatte ich verloren.« Gegen Ende seines Lebens hat er, der schon im Exil Stalin schmeichelnde Gedichte geschrieben hatte, den letzten schriftstellerischen Anstand verloren, als er eine schauderhafte Ulbricht-Biografie verfasste, die ihm immerhin selbst peinlich war. Auf seinem Sterbebett hat man ihm das Buch, das er hasste, zwischen die Hände gelegt, und Becher hat geweint.
Später, viel später, hat eine Zeile der von ihm in offiziellem Auftrag und in bester und hoffnungsvollster Absicht gedichteten Nationalhymne der DDR den Untergang seines Landes intoniert. »Deutschland, einig Vaterland.«
Und Hans Fallada (1893–1947), der auch in Deutschland geblieben war, mitunter so dicht an der Macht, dass er etwa den Roman Der eiserne Gustav (1938) auf Goebbels’ persönlichen Wunsch umarbeitete und mit einer positiven Schilderung der faschistischen Machtübernahme enden ließ, für diesen Hans Fallada hat Johannes R. Becher sogar ganz besondere Aufgaben vorgesehen. Er macht ihn zum Mitarbeiter der neuen Zeitung Tägliche Rundschau, lässt ihm für wenige Artikel hohe Honorare zahlen und wünscht sich von ihm den großen Roman der nationalsozialistischen Ära. Man gibt ihm und seiner Frau eine Villa im Sperrbezirk der deutschen und russischen Prominenz des Zonen-Staates und überweist ihm regelmäßig hohe Summen. Doch das stark morphium- und alkoholabhängige Paar gibt das ganze Geld für Drogen aus. Schnaps. Zigaretten. Morphium. Außerdem für Honig. Butter. Vollmilchpulver. »Bis um zehn Uhr jeden Tages haben wir bereits so viel Geld verbraucht wie ein Durchschnittsangestellter im ganzen Monat verdient«, erzählt er stolz einem Freund. Becher passt das natürlich wenig und er lässt den beiden weniger Geld und stattdessen mehr Lebensmittelzuweisungen zuteilen. Doch Fallada schreibt den Naziroman trotzdem nicht. Die meiste Zeit verbringen die beiden in Entzugskliniken und in Isolierkrankenhäusern für Geschlechtskrankheiten, da seine Frau inzwischen auf anderem Wege Geld besorgen muss. Er schreibt unter dem Titel Der Alpdruck (1947) einen autobiografischen Bericht über sein Leiden nach dem Krieg, die kurze Zeit, als er Bürgermeister des mecklenburgischen Städtchens Feldberg war und die Menschen mitreißen wollte zu einem neuen Aufbruch und Gemeinschaftsgefühl, aber nur Hohn und Spott erntete und später sogar ausgeraubt wurde. Ein hoffnungsloses Buch. »Es schien keine Besserungsmöglichkeit für dieses Volk zu geben«, schreibt er und über sein Alter Ego: »Zum ersten Male dachte Doll – jetzt nach dem Kriege! – ernstlich an Emigration.« Defätismus, Fluchtgedanken. Nein, dafür hatte Becher all das Geld und die Villa nicht bezahlt.
Fallada hat ihn dann schließlich doch noch geschrieben, den bestellten Roman: Jeder stirbt für sich allein (1947). Zwischen Entzugskuren und Drogenrausch. Unfassbar, wie ein so weit von Drogen zerstörter Mann in den letzten Lebensmonaten die Kraft und Disziplin aufbrachte, eines seiner besten Bücher zu schreiben. Ein wunderbarer, tragischer, dramatischer Roman um das Ehepaar Otto und Anna Quangel, das nach dem Tod seines Sohnes plötzlich beginnt, Postkarten gegen den Größenwahn der Zeit zu schreiben. Und um das weiche, lebensuntüchtige Würstchen Enno Kluge, das kräftig zu kämpfen hat, überhaupt am Leben zu bleiben. Alle Roman-Menschen sind im Grunde zu schwach für dieses Leben und der praktizierte Naziwiderstand ist nur ein lächerlicher, verzweifelter Akt eines aussichtslosen, kleinen Lebensheroismus. Kleine Männer, die nicht wissen, was nun. Fallada hat sein Lebensthema auch in dem neuen Staat nicht abgelegt. Man konnte ihn nicht wirklich gebrauchen.
Andere waren da schon nützlicher. Arnold Zweig (1887–1968), der große jüdische Romancier, der mit seiner Frau in Palästina Schutz gesucht hatte, konnte sich lange nicht entscheiden, wohin er nach dem Krieg ziehen sollte. »Aus Prag wie aus Paris rufen Freundesgruppen, nach [West-]Berlin zieht mich mein Haus Kühler Weg 9, nach der Schweiz mein Sohn Adam, nach England die Steuerreduktion«, und sein bester Freund Feuchtwanger bemüht sich um ein Affidavit für die USA. Doch Zweig geht in den Osten Deutschlands und wird einer der repräsentativen Schriftsteller des neuen Staates DDR. Warum? Zunächst signalisierten ihm die Westberliner Behörden, dass er keinen Anspruch mehr auf sein Haus habe. Die englischen Behörden erschwerten ihm die Einreise und aus dem Osten hörte er, dass viele alte Freunde hierhin zurückgekehrt seien, Becher schrieb ihm einen schmeichelnden Brief, wie sehr man ihn brauche, eine Gesamtausgabe seiner Werke käme im soeben neu gegründeten Aufbau-Verlag heraus und er kümmere sich um alle Formalitäten. Zweig wirft alle Bedenken beiseite und schreibt an befreundete Skeptiker, die ihn vor dem Zensor-Staat warnen: »Ich habe keine Angst mehr vor irgendetwas, was mit Kommunismus zusammenhängt, und sehe die Welt viel deutlicher und, wie mir scheint, adäquater, seit ich sie als Marx-Schüler sehe.« In Berlin nimmt ihn Becher in Empfang, Zweig wird in einem unzerstörten Flügel des Hotels Adlon untergebracht, später, 1950, als Präsident der Deutschen Akademie der Künste, in einer prachtvollen Villa. Da ist Zweig schon Volkskammerabgeordneter, Nationalpreisträger erster Klasse und nach Becher erster Repräsentant des geistigen Lebens der DDR. Geschrieben hat er in dieser Zeit nur noch wenig und wenig Lesenswertes. Vom lebenslangen Außenseitertum als Jude und Sozialist hat er genug. Er genießt die repräsentative Stellung, die Ehrungen, die vieltausendfache Verbreitung seiner Bücher als Schullektüre und als geförderte Staatslektüre seiner neuen Heimat.
Auch Anna Seghers (1900–1983) wurde eine treue Repräsentantin des neuen Staates. Für sie war es gar keine Frage, für welchen Teil des Landes sie sich nach ihrer Rückkehr aus Mexiko entscheiden würde. Trotz manchen Kampfes, den die treue Sozialistin in der Vergangenheit mit dogmatischen Vertretern der exilierten KPD kämpfen musste. »Leck mich am Arsch!«, soll sie einem ideologischen Parteigenossen 1934 in Paris knapp entgegnet haben, als er ihr vorwarf, die österreichischen Sozialdemokraten kämen in ihrem Buch Der Weg durch den Februar (1935) zu gut weg.
Ihre besten Bücher hat sie im Widerspruch zu diesen Herren geschrieben. Die herrlichen, bewegenden, kraftvollen Romane Das siebte Kreuz (1942), der ihren Weltruhm begründete, und Transit (1948) – wahrscheinlich die beste Darstellung des deutschen Exilantenleidens und -lebens. Später, in der DDR, als sie fast ihr ganzes restliches Leben lang, von 1952 bis 1978, Vorsitzende des Schriftstellerverbandes ist, wird ihr Schreiben schwächer. Es ist eindeutiger, Partei nehmender, flacher, schematischer und moralischer als in ihrer besten Zeit. Die meisten Bücher teilen die Welt in zwei unversöhnliche, ungleiche Hälften. Die fortschrittliche, sozialistische und die reaktionäre, gewinnsüchtige, kalte Welt des Westens. Zurückhaltend hat sie Kritik an der DDR geübt. In ihrem Buch Das Vertrauen